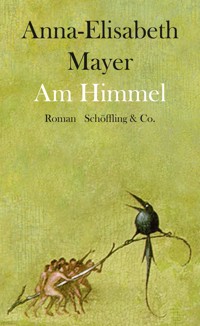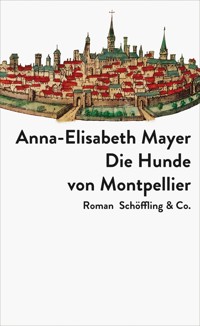18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schöffling & Co.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Martha Kopetzky die E-Mail vom Bildungsministerium bekommt, ist sie sofort alarmiert. Die Behörde will das digitale Lernsystem KREIDE (Kreative Intelligenz durch E-Learning) einführen, das fortan die Schüler:innen beim Lernen überwachen und ihnen je nach Leistung Punkte ver- leihen soll. Aus einer Beschwerdemail wird ein ausgewachsenes politisches Engagement: Martha versucht den Einsatz der KREIDE mit einer Petition zu verhindern und wirbelt damit viel Staub auf. Schließlich hat sie nicht vor, die Kinder kampflos den Tech-Giganten zu überlassen. Aber auch Anatol Penzel, dem Verantwortlichen im Bildungsministerium, kommen immer mehr Zweifel am neuen Programm. So werden die anfänglichen Gegenspieler immer weiter miteinander verstrickt, getrieben vom gemeinsamen Aufbegehren gegen eine zutiefst digitalisierte Welt.überaus unterhaltsam und mit bissiger Ironie erzählt Anna-Elisabeth Mayer in Kreidezeit vom Zusammenleben zwischen Mensch und Maschine in unserer schönen neuen Welt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
[Cover]
Titel
Widmung
Motto
I Anhecheln
II Pah
III Tinnitus
IV Im Magen
V Desserts
VI Talente
VII Schnurvorhang
VIII Kreide fressen
IX Anstecken
X Preis
X Nebelwald
XII Bett
Autor:innenporträt
Kurzbeschreibung
Impressum
Widmung
Für Euch vomrana-gana-modi/bodi-bodi-bodi/rana-gana-tschindermo/bodi-bodi-rennt-davo-Flügel–allen voran Du, Feuervogel&Deine Großmutter
Motto
»Ich bin fürchterlich verschnupft,und wie jeder weiß, stürzen solche Schnupfenganze Universen um.«
Álvaro de Campos/Fernando Pessoa
I Anhecheln
Wenn sich in Wien der Sommer ankündigte, geschah etwas mit den Menschen. Wie bei einem aus dem Keller geholten Sonnenschirm segelte von vielen der Staub. Andere waren eher Butter ähnlich, die vor einiger Zeit aus dem Kühlschrank geholt worden war: weich und leicht verteilbar.
Diesen Sommer aber war es in Wien so heiß geworden, dass die Menschen geradezu zerrannen. Anatol in seinem abgedunkelten Büro dachte an das Zerrinnen, den Blick auf die Schneekugel am Schreibtisch gerichtet, Schweißperlen unter dem Kragen. Von draußen drang das Geräusch von Rotorblättern herein. Wurde die glühende Stadt von oben im Auge behalten? Zur Mittagszeit erst recht keiner auf der Straße – außer Touristen; oder einem Staatsbesuch, zur Abrundung des Programms stand gemeinsames Eisschlecken an. Gleich beim Mahnmal gegen Krieg und Faschismus gab es eine neue Eisdiele. Der Hubschrauber entfernte sich; Richtung Museumsquartier, stellte sich Anatol vor und wie er dort über die Agentur für Bildung flog – und sein Kollege Zachy Reisinger, aus der Mittagspause kommend, endlich die richtige Größe hatte.
Martha sah den Hubschrauber von einem Autofenster aus im wolkenlosen Himmel kreisen. »Staatsbesuch«, sagte Frederika hinter dem Steuer. »Bald werden die Kinder überwacht – da könnte jeder Staatsbesuch neidisch werden«, meinte Martha mit düsterer Stimme, strich ihrem Hund über das Fell. »Übertreib nicht«, kam es von der Rückbank. Martha drehte sich zurück zu Lynn: »Heute früh in meinem Posteingang«, sagte sie, »von Frau Blecha, der Direktorin« und reichte ihr das Telefon.
»KREIDE für die Zukunft«, las Lynn laut, »Ein Pilotprojekt, herausragend im Volksschulunterricht«. »Danke Gott, dass Damian bereits ein Teenager ist!«, bemerkte Martha. »Gott für einen Teenager danken? Mehrmals täglich«, erwiderte Lynn, musste die Stirn runzeln, als sie weiterlas: »Eine neuartige Lernplattform.« »Ich schlaf’ gleich am Steuer ein«, sagte Frederika. Martha ließ die Locke, an der sie gedreht hatte, springen. »Haarsträubend!«, gab sie zu verstehen, dass Langeweile nicht das Problem war: »Die Kinder sollen eine Lernplattform benützen, die sie filmt – in der Schule, zu Hause!« und sie wandte sich um: »Und, habe ich übertrieben?«, während Lynn weiterlas: »Die KREIDE zeichnet sekundengenau auf.«
»Tech-Produkte vom Erstklässler an – klingt nach Goldgrube«, sagte nun Frederika, bevor sie scharf bremste, sodass der Koffer im Heck nach vorne rutschte. »Bestimmt von Herren in hohen Positionen ausgedacht«, kam es von der Rückbank und Lynns graugrüne Augen suchten den Text eilig nach etwas ab. »Ansprechpartner Anatol Penzel (Bildungsministerium) und Zacharias Reisinger (Agentur für Bildung) – na, wer sagt’s denn!«, rief sie schon. »Den Kindern würd’ eine Agentur für Unbildung vielleicht besser gefallen«, kommentierte Frederika, bevor sie hupte.
»Ich glaube, ich werde mal das Bildungsministerium anschreiben«, meinte Martha, nahm das Telefon wieder entgegen und begann Izzy auf ihrem Schoß die Ohren zu kraulen.
»Du bist im Krankenstand«, erinnerte Lynn.
»Ich lüfte kurz durch«, meinte Frederika mit Seitenblick auf Izzy und ließ alle Fenster einen Moment hinunter.
»Zwölf Jahre ohne Zähneputzen«, sagte Martha und schmiegte sich an den Hund, er würde ihr fehlen.
»Direktorin Blecha anhecheln!«, befahl Frederika ihm, während sie auf die Überholspur wechselte. Izzy suchte den Schatten unter dem Handschuhfach und setzte sich auf Marthas Sandalen. Sie selbst schaute unterdessen auf die vorbeiziehende Landschaft, das Gras versengt von der Augustsonne. Ihr schien, dass sie den Sommer vor allem durch Fenster gesehen hatte – die belüfteten des Krankenhauses, die Doppelfenster zu Hause, im Augenblick das von der Hundezunge verschmierte Autofenster und bald ein neues, wohl frisch geputztes.
Zum Parkplatz hochfahrend sagte Frederika: »Hier gehörst du zu den Jüngsten.« Sie parkte unter einem Baum, zog den Autoschlüssel aus dem Schloss und schnallte sich ab. Martha verabschiedete sich von Izzy, trug ihr dabei auf, Frederika zu gehorchen. »Mundwasser!«, verordnete Frederika. Lynn hatte inzwischen den Kofferraum aufgemacht und Marthas Koffer herausgeholt.
Als sich vor den Dreien die automatische Tür öffnete, zuckelte eine hüfthohe Scheuersaugmaschine an ihnen vorbei. Ein oranges Warnlicht blinkte, als winkte es ihnen zu. Die Reinigungsmaschine ließ den Parkplatz mit den Autos zurück und nahm Kurs auf das abschüssige Gelände, in Richtung des Tannenwaldes, an dem sie eben vorbeigefahren waren. »Jetzt haben sogar schon die Maschinen genug«, meinte eine entgegenkommende Frau im Rollstuhl.
»Fängt ja gut an«, murmelte Martha. Lynn, die sich um Marthas Koffer kümmerte, drehte sich noch einmal um und sah, wie jemand sich draußen suchend umblickte. Frederika drückte bereits auf den Klingelknopf in der Eingangshalle.
»Einfach Reißaus genommen«, murmelte die Rezeptionistin, als könnte sie dies auf eine Idee bringen. »Sie hat Kurs auf den Wald genommen«, informierte Lynn die Rezeptionistin, die bloß nickte. Sie händigte Martha die Magnetkarte für das Zimmer aus, gab ihr einen Therapieplan und ein paar Broschüren – das alles tat sie mit angelernter Freundlichkeit, aber Martha hatte Respekt vor jedem Erlernten. Im Spiegel des Aufzugs sah Martha, wie sich die junge Frau mit einer der Broschüren, die sie in ihrer Hand hielt, den Blick hinaus gerichtet, Luft zufächelte.
Als sie auf ihrem Stockwerk ausstiegen, war niemand zu sehen – bis auf eine Scheuersaugmaschine in der Mitte des Ganges. »Das wird doch nicht die Schwester sein«, sagte Frederika. Je näher sie kamen, desto klarer konnten sie den Schlauch am kompakten Körper der Maschine ausmachen, die Bürsten, die sich drehen konnten – würde sie nicht gerade stillstehen und das mitten im Weg. »Eine Verschwörung«, meinte Lynn. »Gut, dass ich von der Schule einiges gewohnt bin«, sagte Martha. Lynn stellte den Koffer beiseite, um mit Frederika – »Deine Bandscheiben, Martha!« – die Maschine zu verrücken.
Schließlich schlüpften sie an ihr vorbei, Martha sperrte bei ihrer Zimmernummer auf und die Tür fiel hinter ihnen zu. Martha ließ sich auf den Sessel in der Ecke fallen, atmete hörbar aus und meinte: »Das Rehazentrum ist mir nicht ganz geheuer!«
»Du hältst uns auf dem Laufenden«, erbat Lynn.
»Wenn mich nicht eine der Scheuersaugmaschinen verputzt«, erwiderte Martha.
Frederika ließ sich unterdessen auf dem Bett nieder. »Meines war weicher«, befand sie, fügte hinzu: »Das unterscheidet den Krebs von den Bandscheiben.«
Lynn, die am Fenster stand, durch das Martha die nächste Zeit blicken würde, sagte: »Ratet, wo die Putzmaschine zum Stehen gekommen ist?«
»Vielleicht hat sie einen Baum zum Umarmen gesucht«, meinte Frederika, die aufgestanden und ebenfalls ans Fenster getreten war.
»Oder für den Strick«, murmelte Martha und blickte auf den vollgepackten Therapieplan.
»Hier gibt’s kein Entkommen«, sagte Frederika, die sich zurück zu Martha gedreht hatte.
»Kein Entkommen«, wiederholte Martha, dachte an die folgenden drei Wochen, an die Scheuersaugmaschine im Wald, an die Zeilen von Frau Blecha – sie richtete sich plötzlich auf, nahm ihr Telefon, suchte die Nachricht der Direktorin und rief aus: »Kein Entkommen, Anatol Penzel!«
Sehr geehrter Herr Penzel, als Lehrerin einer Klasse der Christine-Nöstlinger-Volksschule, die für die Pilotphase der neuen Lernplattform KREIDE bestimmt wurde, würde ich nähere Informationen vor allem den Datenschutz der Kinder betreffend erbeten. Mit freundlichen Grüßen, Martha Kopetzky«, das war das Erste, was Anatol in der Früh las, als er sein E-Mailprogramm öffnete. Anatol seufzte und leitete die Nachricht sogleich an Zachy in der Agentur für Bildung weiter. Wenn das Bildungsministerium schon glaubt, mit einem Start-up-Unternehmen kooperieren zu müssen, dann kann ich auch etwas davon haben, dachte er. Erstaunt war er, als er Zachy wenig später in seiner Abteilung im Bildungsministerium auftauchen sah.
»Ob das Schütteln der Schneekugel gegen die Hitze hilft?«, fragte Zachy im Türrahmen, den Fahrradhelm unter den Arm geklemmt, die Augen auf die Kugel am Schreibtisch geheftet. »Ich habe dir gerade die Nachfrage einer Lehrerin weitergeleitet«, sagte Anatol.
»Du kannst sicher behutsamer mit Ängsten von Volkschullehrerinnen umgehen«, betraute Zachy flugs wieder Anatol damit, öffnete seinen Rucksack und holte eine Blattsammlung in Spiralbindung heraus: »Hier der Präsentationsentwurf zur KREIDE – ausgedruckt, wie gewünscht!« Anatol nahm ihn wortlos entgegen. Zachy hatte schon oft genug erläutert, an wen sich dieser richtete, sodass Anatol im Geiste mitsprach, als er es ein weiteres Mal tat: »Für das geschätzte Lehrpersonal der Christine-Nöstlinger-Volksschule sowie interessierte Direktoren anderer Volksschulen.« Anatol wartete, ob noch etwas kam. »Und das bitte unterschreiben.« Anatol nickte.
»Nach Büroschluss brauche ich eine Abkühlung in der Alten Donau«, sprach Zachy unterdessen weiter, blickte auf Anatols geschlossenen obersten Hemdknopf und den ausgeschalteten Ventilator, als sein Telefon piepste. Mit einem Lächeln meinte er: »Oder der Tag findet einen anderen Ausklang.« Zachy, wie immer mit seinen Kontakten prahlend, dachte Anatol, der nach einem Stift für die Unterschrift suchte. Was denn Anatol heute noch vorhabe, erkundigte sich Zachy.
»Nach Hause gehen«, murmelte Anatol, ärgerte sich, wie langweilig es klang und wie Zachy ihn daraufhin anschaute. Erneut piepste das Telefon. Das Piepsen war Zachys Ausklang, dachte Anatol, während er unterschrieb, sein Schreibtischsessel knarzte dabei.
»Leider abgesagt«, sagte Zachy mehr zu sich, tippte schnell etwas.
»Es wird gleich nochmal piepsen«, meinte Anatol und hielt Zachy das unterschriebene Blatt hin.
»Gesellschaft ist leicht zu finden«, stimmte Zachy zu und nahm es.
»Gesellschaft«, wiederholte Anatol abfällig.
»Du hast ja die Volksschullehrerinnen«, sagte Zachy.
»Da ist mir noch der Präsentationsentwurf lieber«, erwiderte Anatol und voller Groll dachte er: Dazu hat er mich jetzt auch noch gebracht.
Und nachdem Zachy seinen Fahrradhelm aufgesetzt und sich verabschiedet hatte – nicht ohne Anatol darauf aufmerksam zu machen, dass an der Jalousie eine Lamelle gerissen war –, blieb Anatol nichts anderes übrig, als Martha Kopetzky selbst zu antworten.
»Sehr geehrte Frau Kopetzky, wir verstehen Ihre Befürchtungen bezüglich des Datenschutzes der Kinder und sind deswegen ganz besonders bemüht, in dieser Hinsicht jeden Zweifel an der Lernplattform KREIDE auszuräumen.« Er machte eine Pause, tippte weiter, löschte das, was er gerade getippt hatte, begann von Neuem, löschte es wieder, machte eine weitere Pause, bis er die Antwort auf die E-Mail auf später verschob. Warum hat Zachy es nicht einfach übernehmen können?, ärgerte er sich. Das Vorgefertigte war doch seins, dachte Anatol, obgleich er sich eingestehen musste, dass er selbst um andere als vorgefertigte Sätze rang, ja, dass er ihnen immer weniger zu entkommen schien. Er fürchtete auch, er würde nicht darauf hoffen können, dass es Martha Kopetzky nicht auffiel. Diese übereifrigenLehrerinnen, dachte er, und es kam ihm zu Bewusstsein, dass man ihn, kurz nachdem er seine Stelle hier angetreten hatte, ebenfalls so genannt hatte. Er beschloss, sich anderen Aufgaben zu widmen; das Beantworten der Nachricht erledigte er schließlich kurz vor Feierabend.
Wie so oft ging Anatol nach diesem Arbeitstag nicht gleich nach Hause. Anatol glaubte nicht an Geister, aber wenn er abends in die leere Wohnung zurückkehrte, fühlte er sich selbst wie einer. Er ging also in den asiatischen Imbiss, der in der Nähe seiner Wohnung lag; er nahm an einem der Tische bei den bodentiefen Fenstern Platz. Die Kellnerin, die hinter der Theke hervorkam, musste ihn kennen, nachdem er seit fast einem Jahr regelmäßig hier aß, aber sie ließ es sich nicht anmerken. Kommentarlos reichte sie ihm jedes Mal die in Plastik eingeschweißte Karte, die der Schriftzug Zur Frühlingsrolle über den aufgelisteten Nummern der Speisen zierte.
Er bestellte fast immer das Gleiche und während er jetzt auf das Essen wartete, schaute er durch die Scheibe nach draußen. Passanten gingen vorbei, er sah lachende Gesichter, geblümte Stoffe, gestreifte Sonnenhüte. Er wandte den Blick wieder in den schummrigen Imbiss, bemerkte nun den Abdruck eines Tellers in verschütteter Sojasauce auf der metallenen Tischplatte. Und Anatol, den der Tellerabdruck mit den Soßenkringeln plötzlich an Zachys Lockenkopf erinnerte, war versucht, den Tisch etwas anzuheben, um die Sojasauce darüber rinnen zu lassen. Zachy ging ja schließlich so gerne baden. Die Kellnerin kam mit Dose und Glas in der einen Hand an seinen Tisch zurück und wischte mit einem Lappen in der anderen jetzt erst über die Platte. Anatol faszinierte diese Nachlässigkeit, die von einer Gleichzeitigkeit aufgeholt worden war. Die Kellnerin stellte wortlos das Getränk mit dem Glas auf die saubere Tischplatte. Darauf legte sie den zusammengeknüllten Lappen kurz ab und öffnete mit ihrem Fingernagel die Dose. Anatol blickte auf das metallische Blau des lackierten Nagels, dachte an einen Sportwagen. Es zischte. Die Augen der Kellnerin schwarz wie die Cola light. Die Kellnerin schenkte ein, strich sich eine Haarsträhne, silbern wie die Dose, aus dem Gesicht, dann verschwand sie hinter einem Schnurvorhang mit Perlen.
Anatol sah zur Theke, die mit einer Lichterkette aus roten chinesischen Laternen geschmückt war. Dass sie abgestaubt gehörte, schien unbemerkt zu bleiben, obwohl sie immer brannte – sogar an einem Sommerabend wie diesem, an dem es erst dämmerte. Der Ventilator auf der Theke drehte sich in seine Richtung. Zumindest saß er von der kühlen Luft weit genug entfernt. Die Flügel drehten sich weiter und bewegten jetzt die Perlschnüre. Ein heller Ton erklang in das gleichmäßige Brummen des Getränkekühlschranks, dessen Scheibe beschlagen war. Anatol fühlte sich wie eine der Dosen im Getränkekühlschrank: eingeschlossen in kalter Umgebung. Was hilft es mir da, haltbar zu sein!, dachte er und seufzte. Bevor der Ventilator ans Ende seiner Achse kam, bewegte der Wind das erste Blatt eines Kalenders, der an der Wand hing. Das Blatt zeigte ein landwirtschaftliches Fahrzeug. Vermutlich ein Werbegeschenk eines chinesischen Landmaschinenherstellers. Der Kalender hing an einem Nagel ohne Kopf – Er wird doch nicht in eine vorbeigetragene Speise gefallen sein, dachte Anatol.
Die Kellnerin schritt durch den Schnurvorhang und brachte das Nudelgericht. Anatol nahm die Stäbchen aus der weißen Verpackung und brach sie auseinander. Er hatte erst vor ein paar Monaten begonnen, mit Stäbchen zu essen, davor hatte er immer die Gabel aus dem Besteckhalter gezogen. Nach seinen ersten verstohlenen Versuchen aß er jetzt mühelos damit und war unsinnigerweise stolz darauf und wiederum sinnigerweise traurig, denn Gisela hätte es amüsiert, ihn mit Stäbchen essen zu sehen. Anatol seufzte, blickte einen Moment auf die Stäbchen, aß schließlich weiter. Ein Auto fuhr hupend vorbei, eine kroatische Fahne, aus dem Fenster gehalten, wehte im Fahrtwind – heute Abend musste ein Fußballmatch stattfinden, und Anatol blickte unwillkürlich zum Fernseher in der Ecke, der ihm noch nie eingeschaltet untergekommen war.
Die Bedienung kam, um seinen Teller abzuräumen, und er bestellte eine zweite Cola light. Er hörte das Öffnen und Schließen der Tür des Getränkekühlschranks, sie brachte die frische Dose an den Tisch, machte diese wie gehabt mit ihrem blauen Fingernagel auf und stellte sie ihm hin. Anatol nahm einen Schluck. Als er durch die bodentiefe Glasscheibe einen angeleinten Hund vorbeigehen sah, musste er an die Agentur und an Zachy denken. Daran, dass er an deren Leine hing. Der Hund markierte den Hauseingang. Anatol seufzte und öffnete seinen Rucksack. Er zog den Präsentationsentwurf für die KREIDEheraus, den ihm Zachy zur Durchsicht überreicht hatte. »Ausgedruckt, wie gewünscht!«, hörte er Zachy anmerken und dachte, Schulbücher werden den Kindern der KREIDE so verstaubt vorkommen wie die Laternen hier über der Theke, und in deren Licht begann er schlussendlich zu lesen.
Anatol war zwar nicht davon ausgegangen, dass im Präsentationsentwurf Information und Aufklärung vorrangig sein würden, die Stirn runzelte er trotzdem. Er las das erste Kapitel zu Ende, mutete sich das zweite zu, gab aber, anstatt das dritte zu lesen, die Papiere in den Rucksack zurück. Er verschloss ihn sogar mit der dafür vorgesehenen Schnalle, als könnte der Entwurf sonst sein Unwesen treiben, und seufzte laut in das Klicken, sodass die Kellnerin zu ihm herüberlinste. Im selben Moment betrat ein Mann den Imbiss, eine Mappe unterm Arm. Er bestellte ein Take-away wie die meisten, die hierherkamen. Manchmal waren es mehrere Speisen, die turmartig übereinandergestapelt wurden. Der Imbiss hatte noch nicht auf Papiersäcke umgestellt und die übereinandergestapelten Essensverpackungen in Plastiksäcken machten Anatol jedes Mal wehmütig. Auch ihm hatte oft ein solcher voll aufgetürmter Gerichte ins Handgelenk geschnitten, wenn er die Tür aufgesperrt hatte. Er hörte jetzt deutlich Giselas Stimme und ihr Lachen. Dabei saß er doch in einem Imbiss, dessen Eröffnung Gisela gar nicht mehr erlebt hatte. Und neben ihr erschien ein Kinderkopf, der nun zu einer erwachsenen Forschungstaucherin gehörte, und ein Finger in der Soße, als wäre das bereits ein Meer.
Anatol beneidete seine Stieftochter Hanna darum, dass sie einfach abtauchen konnte, ja, dass ihre Arbeit darin bestand. Das Tauchen helfe ihr, hatte sie nach dem Tod ihrer Mutter gesagt. Unter Wasser habe sie das Gefühl, Gisela nah zu sein. Wenige Monate nach dem Begräbnis hatte sie einen Forschungsauftrag in Costa Rica angenommen.
»Wann kommst du mich besuchen?«, fragte sie seitdem Anatol am Telefon in regelmäßigen Abständen und Anatol antwortete: »Bald«, klagte jedoch im nächsten Atemzug, dass er mit Arbeit eingedeckt sei; in letzter Zeit kam er mehr und mehr auf die Agentur zu sprechen, über deren Ausrichtung er sich beschwerte. Den Menschen scheine die digitale Welt entgegenzukommen, könne man bei ihnen doch eine Tendenz zur Verarmung der Gefühle feststellen, hatte Hanna gestern darauf erwidert: »Deswegen sind mir auch die Meeresbewohner lieber.«
»Das liegt wohl kaum an deren Gefühlshaushalt«, hatte Anatol gescherzt und Hanna geantwortet: »Aber an meinem: In dreißig Jahren wird es mehr Plastik als Fisch im Meer geben – und im Schnee der Antarktis hat man Chemikalien gefunden, mit denen Outdoorbekleidung beschichtet ist, um sie wasserfest zu machen.« Beim letzten Teil des Satzes war die Leitung schon unterbrochen gewesen.
»Selbst die Technik erträgt den Menschen nur schwer«, war als Nachricht von Hanna gefolgt.
Anatol schaltete beim Telefonieren mit ihr nie die Kamera ein. Er schob üblicherweise als Grund vor, die Verbindung sei dadurch stabiler, in Wahrheit tat er es, weil ihre Stimme der ihrer Mutter glich. Anatol fragte sich, ob es einen Unterschied gemacht hätte, wenn sie seine leibliche Tochter gewesen wäre. Ob er dann erst recht die Kamera hätte einschalten wollen, um das Gemeinsame zu sehen, anstatt durch den Klang das Verlorene heraufzubeschwören.
Als Anatol Giselas Tochter kennengelernt hatte, war diese zehn Jahre alt gewesen. Hanna und er hatten sich sofort verstanden und mit den Jahren war immer weniger spürbar gewesen, dass er dazugekommen war; nie war es – was er insgeheim gefürchtet hatte – gegen ihn verwendet worden.
Er fragte sich zuweilen, wie oft sie mit ihrem leiblichen Vater telefonierte. Seit Giselas Tod bemerkte er, dass er dem Ex-Mann gegenüber Eifersucht verspürte, was ihm lächerlich vorkam, aber nichts daran änderte, dass er sie empfand – plötzlich, nach mehr als eineinhalb Jahrzehnten.
Anatol fragte sich auch, ob ihr Vater an seine ehemalige Frau dachte, wenn er mit der gemeinsamen Tochter sprach. Vielleicht vergaß ihr Vater sogar, dass sie durch Gisela verbunden waren – Anatol faszinierte die Vorstellung, vergessen zu können, dass man ein Kind gemeinsam gezeugt hatte. Für Gisela war es indes eine Errungenschaft gewesen. Nicht auszudenken, wenn der eine für alle Zeiten an den anderen gekettet gewesen wäre.
Manchmal blitzte geradezu der Gedanke in Anatol auf, ob Hanna das Ungleichgewicht, dass sie nun einen Vater und eine Art Vater, jedoch keine Mutter mehr hatte, in ihrem Kopf aufrechnete. Ob sie sich daraufhin wie er manchmal fragte, warum ihre Mutter gestorben, aber er noch am Leben sei.
Anatol trank den letzten Schluck aus und verlangte die Rechnung. Draußen schlenderten Paare untergehakt in den schwülen Sommerabend. Geschmolzenes Eis lief Kindern aus der Waffel über die Finger. Anatol überquerte gerade die Straße, als in einem Café Jubel ausbrach – es war wohl ein Tor geschossen worden. Er bog in die nächste Seitengasse ein, fingerte in der Hosentasche nach seinem Schlüsselbund und sperrte schließlich das Haustor auf. Im kühlen Stiegenhaus schaltete er das Licht an. Begleitet von einem fernen Taubengurren stieg er die Treppe hoch. In seiner Wohnung im dritten Stock angekommen, ließ er die Tür hinter sich zufallen. Er stand im Dunkeln, den Rucksack mit dem Technologieversprechen auf der Schulter.
Zachy war nach der Arbeit auf sein Fahrrad gestiegen und gleich Richtung Alter Donau gefahren, die Badesachen hatte er schon in der Früh eingepackt. Jetzt lag er auf dem Rücken und ließ seine Badehose trocknen. Er mochte es, wenn er die Unebenheiten der Liegewiese spürte. Er zupfte einen Grashalm aus und wickelte ihn um seinen Zeigefinger, während die Sonne seine Haut wärmte. Dass es in der Abteilung des Bildungsministeriums keinen anderen als Anatol Penzel gab, den man mit der Begleitung des KREIDE-Projektes betrauen konnte, war kein gutes Zeichen für die Zukunft der Bildung, dachte Zachy, der eingedrehte Grashalm rutschte dabei von seinem Zeigefinger. Hoffentlich war er wenigstens im Abfedern von Vorbehalten geschickt. Seufzend drehte sich Zachy auf den Bauch. Ihm fiel Anatols stets geschlossener oberster Hemdknopf ein – dabei hatte es heute einen Hitzerekord gegeben. Zachy verspürte immer den Impuls, Anatol aufzufordern, den Knopf doch bitte endlich zu öffnen. Und plötzlich kam ihm Anatol mit seiner Zugeknöpftheit und dem ausgeschalteten Ventilator wie ein Menetekel vor: Stillstand und unsinnige Handlungen. »Zukunft – wir retten dich!«, rief Zachy, sodass die ältere Dame, die unweit bäuchlings auf einer Liege lag, den Kopf kurz hob. Er sprang auf, rannte auf den Holzsteg, streckte seine Arme nach vorn und tauchte mit dem Kopf voran in die Alte Donau. Er schwamm mehrmals hin und her, bevor er das Wasser wieder verließ, in das gerade die ältere Dame über die Stegleiter stieg, ihr Rücken gerötet; tropfend kam er bei seinen Sachen an und trocknete sich ab. Während er sich umzog, hörte er im Hintergrund ein junges Paar diskutieren und sich wenig später anschreien. In den Streit hinein mischte sich der lautstarke Protest eines Kindes, das von seiner kurz vor der Explosion stehenden Mutter nicht eingeschmiert werden wollte. Unter einem Baum legte indessen ein altes Ehepaar erschöpft eine Pause ein. Die Hitze setzt den Menschen zu, dachte Zachy. Er zog sich um und fuhr mit dem Rad nach Hause, Gruppen von Fußballfans überholend.
Nachdem er angekommen war, setzte er sich in seine Küche und widmete sich seinen diversen Dating-Apps. »Kennenlernportale«, nannte sie Anatol, dachte Zachy amüsiert und ihm fiel dazu Anatols Uhr ein, die in ihrer Unauffälligkeit ausschließlich die Funktion hatte, die Zeit anzuzeigen – aus der er gefallen war.
Der Abend war erst angebrochen, es war weiterhin drückend schwül. Zachy würde ihn nicht allein verbringen. Dank der Technologie war sein Liebesleben reicher und einfacher geworden. Niemand konnte mehr Ansprüche an ihn stellen, denn endlich hatte er die Möglichkeit, diese von vornherein auszuschließen. Das empfand er als große Erleichterung. Man hielt sich an die festgesetzten Spielregeln. Zachy hatte es schon als Kind erlebt, wie es sich anfühlte, wenn Spielregeln nach Belieben außer Kraft gesetzt wurden. So hingegen war er in Sicherheit.
II Pah
Martha konnte am frühen Abend endlich auf ihrem Zimmer bleiben. Nicht einmal mehr in einer Reha durfte man sich ausruhen, dachte sie. Sie legte die Banane aus dem Speisesaal auf den Tisch; dabei kam ihr Gerry in den Sinn, der seine ihm mitgegebene in der Pause gerne als Mikrofon benutzte – nicht selten, nachdem er dazu auf die Schulbank geklettert war. Sie öffnete das Fenster und atmete die am Land angenehm kühle Abendluft ein. Dann ging sie zurück zum Tisch, klappte ihren Laptop auf und rief die Nachrichten ab. Die Vögel vor dem Fenster zwitscherten laut, während sie die Antwort las, die sie vom Bildungsministerium erhalten hatte. Sofort rief sie Frederika an. »Immerhin hast du eine Antwort bekommen«, meinte diese. »Das soll eine Antwort sein?«, empörte sich Martha: »Anatol Penzel wird mich noch kennenlernen!«
Als sie aufgelegt hatte, klickte sie erneut auf die Homepage der KREIDE. »Kreative Intelligenz durch E-Learning!« – Martha konnte nur den Kopf schütteln. Schaffen wir eine positive Lernkultur! Ihre Augen rollten. Geben wir Schülern eine Stimme! »Die Stimme der Sponsoren«, murmelte Martha, scrollte weiter: DieKREIDE bietet gänzlich neue Möglichkeiten der Beurteilung und des individuellen Ansporns. »Pah!«, entfuhr es ihr. Die KREIDE fördert die sozial-emotionale Entwicklung, ein dynamisches Selbstbild und das Durchhaltevermögen der Kinder. Jedes Kind darf sich ein KREIDE-Monster aussuchen, das für das Verhalten des Kindes Punkte sammelt. »Prämien für die braven Kinder – und die anderen werden zu Fleisch«, war Marthas Auslegung, und sie klickte auf die neue, eben eingetroffene E-Mail der Direktorin Blecha, in der nun der Zeitplan erläutert wurde: Vor den Weihnachtsferien würde in der Schule die KREIDE von der Agentur für Bildung vorgestellt werden, einem Start-up-Unternehmen, das sich in enger Zusammenarbeit mit dem Bildungsministerium der Aufgabe verschrieben habe, die digitalen Möglichkeiten optimal für die neue Schülergeneration zu nutzen. Warum wechseltFrau Blecha eigentlich nicht gleich zum Start-up?, dachte Martha. Im nächsten Schuljahr sollte alles bereits in Betrieb genommen werden. Bis dahin sei jedoch genug Zeit für Einarbeitung, wie Frau Blecha zum Schluss versicherte. »Bis dahin genug Zeit fürs Umdenken!«, versprach Martha, und als sie gerade eine weitere E-Mail an Anatol Penzel schicken wollte, rief Lynn an. »Ist die Reinigungsmaschine inzwischen wieder ausgebüxt?«, fragte sie und knüpfte, ohne Marthas Antwort abzuwarten, daran an: »Kann man bei dir nicht ein Zimmer mitbelegen?«, seufzte: »Fünfzehnjährige!«, ergänzte: »Und sein Vater steht bloß am Klopfbalkon und raucht.« »Das hat dir einmal an Joshua gefallen«, erwiderte Martha.
Und Martha hatte recht: Wie er die Zigarette an die Lippen geführt und den Rauch ausgeblasen hatte – war Joshua Lynn einst aufgefallen; den Rücken an die Wand gelehnt, ein Bein angewinkelt, zwischen den feingliedrigen Fingern der anderen Hand das Feuerzeug drehend, und als er auch noch in ihrem Seminar Mittelalterliche Handschriften und Buchmalerei aufgetaucht war, hatte sich das abweisende, unübersichtliche New York, aus dem ihre Mutter stammte und in dem sie zu der Zeit ein Universitätsjahr verbrachte, in ein Städtchen aus Blattgold verwandelt. Was wohl gewesen wäre, wenn sie später nicht die Stelle an der Universität bekommen hätte, fragte sich Lynn oft und dachte daran, wie Joshua als auf Handschriften spezialisierter Jamaikaner in Wien festgehangen war. Auch wenn er noch eine Weile versucht hatte, akademisch Fuß zu fassen, hatte er dann in erster Linie – während Lynn an der Universität unterrichtete – den Kinderwagen durch die Stadt geschoben, mit jeder nächsten Runde weiter weg von seinen Handschriften.
Frederika hatte bereits damals das Auseinanderdriften des Paares bemerkt. »Statik lässt sich auf alles Mögliche anwenden«, rühmte sie regelmäßig ihren Beruf und blies dabei ihren schnurgeraden Pony ein wenig hoch. Lynn hatte zu bemängeln begonnen, dass für Joshua die Buchmalerei, die sie doch so verbunden hatte, gänzlich nebensächlich geworden war und sich nun alles permanent um Kinderfragen drehte. Martha, die keine Kinder kriegen konnte, hatte sich hingegen dabei ertappt zu denken, dass sie mit einem wie Joshua schon drei Kinder hätte adoptieren können – anstatt mit Liam zu zweit in ihrer Wohnung zu sitzen, weil er erstmal seine Dissertation abschließen wollte.
»Die Aussichten auf Mitbelegung stehen also schlecht«, resümierte Lynn, seufzte: »Dann bleib’ ich halt zu Hause in unserem Boxring«, erkundigte sich darauf nach Marthas Kampf – gegen Windmühlen, doch das sagte sie nicht laut. »Dieser Anatol Penzel will mich für dumm verkaufen«, antwortete Martha, aber weil es klopfte, unterbrach sie das Gespräch. Der Kopf einer Physiotherapeutin erschien im Türrahmen.
Es müsse noch hier unterschrieben werden, bat sie, ansonsten könnten die Punkte der absolvierten Einheiten nicht zusammengezählt werden. Martha nickte, setzte ihre Unterschrift auf das Formular und dachte: Ohne Punkte geht wohl gar nichts mehr – wie soll man da gesund werden!
Du siehst aber müde aus«, meinte Zachy, als er in der Früh vor der Agentur Anatol antraf, der auf dem Weg zu dessen Vorgesetzten war. »Ich schlafe ja auch nicht, um erholt auszusehen«, sagte Anatol und fügte kaum hörbar hinzu: »Eher um nicht nachdenken zu müssen.«
Zachy war im Begriff zu erwidern, dass er sich im Grunde am besten erhole, wenn er nicht wirklich schlafe. Aber er besann sich eines Besseren: Anatol hatte auf derartige Bemerkungen bereits in der Vergangenheit empfindlich reagiert. Als Zachy bloß im Scherz einmal gemeint hatte, dass man seine Nächte lieber mit einer gut als einer schlecht aufgelegten Person verbringe, hatte Anatol knapp geantwortet, dass er jetzt jedenfalls schlecht gelaunt sei. Zachy wusste nicht, ob es daran lag, dass Anatol trauerte und Verlangen und Trauer zwei unvereinbare Dinge zu sein schienen. Das Intime und der Tod waren ein seltsames Gefüge, dachte Zachy, während er die Treppe hochstieg. Anatol fuhr unterdessen mit dem Lift und dachte an Zachy. Der erholt sich doch nur, wenn er sich bedienen kann, dachte Anatol mit düsterer Miene an Zachys konsumorientiertes Verhalten in der Liebe – es fiel Anatol schwer, es als etwas anderes zu bezeichnen, von Zachys Gerede über das Einhalten von Spielregeln ließ er sich sicher nicht beeindrucken. Und hatte sich Zachy bisher zweifellos seine Verabredungen aussuchen können, würde der Algorithmus ihn irgendwann nicht mehr ganz oben einreihen. Da könnte er sich noch so oft als »Zac« einloggen – wie er Anatol einmal seinen Username verraten hatte. Vielleicht wirst du, Zac, dann anfangen nachzudenken, statt dich zu erholen, dachte Anatol.
Anatol stieg im letzten Stock aus. Er betrat den großen, lichtdurchfluteten Raum. Hier gab es keine klemmenden Rollos oder alte Schreibtischsessel. Hier war alles neu, allem voran das Denken. Die Schreibtische waren zu Inseln zusammengeschoben und wirkten unberührt wie ein Naturschutzgebiet. In einer Ecke stand ein Wasserspender, einer geschützten Pflanze gleich. Unweit davon ragte ein Terrarium in die Höhe. Ein Baumstamm mit Kletterästen war ins Licht der UV-Lampe getaucht. Im Wasserbecken badete ein Leguan. Nur die Tablets auf den Tischen ließen vermuten, dass in diesem Raum auch etwas anderes getan wurde als baden. Eine Arbeit, die hier verrichtet wurde, konnte nur eine sein, für die man eine freie Sicht brauchte: Durch die bodentiefe Fensterfront blickte man nicht nur direkt auf die Terrasse, sondern war dem Himmel nah.
Von dort kam Kai Schneeberger, der CEO, Anatol entgegen. Anatols Magen machte ein Wasserspendergeräusch. Der CEO begrüßte Anatol überschwänglich und gemeinsam gingen sie in den kleineren der beiden Räume, die für Meetings reserviert und durch eine Glaswand vom Rest des Büros abgetrennt waren. Aus der Ecke leuchtete das Edelstahlgehäuse einer Espressomaschine mit einem Hebel, den Anatol von derjenigen im Imbiss Zur Frühlingsrolle kannte; schon betätigte Kai den in Holz eingefassten Kolben. Anatols Augenbrauen hoben sich wie auf Knopfdruck. »Cola light kommt nicht zufällig aus der Maschine?«, fragte er in Kais Richtung, der so tat, als hätte er ihn nicht gehört. Während der Kaffee langsam in die Tasse aus Glas floss, betrachtete Anatol Kai.
Der Schneeberger hat auch etwas Gläsernes an sich, dachte Anatol. Geschliffen waren nicht nur seine Gesichtszüge, sodass er ein aus jedem Blickwinkel schöner Mann war, sondern auch sein Auftreten. Zudem hatte er einen Doktor in Philosophie – wie Anatol aus dem zu Beginn der Zusammenarbeit vorgelegten Lebenslauf wusste und woran er überdies von der im Meetingraum aufgehängten Urkunde erinnert wurde. Mit einem solchen Abschluss hätte er doch etwas anderes angehen können als einen weiteren in Leadership and Entrepreneurial Skills, dachte Anatol beim Anblick der zweiten Urkunde hinter Glas. »Der Kaffee ist gleich fertig«, rief Kai mit kristallklarer Stimme. Anatol nickte, blickte durch die gläserne Trennwand hinaus in den Büroraum, zu dem einzigen Tisch, auf dem sich ein gerahmtes Familienbild befand. Mitten im Naturschutzgebiet stand dieses Relikt. Als Kai Schneeberger vorher sein Tablet von diesem Tisch geholt hatte, waren Anatols Augen an der Fotografie hängen geblieben. Ein kleiner Bub saß auf Kais Schoß, seine Frau hielt ein Baby im Arm. Anatol fiel ins Auge, dass sie sich deutlich von Kai unterschied, sie war in jeder Hinsicht unauffällig. Anatol begann ihm zuzutrauen, dass er sich auch damit bloß hervortun wollte. Der Schneeberger erscheint mir langsam, aber sicher aus Panzerglas, dachte Anatol.
»Achtung, heiß«, warnte Kai und reichte Anatol die Tasse.
»Danke«, sagte Anatol und als er sie entgegennahm, fielen ihm Kais Hände auf. Durch ihre Haut schimmerten die Adern, im Nagelbett leuchtete der Halbmond und die Fingernägel glänzten poliert.
Während Anatol die Besprechung mit Kai Schneeberger führte, klickte Zachy im gegenüberliegenden Meetingraum auf das Link für die bundesweite Kommunikationsschulung zur KREIDE-Lernplattform, die nach der erfolgreich abgeschlossenen Pilotphase in der Wiener Volksschule Christine Nöstlinger sukzessive in den übrigen Bundesländern eingesetzt werden sollte. Ein Schulungsleiter stellte sich vor und hieß die Teilnehmer aus den anderen Bundesländern willkommen, auch eine Assistentin – Ada Mazur – begrüßte sie. Ein Leberfleck mitten auf ihrer rechten Wange tat es Zachy sogleich an. Auf seinem Bildschirm erschien unterdessen groß der Schriftzug: KREIDE.
Der Schulungsleiter sagte: »Zuerst gehe ich auf den Charakter der KREIDE ein. Die KREIDE ist nämlich nicht einfach eine Software, die man kaufen kann, schon gar nicht ein vorgeschnürtes Paket.«
Zachy dachte, dass sie den Schulen doch gerade ein Paket verkaufen wollten, unterdessen sagte der Schulungsleiter, die KREIDE sei vorurteilsfrei, motivierend, präzise. »Und die KREIDE denkt immer mit. Lernen wird so endlich der modernen Welt gerecht, in der Kinder heute aufwachsen.«
Zachy nahm einen Schluck aus seiner Wasserflasche. Man solle aber darauf achten, betonte der Schulungsleiter, die KREIDE nicht als Revolution des Lernens zu bezeichnen – der Begriff Revolution mache vielen Angst, sowohl Eltern als auch Interessenvertretern. In dem Moment verschluckte sich Zachy. Es gehe vielmehr um eine logische Weiterentwicklung des Lernens, hörte er in sein Husten. »Keine Frage der Wahl, sondern eine der Notwendigkeit.«