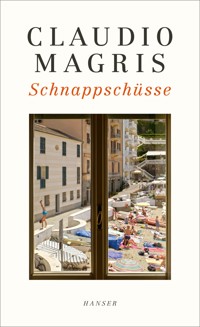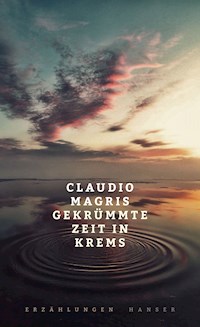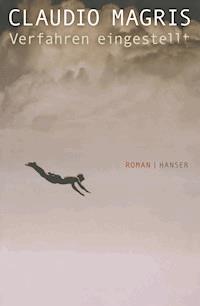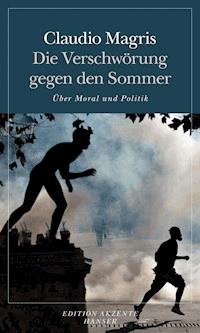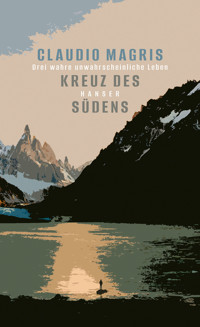
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Geschichten von Ländern, Grenzen, Entdeckungen und der Fremde – meisterhaft erzählt von Claudio Magris Drei unwahrscheinliche, wahre Geschichten von der Welt „am Ende der Welt“. Claudio Magris‘ meisterhafte Erzählungen handeln von außergewöhnlichen Menschen, die Ende des 19. Jahrhunderts nach Patagonien auswanderten, um sich mit dem „Anderen“ zu konfrontieren: Ob es der slowenische Ethnologe Janez Benigar ist, der sich mit einer Mapuche vermählt, der französische Anwalt Orélie-Antoine de Tounens, der sich zum König von Araukanien ausrufen lässt und einen hoffnungslosen Freiheitskampf initiiert, oder schließlich Schwester Angela Vallese aus dem Piemont, die ihr Leben für die verfolgten Ureinwohner Feuerlands opfert. Magris erzählt die erstaunliche Geschichte unbekannter Helden, die die Fremde zur Heimat machten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 160
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Geschichten von Ländern, Grenzen, Entdeckungen und der Fremde — meisterhaft erzählt von Claudio MagrisDrei unwahrscheinliche, wahre Geschichten von der Welt »am Ende der Welt«. Claudio Magris‹ meisterhafte Erzählungen handeln von außergewöhnlichen Menschen, die Ende des 19. Jahrhunderts nach Patagonien auswanderten, um sich mit dem »Anderen« zu konfrontieren: Ob es der slowenische Ethnologe Janez Benigar ist, der sich mit einer Mapuche vermählt, der französische Anwalt Orélie-Antoine de Tounens, der sich zum König von Araukanien ausrufen lässt und einen hoffnungslosen Freiheitskampf initiiert, oder schließlich Schwester Angela Vallese aus dem Piemont, die ihr Leben für die verfolgten Ureinwohner Feuerlands opfert. Magris erzählt die erstaunliche Geschichte unbekannter Helden, die die Fremde zur Heimat machten.
Claudio Magris
Kreuz des Südens
Drei wahre unwahrscheinliche Leben
Aus dem Italienischen von Anna Leube und Dietrich Leube
Hanser
Für Pedro Luis Ladrón de Guevara
Übersicht
Cover
Über das Buch
Titel
Über Claudio Magris
Impressum
Inhalt
Slowenischer Gringo, araukanischer Kreole
König von Araukanien und Patagonien
Nonnen und Pinguine
Slowenischer Gringo, araukanischer Kreole
Im Jahr 1946 fragte sich Janez Benigar in einer autobiografischen Notiz, ob das Heimatland eines Menschen — der Ort, an dem man sich zu Hause fühlt und dessen Farben, Landschaften, Winde die vertraute Musik der Existenz sind — das Land ist, in dem die eigenen Kinder leben, oder das, in dem die Eltern begraben sind. Er hatte gute Gründe, sich diese Frage zu stellen, da zwischen dem einen Land und dem anderen der Ozean und eine noch größere kulturelle Entfernung lag. Wie viele andere würde auch er in Argentinien ein Gringo sein, ein Mann, der keine Toten in Amerika hatte. Bei seiner Ankunft in Buenos Aires am ersten Oktober 1908 — das Schiff, die Oceania, hatte in Triest abgelegt — war er als Arbeiter, Katholik und Junggeselle gelistet worden.
Für die Veränderung dieses Status sollte ein coup de foudre sorgen: 1910 heiratete er Eufemia Barraza, mit wahrem Namen Sheypukíñ, eine Indigene, die von einer Adelsfamilie von Mapuche- bzw. Araukaner-Kaziken abstammte und ihm zwölf Kinder schenken sollte, von denen eines früh starb und die sowohl einen spanischen als auch einen araukanischen Namen trugen: Nancú, Aquila; Huenumanqué, der hochfliegende Kondor, Feliciano; Kallvuray, Blaue Blume, Elena …
Der Mann, der Europa und die europäische Zivilisation flieht, ist ein Familienmensch. 1932, wenige Jahre nach dem Tod Eufemias heiratet er Rosario Peña, auch sie Araukanerin; aus dieser Ehe gehen weitere vier Kinder hervor. Als auch Rosario Peña stirbt, verfasst Benigar ein Testament, in dem er erklärt, er wolle an der Seite von Rosario, aber auch von Eufemia begraben werden, deren sterbliche Überreste in ein gemeinsames Grab für alle drei überführt werden sollen. Auch der große Thomas Morus, Heiliger und Märtyrer der katholischen Kirche, hätte gern die Liebe zur ersten und zur zweiten Ehefrau miteinander vereint, die er beide sehr liebte. Ja, er stellte sich sogar vor, wie schön es gewesen wäre, hätten sie gemeinsam zu dritt leben können, »hätten menschliche und göttliche Gesetze es gestattet«. Wer weiß, ob ihm der einzige vernünftige Einwand gegen diesen höchst menschlichen Wunsch durch den Kopf gegangen ist, nämlich, dass seine beiden Frauen sich nicht nur im Grab, sondern auch im Leben einen anderen geliebten Mann außer ihm an ihrer Seite hätten wünschen können, der dann wiederum … Und dann hätten der Zauber der Liebe und des Widerspruchs mit einer geschmacklosen Anhäufung geendet. Der slowenische oder vielmehr österreichisch-slawische, in Zagreb geborene Abenteurer, Bürger des untergehenden Habsburgerreichs, der mit den Plänen für einen zukünftigen jugoslawischen Staat sympathisierte, ist ein bedächtiger Gewohnheitsmensch und neigt zu einer ganz und gar österreichischen Pedanterie. Er erinnert an die Anekdote vom k. u. k.-Beamten, der seine Untergebenen ermahnt, die auf ihren Schreibtischen verstreuten Papiere säuberlich zu ordnen und sie dann in den Papierkorb zu werfen. Benigar bricht auf nach Argentinien beziehungsweise nach Patagonien und Araukanien, von wo er nie mehr zurückkehren wird. Neunzehn Jahre lang wird er nie eine Stadt betreten, nur ein einziges Mal in ein Automobil steigen, nie wird er ein Flugzeug sehen und lange Zeit in Wigwams leben, den Zelten des indianischen Volkes, das auch zu seinem eigenen wurde. Diese Zelte werden ihm später immerhin nahelegen, eine bescheidene, doch erfolgreiche Tätigkeit in der Textilbranche aufzunehmen, in seinem eigenen kleinen Familienbetrieb.
Wahrscheinlich war es ihm recht, dass ihn das Einreisevisum als Arbeiter auswies, denn in vielen seiner Schriften — fast alle auf Spanisch und zum Glück der Städtischen Bibliothek von Ljubljana übergeben — sollte er die Handarbeit preisen und neue Methoden des Ackerbaus studieren, der Kanalisierung von Flüssen und Gebirgsbächen, der Bewässerung von Feldern, des Baus von Lagerräumen, der Unterrichtung von Einheimischen mit dem Ziel der Verbesserung der Landwirtschaft. Eines Tages sollte er sich sogar dazu bequemen, in einem Haus anstatt in einem Mapuche-Zelt zu schlafen. Keineswegs wollte er die Behörden des Landes, in dem er für immer bleiben würde, wissen lassen, dass er kein Arbeiter war, sondern de facto ein Ingenieur, ein Gelehrter, bewandert in Linguistik, Ethnologie und Anthropologie, Studienfächern, die er in den vielen Jahren pflegte, als er zwischen Pampa und Kordilleren lebte.
Bevor er den Ozean überquerte, hatte er eine abenteuerliche Studienreise in Bulgarien unternommen. Sein Vater, Gymnasiallehrer für Mathematik in Zagreb, hatte dem Sohn, als der ans Schwarze Meer hatte reisen wollen, fünf Silberkronen gegeben und darauf vertraut, dass er es damit höchstens bis Belgrad schaffen und dann umkehren würde. Stattdessen war Janez zu Fuß von Zagreb bis nach Sofia gelangt und hatte dabei ein Land durchquert, das der Wiener Reisende Felix Philipp Kanitz als das unbekannteste von ganz Osteuropa beschrieben hatte, als »vollkommene terra incognita«. Unzuverlässige Karten verzeichneten Orte, die es nicht gab, erfanden ganze Städte oder versetzten sie um Hunderte von Kilometern, leiteten Flussläufe zu imaginären Mündungen um, einschließlich die Donau, von der man weniger wusste als vom Nil.
Janez — Ivan, Janko — Benigar, noch nicht Don Juan Benigar, hatte sich nicht beirren lassen, hatte sich mit der Sprache und den Bräuchen des Landes beschäftigt und auf Slowenisch eine bulgarische Grammatik verfasst. Dann ging er nach Prag, schrieb sich für Ingenieurwesen ein und verzichtete auf den Abschluss, als ihm nur noch zwei Prüfungen fehlten, weil er, wie er viel später an seinen Freund Victor Sulcic schrieb, »das, was ihr Zivilisation nennt, als junger Mensch zur Genüge kennengelernt« habe, und »wenn ich sie hinter mir gelassen habe, gibt es dafür gute Gründe. Dazu zählt vor allem die Überzeugung, dass es sich nicht um Zivilisation handelt. Daher lebe ich lieber hier, so wie es mir gefällt, fern von den Metropolen, und bin ganz und gar glücklich.« Nicht viele Menschen hätten in dieser Phase des Zusammenbruchs und der Verwandlung einer jahrhundertealten europäischen Kultur von sich sagen können, sie seien glücklich. Aus ähnlichen Gründen hätte Janez nie in Buenos Aires leben wollen. »Ich ertrage die Stadt einfach nicht. Sehen Sie, ich war vierundzwanzig, als ich Prag verließ und weit weg in eine ferne Welt ging. Und glauben Sie mir, ich hatte gute Gründe … Wie könnte ich mich heute an das Leben in diesen Orten der Verdammnis gewöhnen, was sind die modernen Metropolen denn sonst?«
Er war ein leidenschaftlicher Leser Rousseaus gewesen, der sein Maßstab in Bezug auf Zivilisation und Barbarei bleiben sollte. Rousseau und den Naturzustand hatte er in der Bibliothek von Ljubljana entdeckt, mit dem Eifer des Epigonen, der sich mit einer Verspätung von hundertfünfzig Jahren mit einem radikalen Gedankengut auseinandersetzt, dem Europa einst mit revolutionärer Begeisterung angehangen, das es absorbiert, kritisiert und vielleicht, zumindest in Teilen, auf den Dachboden verbannt hatte. Doch der Epigone weiß nicht, dass er epigonal ist, und findet daher die ursprüngliche Kraft eines Gedankens wieder, der von der liberalen Gesellschaft ad acta gelegt wurde und dazu bestimmt war, wiederaufzutauchen im Guten wie im Bösen: in Form der stürmischen Projekte direkter und totaler Demokratie, der populistischen Bewegungen, die unbedingt direkt und kollektiv regieren wollen, ohne Repräsentanten und ohne eine politische Klasse der Wenigen.
Der südamerikanische Kontinent war par excellence die Bühne für populistische Bewegungen, die zu zahlreichen Staatsstreichen und Diktaturen führten und lokale Caudillos wie den grausamen Facundo der Pampa hervorbrachten, das blutrünstige Regime des Generals und späteren Präsidenten Rosas, des erbarmungslosen Verfolgers der Indigenen in der von ihm 1833 entfesselten »Wüstenkampagne«. Die Wüste, ein Begriff, der ursprünglich die menschenleere Einsamkeit der Pampa bezeichnete und schließlich die Vernichtung der Indigenen, ihre am Ende des Krieges zu einer Wüste gewordene Lebenswirklichkeit.
Die liberale Demokratie ist ein kalter Wert, sie gründet auf Normen und Gesetzen und verabscheut die Verführer der Massen, bezahlt aber für ihre Aufrichtigkeit mit dem Unvermögen, Begeisterung und Faszination zu wecken; das vermag hingegen der Volkstribun, dem manchmal auch scharfsinnige Geistesgrößen verfallen. Darwin, der sich offensichtlich besser mit Brontosauriern und Riesenfaultieren auskannte als mit menschlichen Lebewesen, begegnete im August des Jahres 1833 auf seiner Reise mit der Beagle nach Patagonien bzw. Feuerland, entlang der Küste Chiles und Perus und zu ein paar Inseln im Pazifik, dem blutrünstigen General Rosas. Der Mann, der dreiundzwanzig Jahre lang als Diktator über Argentinien herrschte, hatte ihn zu sehen gewünscht, »ein Umstand, über den ich mich im Nachhinein sehr freute«. Darwin ist überhaupt nicht schockiert über die von Rosas’ politischer Polizei, der berüchtigten Mazorca, begangenen Folterungen und interessiert sich weder für die Existenz noch die Struktur dieser Geheimpolizei. Stattdessen weiß er zu würdigen, dass der Präsident dreihundert Quadratkilometer Grund und dreihunderttausend Stück Vieh besitzt. Er notiert, dass der General die beiden Clowns, die die Gäste beim Mittag- und Abendessen unterhalten, wegen irgendwelcher Lappalien hart bestrafen lässt, doch hält ihn das nicht davon ab, ihn für einen »Mann von außerordentlichem Charakter« zu halten, »begeisterungsfähig, sensibel und sehr ernsthaft«, der seine enorme Macht »zugunsten des Wohlstands und des Fortschritts« in seinem Land nutzen will. Garibaldi mit seinen Freiwilligen wird dann mit Waffengewalt zum Sturz des Tyrannen beitragen.
Argentinische Geschichte. Gewalt von Seiten der Populisten und der militärischen Eliten, Perón, die Junta, die desaparecidos, die Mütter der Plaza de Mayo. Die einsame, melancholische Gewalt in der Pampa, Narben im Gesicht des Gauchos, der die Gitarre spielt — in seinen »schwarzen Augen das Blitzen des Messers«, singt Evaristo Carriego. Die »tödliche Sicherheit des Armes, der töten wird, da er keine Furcht kennt«, eignet nicht nur dem guappo Juan Muraña, sondern auch vielen anderen Gauchos mit ihren Bolas und ihrem Dolch. Borges besingt das Messer, doch kennt er sehr wohl die Furcht; er weiß sich ähnlich seinem geliebten Snorri, dem großen skandinavischen Dichter der heroischen Zeit, der den Degen besang, ihn jedoch nicht zu führen wusste, weil er ihn feige fürchtete. Das Heldenlied von Mut und Zweikampf erstirbt im Gesang seines größten Dichters, der nicht zu den Waffen greifen kann, die er liebt, weil die Freude am Krieg ihm durch seine Furcht verwehrt ist. Die Wahrheit, schreibt Borges, fasziniert und furchtsam, wie er weiß, ist im Dolch, bereit für die Hand dessen, der damit zustoßen wird.
Benigar kümmert der Dolch nicht, er kennt nicht den Wunsch, ihn zu ergreifen; nie wird er das tun, und nie wird er sich davor fürchten. Er hat herzlich wenig gemein mit den Hunderttausenden anderer Emigranten, auf die nach der Ankunft das Elend wartet oder der Reichtum, ausgeübte oder erlittene Gewalt, Ausgrenzung, Herrschaft oder Verbrechertum. Menschenmassen, die mit ihm in der Neuen Welt ankommen, auf der Suche nach Glück oder auch nur nach Arbeit; Männer und Frauen aus aller Herren Länder, ehrliche, fleißige Arbeiter im gnadenlosen täglichen Kampf um die elementare Menschenwürde ihrer Familien und andererseits zu allen Schandtaten bereite Mafiosi; auf der Suche nach einer Arbeit, die zu Wohlstand und auch zu großem Reichtum führen mag, aber auch zu finsterem Elend und zu Kriminalität.
Hartnäckige Reproduktion von Gefühlen, Werten, Gebräuchen des Herkunftslandes, Vermischung mit den vorangegangenen Generationen von Emigranten und den Einheimischen. Kreolen und Gringos. Wilder Kapitalismus und Bilder der Verarmung; Bäcker, Textilarbeiter, Winzer, Ziegelhersteller; Solidarität und harte Konkurrenz, schnell erworbenes Vermögen und plötzlicher Verlust. Kampf ums tägliche Überleben, bedroht durch das organisierte Verbrechen wie auch durch die Brutalität der Polizeigewalt, Integration und Ghettoisierung, arabische Polen und Piemontesisch sprechende Andalusier; bäuerliche Massen aus dem Veneto, lombardische, schottische und irische Handwerker, noch vor ihnen waren die Waliser gekommen, die in Patagonien, schreibt Sepúlveda, den modernen walisischen Nationalismus erfanden. Paternalismus in den Betrieben, kapitalistische Modernisierung und Rückfall ins Proletariat, italienische Emigranten in teuren Elendsquartieren, die wucherischen Landsleuten gehören, Missionen der Salesianer. Dieses Leben und seine Schilderung in der Literatur, Sull’oceano von Edoardo De Amicis oder Emigrati von Antonio Marazzi. Die Durchquerung des Lebens ähnelt der Fahrt der Medusa und hinterlässt nicht nur vom Meer verschlungene Leichname, sondern auch Flaschenpost, die auf den Wellen treibt und irgendwann ein Ufer erreicht.
In Patagonien landen aus dem deutschsprachigen und dem jüdischen Mitteleuropa, aus Asturien und aus England, aus Russland wie auch aus Portugal oder Italien skrupellose, geschäftstüchtige Männer. Es entstehen Latifundien, Kupferminen, Wollproduktion, Transportmittel für den Verkehr zur See und die Flussschifffahrt. Im selben Jahr, in dem Benigar ankommt, tun sich der Asturier José Menendez, der bezichtigt wird, er habe viele Indigene im Süden des Kontinents verhungern lassen, und Mauricio Braun, Besitzer von 1.376.160 Hektar Grund und Boden in Feuerland, zusammen, um die Sociedad anónima importadora y exportadora de la Patagonia zu gründen. Dort, in Patagonien, landen auch »anarchistische bolschewistische Horden«, sozialistische und kommunistische Arbeiter; sie gründen Arbeiterbünde, es kommt zu den ersten großen Streiks, blutig unterdrückt vom Colonel Ramón Falcón, der 1909 von einer Bombe des Anarchisten Simón Radowitzky getötet wird, Radowitzky, der dann entsetzliche Leidensjahre in argentinischen Gefängnissen mitmachen muss, Vergewaltigung, Folter, Gewalttaten jeglicher Art.
Patagonien und Araukanien sind die Schauplätze niederträchtiger Ausbeutung, von Streiks und deren blutiger Niederwerfung. Die wichtigsten Bücher über Patagonien stammen nicht von Bruce Chatwin oder William Henry Hudson — der Titel seines Buchs The Purple Land erinnert daran, dass diese Erde blutgetränkt ist —, so faszinierend sie literarisch sind, sondern Los vengadores de la Patagonia trágica (1972—74) und La Patagonia rebelde (1980) von Osvaldo Bayer. Verglichen mit diesen ruhmlosen Geschichten verblassen die Unternehmungen legendärer, abenteuerlicher Banditen, wie Chatwin sie erzählt, wie die von Butch Cassidy, Sundance Kid und Etta Place, der gemeinsamen Geliebten, die alle drei zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts aus den Vereinigten Staaten nach Patagonien geflohen waren. Ihre erbarmungslosen Raubzüge waren gefärbt von jener Aura eines rauen Charmes, der zum Klischee des Cowboys gehört, des großmütigen Banditen. Sie sind Figuren eines unterhaltsamen klassischen Western, verglichen mit den shakespeareschen Tragödien der blutig unterdrückten Streiks. Während der »tragischen Woche Patagoniens« im Jahr 1919 wandten die Weißen Garden der argentinischen Patriotischen Liga die »picana eléctrica« an, die Folter mittels Elektroschocks, die Colonel Pilotto und Major Rosasco für rechtens erklärten.
Es gibt eine Episode in Aufstand in Patagonien, die an die berühmte Szene in Panzerkreuzer Potemkin erinnert und im Film Die Unberührbaren aufgegriffen und variiert wird: die Ermordung von Colonel Varela, dem »Schlächter von Patagonien«, am 27. Januar 1923. Er hatte tausendfünfhundert Peones auf dem Gewissen, die ihren Streik beendet hatten, nachdem der Colonel offiziell zugesichert hatte, dass ihnen kein Haar gekrümmt werde. Der Attentäter Kurt Gustav Wilckens, ein deutscher Anarchist mit rotem Haar, Anhänger Tolstois und Feind jeglicher Gewalt, war aus Europa gekommen, um die moralische Pflicht zu erfüllen, die Rechnung für das Massaker zu begleichen. Der Colonel verlässt das Haus, auf der Straße erwartet ihn der Rächer, der die deutschsprachige Zeitung von La Plata liest, mit einem Päckchen in der Hand; plötzlich läuft ein kleines Mädchen über die Straße, sodass der Attentäter, der schon die Bombe aus dem Päckchen gezogen hat, einige Sekunden verliert, als er das Kind am Arm packt und von der Straße wegschubst, wobei es auf eine Treppe fällt. Erst dann wirft er die Bombe, die nicht nur Varela, sondern auch ihn selbst betäubt. Seine Pistole gegen den gezückten Säbel des Colonels; Säbelhiebe und Pistolenschüsse, der Colonel stirbt, der Attentäter ist verletzt, sein Gesicht von Stockschlägen zertrümmert, zwei vigilantes rennen hinzu und treten ihm in die Hoden, während die Frau des Colonels aus dem Haus kommt und die Szene mit ansieht und einige Passanten stehen bleiben und zuschauen. Wilckens, von den Schlägen übel zugerichtet, schafft es noch, seinen Mördern den Revolver, den er behutsam am Lauf hält, mit den Worten »Ich habe meine Brüder gerächt« zu übergeben. Dann stirbt er. Die Mission hat er erfüllt, eine kleine Episode in dem Schlachthaus der Universalgeschichte.
Dies ist die Welt, in der fünfzehn Jahre zuvor Benigar angekommen ist, der sein ganzes Leben lang niemals die Pistole oder einen Degen ziehen sollte. Dem Verfasser der bulgarischen Grammatik müssen solche Akte der Gewalt fremd gewesen sein, er wird sie im Übrigen deutlich und mutig bekämpfen, freilich nur mit der Feder, doch in energischen, maßvollen Tönen, dabei stets auf konkrete Probleme achten, auf Vertragsbrüche der Regierung, Fehler der Verwaltung, öffentliche Vergehen und Betrügereien, begangen an den Indigenen, Enteignungen, Eingriffe in Lebensbedingungen und die für sie lebensnotwendige Umwelt.
Er hat nicht viel gemein mit anderen Emigranten in dieser Zeit, mit solchen, die in den Territorien jenseits des Ozeans Erfolg, Glück oder ein echtes Zuhause suchen, sondern ist auf der Flucht vor jeglicher Behausung und hat die Reise durch die Nacht angetreten, durch die Antipoden als Unterwelt des Herzens und des Geistes, wo zugleich eine utopische Weihnacht auf Erden aufflackert. Ein Jahr vor Benigar landet der Dichter Dino Campana in Argentinien, ein »schiffbrüchiges Herz«, dem Irrenhaus von Imola entronnen. Er bereist den Rio de la Plata, der so breit ist, dass seine Ufer oft nicht zu sehen sind, er verliert sich in den Städten und mehr noch in der Pampa, deren weite Ebene, in der sich zu orientieren unmöglich ist, die Leere des Lebens selbst ist.
Die Pampa findet Eingang auch in die Canti Orfici, sie ist selbst ein orphischer Gesang. Doch gerade die Pampa führt ihn zurück ins Irrenhaus, diesmal in das von Florenz. Campanas nekyia, seine Reise in die Unterwelt seiner Person und der Welt, ist eine radikale, unerträgliche Erfahrung, die sich der Zerstörung anbietet. Für ihn ist die Pampa der »aus des Dunstes Feuchte aufragende Berg« Dantes, die Auslöschung. Die futuristischen, die hermetischen Dichter und noch weitere, die nach ihm den Ozean überqueren und in der südlichen Hemisphäre landen, werden zur Avantgarde, zur literarischen Revolution und linguistischen Neuschöpfung und schließlich zur offiziell deklarierten, wenngleich innovativen Institution.
Ein Jahr nach Benigar kommt Enrico Mreule in Argentinien an, beinahe ein Landsmann; auch er spricht Slowenisch und kommt aus Gorizia, dem Nizza des Habsburgerreichs, vom unvergleichlichen Grün des Isonzo — isonzogrün, wassergrün — und dem absoluten Blau von Salvore am äußersten Punkt von Istrien. Er sucht, was sein großer Freund und Lehrer Carlo Michelstaedter ihm ein für alle Mal gezeigt hat: die »Überzeugung«, das wahre Leben, wie es in jedem Augenblick als absolutes gelebt wird, in der Gegenwart und nicht in dem rasenden Lauf der Zukunft, in der Hast, schon etwas getan zu haben, jener Furcht, die das Tun in dem Wahn vernichtet, das Heute so schnell wie möglich zum Morgen werden zu lassen, das heißt, näher dem Tode. Mreule wird die Pampa viele Male durchqueren, allein wie ein Gaucho, mit seinen Herden und seinen griechischen Klassikern — vor allem Tragödien in den deutschen Teubner-Ausgaben — in einer Tasche seines Ponchos. Abends wird er ihre Seiten mit Anmerkungen auf Spanisch versehen, am Biwakfeuer, allein unter der blauen Mimosa und der roten Gacrux im Kreuz des Südens.