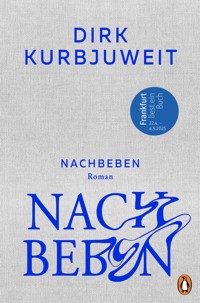9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die junge Esther beschließt, Soldatin zu werden, um ihrem bislang ziellosen Leben Halt zu geben. Bald wird sie nach Afghanistan geschickt. Staub, betäubende Hitze und eine trügerische Langeweile, in der stets Anschläge drohen, bestimmen die Tage im Bundeswehrcamp. Als Esther die Chance bekommt, Patrouillenfahrten in die Berge zu machen, lernt sie ein wildes, schönes, aber unnahbares Land kennen – und trifft auf den rätselhaften Schulleiter Mehsud. Zögerlich verlieben die beiden sich und beginnen eine zarte, riskante Beziehung gegen alle Regeln, die militärischen wie die afghanischen. Schnell werden ihre Treffen zur Gefahr, und Esther steht vor einer Entscheidung: Was muss sie tun, damit die unwägbare Liebe zu Mehsud eine Zukunft hat? Ebenso bildhaft wie realitätsnah schildert Dirk Kurbjuweit die ferne, fremde Welt Afghanistans, in der Esther erstmals begreift, wie der Krieg sich in die Herzen der Menschen frisst – und in der sie sich endlich ihrem eigenen Leben stellen muss. Ein kraftvoller, spannungsreicher Roman, der vor packendem zeitgeschichtlichem Hintergrund die Frage stellt, was wirklich zählt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Dirk Kurbjuweit
Kriegsbraut
Roman
AFGHANISTAN,
FRÜHSOMMER 2006
Der Himmel zeigte ein blasses Blau, auf den Bergen lagen reglos Wolken, ein langes Band, weiß und grau, struppig. Der Staub, der durch die Ritzen der Autos drang, schmeckte anders als sonst, ein bisschen feucht, nicht ganz so aschig. Nach einer Stunde hielten die beiden Geländewagen vom Typ Wolf auf einem Plateau. Das Land lag weit und gelb unter ihnen, Kunduz leuchtete grün wie eine Oase, der Fluss silbergrau. Esther stieg aus, in der Ferne sah sie einen anderen Konvoi der Bundeswehr, drei Fahrzeuge, gehüllt in eine Wolke aus Staub. Winzig und verloren wirkten sie in dieser gewaltigen Ödnis, und doch war es ein Trost, sie zu sehen, Freunde, Gefährten, sie würden helfen.
Esther hörte die Männer in den Sand pinkeln, dann hörte sie Stimmen. Kinder liefen herbei, drei Jungs, ein Mädchen. Ihre Gesichter waren älter, als sie sein konnten, nahm man die Körpergröße als Maßstab. Sie standen zwei Meter entfernt, schauten die Soldaten an, niemand sagte etwas. Tauber holte eine Tüte aus dem Wolf und verteilte Kugelschreiber mit der Aufschrift «Zum Hirschen Paderborn». Einer der Infanteristen zog ein Zwei-Euro-Stück aus der Hosentasche und zeigte damit ein paar Zaubertricks. Die Münze verschwand aus der Hand, tauchte im Ohr wieder auf. Es war nicht zu erkennen, ob die Kinder sich freuten. Esther sah einen Mann, der auf sie zurannte, weit draußen auf dem Feld. Die beiden Infanteristen strafften sich und packten ihre Gewehre, die bis dahin von ihren Schultern gebaumelt hatten. Der Mann rannte und rannte. Esther ging zurück zum Wolf, nahm ihr Gewehr. Den rennenden Mann ließ sie nicht aus den Augen. Er war noch fünfzig Meter entfernt, sie entsicherte, stellte auf Einzelfeuer. Er wurde langsamer, trottete heran und stand dann bei den Kindern. Sein Atem ging schwer, er sah auf die Tüte mit den Kugelschreibern. Gelbe Augen, tausend kleine Falten in seinem Gesicht. Tauber gab ihm einen Stift. Esther ging zu ihrem Wolf, öffnete eine Einmannpackung, «Hamburger in Tomatensauce», und nahm die Dose mit der Schweinswurst heraus. Dann reichte sie dem Mann die Einmannpackung. Er nickte. Sie stiegen ein, fuhren los. Als sich Esther nach einer Weile umdrehte, sah sie den Mann über das Feld zurückgehen. Sie hoffte, dass die Hamburger nicht mit Schweinefleisch waren, sondern mit Rindfleisch. Die Kinder waren verschwunden.
«Ich war neun, Schülerin in der Schulkate, als es hieß, ein Wal sei auf Rügen gestrandet», erzählte sie dem Schuldirektor, als sie im Dorf angelangt waren. Sie saß auf dem Boden des Direktorenzimmers, Rücken an der Wand, die Beine gestreckt, das Gewehr wippte auf ihren Oberschenkeln. Sie schwitzte unter der Schutzweste. Vom Windstrom des Ventilators kam nichts bei ihr an. Der Schuldirektor hockte hinter seinem Schreibtisch und schien in eine Kladde vertieft. «Eigentlich gibt es keine Wale in der Ostsee, aber manchmal verirrt sich einer. Wir erfuhren das beim Unterricht. Der Kleinbus der LPG fuhr vor, mein Vater hatte ihn geschickt, damit wir Kinder den Wal sehen konnten. Wir quetschten uns alle hinein und spekulierten auf der Fahrt, wie groß der Wal wohl sei. Wie eine Scheune, sagte einer, und das kam uns realistisch und wünschenswert vor. Möge er doch so groß sein wie eine Scheune. An der LPG hielt der Kleinbus, und mein Vater stieg ein. Den Wal wollte er sich nicht entgehen lassen. Noch bevor wir den Wal sahen, konnten wir ihn riechen. Es war ein übler, fischiger Geruch, und wir hielten uns die Nase zu und schrien Bäh! und Bah! gegen den Wind. Komisch, dass der Wal wie ein Fisch riecht, aber kein Fisch sein soll, oder?»
Sie hatte bis dahin zum Fenster geblickt, nun, nach ihrer Frage, sah sie den Schuldirektor an. Er senkte rasch den Blick auf seine Kladde, und sie freute sich, weil er sie angeschaut hatte.
«Aus der Ferne», fuhr sie fort, «war schon klar, dass der Wal nicht so groß war wie eine Scheune, bei weitem nicht. Ein paar Leute standen um ihn herum, darunter eine Frau in einem weißen Kittel. Als wir näherkamen, sah ich, dass das meine Mutter war, die Meeresbiologin. Sie war als Einzige dicht bei dem Wal, die anderen hielten Abstand. Was machen die Kinder hier?, rief meine Mutter, als sie uns sah. Meine Mutter war wütend, das konnte ich hören, sehr wütend. Der Wal war enttäuschend klein, er stank nur wie etwas sehr Großes, Fürchterliches. Ob ihm nicht klar sei, dass ein Wal explodieren könne, herrschte meine Mutter meinen Vater an. Ich habe mich furchtbar erschrocken, so hatte ich sie nie mit Vater reden hören. Nein, er wisse nicht, dass ein Wal explodieren könne, sagte mein Vater kleinlaut. Meine Mutter sprach von Fäulnisgasen, sie müsse erst einmal feststellen, wie lange der Wal hier schon liege. Wir sollten Abstand halten. Es war kalt, es war Winter. Ich sah, wie meine Mutter das schwarz und blau schimmernde Tier mit einem Riesenstethoskop abhörte. Zwei Männern, die Gummigamaschen trugen, gab sie Anweisungen, und dann machten sie genau das, was meine Mutter ihnen aufgetragen hatte. Das alles war schwer zu verstehen für mich. Ich kannte meine Mutter nur so, dass sie morgens das Frühstück machte und abends Essen kochte und sich um den Haushalt kümmerte, während ihr Mann las. Und wenn die Freunde meines Vaters kamen, brachte sie ihnen Bier und Schnittchen, aber sie setzte sich nicht zu ihnen an den Wohnzimmertisch in die Polstermöbel, sondern an den kleinen Esstisch und blätterte in einem ihrer Meeresjournale und hatte zugleich ein Auge darauf, ob die Gäste etwas brauchten. So war das bei uns in der DDR, die Frauen haben gearbeitet, aber sie haben auch zu Hause alles gemacht.»
Esther sah den Schuldirektor wieder an, weil sie wissen wollte, ob ihm dieses Thema unangenehm war. Sein Gesicht war ernst, ein bisschen müde, fand sie. Aristokratisch auch, es gab einen aristokratischen Zug in diesem Gesicht. Sie redete weiter.
«Der Wal war tot, aber explodieren konnte er offenbar nicht. Nach einer Weile winkte meine Mutter uns heran und erklärte uns die Körperteile. Ich bekam wenig mit, weil der Geruch unerträglich war. Als wir gingen, waren wir traurig, denn wir hatten gehofft, den Wal zurück ins Meer ziehen und retten zu können. Nun wussten wir, dass man ihn auseinanderschneiden würde. Sein Skelett sahen wir später im Meeresmuseum. Ich fragte mich, ob mein Vater jetzt böse mit meiner Mutter war und sich das Leben verändern würde, aber am Abend war alles wie immer. Meine Mutter machte das Abendbrot, mein Vater las behaglich. Ich war erleichtert, wie Sie sich vorstellen können.»
Sie wusste nicht, ob er sich das vorstellen konnte. Es war ihr so rausgerutscht.
«Als ich älter war und mir klar wurde, warum die Rollen so verteilt waren zwischen meinen Eltern, habe ich manchmal zu meiner Mutter gesagt: Es ist wieder Walzeit. Sie wusste sofort, was gemeint war. Sie sollte sich wehren gegen meinen Vater, sie sollte bestimmt auftreten. Es wurde ein geflügeltes Wort zwischen uns.»
Ein Mädchen kam herein. Sie stellte sich vor den Schreibtisch, stramm, Rücken gerade, und berichtete etwas. Esther sah nur ihren Rücken, aber die Stimme klang, als habe sie Angst. Als das Mädchen fertig war, sagte der Schuldirektor ein paar Worte, das Mädchen ließ die Schultern fallen, dann ging sie hinaus.
«Was wollte sie?»
«Ihr Lehrer hat entdeckt, dass sie abgeschrieben hat.»
«Was haben Sie ihr gesagt?»
«Sie muss nachsitzen.»
Mehr sagte der Schuldirektor nicht, aber es war ein Dialog, immerhin. Sie wischte Staub von ihrem Gewehr. Es war still, ihr Unterhemd war nass.
«Wussten Sie, dass ein toter Wal explodieren kann?», fragte sie.
Er nickte. Sie glaubte es ihm nicht.
«Ich bin erst am Abend im Bett erschrocken. Ich stellte mir vor, wie das ausgesehen hätte, wäre der Wal explodiert. Herumfliegende Flossen, Knochenstücke, Tod durch ein Walteil.» Sie lachte leise. «Das ist den Taliban noch nicht eingefallen», sagte sie, «uns einen toten Wal an den Straßenrand zu legen, Wal-Sprengfalle.» Sie sah ihn an, lächelnd, dann erschrocken, weil ihr eingefallen war, dies könne eine unpassende Bemerkung gewesen sein.
Er blätterte eine Seite um.
Sie sah auf die Uhr, Zeit zu gehen. «Auf Wiedersehen, bis Donnerstag», sagte sie an der Tür.
Der Schuldirektor blickte kurz auf, ein schwaches Nicken.
Auf der Rückfahrt fühlte sich Esther unwohl. Sie starrte auf die Straße, auf den Straßenrand, als könne sie mit ihrem Blick die Erde aufpflügen und das IED, das Improvised Explosive Device, das dort irgendwo vergraben sein konnte, rechtzeitig entdecken. Die Angst schnürte ihr den Hals zu. Sie hoffte, Tauber würde sie nichts fragen, die Worte wären ihr nur in unfertigen, abgewürgten Brocken aus dem Mund gekommen. Ihre Hände waren nass.
Nach einer halben Stunde lief den beiden Geländewagen eine Ziegenherde entgegen, hundert Ziegen, und die beiden Wölfe steckten fest auf der Straße, umgeben, umzingelt von einer dunklen zotteligen Masse. Das ist eine Falle, dachte Esther, das kann nur eine Falle sein, und sie nahm das Gewehr aus der Halterung und hielt es schussbereit in ihren Händen.
«Willst du eine Ziege abknallen?», fragte Tauber.
«Vielleicht haben sie eine Bombe in der Herde versteckt.»
Er sah sie an, als sei sie ein Kind, das man nur nachsichtig behandeln kann.
«Eine Terrorziege? Die bringen lieber sich selber um als ihre Ziegen.»
Drei Halbwüchsige begleiteten die Herde. Sie gingen gleichmütig vorüber, im Tempo ihrer Tiere, einer winkte kurz mit der Hand. Esther sah die Ziegen rot statt braun, in Blut getränkt. Dann waren die Wölfe frei, aber Esthers Panik löste sich nicht. In der Schlucht wurde es noch schlimmer. Kalter Schweiß lief über ihre Haut. Sie wollte raus aus dem Wolf, raus aus der Schlucht. Tauber legte ihr seine Hand auf den Unterarm, und sie war dankbar dafür. Sie hielten nach der Schlucht, Esther sprang aus dem Wolf, ging zum Fluss, schöpfte Wasser mit ihren Händen und warf es sich ins Gesicht.
Als sie aufblickte, sah sie am anderen Ufer eine Frau, die eine blaue Burka trug und Decken wusch. Wenn Esther das richtig erkennen konnte, hatte sie zu ihr herübergeschaut. Wahrscheinlich war ihr eine Frau in Uniform genauso fremd wie Esther eine Frau in einer Burka. Sie sammelte ihre Wäsche ein, rief die beiden Jungs, die bis zur Hüfte im Wasser standen, und ging mit ihnen den Hügel hinauf, zum Hof. Esthers Blick folgte ihr, sie hätte gerne gewusst, welches Gesicht sich hinter der Burka verbarg, wie alt die Frau war und welches Leben sie führte. Die Frau öffnete das Hoftor und schaute, bevor sie mit ihren Kindern verschwand, noch einmal zu Esther. Das Tor schloss sich.
Esther stieg ein, die Wölfe durchquerten den Fluss und schaukelten über die staubige Piste weiter zum Lager. Die Sonne stand tief und verlieh den Bergen messerscharfe Konturen, man sah jeden Knick, jede Falte. Sie wirkten nicht mehr gelb, sondern hatten einen Rotstich. Mücken flogen ins Auto, surrten, stachen.
BERLIN,
HERBST 2003
Esther verließ den Bahnhof, ging über die Straße zur Spree und warf ihr Handy ins Wasser. Dann ging sie zurück und stieg in ein Taxi. Sie hatte achtundzwanzig Nachrichten bekommen, die nun ungelesen, ungehört versanken. Das Taxi brachte sie nach Schöneberg zu einer kleinen Pension. Dort wohnte sie in den ersten Wochen, zwischen verstoßenen Möbeln und verblassten Tapeten, alter Rauch hing in ihrem Zimmer. Im Frühstücksraum saßen morgens Männer, die graue Kittel oder blaue Latzhosen trugen. Manche hatten ihren Zollstock schon dabei. Sie teilte sich das Bad mit ihnen, konnte aber nicht klagen. Auch Jasper hatte es nie geschafft, alle Barthaare aus dem Waschbecken zu entfernen, und sie hatte kein Geld für eine andere Bleibe. Sie war überstürzt aufgebrochen, hatte ihren Freund verlassen, ihren Job nicht angetreten. Kaum war der Entschluss gefasst, saß sie im Zug von Greifswald nach Berlin, nichts anderes dabei als eine Reisetasche. Nach zwei Tagen suchte sie eine Telefonzelle und brauchte eine Weile, bis sie eine gefunden hatte. Sie rief ihre Mutter im Meeresmuseum an und sagte, dass sie sich keine Sorgen machen müsse. Dann legte sie auf. Sie war vierundzwanzig Jahre alt.
Sie kannte niemanden in Berlin. Sie besorgte sich ein neues Handy, erkundete eine Laufstrecke und suchte im Internet nach einer Wohnung. Sie lief jeden Morgen eine Dreiviertelstunde lang, danach ging sie ins Museum oder tat andere Dinge, von denen sie dachte, dass man sie in Berlin tun müsse, abends lange ausgehen zum Beispiel und mit Männern schlafen, deren Nachnamen man nicht wissen wollte und die meist eine Enttäuschung waren in ihrem Unbedingt-gut-sein-Wollen, aber auch das gehörte ja dazu. Manchmal saß sie in Cafés und las Bücher, kam sich allerdings bald seltsam dabei vor. Du hast deine Fähigkeit, Haltlosigkeit aushalten zu können, überschätzt, dachte sie, als sie nach hundert Seiten «Die Kartause von Parma» an einem Vormittag im Café Manzini vollkommen deprimiert war. Sie empfand es als ungerecht, dass sie in dem Moment, da es niemanden mehr gab, der ihr zur Last fiel, sich selbst eine Last wurde.
Sie fragte in der Cincinnatus Bar, die in der Nähe der Pension lag, nach einem Job und bekam einen. Wenige Tage später hatte sie eine kleine Wohnung in Schöneberg. Sie hörte auf, mit Männern ohne Nachnamen zu schlafen, wollte aber auch niemanden kennenlernen, noch nicht. Und nie wieder das, was sie schon gehabt hatte, sieben zähe Jahre. Sie wollte jetzt ihren Job in der Bar gut machen, als müsse sie eine Schuld abarbeiten.
Ihre liebsten Stammgäste waren ein Mann und eine Frau, die einmal in der Woche kamen und sich auf eine Bank im hinteren Raum setzten. Sie bestellten ein Bier und ein Bitter Lemon und küssten sich bis zum Morgengrauen. Ihre Hände verschwanden manchmal unter dem Tisch, Esther sah nicht so genau hin. Wenn die beiden die Cincinnatus Bar verließen, waren ihre Gläser nicht leer, sie hatten keine Zeit gehabt. Esther fragte sich, warum die beiden nicht früher gingen. Sie überlegte, ob sie ihnen den Schlüssel für ihre Wohnung geben sollte, damit sie ungestört sein konnten, aber dann fand sie das zu aufdringlich. Sie mochte die beiden. Er trug immer einen Anzug, sie immer eine Jeans.
An einem frühen Morgen, als sie wieder allein war mit den beiden und Flaschen sortierte, kam ein Mann herein, der etwa einen Meter und achtzig groß und ein bisschen gedrungen war. Er hatte einen kahl rasierten Schädel und trug eine Brille mit einem dicken Rand aus Schildpatt. Sie schätzte ihn auf Anfang vierzig.
«Die von Warner Brothers sind vollkommen verrückt», sagte er, nachdem er einen Four Roses ohne Eis bestellt hatte. Den ganzen Abend habe er mit dem Deutschland-Chef des Verleihs verhandelt, weil er dessen Geld brauche, um den Film über die Riefenstahl machen zu können; hätte er erst die Zusage von Warner Brothers, sei es kein Problem mehr, das andere Geld einzusammeln, aber der Kerl sei so sperrig gewesen, dass alles auf der Kippe stehe. «Wir können nicht den Adolf die Riefenstahl küssen lassen», habe der Chef von Warner Brothers gesagt, das deutsche Publikum sei noch nicht bereit für einen küssenden Führer. «Dummkopf», habe der Mann erwidert, das sei es doch gerade, das deutsche Publikum müsse endlich sehen, was es noch nie gesehen habe, und einen küssenden Führer habe es noch nie gesehen. «Die Riefenstahl hat den Führer nämlich geküsst», sagte er, sie habe ihm das selbst erzählt. Die Frage sei nur, ob der Führer die Riefenstahl auch gefickt habe, sie sei immer so undeutlich in diesem Punkt. Wenn man ihn frage, er klopfte sich mit dem Zeigefinger auf die Brust, dann sage er: «Der Führer hat nicht gefickt.» Das sagte er so laut, dass das Paar sich voneinander löste und zur Theke blickte. «Der Führer hatte keine Zeit und auch keine Lust», sagte der Mann. Er bestellte noch einen Four Roses, wieder ohne Eis. Dann nahm er seine Brille ab und hielt sie ins Licht. Esther legte ihm eine Serviette hin, mit der er über die Brillengläser wischte. Ohne die Brille sah er ein bisschen jungenhaft aus.
«Entschuldigung», sagte er.
«Wofür?»
«Dass ich Sie so überfallen habe.»
«Ist okay.»
«Kennen Sie die Szene aus ‹French Connection II›, wo Gene Hackman in einer Bar in Marseille einen Four Roses bestellt?»
«Nein.» Sie hatte nur «French Connection» gesehen.
«Ich bestelle seitdem immer einen Four Roses, wenn es mir nicht gutgeht.»
Sie wusste nicht, was sie sagen sollte.
«Er schaut so traurig. Niemand schaut so traurig wie Gene Hackman in ‹French Connection II›.»
Das Paar aus dem hinteren Raum wollte zahlen. Sie ging hin und kassierte, die Gläser waren wieder nicht leer. Das Paar verließ die Bar, der Mann warf einen skeptischen Blick auf den Mann an der Theke.
«Ich versuche seit sechs Jahren, einen Spielfilm über die Riefenstahl zu finanzieren», sagte er, «aber es ist wahnsinnig schwer, das in Deutschland zu machen. Die amerikanischen Filmleute verehren die Riefenstahl, hier denken sie nur, sie sei eine Nazischlampe.»
Esther nickte. Was sollte sie sagen?
Er trank seinen Four Roses, zahlte und ging. Zum Abschied hatte er ihr die Hand gegeben.
Dass er am nächsten Abend nicht wiederkam, fand sie einerseits gut, weil sie nicht wollte, dass er ein gieriger, älterer Mann war, der eine jüngere Frau braucht, um sich gut zu fühlen. Aber sie hätte ihn gerne wiedergesehen. Vier Tage später tauchte er kurz nach Mitternacht in der Cincinnatus Bar auf. Seine Frau hieß Greta. Sie hatten zwei Kinder miteinander, und Esther war ein bisschen enttäuscht, dass er irgendwann nur noch von diesen Kindern erzählte, als wolle er sich nicht einmal auf ein Spiel mit ihr einlassen. Um halb fünf sang er ein Lied für sie, «Lucky» von Radiohead. Es ging um ein Flugzeug, und er breitete die Arme aus und drehte kleine Kreise vor ihr, als wäre er ein Flugzeug. «Pull me out of the aircrash», sang er. Um fünf machte sie die Bar dicht. Er schlug vor, sie mit dem Taxi nach Hause zu fahren, und sie willigte ein, obwohl es nur ein kurzer Weg war, den sie zu dieser Stunde eigentlich gerne ging. Zum Abschied gab er ihr wieder die Hand.
«Schlafen Sie gut.»
«Sie auch.»
Sie stieg aus und winkte dem Taxi hinterher.
Er kam dann häufiger, erzählte von Filmen, die sie nicht kannte, und manchmal von seiner Familie. Esther war niedergeschlagen, wenn er sich nicht sehen ließ. Sie wusste immer noch nicht, was sie mit ihrem Leben machen sollte. Doch noch als Informatikerin arbeiten? Nein, das war behaftet mit einem anderen Leben. Etwas anderes fiel ihr nicht ein. Wenn sie nachmittags, vor ihrer Schicht, in einem Café saß, fragte sie sich, ob sie verliebt war in diesen Mann, und wenn ja, warum? Er sah gut aus, aber er war ein Angeber mit seinen Filmgeschichten. Manchmal rief sie ihre Mutter an und ließ sich von den Fischen berichten. Ihre Mutter wusste, was sie fragen konnte und was nicht.
Seltsamerweise mochte Esther diesen Mann am meisten, wenn er ihr von seinen Kindern erzählte, obwohl ihr diese Geschichten mehr und mehr wehtaten. In seiner Fürsorge und seiner Angst, ihnen könne etwas Böses geschehen, zeigten sich ein Ernst, eine Erwachsenheit, die ihr unbekannt waren und die sie rührten. Jasper war immer bemüht gewesen, erwachsen zu werden, dieser Mann war es. Und dann doch wieder Filmkind. Sie entschied sich, vorsichtig zu sein, skeptisch, aus Misstrauen gegen sich und gegen ihn. Auf keinen Fall würde sie sich für ein paar Filmgeschichten ins Bett ziehen lassen, undenkbar, dann lieber Männer ohne Nachnamen, mit langweiligen Geschichten aus Büros und Vorlesungssälen. Dabei ging es um Körper, das war reell. Allerdings hatte der Mann nie versucht, sie ins Bett zu bekommen, was sie seltsam fand, selbst bei einem kritischen Blick in den Spiegel. Sie hatte beinahe schwarzes Haar, ein schmales Gesicht mit großen Augen und einer feinen Nase, lange Wimpern. Vielleicht war sie ein bisschen dünn, aber dafür, dass sie so dünn war, fand Esther, hatte sie ganz ordentliche Brüste, die sie mit weniger Laufen und mehr Essen noch etwas vergrößern könnte, aber egal. Das Einzige, was sie wirklich an sich störte, waren die dunklen Haare an Armen und Beinen. Ständig kaufte sie Großpackungen Wegwerfrasierer. Sie fragte sich, wie es ist, mit einem Mann zu schlafen, den man siezt. Niemand siezte sie in der Bar. Warum tat er das?
Skepsis also, Widerständigkeit, falls es mal losgehen sollte, das war sicher. Und doch ließ sie sich küssen, als er es nach der vierten oder fünften Taxifahrt vor ihrer Haustür versuchte. Dafür nahm sie ihn nicht mit nach oben. Gefragt hatte er allerdings nicht. Das tat er beim nächsten Mal. Entschiedenes nein. Sie ging weniger Laufen, aß mehr. Im Café dachte sie immer wieder daran, wie er sie gefragt hatte: «Würden Sie mich mit nach oben nehmen?»
Erst fand sie es befremdlich, dass sie sich siezten, dann lustig und irgendwie schön, aber jetzt ärgerte sie sich darüber. Wollte er sie so auf Distanz halten? Wollte er, dass sie ihm das Du anbot? Und war es unschicklich, wenn die Frau die Initiative ergriff? Sie wusste es nicht. Es hatte nie eine Rolle gespielt in ihrem Leben. Allmählich hatte sie den Eindruck, die Sache werde zur Machtprobe. Sie war wütend, als er beim nächsten gemeinsamen Abend immer noch Sie sagte, obwohl sie sich wieder geküsst hatten, lange diesmal.
In der folgenden Nacht, morgens um zwei, klingelte in der Bar das Telefon. Sie erschrak, weil es noch nie geklingelt hatte. Wenn der Besitzer etwas wollte, rief er sie auf dem Handy an.
«Cincinnatus Bar, Esther», sagte sie.
«Wollen wir uns duzen?»
«Ja.»
«Thilo.»
«Esther.»
Eine halbe Stunde danach war er da, und sie war so glücklich wie schon lange nicht mehr. Thilo erzählte von der Riefenstahl. Als er sie später vor der Haustür fragte, ob sie ihn mit nach oben nehme, sagte sie nein.
«Warum nicht?»
«Ich kann deine Wohnung auch nicht sehen.»
Der Taxifahrer schaltete den Motor aus. Sie küssten sich wieder.
Als er sie am übernächsten Abend in der Cincinnatus Bar besuchte und alle anderen Gäste gegangen waren, sagte er, dass er mit Greta nicht glücklich sei, sie aber wegen der Kinder nicht einfach verlassen könne.
«Liebst du sie?»
«Ich kämpfe jeden Tag darum, sie zu lieben, und manchmal liebe ich sie bis zum Abend, aber immer häufiger schon am Morgen nicht mehr. Sie sagt ein Wort, und ich habe den Kampf verloren. Sie macht ein bestimmtes Gesicht, und ich habe den Kampf auch verloren.»
«Gibt es eine Perspektive?», fragte sie.
«Ja.»
Er brachte sie wieder nach Hause, und sie küssten sich lange im Taxi. Der Fahrer stand draußen und rauchte. Dann stieg er ein und sagte, er müsse den Weg freimachen, hinter ihm sei einer. Esther wohnte in einer schmalen Straße, in der es nur eine Spur gab, wenn die Ränder zugeparkt waren, und das waren sie immer.
«Fahren Sie», sagte Thilo und küsste sie wieder.
«Wohin?», fragte der Taxifahrer.
«Fahren Sie so, dass Sie bei fünfzig Euro zurück sind.»
Das Taxi startete, Esther kringelte sich um Thilo und verlor sich in einem endlosen Kuss. Wenn sie die Augen öffnete, sah sie rote Ampeln, gelbe Ampeln, grüne Ampeln, weiße Lichter, die Lichter der Stadt. Das Taxi rollte, stoppte, stand, fuhr an. Eine Hand Thilos war in ihren Haaren, eine auf ihrem Hintern.
«Von deinen Küssen könnte ich leben», hörte sie ihn sagen.
Manchmal tickte der Blinker, einmal ertönte eine Hupe. Als das Taxi hielt und nicht wieder anfuhr, erwachte sie aus einer Trance. Sie drehte sich nach vorne und sah die Zahl 50,40 auf dem Taxameter.
Thilo sah sie lange an. Sie schüttelte den Kopf, gab ihm einen Kuss auf die Stirn und stieg aus, ihre ersten Schritte waren unsicher. Als sie im Bett lag, fragte sie sich, ob fünfzig Euro das Maß für eine große oder für eine kleine Liebe sind. Warum nicht hundert? Zweihundert? Warum nicht nach Paris? Nach Barcelona? Nach Wien?
Er kam nicht mehr in die Bar, sie trafen sich in den guten Restaurants der Stadt. Danach küssten sie sich im Taxi, sie erreichten hundert, hundertzwanzig Euro. Als sie einmal an einer Ampel die Augen aufschlug, sah sie Schneeflocken, rote Schneeflocken vor dem roten Licht. Es war Februar. Sie richtete sich auf, sie kannte diese Gegend nicht. War das noch Berlin? Es war egal, sie sank zurück, der nächste Kuss.
«Der Taxifahrer gestern meinte, ich soll dich heiraten», sagte Thilo eines Tages im Taxi. «Als wir alleine waren, sagte er, dass du eine gute Frau bist und ein anständiges Leben verdient hättest. Er war Türke oder Araber.»
«Dann heirate mich doch», sagte Esther.
Er küsste sie. Im Radio erzählte jemand, dass sein Hund am Grunewaldsee von einem anderen Hund gebissen worden sei. Sie hörte eine Weile Hundegeschichten, dann verlor sie sich in dem Kuss. Als ihre Zähne gegen Thilos klackten, wusste sie, dass ihr Taxi über Kopfsteinpflaster fuhr. Es gab noch viel Kopfsteinpflaster in Berlin.
«Du siehst ihre Gesichter nicht», sagte Thilo in einem der Restaurants. «Ich sehe sie im Rückspiegel, Taxifahrergesichter: alte Deutsche, die früher Tankwart waren, mittelalte Iraner, denen man die Folter noch ansieht, junge Türken, die so entschlossen das Lenkrad einschlagen, als sei dies der nächste Schritt zu einem weltumspannenden Taxiimperium. Es gibt Wegschauer und Hingucker. Die Wegschauer unterteilen sich in die wohlwollenden und die missbilligenden, bei den Hinguckern gibt es die mit den geilen und die mit den strafenden Blicken. Die gefolterten Iraner sind alle wohlwollende Wegschauer, die meisten Ex-Tankwarte strafende Hingucker.»
«Du hast die Augen auf beim Küssen?»
«Manchmal.»
«Mach sie zu.»
«Fährst du mit mir ein paar Tage nach Heiligendamm?»
«Mit dem Taxi?»
«Mit meinem Auto.»
Sie hatte nein gesagt, als er sie gefragt hatte, ob sie mit ihm in Berlin in ein Hotel gehen würde. Hotel in der eigenen Stadt, das war etwas für Nutten und verheiratete Frauen. Jetzt sagte sie ja.
Eine Woche später klingelte er an einem frühen Sonntagabend bei ihr. Sie hatte ihre Tasche schon gepackt und stieg dann in einen Renault Kombi, Familienkutsche, hinten waren zwei Kindersitze. Es begann zu schneien, als sie auf der Autobahn waren. Es schneite die ganze Fahrt über. Am Oranienburger Kreuz nahm sie seine rechte Hand und ließ sie bis Heiligendamm nicht mehr los. Der Renault pflügte mit knapp hundertsiebzig durch den Schnee, sie hörten Coldplay und sagten nichts. Manchmal gab Thilo einen neuen Zwischenstand an. Er versuchte, den Navigator zu schlagen, wie er das nannte: vor der beim Start errechneten Ankunftszeit in Heiligendamm sein. Wenn er seine Hand zurückzog, um die Scheibenwischer auf eine andere Geschwindigkeit einzustellen, murrte sie. Es war wie fliegen, nur gefährlicher. Glück, reines Glück. Schneeflocken, weiße Straße. Ein Räumfahrzeug blinkte ihnen empört hinterher. Kurz vor Rostock dachte sie darüber nach, was eigentlich sein Alibi war, aber sie würde ihn nicht danach fragen. Sie wollte nicht, dass das, was sie so glücklich machte, auf einer Lüge gründete. Sie schlugen den Navi um siebzehn Minuten, obwohl der vom Schnee nichts gewusst hatte. Oder hatte er doch? Diese Geräte waren ihr unheimlich.
Als sie auf dem Zimmer waren, saßen sie ratlos da, er auf der Bettkante, sie auf einem Stuhl, von dem aus sie die Ostsee sehen konnte, ihr Meer.
«Hast du Hunger?», fragte er.
Sie nickte rasch.
Sie gingen ins Restaurant, wo nur ein älteres Paar saß, in einem riesigen Saal, der lindgrün tapeziert war, chinesisches Muster. Der Tisch war mit mehr Besteck eingedeckt, als Esther an zwei Tagen gebraucht hätte, und der Kellner war zu oft da, um sich zu erkundigen, ob alles recht war. Das war es aber nur, wenn er nicht da war. Das heißt, so ganz recht war es dann auch nicht. Ihr Gespräch kam nicht in Gang. Sie sagte nichts, Thilo sagte, dass es schwierig sei, mit Arthouse-Filmen Geld zu verdienen. «Vielleicht ist das Wort nur eine Entschuldigung für alles», sagte sie. Es stand im Raum, dass es falsch gewesen sein könnte, gemeinsam herzukommen.
Als das Restaurant schloss, gingen sie in die Bar. Er rauchte eine Zigarre und stellte ein paar Fragen zu ihrem Leben, aber sie speiste ihn mit kargen Antworten ab. Es lag nahe, was sie ihm hätte sagen können. Dass sie schon einmal hier war, nicht in diesem Raum, aber in Heiligendamm. Damals gab es eine Demonstration gegen das Hotel, und sie war mit Jasper von Greifswald hergefahren. Es ging darum, dass man für das Hotel ein paar Wege, die vorher öffentlich waren, gesperrt hatte. Sie kamen über den Strandweg, vielleicht zweihundert Leute, mit ein paar Plakaten, eine Frau mit Megaphon. Kurz vor dem Hotel hielt sie eine Reihe von Polizisten auf, sie hatten Knüppel und Schilder. Hinter den Polizisten strahlten die schönen, alten Häuser weiß in der Sonne. Menschen in weißen Bademänteln gingen vom Hotel zum Strand oder vom Strand zum Hotel, ihre Schritte knirschten auf den Kieswegen. Die Frau rief durch das Megaphon, dass der Strand und die Wege öffentlich zugänglich bleiben müssten, sie drückte sich etwas umständlich aus. Dann riefen sie: «Wir sind das Volk!» Jemand warf eine Tomate über die Polizisten hinweg und traf einen Hotelgast an der Schulter. Ein roter Fleck auf einem weißen Bademantel, alle lachten, aber dann gab es in der Gruppe eine Diskussion über Gewalt, vielleicht weil der Fleck so nach Blut aussah. Sie standen noch eine Weile da, und irgendwann löste sich die Demonstration auf. Jasper und sie legten sich an den Strand, schwammen in der Ostsee. Es war ein heißer Tag. Thilo erzählte sie nichts davon, kein Wort.
Seine Zigarette glühte im Aschenbecher, und er sagte, dass die Riefenstahl in einem Haus am Starnberger See gewohnt habe und schlank gewesen sei wie eine Siebzehnjährige trotz ihrer hundert Lebensjahre und immer rote Lippen gehabt habe, wenn er gekommen sei, rote Lippen und enge Röcke, dazu hohe Schuhe. Toll habe sie ausgesehen. Esther war nach Heulen zumute. Aber aus der Nähe habe sie seltsam ausgesehen, sagte Thilo, Hunderte von Falten im Gesicht, und diese Falten mit den knallroten Lippen, das habe einfach nicht zusammengepasst.
«Soll ich dich nach Hause bringen?», fragte er.
Sie schüttelte den Kopf.
Als die Bar schloss, gingen sie auf ihr Zimmer, und Esther verschwand sofort im Bad. Sie ließ das Wasser laufen, ohne es zu benutzen. Nach zehn Minuten zog sie sich aus und verließ das Bad in einem weißen Bademantel vom Hotel. Eine goldene Krone war auf die Brusttasche gestickt. Er war im Bett, seine Sachen hingen über dem Stuhl. Sie machte das Licht aus und stieg ins Bett, den Bademantel ließ sie an. Sie lag steif da, ihr Gesicht zur Decke gewandt. Nach einer Weile spürte sie, wie seine Finger über ihren Oberarm streiften.
Als sie am nächsten Morgen aufwachte, fragte sie sich, was passiert war in der Nacht, aber sie hatte keine Erinnerung. War nichts passiert, oder hatte sie es verdrängt? Ehe sie darüber nachdenken konnte, schmiegte er sich an sie, und sie merkte erst wieder, dass es noch eine Welt gab, die nicht Thilo und sie war, als der Room Service klopfte. Er klopfte fünfmal an diesem Tag und störte so, wie früher ihre Mutter gestört hatte, wenn Freunde zu Besuch waren. Einmal hatten sie das Klopfen nicht gehört, und dann stand da plötzlich eine Frau mit Schürze, die Esther so sah, wie sie sonst nur Männer hatten sehen können. Das heißt, die meisten Männer hielten dabei die Augen geschlossen.
«Nächstes Mal nehmen wir ein billiges Hotel», sagte Thilo.
Sie ließen sich Caesar Salad bringen und Sandwiches und Champagner in einem Kühler. Sie verließen das Zimmer nur einmal am frühen Abend. Es schneite nicht mehr, sie gingen Hand in Hand auf die Seebrücke und schauten auf die Ostsee, die heute so still dalag, als wäre es Land. Drei Angler lehnten am Geländer und starrten ins Wasser. Das Hotel lag weiß und hell erleuchtet hinter dem Strand. Ein Paar kam aus dem Restaurant, sie trug eine Pelzjacke, er einen Hut, sie redeten laut und lachten und fragten die Angler, was sie gefangen hätten. Keine Antwort. Einer der Angler schnitt einen Fisch auf, riss die Innereien raus und warf sie achtlos weg. Blut spritzte auf einen Schuh der Frau. Das Paar ging wieder. Weit hinten auf dem Meer zogen die Lichter eines Schiffes vorüber.
«Wir hätten sterben können», sagte Esther.
«Auf der Autofahrt?»
«Wäre das schlimm gewesen?»
Sie hatte darüber nachgedacht. Nicht dass sie sterben wollte, aber wenn sie mit Thilo im Auto gestorben wäre, hätte man sie zusammen in dem Wrack gefunden, und sie hätte Greta etwas voraus gehabt. Etwas, das Greta nicht mehr wettmachen konnte.
«Nein.»
Sie mochte nicht, wie er das Wort dehnte, wie er erst die Stimme senkte und dann hob. Er nahm sie in den Arm und küsste sie. Esther durchschaute die Absicht, sie von dem Thema abzulenken, ließ es aber zu. Vielleicht war es zu früh für große Fragen. Andererseits gilt für große Fragen, dass nur die frühen Antworten große Antworten sind, wenn nicht alles abgeklärt, abgeklopft, abgesichert ist.
Auf der Rückfahrt hielt sie ihm fordernd die Hand hin. Er schaute ihr kurz in die Augen, dann nahm er sie. Es schneite nicht mehr, die Straße war frei.
«Warum sagst du nie etwas?», fragte er.
«Ich sage etwas.»
«Nicht viel.»
Sie sah ihn an, sagte nichts.
Es stimmte. Sie hatte auch nach dem ersten Abend nicht angefangen zu sprechen. Wenn sie sich nicht liebten, hörte sie ihm zu. Stellte er eine Frage, blieb sie knapp in den Antworten. Er war darüber hinweggegangen, aber sie wusste, dass sie so deutlich schwieg, dass er es bemerken musste. Manchmal war es so, dass sie auf ihre eigenen Worte wartete, aber sie kamen nicht. Und wenn sie den Impuls spürte, etwas erzählen zu wollen, suchte sie seine Lippen. Sie küsste sich die eigenen Worte weg.
Wenig später lud er sie zu einer Party bei sich zu Hause ein. «Ein paar Leute, Wein und Grill», sagte er. Sie wollte da erst nicht hin und dann doch. Aber was anziehen? Alles das, was nur eine wirklich junge Frau tragen konnte, kurzer, enger Rock, kurzes Top, das den Bauch zeigt, Arme frei? So reizvoll konnte Thilos Frau gar nicht sein. Der Nachteil war, dass sie dann als die Fickmaus auftreten würde, die sie auf keinen Fall sein wollte und auch nicht war, sicher nicht. Also das Gegenteil? Eleganz, Fraulichkeit, Ernst und Würde – der Rolle, die sie künftig einnehmen wollte, gerecht. Die Frau an seiner Seite. Sie wälzte das ein paar Tage hin und her und probierte den halben Kleiderschrank durch, kaufte auch einiges dazu, obwohl sie sich sonst nicht viel mit Modefragen befasste. Es wurde etwas in der Mitte, kurzer, enger Rock, darüber eher züchtig, flache Schuhe.
Greta begrüßte sie an der Tür, ein genauer Blick, aber pure Freundlichkeit. Esther war spät gekommen, um nicht den Verlegenheiten eines frühen Smalltalks ausgesetzt zu sein. Eine Menge Leute waren da, sie standen und saßen in der Küche, im Wohnzimmer und draußen unter Heizpilzen neben dem Grill. Sie ging hierhin und dorthin, ohne mit jemandem zu reden. Ein paar Gesichter kannte sie aus dem Fernsehen. Sie schaute sich das Haus an, aber nicht so, sagte sie sich, als wäre es das Haus, in dem sie künftig leben würde. Wahrscheinlich müsste Thilo es seiner Frau überlassen, auch wegen der Kinder. Sie verstand das. Und sie wunderte sich, wie groß es war, er hatte nie darüber gesprochen. Es stand direkt am Wasser, in Sacrow, es war eine Villa mit einer Freitreppe zum Garten hin. Rechts und links neben der Terrassentür wölbten sich Halbsäulen aus der Fassade, darüber ein angedeutetes Kapitell. Prächtig war das nur auf den ersten Blick. Als sie näher hinsah, entdeckte sie Risse und Löcher. Mauersteine traten unter dem Rauputz hervor. Innen waren die Wände bis Schulterhöhe mit dunklem Holz verkleidet, aber das Holz war matt, verkratzt, fast unansehnlich. Das Haus roch wie die Häuser ihrer Kindheit, nach angestrengter Sauberkeit, ein bisschen giftig nach heutigen Maßstäben. Sacrow war früher DDR gewesen. Sie dachte daran, dass Thilo mit einem seiner ersten Filme einen Erfolg gehabt hatte, sogar international, aber dann war ihm nichts mehr gelungen. Dem entsprach dieses Haus. Es sah aus, als hätten seine Bewohner auf eine Zukunft gesetzt, auf die sie noch immer warteten.
Sie ließ sich durch das Fest treiben, ohne sich auf längere Gespräche einzulassen. Später, als die Drogen umgingen, tanzte sie, um in Ruhe gelassen zu werden. Thilo stellte sich einmal zu ihr und erzählte ihr von einem neuen Projekt. Das «Tagebuch eines Landpfarrers» interessiere ihn, ein Roman von Georges Bernanos, kraftvoller Stoff, meisterhaft, kirchenkritisch auch. «Wir dürfen der Katholischen Kirche das nicht alles durchgehen lassen», sagte er. Es gebe schon eine Verfilmung von Bresson, ein Meilenstein der Filmgeschichte, genau das reize ihn, da etwas dagegenzusetzen. «Wir müssen es mit den Klassikern aufnehmen», sagte er. Sie berührte seine Hand, er zog sie zurück, ein Reflex eher, dachte sie und war trotzdem verstimmt. Jemand sprach ihn an, sie zog weiter, dann sah sie auf dem Tisch, auf dem das Essen stand, ein Handy liegen. Das Display zeigte einen Pornofilm. Sie blickte sich nach einem Besitzer um, sah aber niemanden, der auf das Handy achtete. Es klingelte, so wie früher Bakelittelefone geklingelt hatten, und ein Mann mittleren Alters eilte herbei. Esther sah, wie sein Ohr von dem Pornofilm erleuchtet wurde. Sie ging wieder tanzen. Eine Frau stürzte, eine Diele war unter ihren Füßen gebrochen.
Am nächsten Morgen wachte Esther auf, weil zwei Kinder neben ihr standen und miteinander redeten. Sie lag auf dem Sofa unten im Salon und rätselte, warum sie nicht nach Hause gefahren war. Die Kinder fragten sie, wie sie heiße, und sie sagte ihren Namen.
«Und wie heißt ihr?»
«Paulus.»
«Ich Henriette.»
Sie wusste das längst, sie wusste auch, dass sie vier und sechs Jahre alt waren, und fragte trotzdem danach. Thilo brachte ihr einen Espresso ans Sofa und strich seinen Kindern über den Kopf. Sie wollten, dass sie ihnen etwas vorlas, und das tat sie auch, in die Decke gewickelt. Sie fragte sich, wie sie jetzt aufstehen solle, sie hatte nur ein Höschen an und ein T-Shirt, das ihr nicht gehörte. Greta kam, begrüßte sie freundlich und räumte Flaschen weg, während Esther den beiden Kindern vorlas.
Greta war Ende dreißig, nicht ganz so schlank wie Esther, aber größer, dunkelblond, und sie hatte ein Porzellangesicht mit verträumten Augen. Das Kinn war ein bisschen zu spitz. Als Esther gestern Abend, als es schon spät war, eine halbe Stunde mit Greta geredet hatte, war ihr nichts aufgefallen, was an dieser Frau besonders war, nichts, was sie zur Frau eines Mannes wie Thilo machte. Aus ihren Worten sprach nicht viel mehr als Müdigkeit. Am Ende war es die Schönheit, die Frauen wie Greta in solche Kreise schob. Sie erschrak bei diesem Gedanken. Konnte man das Gleiche von ihr sagen? Was war an Esther Dieffenbach besonders?
«Warum liest du nicht weiter?»
Henriette hatte das gefragt, und Esther war erleichtert, dass sie sich auf den Text konzentrieren musste.
Sie wurde danach häufiger in das Haus von Thilo und Greta eingeladen, zunächst nur mit anderen Gästen, dann auch alleine. Sie verstand sich gut mit Greta. Als sie einmal nebeneinander in der Küche standen und Gemüse für ein Wokgericht schnibbelten, kamen ihr Gretas Worte und Gesten so selbstverständlich und gelassen vor, als sei sie es gewohnt, mit jungen, hübschen Frauen, die ihr Mann angeschleppt hatte, Essen zuzubereiten. Kein schöner Gedanke. Aber Esther konnte so etwas verdrängen. Wenn sie Glück hatte, tauchte der Gedanke nie mehr auf. Sie war bis jetzt ganz gut damit gefahren.
Thilo besuchte sie ein-, zweimal in der Woche in ihrer Wohnung, das war inzwischen erlaubt. Meistens machte er um zwei Uhr morgens erste Anstalten zu gehen, sie hielt ihn zurück, mit Locken, Maulen, Flehen. Manchmal konnte sie ihn so bis zum Morgengrauen halten, aber wenn er gegangen war, schämte sie sich ein bisschen für ihr Klammern. Sie hatte sich noch nie so verzweifelt erlebt wie in diesen Morgenstunden. Alle Entscheidungen über ihr Leben hatte sie vertagt. Als sie einmal auf ihn wartete, blieb sie beim Zappen an einem Film über deutsche Soldaten in Afghanistan hängen. Sie fand die Herausforderung interessant, bei vierzig Grad anstrengende Dinge zu tun. Dann klingelte es, Thilo. Sie machte ihm unten auf, öffnete ihre Wohnungstür und ging in die Küche, beschäftigte sich dort mit Dingen, die nicht notwendig waren. Er kam in die Küche, sie küssten sich und schoben einander ins Schlafzimmer. Seine Fragen nach ihrem Leben, ihrem Vorleben wurden drängender, sie sagte nichts.
Manchmal riefen Leute an, und er verhandelte mit ihnen über Filme, während er nackt neben ihr lag. Er hatte zuletzt einen Film produziert, bei dem es um einen Turmspringer aus Tiflis ging. Der Turmspringer trainierte für die Olympischen Spiele 1992 in Barcelona, doch nach dem Zusammenbruch des Sozialismus funktionierte für eine Weile die Wasserversorgung nicht. Es war ein heißer Sommer, und die Leute holten sich Wasser aus dem Becken, bis es leer war. Nach der Krise wurde es nicht mehr aufgefüllt, obwohl der Turmspringer, der sich als Medaillenhoffnung sah, sogar den Staatspräsidenten anflehte. Das Wasser werde woanders dringender gebraucht, hieß es. Der Turmspringer begann, das Becken mit zwei Eimern eigenhändig aufzufüllen, musste aber bald einsehen, dass er es nicht rechtzeitig schaffen würde, um bis zu den Olympischen Spielen in Form zu sein. Für ein Trainingslager in einem anderen Land fehlten ihm die Devisen. Esther hatte den Film auf einer DVD gesehen, er war langsam erzählt, sie fand ihn ein bisschen langweilig, aber die Trockenübungen des Turmspringers hatten poetischen Charme. Das Ende war erwartbar und daher enttäuschend. Der Turmspringer stieg auf den Zehnmeterturm und machte einen wunderschönen Sprung mit Salti und Schrauben und landete kopfüber in dem Becken, das höchstens zwei Handbreit hoch mit Wasser gefüllt war. Der Film lief auf einigen Festivals, und nun suchte Thilo einen Verleih fürs deutsche Kino. Die großen hatten schon abgesagt, auch von den Nischen-Verleihern war nur noch ein Interessent übrig.
Er lag in ihrem Bett, sie hatten sich geliebt, wie sie sich nun immer liebten. Sie forderte harte Stöße, die sie nicht bekam. Er bewegte sich sanft in ihr, weich, rund, und sie schrie und flehte, dass er sie hart nehmen solle. Er flüsterte ihr ins Ohr, forderte Liebe und Treue, und sie versprach ihm alles, aber er bewegte sich noch langsamer, hielt inne, drückte sie nieder, damit sie sich nicht rühren konnte, und sie kämpfte dagegen an, wütend, verzweifelt, sie biss ihn so fest, dass er sie schlug, damit sie ihre Zähne löste, und er bewegte sich wieder, aber seiner quälenden Verhaltenheit konnte sie nur entkommen, indem sie kam.
Nach ein paar Wochen fragte er sie, was er tun müsse, damit sie kommen würde, sie wirklich hart stoßen, obwohl er das nicht möge? Da verstand sie erst, was passierte. Sie kam lautlos, reglos, die ganze Energie ging nach innen, und das war schöner als alles, was sie sonst erlebt hatte. Sie wusste nicht, was sie sagen sollte. Der Zauber war bedroht durch seine Frage. Er musste ihr die Härte verweigern, aber er durfte nicht wissen, dass sie genau das wollte. Nur in der Nichterfüllung ihrer Wünsche fand sie diese wunderbare Erfüllung, und das, dachte sie, würde nicht gehen, wenn es reines Spiel wäre, reine Fiktion. Sie brauchte seine echte Verweigerung, um dagegen ankämpfen zu können. Deshalb sagte sie nichts, sagte nur, dass es schön sei mit ihm, und wechselte das Thema. Sie fürchtete, der Zauber sei womöglich schon zerstört durch ihre eigenen Überlegungen, aber als sie das nächste Mal miteinander schliefen, war es wie immer, sie vergaß ihre Gedanken und biss ihn verzweifelt.
Danach saßen sie auf ihrem Bett und aßen Litschis. Das war der Ablauf, der sich eingespielt hatte. Beim ersten Mal waren zufällig Litschis in der Obstschale gewesen. Sie mochte es, die Litschis für ihn zu schälen. Die rote, harte Schale, die riss, wenn man daran knibbelte, darunter das weiße, saftige Fleisch. Ihre Hände trieften bald. Thilo biss das Fleisch vom Kern, den er anschließend in den Mund steckte und ablutschte. Wenn er genug Litschis gegessen hatte, forderte er sie auf, sich einen Finger reinzuschieben, den er dann ebenfalls ablutschte. «Ich mag diese Mischung», sagte er.
Sie schälte gerade eine Litschi, als sein Handy klingelte. Er ging dran, der letzte Nischen-Verleiher sagte ab. Thilo schluchzte auf, und damit hatte sie nicht gerechnet. In dem Moment wusste sie, dass es eine Rolle gab für sie in Thilos Leben, und das waren nicht Jugendlichkeit und Schönheit. Sie fühlte sich gebraucht. Er redete eine Stunde davon, warum ihm, ausgerechnet ihm nicht das Glück vergönnt sei, noch einmal einen erfolgreichen Film zu machen, wie es sich anfühle, so oft gelobt zu werden für seine Filme, von Kollegen, in der Presse, aber nie mehr als dreißigtausend Leute zu finden, die bereit seien, für einen seiner Filme Geld zu bezahlen. Sie hörte sich das an, hielt ihn fest, aber das Entscheidende war das Schluchzen. Gegen dieses Schluchzen würde sie ihm helfen können, dachte sie.
Sie arbeitete weiter in der Cincinnatus Bar, zunehmend lustlos. Manchmal ging sie ins Museum, fragte sich aber, warum sie das alleine tun musste. Sie lief wieder jeden Tag und war ein bisschen zu dünn, wie sie fand. Sie rief ihre Mutter an und fragte, was die Fische machten; diesmal war die Antwort kurz, weil ihre Mutter rasch erzählen musste, dass Esthers Vater eine Vertretung für Swimmingpools übernommen hatte. Dies war sein vierter Versuch gegen die Tatenlosigkeit, seitdem er die Arbeit bei der LPG verloren hatte. Hinter dem Haus, sagte die Mutter, lägen zwei hellblaue Becken, Muster für die Kunden, die er zu finden hoffte. Esther fragte nicht, warum Leute, die auf einer Insel wohnen, sich einen Swimmingpool kaufen sollten. Wahrscheinlich war das ein dummer Gedanke.
Anfang März machte Thilo das Ruderboot klar, und sie ruderten auf den Wannsee hinaus. Sie hielt eine Hand ins kühle Wasser und fragte, als sich die Hand wie erfroren anfühlte, wann er sich entscheiden würde. Er hörte auf zu rudern, legte die Skulls flach aufs Wasser und sagte, dass er sich den Moment nicht vorstellen könne, da er vor seine Kinder trete, um zu sagen: Papa zieht jetzt aus.
«Ich bekomme diese Trennung in Gedanken nicht hin», sagte er. «Ich lebe so, dass in meinem Kopf Bilder entstehen, und diesen Bildern lebe ich dann nach.»
«Was heißt das?»
«Ich mache aus den Bildern Realität. Und wenn ich kein Bild habe, dann folgt auch keine Realität. Das Bild, in dem ich zu meinen Kindern sage, dass ich jetzt gehe, entsteht einfach nicht.»
Sie sagte, dass er sich nicht von den Kindern trennen würde, nur von Greta, da die Kinder ihren Platz auch in der neuen Familie hätten, einen großen Platz, und am Ende des Gesprächs hatte sie den Eindruck, dass es Gründe gab, ihre Hoffnung nicht aufgeben zu müssen. Thilo ruderte sie zurück zum Haus. Greta und sie machten Gulasch, Thilo kümmerte sich um die Nachspeise, eine weiße Mousse au Chocolat.