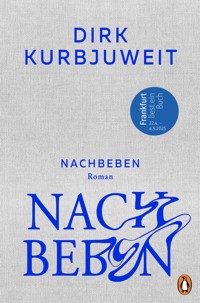9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der moderne Mensch hat sich in den letzten Jahren sehr verändert. Sein oberster Wert ist Effizienz. Er verschwendet keine Zeit, er möchte stark sein, selbständig, flexibel und innovativ, so wie es die Propheten großer Unternehmensberatungen seit Jahren für das Arbeitsleben predigen. Die weltweit operierenden Unternehmensberater sind die Speerspitze eines umfassenden Wirtschaftlichkeitsdenkens, das längst alle unsere Lebensbereiche durchdringt: Politik und Wirtschaft, Religion und Kultur, Medizin und Gentechnik. Deutschland ist auf dem Weg zur «McKinsey-Gesellschaft». Wie sieht sie aus? Was ist ihr Menschenbild? Wer treibt diese Entwicklung voran, und was treibt sie an? Dirk Kurbjuweit porträtiert in seinem erstmals 2003 erschienenen Buch mit genauem Blick für Typisches und Details die Macher und ihre Jünger von Jürgen Kluge über Friedrich Merz bis hin zu jenem Pfarrer, der sich der «spirituellen Marktwirtschaft» öffnet. Der Mensch wird Gegenstand immer neuer Optimierungsphantasien, aber auch zum Manager in jeder Lebenslage. Allmählich entsteht eine Gesellschaft, die den Unterschied ausmerzt, den Zufall, die Muße, die Phantasie. Was aber wird aus jenen, die hier nicht mithalten können? Kurbjuweit beschreibt anschaulich, wie das Prinzip McKinsey uns alle immer mehr verwandelt. Eine geschlossene Gesellschaft von Hochleistungsmenschen scheint am Horizont auf. Und die Frage wird unausweichlich: Wollen wir das wirklich?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 211
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Dirk Kurbjuweit
Unser effizientes Leben
Die Diktatur der Ökonomie und ihre Folgen
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Der moderne Mensch hat sich in den letzten Jahren sehr verändert. Sein oberster Wert ist Effizienz. Er verschwendet keine Zeit, er möchte stark sein, selbständig, flexibel und innovativ, so wie es die Propheten großer Unternehmensberatungen seit Jahren für das Arbeitsleben predigen. Die weltweit operierenden Unternehmensberater sind die Speerspitze eines umfassenden Wirtschaftlichkeitsdenkens, das längst alle unsere Lebensbereiche durchdringt: Politik und Wirtschaft, Religion und Kultur, Medizin und Gentechnik.
Deutschland ist auf dem Weg zur «McKinsey-Gesellschaft». Wie sieht sie aus? Was ist ihr Menschenbild? Wer treibt diese Entwicklung voran, und was treibt sie an? Dirk Kurbjuweit porträtiert mit genauem Blick für Typisches und Details die Macher und ihre Jünger von Jürgen Kluge über Friedrich Merz bis hin zu jenem Pfarrer, der sich der «spirituellen Marktwirtschaft» öffnet.
Über Dirk Kurbjuweit
Dirk Kurbjuweit, geboren 1962, ist Journalist und Buchautor. Er studierte Volkswirtschaft, war von 1990 bis 1999 Redakteur bei der «ZEIT» in Hamburg und wechselte 1999 zum Nachrichtenmagazin «Der Spiegel». 1998 und 2002 wurde er mit dem Egon-Erwin-Kisch-Preis für die beste Reportage ausgezeichnet.
Dirk Kurbjuweit ist verheiratet, Vater von zwei Kindern und lebt in Berlin. Bisher erschienen von ihm u.a. die Romane «Die Einsamkeit der Krokodile» (Frankfurt a.M. 1995, Kinofilm im Sommer 2001), «Schussangst» (Frankfurt a.M. 1998), die Novelle «Zweier ohne» (Zürich 2001), «Nachbeben» (Zürich 2004).
Inhaltsübersicht
Vorbemerkung
Dieses Buch sollte eigentlich anders heißen. «Die McKinsey-Gesellschaft» hatten Verlag und Autor als Titel ausgesucht. Denn darum geht es. Eine Gesellschaft, eine Republik, die mehr und mehr geprägt wird vom Effizienzdenken, und besonders fanatische Propheten der Effizienz arbeiten bei der Beratungsfirma McKinsey. Auch wenn nicht jeder von ihnen beraten und direkt geprägt wurde, ihr Denken ist längst in unseren Köpfen. McKinsey ist zum Symbol für die Diktatur der Effizienz geworden. Aber dieses Buch darf nicht «Die McKinsey-Gesellschaft» heißen, weil McKinsey das nicht will. Die Firma hat Titelschutz beansprucht. Deshalb heißt das Buch «Unser effizientes Leben». Aber es geht um die McKinsey-Gesellschaft.
McKinsey und ich
Ich glaube, nur einmal in meinem Leben habe ich einem anderen Menschen richtig Angst gemacht. Das war in jenen fünf Minuten, als man mich für einen Mitarbeiter von McKinsey hielt. Ich war beim Verlag S. Fischer in Frankfurt am Main zu Besuch und wollte mit dem Programmchef über ein Buchprojekt reden. Ich trug einen dunklen Anzug und ein weißes Hemd, vielleicht auch eine Krawatte, ich erinnere mich nicht mehr genau. Als mich der Programmchef nach unserem Gespräch durch die Flure von S. Fischer führte, begegnete uns eine ältere Frau. Sie blieb stehen und sprach mich an. Sie erzählte mir von ihrer Arbeit im Verlag und sagte, dass dies eine wichtige Arbeit sei. Sie sprach von ihren Erfahrungen, ihrem Fleiß und anderen Stärken. Ich wusste nicht, warum sie mir das erzählte. Sie redete und redete. Allmählich war zu spüren, dass sie Angst hatte, dass sie verzweifelt kämpfte. Sie hörte nicht auf zu reden. Es war klar, dass sie ihren Arbeitsplatz verteidigte, aber mir war nicht klar, warum sie das mir gegenüber tat. Schließlich unterbrach sie der Programmchef und sagte, ich sei ein Autor des Hauses. Ich sei nicht von McKinsey. Die Frau sah mich überrascht an, dann lächelte sie verlegen und entschuldigte sich für das Missverständnis.
Zu dieser Zeit waren Mitarbeiter der Unternehmensberatung McKinsey bei S. Fischer und pflügten den Verlag um auf der Suche nach mehr Effizienz. S. Fischer machte Verluste, und mit Hilfe von McKinsey sollten die Kosten gesenkt werden. Allen war klar, dass Leute entlassen würden. Fast jeder hatte Angst um seinen Job. Fast jeder hatte Angst vor den Männern in den dunklen Anzügen.
Ich fuhr sehr nachdenklich nach Hause. Es ist eine seltsame Erfahrung, einen anderen Menschen in eine tiefe Angst zu versetzen. Ich werde nie vergessen, wie mir diese Frau ihre Arbeit anpries. Es war fast ein Flehen, ein Betteln. Ich glaube, dass ich erst damals wirklich verstanden habe, was die Arbeit von McKinsey in einem Menschen anrichten kann.
Dabei hatte ich mich schon vorher intensiv mit McKinsey befasst. Mitte der neunziger Jahre fielen mir in den Zeitungen immer häufiger Meldungen auf, dass Unternehmensberater nicht nur Unternehmen beraten, sondern auch ein Theater, ein Opernhaus, einen Fußballverein, die evangelische Kirche, die katholische Kirche, Krankenhäuser. Damals war ich Redakteur bei der Wochenzeitung Die Zeit und begann, in der Szene der Unternehmensberater zu recherchieren. Mich interessierte die Frage, was es heißt, wenn immer mehr Bereiche der Gesellschaft nach ökonomischen Gesichtspunkten gestaltet werden. Mein Eindruck war, dass es besonders die Unternehmensberater sind, die still und effizient unsere Welt umbauen, indem sie ihre Ideen und Konzepte in mehr und mehr Köpfe pflanzen. Ich sprach mit verschiedenen Leuten der Branche und mit Leuten, die von ihnen beraten worden waren. Der Eindruck bestätigte sich.
Ich sprach auch mit Leuten von McKinsey. Ich kann nicht verhehlen, dass ich rasch fasziniert war. Es ist ein eigener Menschenschlag, auf den man dort trifft. Ich musste gleich an Ledernacken denken, an amerikanische Elitesoldaten also, darauf gedrillt, ihr Ziel mit letzter Konsequenz zu verfolgen, bestens ausgebildet und durch einen fast religiösen Korpsgeist verbunden. McKinsey ist ähnlich. Ich änderte den Ansatz meiner Geschichte, vergaß die Recherchen bei anderen Unternehmensberatern und konzentrierte mich auf McKinsey. Niemand sonst verficht die Idee von der Effizienz und von der Ökonomisierung der Gesellschaft derart konsequent. Nach einem Dutzend Interviews schrieb ich ein Dossier in der Zeit mit dem Titel: «Die Propheten der Effizienz».
Als Reporter, mittlerweile für das Nachrichtenmagazin Der Spiegel, ändern sich die Themen, die ich behandele, in rascher Folge. Mal begleite ich zwei Wochen lang einen Politiker, dann berichte ich von einer Fußball-Weltmeisterschaft, dem folgt eine große Reportage über ein Unternehmen, einen Wissenschaftler, einen neuen Trend in der Kulturszene. Ein Thema allerdings hat mich nie verlassen, beschäftigt mich seit Jahren nun: McKinsey. Auch wenn ich nach jenem Dossier nie mehr einen größeren Artikel über Unternehmensberater geschrieben habe, so begegnet mir das Thema doch bei fast jeder anderen Recherche. McKinsey ist für mich zur Metapher geworden für die Diktatur der Effizienz, für die totale Ökonomisierung der Gesellschaft. Das Denken, das ich zuerst bei den Unternehmensberatern kennen gelernt habe, begegnet mir mittlerweile bei fast jedem Gespräch, ein Denken in Zahlen, das Denken eines Managers.
Der Manager ist unangefochten das Rollenmodell Nummer eins unserer Zeit. Fast jeder will und soll wie ein Manager handeln, Politiker, Wissenschaftler, Ärzte, Pfarrer. Sie haben immer auch eine andere Rolle, aber die des Managers ist allen gleich. Für mich ist das der große Triumph von McKinsey. Niemand sonst hat unser Denken in den letzten Jahren so verändert wie die Unternehmensberater. Auch wer nicht von McKinsey beraten wurde, denkt und handelt, als sei er von McKinsey beraten worden. Börsenboom, New Economy und die biotechnische Revolution haben diese Ökonomisierung der Gesellschaft weiter verstärkt.
Ich bin nicht gegen die Marktwirtschaft, im Gegenteil. Als ich in den achtziger Jahren in Köln Volkswirtschaft studiert habe, wurde mir auch auf theoretischer Ebene bald klar, dass eine Gesellschaft, die Wettbewerb und das Streben nach Vorteilen, also nach Ungleichheit, ausschließen will, nicht funktionieren kann. Von sozialistischen Ideen auch als Jugendlicher nur schwach angehaucht, habe ich meinen Frieden mit den herrschenden Verhältnissen weitgehend schmerzlos gemacht.
Die Perspektive dieses Buches ist nicht die grundsätzlicher Opposition. Ich halte die soziale Marktwirtschaft nach wie vor für das richtige System, funktionstüchtige Alternativen sehe ich nicht. Insofern habe ich natürlich auch nichts gegen McKinsey. Dass die Ökonomie nach ökonomischen Prinzipien funktionieren soll, halte ich für selbstverständlich. Effizienz ist dabei wesentlich, und die Leute von McKinsey sind Spezialisten für Effizienz. Ihr Rat kann hilfreich sein. Dazu gehört dann leider auch, dass in manchen Situationen Leute entlassen werden, obwohl das für jeden Einzelnen eine Katastrophe sein kann. Ich war sehr froh, später zu hören, dass jene ältere Angestellte von S. Fischer, deren Angst ich so unmittelbar erlebt hatte, nicht entlassen wurde. Allerdings haben Kollegen von ihr, die nicht weniger Angst hatten, ihren Job verloren. Es ist schmerzlich, das zu sagen, aber solche Entlassungen können notwendig sein, auch wenn die Entlassenen mitunter die Opfer von Fehlern sind, die andere gemacht haben. Eine Position der Unschuld gibt es in der Marktwirtschaft nicht. Aber gibt es sie in anderen Systemen?
In diesem Buch geht es um Kritik an etwas anderem: der totalen Ökonomisierung, der Ökonomisierung aller Lebensbereiche, der Expansion des Kapitalismus in der sozialen Marktwirtschaft. Wobei Marktwirtschaft meint: Privateigentum, freier Handel, Gewinnstreben als Möglichkeit, als Teil einer gesellschaftlichen Ordnung, in der auch andere Prinzipien gelten können, zum Beispiel sozialer Ausgleich, in der es Lebensbereiche gibt, die frei sind von den Gesetzen der Ökonomie. Kapitalismus hingegen ist die zwanghafte Ökonomisierung aller Lebensbereiche, die totale Dominanz des Gewinnstrebens, die Verwandlung der gesamten Gesellschaft in ein Unternehmen.
Ich denke, dass der Kapitalismus in eine neue, eine dritte Phase getreten ist. Zunächst gab es den Kapitalismus des 19. Jahrhunderts, in dem die Gesetze der Ökonomie schrankenlos im Bereich der Wirtschaft herrschten. Er war expansiv, indem er immer mehr Betriebe und Arbeitsverhältnisse seinen oft unmenschlichen Bedingungen unterwarf. Ihm folgte der Kapitalismus des 20. Jahrhunderts, der herausgefordert war durch den real existierenden Sozialismus und sich intern Schranken auferlegte, um im Systemwettbewerb nicht als gänzlich unsozial zu erscheinen. Dieser Kapitalismus war expansiv, indem er sich anderen Volkswirtschaften als das bessere System empfahl und aufdrängte. Der Kapitalismus des 21. Jahrhunderts ist ohne Konkurrenz, nachdem der Kampf der Systeme gewonnen wurde. Er ist expansiv, indem er alle Lebensbereiche seinen Bedingungen unterwerfen will.
Die Gesetze der Marktwirtschaft grundsätzlich für sinnvoll zu halten heißt ja nicht, dass alles nach den Prinzipien des Kapitalismus funktionieren soll, also vorrangig nach dem Diktat von Effizienz, weil Effizienz die monetär größten Gewinne verspricht. Muss ein Krankenhaus geführt werden wie eine Stahlschmiede? Soll ein Theater die gleiche Struktur haben wie ein Kaufhaus? Ist eine politische Wahlkampagne mehr oder weniger das Gleiche wie ein Werbefeldzug für ein Deodorant? Muss in meinem Alltag jede Minute so verplant und ausgefüllt sein wie im Alltag eines Managers? Muss ich mich durchökonomisieren wie ein Unternehmen, muss ich zur Ich-AG werden, um den Anforderungen unserer Zeit zu genügen?
In seiner dritten Phase ist der Kapitalismus ähnlich gefräßig wie in seiner ersten. Im 19. Jahrhundert mussten die Industriearbeiter mehr oder weniger den ganzen Tag lang arbeiten. Zeit blieb praktisch nur für Erholungsschlaf. Diese Menschen waren daher reine Wirtschaftssubjekte. In seiner zweiten Phase, der milden, ging diese Belastung stark zurück. Derzeit steigt sie wieder leicht an, aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Wir sind erneut reine Wirtschaftssubjekte, weil wir von morgens bis abends in allen Lebensbereichen den Gesetzen der Wirtschaft ausgesetzt sind.
Ich glaube, das Wort, das ich bei meinen Recherchen am häufigsten höre, egal zu welchem Thema, heißt Effizienz. Es ist das ganz große Wort unserer Zeit. Es wird nie angefochten, nie infrage gestellt. Ist es ausgesprochen, liegt es wie ein Fels im Raum, tonnenschwer und unverrückbar. Niemand würde im Ernst für Ineffizienz streiten. Effizienz ist gut. Seine Ziele mit dem geringstmöglichen Einsatz zu erreichen kann nur sinnvoll sein. Und doch glaube ich, dass eine Welt, die unter der großen, alles beherrschenden Überschrift Effizienz steht, keine besonders gute, besonders lebenswerte Welt ist. Das ist das Paradox, das hinter diesem Wort steht: In fast jedem Einzelfall ist es wahrscheinlich richtig, wenn effizient gehandelt wird. Wenn aber überall und von jedem effizient gehandelt wird, kommt insgesamt etwas Falsches dabei raus. Das soll dieses Buch zeigen.
Im Herbst 2001 war ich in Peshawar, einer pakistanischen Stadt nahe der Grenze zu Afghanistan. Die Vereinigten Staaten hatten gerade den Krieg gegen die Taliban und die Al Qaida begonnen, Folge der Anschläge vom 11. September. Mein Thema waren Kriegsflüchtlinge und wie man ihnen helfen kann. Bei einem längeren Gespräch mit dem Chef von Terre des Hommes in Peshawar fiel das Wort Effizienz häufig. Der Mann, ein Deutscher, stand unter starkem Druck, die Spendengelder effizient einzusetzen, was sicher nicht verkehrt ist. Allerdings konnte man den Eindruck haben, er sei vor allem mit Fragen der Effizienz befasst. Sein Gewerbe, die Hilfe für die Schwachen, war schon so weit ökonomisiert, dass der Mann in vielem dachte wie ein Manager.
Aber das war nicht der stärkste Eindruck dieses Tages. Am Morgen wollte ich New Shamshatoo besuchen, ein Lager für Flüchtlinge aus Afghanistan. Dazu brauchte ich eine Erlaubnis vom Gouverneur der Region. Wir fuhren zu seinem Sitz am Rand von Peshawar und wurden in ein Büro geschickt, wo wir ein Formular ausfüllen sollten. Es gab keinen Computer in diesem Büro. Ich war seit ewigen Zeiten nicht mehr in einem Büro ohne Computer gewesen. Ich füllte ein Formular aus, das sofort weggetragen wurde. Es gab in diesem Büro zwei Schreibtische aus dunklem Holz, sehr alte Schreibtische. Darauf stapelte sich Papier, das zum Teil stark vergilbt war. Auf den Stapeln lag jeweils ein Stein, damit nichts wegfliegen konnte. Ein Ventilator, der sich träge und unrund an der Decke drehte, sorgte für einen leisen Lufthauch. Es war sehr heiß. Außer den Papierbergen gab es noch Kladden, die mit Kordeln zusammengebunden waren, Stifte in Haltern, Feuchtigkeitskissen für den Daumen, ein Fläschchen mit Klebstoff. An jedem Schreibtisch saß ein Mann, der nichts tat, außer dort zu sitzen. Mit einer trägen Geste wurde mir ein Stuhl zugewiesen, der Rahmen war aus Holz, die Sitzfläche aus Bastgeflecht, aber das existierte nur noch an den Rändern. So saß ich etwas unbequem. Niemand sprach. Außer den beiden Männern hinter den Schreibtischen gab es noch drei Männer, die sich gegen die Wand lehnten. Alle fünf sahen aus, als hätten sie sich seit Jahren nicht mehr bewegt. Die Papiere und alle Gegenstände wirkten, als seien sie seit Jahren nicht mehr bewegt worden. Einmal kam ein Mann, der einen neuen Stapel Kladden brachte. Er legte sie auf einen der vorhandenen Stapel und ging wieder. Niemand nahm Notiz von ihm. Dann kam ein Mann, der Tee brachte und Tassen. Alle nahmen Tee und tranken schweigend. Ich dachte, dass ich meine Erlaubnis nicht in fünf Tagen bekommen würde.
Ich bekam meine Erlaubnis nach einer halben Stunde. Auf deutschen Ämtern habe ich schon zwei oder drei Stunden zugebracht. Ich will damit nicht sagen, dass ich jenes Büro in Peshawar für ein Ideal halte. Ich bin kein Romantiker, der sich alte oder orientalische Verhältnisse für unsere Lebenswelt wünscht. Ich erzähle das nur, weil ich nicht mehr oft eine Gegenwelt zu unserer Effizienzwelt erlebe. Dieses Büro war eine solche Gegenwelt, eine Welt mit riesigen Schwächen und doch eine Welt, die eine Sehnsucht auslösen kann. Zum Beispiel nach einem sich behäbig wälzenden Zeitfluss, nach gedehnten Minuten und Stunden, nach träger Nachdenklichkeit: Dinge, die uns verloren gehen.
Ich musste in diesem Büro an McKinsey denken, an ein Gutachten, das sicherlich die Entlassung aller fünf Männer, die sich dort aufhielten, empfehlen würde. Ich musste auch an Jürgen Kluge denken, der heute Chef von McKinsey Deutschland ist. Als ich bei den Recherchen für das Dossier mit ihm geredet habe, kam er unvermutet auf die Amischen zu sprechen, jene seltsamen Menschen, die auf ihren Ländereien in Pennsylvania den Effizienzbegriff des 18. Jahrhunderts eingefroren haben. Sie arbeiten nicht mit Traktoren, sondern mit Pferden. Manchmal, sagte Kluge am Ende eines langen Gesprächs über Effizienz, Effektivität, Flexibilität und Leistung, habe er Sehnsucht nach diesen Zeiten und Verhältnissen. Es war ziemlich überraschend, das von ihm zu hören, weil er so durch und durch die Prinzipien von McKinsey verkörpert, weshalb er dann ja auch zum Chef aufstieg. Wenn einer wie er schon diese Sehnsucht hat, nährt das den Verdacht, dass wir uns, vielleicht in bester Absicht, eine Welt einrichten, in der wir nicht gerne leben.
Kluges Sehnsucht nach der langsamen Welt der Amischen bleibt natürlich folgenlos. Er arbeitet am Gegenteil. Niemand presst den Effizienzbegriff so konsequent in unsere Gesellschaft wie McKinsey. Niemand kämpft so entschlossen für Beschleunigung, Verschlankung, Ökonomisierung. McKinsey ist für mich mehr als eine Firma, die Unternehmen und andere Einrichtungen berät. McKinsey ist die Metapher für die dritte Phase des Kapitalismus, eine bedrohliche Phase, weil wir uns ihren Gesetzen in aller Freiwilligkeit und geradezu freudig unterwerfen. Kaum jemand würde die totale Ökonomisierung aller Lebensbereiche gutheißen. Aber fast jeder macht mit bei der Ökonomisierung, weil er denkt, es blieben noch Freiräume, Lebenswelten, die unberührt bleiben vom Effizienzdenken. Das ist das Trügerische. Sie schwinden von Tag zu Tag. Es gibt sie bald nicht mehr.
McKinsey & Company: Die Propheten der Effizienz
Als ich Wilhelm Rall kennen lernte, bei den Recherchen für das Zeit-Dossier, war er 49 Jahre alt. Ich traf ihn in Stuttgart, er war Director bei McKinsey. Er ist ein Mann von beeindruckender Präsenz, braun gebrannt, muskulös. Früher war er Fallschirmjäger bei der Bundeswehr. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. In seiner Freizeit klettert er ungesichert in Steilwänden oder fliegt mit Gleitschirmen. Allerdings hat er nicht viel Freizeit. Sechzig Stunden in der Woche gehören McKinsey. Rall hat eine ruhige, aber sehr nachdrückliche Art zu reden. Er war der Interviewte, ich der Interviewer, aber irgendwann stellte er die Fragen. Präzise, forschende Fragen, die einem rasch das Gefühl geben können, das falsche Leben zu leben, den falschen Beruf zu haben, mehr Sport treiben und mehr riskieren zu müssen, ein bisschen so zu werden wie Wilhelm Rall, der das Leben als sportliche Herausforderung nimmt. «Das Gefühl, eigene Grenzen zu verschieben, ist durchaus faszinierend», sagte Rall. Er lächelte sportiv. Er lächelte oft, ein wissendes, herausforderndes Lächeln.
Als ich George Kerschbaumer kennen lernte, war er 27 Jahre alt. Er war Berater bei McKinsey und pendelte gerade zwischen Stuttgart und München. Kerschbaumer ist nicht so muskulös wie Rall, eher drahtig. Sein Sport ist Tennis. Er sagte nicht direkt, dass er ein exzellenter Spieler sei, aber er gab mit großer Behaglichkeit Hinweise, die unbedingt diesen Eindruck vermittelten. Er hatte in London studiert und in Bologna, seine Promotion hatte er in Wien gemacht. Er hatte eine lässige Art, das zu erzählen, als sei ein solcher Lebenslauf eine Selbstverständlichkeit. In den Semesterferien hat er als freier Mitarbeiter von McKinsey Unternehmen saniert. Bei unserem Gespräch trug er einen dunklen Anzug, eine Krawatte und eine Brille. Auf meine Frage, ob er ehrgeizig sei, sagte er, das Wort klinge ihm zu negativ. Er suchte nach einem anderen Wort, und nach ein paar Sekunden fiel ihm «zielstrebig» ein. Ja, sagte er, so könne man es sagen: Er sei zielstrebig. Mit dem Wort «Elite» hatte er keine Probleme. Er nickte: Klar, wer bei McKinsey lande, gehöre zu einer Elite.
Sein normaler Arbeitstag beginnt um 8.30 Uhr, endet um 21 Uhr. Es wird von ihm erwartet, jederzeit an jedem Ort in Deutschland arbeiten zu können. Er lebt viel in Hotels, ist manchmal über Wochen von zu Hause fort. Morgens geht er in die Firma, die er berät, abends geht er ins Hotel und redet noch ein wenig mit den anderen Beratern von McKinsey, die in seinem Team sind, dann geht er schlafen. Er trinkt wenig Alkohol, isst gesund. Schon als junger Mann verdiente er sehr gut, weit über 100000 Mark.
Wie gesagt, damals war er 27, wirkte aber viel älter auf mich, abgeklärt, eine große Sicherheit ausstrahlend, dass er auf dem richtigen Weg sei. Genauso vermittelte er das Gefühl, dass er bereits Macht kennen gelernt hatte, Macht über andere, und er schien keine Zweifel zu haben, diese Macht zu Recht zu besitzen. Gleichzeitig wirkte er jünger als 27, weil seine Erfahrungen vor allem aus der Arbeitswelt kamen, weniger aus der Lebenswelt. Sein Leben bis dahin war ein Leben in Studierzimmern und Betrieben gewesen.
Im Sommer 2002 waren Rall und Kerschbaumer immer noch bei McKinsey & Company. Sie sind Mitinhaber der Firma und gehören zum engsten Führungskreis.
Leute wie Rall oder Kerschbaumer sucht McKinsey unter den Besten an den Universitäten. Man sucht nicht nur Ökonomen, sondern auch Physiker, Biologen, Soziologen, Mediziner. Sie werden zu Seminaren eingeladen, in schöne Städte oder auf ein luxuriöses Schiff; dort ist man sehr nett zu ihnen und fühlt ihnen gleichzeitig auf den Zahn. Es wird ein bestimmter Menschentypus gesucht. Er soll selbständig sein und stark. Er nimmt sein Schicksal in die eigenen Hände und deshalb will er, dass ihn der Staat weitgehend in Ruhe lässt. Er ist mobil, flexibel, wissbegierig. Er ist effizient, das heißt, seine Ziele versucht er mit minimalem Aufwand zu erreichen. So hat er ständig ein Augenmerk auf die Kosten. Risiken scheut er nicht, und er ist allezeit auf der Suche nach Innovationen. Wettbewerb, zumal weltweiter, ist für diesen Menschen eine Herausforderung, die ihn noch stärker macht. Wer so ist oder das Potenzial hat, so zu werden, bekommt eine Chance bei McKinsey. Unterschreibt man den Vertrag, wird weiter gefeilt an der Persönlichkeit, bis endgültig der McKinsey-Mensch herauskommt. Rall und Kerschbaumer sind Prototypen davon.
Es gibt kein Ausruhen für sie. Stillstand ist das Schlimmste bei McKinsey. Alle müssen immerzu in Bewegung sein, neue Ideen, neue Ideen, neue Ideen. Alle vier bis sechs Monate werden die Leistungen der Mitarbeiter in einem Zeugnis bewertet. Es herrscht Karrierezwang. Wer die nächste Stufe nicht schafft, fliegt. Up or out, aufwärts oder raus. Härter wird nirgendwo gesiebt. Wer durchkommt, hat ein Selbstbewusstsein, das fast jeder Herausforderung standhält.
Gegründet wurde McKinsey, genannt die «Firma», 1926 in Chicago von James Oscar McKinsey, einem Experten für das Rechnungswesen. Er beriet die Führungsspitzen großer Unternehmen in Wettbewerbsfragen so erfolgreich, dass seine Firma ständig wuchs, auch über seinen frühen Tod hinaus. Heute hat McKinsey in über 40 Ländern 87 Büros und beschäftigt mehr als 7500 Berater. Das erste deutsche Büro wurde 1964 in Düsseldorf gegründet. Heute arbeiten über tausend Berater von McKinsey in Deutschland. Die Zahl wuchs zuletzt jährlich um 10 bis 15 Prozent.
McKinsey-Menschen kommen nie allein. Sie kommen in Teams, zwei, drei Leute mindestens, je nach Größe des Auftrags. Irgendwann sind sie da, erscheinen morgens in ihren dunklen Anzügen oder dunklen Kostümen in dem Betrieb, den sie beraten sollen. Wenn es länger dauert, beziehen sie eigene Büros. Zunächst sagen sie nicht viel. Aber sie sind überall dabei, sie werden zu Schatten der Mitarbeiter. Wenn der Dienst beginnt, sind sie schon im Haus. Wenn Dienstschluss ist, bleiben sie noch eine Weile. Während der Dienststunden beobachten sie, wie die Leute ihre Arbeit machen. Sie gucken oft auf die Uhr, gute, teure Uhren, immer die exakte Zeit. Sie wollen wissen, wie lange ein Arbeitsvorgang dauert. Sie haben Clipboards dabei, machen Notizen. Dann stellen sie Fragen. Was machen Sie da? Warum machen Sie es? Warum machen Sie es so? Die McKinsey-Menschen wollen alles ganz genau wissen. Sie machen weitere Notizen. Man hört sie jetzt viel untereinander reden. Man versteht sie kaum. Sie haben eine eigene Sprache, Deutsch gemischt mit viel Englisch, dazu Wortunholde eines Ökonomensprech: Reengeneering. Top down bottom up. Ressourcen-Leverage. Produktportfolio. Outsourcing. Time-Compression-Management. Man kommt sich dumm vor in ihrer Gegenwart, weil man ihre Sprache nicht versteht. Aber sie sind freundlich, immerzu freundlich, gleichzeitig so selbstbewusst, dass es arrogant wirkt. Man hat bald das Gefühl, nicht flexibel, nicht mobil, nicht effizient, nicht leistungsfähig, nicht dynamisch zu sein. Denn sie sind das alles, sie strahlen eine Kraft aus, die einen bange werden lässt.
Ihre Fragen ändern sich allmählich. Warum machen Sie das so und nicht anders? Könnte man das nicht auch ganz anders machen? Sie geben einem das Gefühl, dass sie alles wissen, dass sie zu allem eine bessere Idee haben. Abends sieht man sie in ihren Büros vor Laptops sitzen.
Die McKinsey-Menschen sind Sucher. Sie suchen die Nischen, in denen sich jene verstecken, die wenig leisten können oder wollen. Sie suchen nach Umständlichkeiten und Zufällen im täglichen Betriebsablauf. Sie hassen Umständlichkeit, weil der direkte Weg der schnellste ist. Sie hassen Zufälle, weil etwas Nützliches oder etwas Unnützes dabei herauskommen kann. Sie wollen immer das Nützliche. Ihr Ideal ist Kontrolle, Steuerung, damit das Ergebnis jedes Handgriffs, jeder Besprechung immer gut ist für das Betriebsergebnis. Sie sind Nischenkehrer, Umständlichkeitsglätter, Zufallsvernichter.
Die Angst im Betrieb nimmt zu. Jeder weiß, dass es um Arbeitsplätze geht. Aber es ist nicht möglich, mit den McKinsey-Menschen darüber zu reden. Sie zucken die Achseln, sie lächeln. «Ihr Arbeitgeber wird Ihnen …», sagen sie, wenn man sie anspricht. Sie sind sehr freundlich. Sie halten sich raus. Irgendwann sind sie verschwunden, ihre Büros sind leer, die Laptops weg.