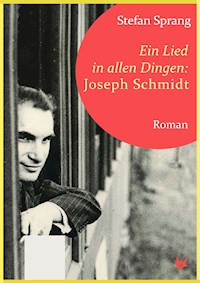Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Ist die wahre Liebe nicht stets die unerfüllte?" Zehn unterhaltsame Storys über die (Un-)Möglichkeiten der Paarfindung im 21. Jahrhundert. So schön kann das sein mit der Liebe, wenn es "Klick" macht. Aber heutzutage, da wird es danach schnell kompliziert. Denn ist SIE, ist ER wirklich Traumprinzessin/Traumprinz und ein Mensch fürs Leben? "Kriegt wer wen? – Vom Ende im Anfang der Liebe" versammelt rund um dieses Thema 10 Storys zu einer Art Episoden-Roman. Alle Geschichten haben eine Pointe – und eine Verbindung: Figuren, die hier als Nebenfigur auftauchen, spielen dort die Hauptrolle. Alles beginnt, als ein Ich-Erzähler sich in die Austauschschülerin aus Kanada verknallt. Schade nur, dass er nicht auf Händen laufen kann. Später begegnen sich Jens aus Deutschland und Claudine mit den französisch-georgischen Wurzeln in Wien. Sie leben ihre Liebe intensiv, aber auf Distanz. Näher dran ist der Philosoph, der ein Date hat mit einer Köchin und allein erziehenden Mutter. Sie bringt ihm das Zwiebelschneiden bei - dafür stellt er am Ende leider eine "dumme" Frage. Mit viel Einfühlungsvermögen und Sprachkunst wechselt Stefan Sprang den Sound und Erzählblick der revueartig vorbeiziehenden Episoden: Einige sind melancholisch oder tragisch-komisch, andere schweben mit der Leichtigkeit des heiter ironischen Seins vorüber - nicht ohne einen Hauch Wehmut zu hinterlassen. Inhalt PROLOG: Als Kanada zu uns kommt Frankfurt – Wien – Frankfurt Wenn das Licht angeht Junge trifft Mädchen Mili Salatbar An-ni-ka, An-ni-ka Das blaue Wunder Flughafen, Ankunft EPILOG: Hanna im Glück Bonustrack 1: An der Straße der Au-Pair-Mädchen Bonustrack 2: Exponat 145
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 216
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan Sprang
„Kriegt wer wen?“ – Vom Ende im Anfang der Liebe
10 Storys plus Bonustracks
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
PROLOG: Als Kanada zu uns kommt …
Frankfurt – Wien - Frankfurt
Wenn das Licht angeht
Junge trifft Mädchen
Mili
Salatbar
An-ni-ka, An-ni-ka
Das blaue Wunder
Flughafen, Ankunft
EPILOG: Hanna im Glück
Bonustrack 1: An der Straße der Au-Pair-Mädchen
Bonustrack 2: Exponat 145
Impressum neobooks
PROLOG: Als Kanada zu uns kommt …
… verwandelt sich alles. Vor allem meine Zukunft.
„Kanada“ steht in der Mitte der Pausenhalle. Sie könnte Einssechzig groß sein, aber auch kleiner. Ihre Strahlkraft mindert das nicht. Sie ist ein Leuchtturm inmitten der Wogen. Ich weiß noch nicht, dass sie Brandi heißt, aus Toronto kommt, Austauschschülerin ist. Sie steht dort, namenlos und regungslos, ein heimliches Zentrum in einem Wirbel aus Schülern. Die rennen herum, stoßen aneinander, werden auf neuen Kollisionskurs geschleudert, halten kurz inne mit dem instinktiven Willen, sich weiter treiben zu lassen – der Stillstand wird folgen.
Vor dem Schwarzen Brett drängen sich jene, die noch nicht ihre neuen Stundenpläne abgeschrieben haben; vorsätzlich fallen gelassenes Papier von Schokoriegeln segelt auf glänzend gebohnerte Fliesen, die das Stimmengewirr vervielfachen.
Das Bild habe ich niemals vergessen. Es ist, wie ein Dichter es einst beschrieben hat: Man wird es noch finden können, wenn ich gestorben bin. Man könnte mich obduzieren und nachschauen, da wäre es: im Hirn und im Herzen, vielleicht wären die Farben ausgebleicht. Aber es wäre da.
Brandi ist sechzehn. Schwarzes Haar fällt auf schmale Schultern, ein Pony schwebt dichten Augenbrauen entgegen. Ihre Augen aber sind blau, so leuchtend wie die roten Klammern, die ihre Frisur in Strähnen bändigen. Die Arme hat sie vor der Brust verschränkt. Diese Geste habe ich später immer wieder bei Frauen beobachtet: Wenn sie Schutz suchen, weil die Welt ihnen mal wieder oder schon seit langem nicht geneigt genug erscheint. Oder wenn sie dies behaupten wollen. Oft klemmen sie dazu die Säume ihrer stets zu langen Ärmel in die Hand. Nicht Brandis Art. Stattdessen umklammert sie vor einer dunkelgrünen Strickjacke mit zu langen Ärmeln eine Mappe, ein Element mehr in jenem Bollwerk, das sie in diesem Moment sein möchte. Ich sehe, wie sie die fremde Luft einsaugt und mit unauffälligen Blicken die unbekannten Jungen und Mädchen beobachtet.
Ich habe sie noch nie gesehen, sie muss also eine neue Schülerin sein. Denkt sie, dass dies der erste Tag einer neuen abenteuerlichen Zukunft ist, der sie eigentlich mit offenen Armen begegnen sollte? Ich kann mich nicht entscheiden: Sieht sie „nett“ aus? Darin liegt kein Geheimnis. Ist sie „süß“? Das wäre herablassend. Oder „hübsch“? Das wäre zu wenig. Es ist etwas, für das ich noch kein Adjektiv habe. Auch ich stehe nun reglos, sie ist ein Pol, ich bin der andere, spiegele ihre Haltung und blicke sie geradeheraus an. Es ist ein Versprechen, in dem ich mich verliere für die kommenden Wochen. Dann ist Brandi verschwunden. Und ich stehe dort immer noch und merke erst jetzt, wie still es geworden ist. Die Stunde hat begonnen.
Was ich damals vor dreißig Jahren nicht bedacht habe: Ich war nicht der einzige, dem Brandi aufgefallen ist. Alexander, der Adlige; Jens, der Athletische; Marcus, der Rebellische; Sascha, der Schönäugige – sie alle wurden im Schatten ihrer Phantasien zu Insekten; ihre Facettenaugen: verwirrt von Brandis kanadischen Lichtstrahlen. Reiner waren die als der Glanz einer perfekten Vollmondnacht. Sie alle lenkte ein archaischer Autopilot auf die Quelle zu in spiralförmigen Bahnen. Vergessen wurden: Birgit, die Ponyhofprinzessin; Jutta, die rote Zora; Katharina, das Rapunzelchen; Ulli, das Tittenwunder; neben all denen, die nicht einmal für würdig befunden waren, vergessen zu werden.
Ich komme zu spät in den Klassenraum. Noch nie ist der „Nachrichtensprecher“ zu spät gekommen. Seit einiger Zeit weiß ich, dass sie mich den „Nachrichtensprecher“ nennen. Immer bin ich pünktlich, ich rede überdeutlich und korrekt, es stimmt, was ich sage. Wenn ich etwas sage. Ein Kompliment war es nicht.
Heute bin ich tatsächlich Nachrichtensprecher. Aber niemand sieht mich bei der Arbeit, denn ich spreche nur im Radio. Es ist ein Lokalsender. Mein Publikum ist überschaubar, aber stets bin ich konzentriert und souverän – ich stelle mir vor, dass ich zur ganzen Nation sprechen darf.
Ich habe damals nicht daran gedacht, dass der Platz rechts von mir noch frei ist, der Stuhl in der ersten Reihe neben dem Eingang. Brandi. Schon von der Tür aus kann ich ihn fühlen, den wolkenlosen Himmel unter einer Sonne, die blühende Bäume und Blumen kitzelt. Ihr Parfum, frischester Frühling an einem durchschnittlichen Spätsommertag. Ich aber werde katapultiert in einen nordischen Dezember, nackt und hilflos stehe ich im Schnee: Kann man sehen, dass ich bibbere? Hört man das Herzklopfen? Die Tische zittern. Stühle wackeln. Die Fensterscheiben halten es nicht auf. Die Schallwellen gehen über den Schulhof hinaus und immer weiter …
Am Ende der Stunde spricht sie mich an. Ihr Akzent, minimal: „Hi, du warst ja noch nicht da. Ich bin Brandi aus Toronto in Kanada.“
Tief hole ich Luft und verkünde meine Nachricht: „Dort steht das höchste Gebäude der Welt.“
Sie schweigt, runzelt die Stirn.
„Der Fernsehturm, über fünfhundertfünfzig Meter.“
„Oh, das wusste ich noch nicht. Great.“
Dann steht sie auf, klemmt ihre Mappe unter den Arm und geht und nimmt den wolkenlosen Himmel mit und weiß nicht einmal, wer ich eigentlich bin und hat auch nicht gefragt, wer es ist, der alle Zeit der Welt unter diesem Himmel verbringen will.
Ab sofort übe ich mich darin, die Stunden neben Brandi zu verbringen ohne tosenden Puls. Dafür mit klarem Kopf, denn ich brauche einen Plan, mit dem ich mehr erschaffen kann als das höchste Gebäude der Welt.
Am Beginn eines Tages lächelt sie mich manchmal an, einen Moment zu lang, mit unbewegten Augen: „Hi, wie geht’s dir?“
Es ist jene geradlinig übersetzte Floskel, auf die man antworten muss: „Fein, danke!“
Was nicht stimmt, denn ich weiß, dass ich etwas tun muss. Und ich weiß ebenso, dass ich immer noch keinen Plan habe.
Wenn Brandi sich langweilt, zeichnet sie auf ihren Block schnell mustergültige Kopien, Szenen aus den „Peanuts“: Charlie Brown, sein Drachen, wie er unter einem wolkenlosen Himmel landet im Drachenfresser-Baum. Ich schreibe „Super!“ auf den Rand meines Heftes und schiebe es in ihre Richtung. Brandi liest, schaut auf – und dieses Mal lächeln auch ihre Augen. Aber ich, ich kann nicht zeichnen, kann nicht Gitarre spielen wie Sascha, der Schönäugige, bin nicht sehnig und kräftig wie Jens, der Athletische.
Geduldig warte ich auf den Tag, an dem wir unseren Klassenausflug machen, nach Trier.
Die Wetteraussichten: Die Bewölkung nimmt zu. Am Nachmittag Schauer bei zehn bis fünfzehn Grad. Der Wind kommt aus Ost bis Nordost und ist überwiegend mäßig. Weitere Aussichten: überwiegend stark bewölkt und kühler.
„Kanada“ sitzt in der rechten Reihe vor mir am Fenster, neben Alexander, dem Adligen. Neben mir Ulli, das Tittenwunder. Die hat ihre Haare zu einem blonden Kranz geflochten; ein Bauernmädchen, auf den Wangen ein Rot wie aus einem ganzen Korb Erdbeeren. Das Holz vor ihrer Hütte, es reichte für mehr als einen Winter. Aber ich träume von anderen Jahreszeiten. Ich beuge mich vor und sehe zwischen den Sitzen hindurch: Alexanders Profil. Lange Buckel-Nase, verschlafener Blick. Er ist der junge Mann auf dem Zehn-Mark-Schein. Seine blonden Locken trägt er allerdings deutlich kürzer. Niemals geht er ohne sein dunkelblaues Sportsakko aus dem Haus. Seine Stimmung erkennt man daran, ob er den obersten Knopf seines weißen Hemdes geschlossen hat oder nicht. Alexander, der Adlige, hat den Knopf offen gelassen. Er redet auf Brandi ein, in perfektem Englisch. Er hat Verwandte in Yorkshire.
Der einzige Satz, der mir in diesem Moment einfällt: „When the sun set in the east, King George was killed by an arrow in his eye.“
Was ich könnte: den Anfang der „Odyssee“ im Original zitieren, über den Helden, den Listenreichen, dem vieles geschah, nachdem Troja fiel. Hat man in Kanada Altgriechisch auf dem Stundenplan? Worüber würde ich mit Brandi sprechen? Was hält sie von den amerikanischen Raketen, die bei uns aufgestellt werden sollen?
Vielleicht will sie allein bleiben unter ihrem wolkenlosen Himmel, denn sie antwortet Alexander, dem Adligen, kaum – und sagt nach ein paar Minuten mit pädagogischer Ernsthaftigkeit: „Bitte rede Deutsch mit mir. Ich bin ja hier, um es zu lernen …“
Dann schaut sie aus dem Busfenster, so wie ich es tu. Ulli, das Tittenwunder, liest ein Buch. Es ist von einem französischen Autor, den ich auch mag, denn er schreibt über das Absurde.
Vor mir in diffusem Schnelldurchlauf: die Tankstelle mit der gelben Muschel und dem roten Schriftzug; auf einem Rastplatz Sattelschlepper mit schmutzigen Planen, von weither gekommen, noch lange werden sie unterwegs sein; jetzt wieder das flirrende Grün der Wälder, ein blaues Schild, das ich gerade noch entziffern kann: „Trier – 100 km“. Sehen wir dasselbe, frage ich mich und schließe die Augen – ein Frühling, warm wie ein Sommer, aber voller Blüten, die nie verwelken und Gras, das nie gemäht werden muss.
Der Besuch an der „Porta Nigra“ ist der Höhepunkt unseres Rundgangs. Der Wetterbericht war korrekt. Herr Kluthmann, der Geschichtslehrer, kann den Regen ignorieren: Er trägt ein Toupet.
Wie ein Shakespeare-Darsteller beginnt er zu zitieren: „Sie nannten es Marstor, nach Mars, den sie als Gott des Krieges ansahen. Wenn sie auszogen zum Krieg, marschierten sie zu diesem Tor hinaus. Schwarzes Tor aber wurde es genannt wegen der Trauer, mit der sie, wenn sie vom Felde flohen, durch es zurückkehrten.“
Niemals will ich zu einem „Schwarzen Tor“ zurückkehren. Einen heiligen Eid lege ich ab – und lasse mich langsam und unauffällig zurückfallen.
Brandi geht weit hinten. Sascha, der Schönäugige, ist bei ihr und Jens, der Athletische. Marcus, der Rebellische, hat die Daumen in den Gürtellaschen seiner Blue Jeans, er spreizt Federn, die er nicht besitzt, er drückt seine Brust heraus. Er erzählt seinen Witz von der schwangeren Nonne mit den Kerzen.
Meiner ginge so: “Was hatten die alten Römer uns voraus? … Sie brauchten kein Latein zu lernen.”
Aber Brandi ist schneller, hat kaum gelacht, aber die Hand gehoben. „Kennt ihr die Unterschied zwischen eine Jungfrau bei ihre erste Mal und Jesus …“ – sie spricht es „Tschisäss“ aus – „… am Kreuz? Das ist die Gesicht beim Nageln.“
Aus den Augenwinkeln sehe ich ein endloses Grinsen auf ihrem makellosen Mund. Dann boxt sie Markus, den Rebellischen, in die Seite und geht zu Jutta, der roten Zora. Sie tuscheln und ich beschließe, ein Held zu werden.
Am nächsten Tag sitze ich da und starre auf das weiße Blatt Papier auf meinem Schreibpult aus Plastik, grün und orange ist es und voller Bruchstellen. Es steht auf meinem Schreibtisch, seit ich Schüler bin. Aus der Schublade hole ich jenen Füller, den ich nur zu besonderen Gelegenheiten benutze, denn man muss ihn mit Tinte aus einem Glas befüllen. Ich erinnere mich an den Heimweg durch die Seitenstraße, die auf das Haus zuführt, in dem wir wohnen. Am Anfang steht ein alter Baum. Die Mauer, sie gehört zum Parkplatz dahinter, hat man um ihn herum gebaut. Einmal bin ich so hoch gesprungen wie ich konnte und habe nach jenem Ast gegriffen, der weit herunterhing über den Gehweg:
Ahornzweig
Geborgt im eiligen Sprung
Jetzt wartend
Verwelkt
Die Zeichen haben getrogen
Es ereignet sich nicht
Was erwartet wird
Es ändert sich kaum
Was umgibt
Denn die Bilder liegen seit je
In meinem Kopf
Die Bilder aufgehäuft
Eine Flamme dazwischen
Bald Rauch, bald Asche
Ein leerer Briefkasten
Warum findet man nicht
Ein Ahornblatt in ihm:
Darf auch spröde sein …
Am nächsten Tag schleiche ich mich vor der Zeit in die Klasse. Ich bin Agent, ich habe eine Mission. Nicht die Welt will ich retten, sondern mich und meine Zukunft. Ein Stuhl, Brandis Stuhl, ist mein toter Briefkasten. Ich lege das gefaltete Blatt so, dass die eine Hälfte zwischen Sitz und Gestell klemmt. Es darf nicht verloren gehen.
Vielleicht hätte es eine Chance gegeben.
Es ist zu kühl für die Jahreszeit, Regenwolken hängen über den Hügeln, dem glatt lackierten See, dem Boothaus mit dem grünen Symbol unserer Schule auf dem Giebel. Wir haben eine Grillparty organisiert zu Brandis Abschied.
Aus dem Aufenthaltsraum blicke ich ins Zwielicht: Es hat zu regnen begonnen. Ein Regen geht nieder, der alles trifft, nur nicht dieses Paar. Seine ulkigen Gesten sind es, die die Tropfen abwehren. Jens ist der Clown, der stutzt, der staunt und aus dem Schauer Sternenstaub macht.
Gemessene Zeit für „Im-Regen-Stehen“: zweiundzwanzig Minuten.
Der Sportunterricht hat alles verändert. Insbesondere meine Zukunft. Brandi hat einen engen blauen Dress an, ein weißes Gummi schnürt ihre Haare zum wippenden Pferdeschwanz. Basketball steht auf dem Plan. Es ist Brandis Stunde. Sie beherrscht den Ball, umdribbelt alle schnell und geschmeidig, eine Katze mit dem Auge eines Adlers, wenn sie aus großer Entfernung auf den Korb wirft. Sie verfehlt ihn selten. Ich werfe nie. Unser Team gewinnt dennoch haushoch. Nach dem Schlusspfiff steht sie am Anwurfpunkt, allein, die Hände auf die Schenkel gestützt, und ringt nach Luft.
Ich sitze auf der Bank, schnüre meine Turnschuhe auf und mache wieder eine Schleife, die ich umständlich löse. Auch Jens ist geblieben. „Schau mal“, ruft er.
Dann kippt er in den Handstand und beginnt auf Händen zu laufen, quer durch die Halle, an Brandi vorbei, die sich einen Schweißtropfen von der Nase wischt. Er läuft hin und läuft wieder her und noch einmal quer. Als er wieder auf den Beinen landet und ihr zuwinkt, da beginnt sie zu lachen: lacht und lacht, so laut und herrlich, wie sie in all den Monaten noch nie gelacht hat, mit den so weißen gerichteten Zähnen …
Jens wird sie vom Bootshaus auf seiner brandneuen 80er-Enduro mitnehmen. Er hat einen zweiten Helm dabei.
Von irgendwoher höre ich einen Raubvogel rufen. Es ist ein Habicht, der gickert. Ich habe diesen Ruf nie vergessen. Träumt man von einem Habicht, habe ich später einmal gelesen, hat man kein Glück in der Lotterie. Ich spüre eine Hand auf meiner Schulter. Jemand steht hinter mir und schaut ebenfalls aus dem Fenster.
„Ist doch eh bald vorbei“, sagt Sascha, der Schönäugige. Er hat sie schon vor Wochen in der Stadt gesehen. Händchen haltend kamen sie aus dem Kino.
„Unsere Sportskanone will in den Ferien nach Toronto fliegen. Was soll das bringen? Vergiss Kanada … Übrigens, Nachrichtensprecher, kostenloser Tipp: du solltest etwas aufmerksamer sein, da gibt es …“
Aber ich drehe mich nur weg und gehe hinaus in den Bootskeller, wo es nach Holz riecht und Schmierfett. Das Tor ist offen: draußen stehen die beiden genau im Fluchtpunkt unter einem faltenlosen Nachthimmel, aus dem Mondschein rieselt wie Grillasche. Wieder höre ich diesen Vogel rufen. Was er mir prophezeit?
Dass ich es nie lernen werde, auf Händen zu laufen.
Frankfurt – Wien - Frankfurt
Sie hatten ein glückliches Leben, sie haben es noch. In immer neuen Anläufen fanden die alten Damen hinter ihm Erinnerungen, die das beglaubigen; getrocknete Blumen, aufbewahrt in einem dicken Buch. Für vier Tage waren sie in Wien gewesen: um über die Weihnachtsmärkte zu spazieren, Punsch zu trinken und die Sängerknaben zu hören.
„Am Karlsplatz war es besonders schön.“
„Oh ja, das Gehege mit dem drolligen Wollschwein, das hätte auch unserer Jenni gefallen.“
„Ach, wie all die Kinder sich gefreut haben. Und der Sternentanz mit den Kleinen. So süß waren die verkleidet.“
„Aber am Belvedere, da war es auch sehr stimmungsvoll. Das musst du zugeben.“
„Schade, dass es schon vorbei ist.“
„Nächstes Jahr fahren wir wieder.“
Er sah sich um im Großraumabteil, ausgeleuchtet von hartem Licht aus den Röhren unter der Gepäckablage, blickte sich an in der Scheibe schräg gegenüber, beobachtete sich wiederum in einer bleichen Großaufnahme, die direkt neben ihm auftauchte. Auf seinem Fensterplatz in der Sitzgruppe in der Wagenmitte war er eingekreist von Doppelgängern. Er spielte mit ihnen, schnitt seinen Gegenstücken Gesichter, die sofort reagierten.
Seit er ein Kind war, liebte Jens es, im Zug durch die Nacht zu fahren auf endlosen Gleisen.
Sein Zimmer war groß genug gewesen, um an der Wand neben der Tür eine tischgroße Holzplatte aufzustellen mit einer H0-Eisenbahn. Das Doppeloval mit den Gleisen war eigentlich langweilig. Nur auf der äußeren Runde konnte ein Zug einigermaßen beschleunigen. Die Innenfläche war mit einer kleinen Siedlung bebaut. Auf der einen Seite gab es einen verfallenen Güterbahnhof, auf der anderen Seite den Hauptbahnhof „Steinheim“ mit seinen leuchtend roten Ziegeldächern. Eine Durchgangsstraße, ein Marktplatz mit zwei Fachwerkhäusern, am Ortsausgang zwei moderne Zweifamilienhäuser. Alle Gebäude waren illuminiert mit kleinen Birnchen, auf dem Marktplatz stand winters ein Christbaum mit gelben Leuchtdioden. Manchmal ließ er bei strahlendem Sonnenschein das Rollo herunter und ging auf große Fahrt. Langsam ließ er den „Trans Europa Express“ anrollen, neben sich auf einem Teewagen das Kursbuch, das sein Vater aufgetrieben hatte, und die Zugführer-Ausrüstung. Immer wieder neue Bahnhöfe fuhr Jens an, kreuz und quer durch Europa. Mal von Amsterdam nach Basel, mal von Hamburg nach Rom – auf dieser Strecke spannte er einen blauen Schlafwagen hinter die beige-rot lackierte Schnellzug-Lok, in der er saß, und fuhr und fuhr.
Der Druck in den Ohren bei einer Tunneldurchfahrt, das Kitzeln in den Gehörgängen, er berauschte sich jedes Mal am Stroboskop-Effekt der Tunnelbeleuchtung. Claudine fuhr nicht gern durch Tunnel. Tunnel und Brücken machten ihr Angst. Das Fliegen liebte sie. Er jedoch hatte Flugangst.
Drei Jahre lang war er regelmäßig nach Wien gefahren. Er konnte bei einer Freundin übernachten, die in der Nähe vom Augarten wohnte. Christina hatte er in Hamburg kennengelernt. Sie war damals mit einem seiner Studienfreunde zusammen. Die beiden waren längst getrennt. Jens war mit Christina in Kontakt geblieben.
In Wien hatte er sich verliebt. Auf den ersten Blick, mit einem spöttischen Lächeln, aber freimütig glänzenden Augen. Diese Beschwörung imperialer Erhabenheit; wie viel Kitsch, per Sandstrahl aus den Sedimenten von Jahrhunderten herausgelöst; dieses steinerne Bühnenbild, wie albern war das, verrückt, ja, und genial anders als die Stadt aus der er kam – die war zusammengeflickt aus Kriegstrümmern mit hässlichen Lückenfüllern. Wien, so anders, so schizophren. Zwischen den protzigen Kulissen das ganze lässige Leben, selbstbewusstes 21. Jahrhundert, die jungen Leute, die – wie hieß das noch – vielen „Frauenzimmer“, so „fesch“ und charming mit ihrem Schmäh und den Stimmen, die irgendwie eine Spur tiefer klangen und wärmer.
Wenn er durch die Straßen flanierte, schaute er wahlweise den Frauenzimmern nach und an den Fassaden hoch. Ihn beeindruckte die Leistung der Architekten, die all das mit Stift und Papier bewerkstelligt hatten – das nennt man Tragwerke für die Ewigkeit.
Jens war Prüfingenieur für Baustatik, Fachrichtung: Steinbeton, Stahlbeton, Holzbau. Mit seinem Freund Wolfgang hatte er ein eigenes Büro gegründet. Sie wollten unabhängig sein und hatten Großes vor. Zunächst berechneten sie vor allem Standsicherheitsnachweise in der Bauklasse I: Einfamilienhäuser, die hochgezogen wurden auf geschleiften Militärsiedlungen, aufgelassenen Äckern am Stadtrand und Industriebrachen. Häuser, die aussahen wie aus dem Modellbahn-Baukasten, aber für ihre Bewohner Paläste waren. Traumschlösser, die sie vor langer Zeit für sich in Gedanken entworfen hatten und für ihre Partner und die Kinder, den Golden Retriever und den Bonsai-Baum: Junischnee auf der Fensterbank.
Wolfgang und er rechneten nach, ob die Architekten an ein stabiles Gleichgewicht gedacht hatten, ob sich alles tragen würde und den Lasten standhalten.
„Nur Wolkenkuckucksheime brauchen keine Statiker“, hatte Wolfgang einmal gesagt, als nichts mehr zu tun war und sie an einem Nachmittag einfach losgezogen waren, um ein Bier zu trinken.
„Ist was dran. Trotzdem schön für unser Konto, dass es so viele Bausparermetastasen gibt“.
„Weißt du, was das Verrückte dabei ist?“ Wolfgang grinste.
„Nein, und ich ahne es nicht mal.“
„Wir wissen, wie die Verhältnisse sein müssen, damit alles steht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag …“
„Das ist unser Job.“
„Aber darum wissen wir auch ganz genau, wo man das Dynamit anbringen muss, damit alles mit minimalem Aufwand fein säuberlich in sich zusammenklappt.“
„Du meinst ratzeputz weg?“
„Staub zu Staub.“
Jens wusste damals nicht, ob Claudine es ernst gemeint hatte, ob sie mit jener Arglosigkeit sprach, die Teil ihres Charakters war. Oder ob sie ihn hochnahm mit jener Ironie, die auch in dieser Frau wohnte als ebenbürtige Nachbarin der Naivität. Er war verliebt in das eine wie das andere.
„Monsieur Statique …“, fing sie an und machte weiter in Deutsch mit einem grazilen Akzent, „… bau uns ein Haus. Ein langes niedriges Haus, mit bauchigen Wänden und runden Fenstern und vielen Zimmern und viel Platz für alle Dinge, die man ansammeln kann, auch wenn man sie nicht braucht, ein Haus mit einem Strohdach, das nicht wackelt. Bau uns ein Hobbithaus.“
Er war Claudine im Leopold-Café im Museumsquartier begegnet. Am Vormittag hatte er sich eine Ausstellung mit Bildern amerikanischer Fotografen angeschaut. Im Café wollte er etwas essen, etwas Schweres. Er hatte Hunger, er wollte ein großes Bier trinken, um dann wieder allein durch die Stadt zu streifen. Er fand einen Platz auf der verglasten Brücke. Claudine saß schräg gegenüber auf einer Bank. Sie trug ein verwaschenes T-Shirt, bauchfrei mit einem roten Stern auf der Brust. Claudine hatte sich breit gemacht an dem Vierertisch, als wäre sie dort zuhause. Bücher, ein Block, zwei Magazine lagen auf dem Tisch, Geschirr von einem großen späten Frühstück war fahrlässig gestapelt. Vor ihr stand ein halbvolles Glas Wein. Sie hockte auf der Bank, ein Bein untergeschlagen, und beugte sich über ein Buch. Auf der abgewandten Seite fielen ihre dunklen Locken über die Schultern, auf der ihm zugewandten Seite hatte sie das Haar nach hinten gestrichen. Ihr Halbprofil lag im Schein der Nachmittagssonne, die sich langsam, aber sicher auf den kommenden Winter einrichtete.
Er schaute sie an. Immer wieder und jedesmal länger. Sie hatte es bemerkt. Sie sah auf, legte den Kopf schräg und schaute von unten zu ihm herüber: Das ist ein Blick wie aus Fernost, wer will dem widerstehen – ein Blick aus Fernost, so anders.
Ihr Vater war Georgier, erfuhr er später, die Mutter Französin. Schmale Augen unter hochgezogenen Brauen funkelten ihn an. Das sind die schwärzesten Augen der Welt. Aber zittern nicht ihre Wimpern? Könnte sie ärgerlich sein? Dafür sollte sie keinen Grund haben.
Was starrst du so? Ihr Blick, eine Frage. Er sah die Sehnen und Muskeln an ihrem schlanken Hals hervortreten. Aber ihr gespitzter tiefroter Mund stellte wortlos fest: Ich interessiere dich also.
Plötzlich eingeschüchtert, aber entschlossen zeigte er auf das Buch, machte eine interessierte Handbewegung.
Sie hob das Buch hoch, hielt es ihm mit ausgestreckten Armen entgegen: Der kleine Hobbit in einer Originalausgabe. Über das Buch hinweg fixierte sie ihn frech, aber mit leiser Ironie. Er lächelte und nickte stumm.
Tolkien also, ist das nicht ein Kinderbuch?
Es war Claudines Lieblingsbuch. Dann zog er eine schwarzweiße Postkarte, die er im Museumsshop gekauft hatte, aus der Jackentasche und schrieb: Im Nordwesten der Alten Welt, östlich des Meeres.
Kühn und kämpferisch stand er auf, ging drei Schritte und legte die Karte mit einer tiefen Verbeugung vor sie hin, ein gewissenhafter Diener in einem alten Film. Oder ein Ritter, der das alles entscheidende Turnier gewonnen hat.
Er rechnete mit nichts. Oder einer bösen Bescherung. Einem Platzverweis. Sie las, lachte, winkte ihn mit zwei Fingern heran. Er nahm sein Bierglas und setzte sich ihr gegenüber.
Claudine jobbte in der UNO-City.
„Wusstest du, dass die Gebäude dort so gebaut sind, dass sie sich nicht gegenseitig in den Schatten stellen?“, hatte er sie gefragt.
„Klar, ich muss es ja den Touristen erklären und allen, die es sonst noch wissen wollen.“
Claudine war einunddreißig, sie machte Führungen im Vienna International Centre, informierte über die Arbeit der Vereinten Nationen und die Aufgaben der in Wien tätigen Organisationen. Sie hätte dort auch als Dolmetscherin arbeiten können.
„Wenn, dann am liebsten beim Flüchtlingskommissariat. Oder bei denen mit den Weltraumfragen.“ Aber sie wollte sich nicht festlegen, noch nicht, nicht so. „Ich will Alltag ohne Alltäglichkeit. Nichts Einförmiges, so wie bei mir zu Hause. Meine Eltern sind Lehrer. Sie sind gerecht, aber geordnet. Wenn du weißt … Jedes Jahr sind wir für drei Wochen in ein kleines Haus gefahren im Süden … Jedenfalls, ich will, dass sich was verändern kann … Ich will was sehen von der Welt. Konkret, aber auch in einem übertragenen Sinne, wenn du weißt … mein Leben soll anders sein …“
Er wusste. Jeden Sonntag hatte es bei ihm daheim um dreizehn Uhr das Essen gegeben. Pünktlich zu den Nachrichten hatte Vater das Radio eingeschaltet, danach kam eine Sendung, in der bedeutende Menschen aus ihrem Leben erzählten und klassische Musik einspielen ließen, die ihnen gefiel oder etwas Besonderes aussagte. Nach dem Nachtisch spülte Mutter das Geschirr, Vater machte einen Mittagsschlaf. Lokomotivführer Jens ging dann in sein Zimmer, zog den alten Drehstuhl an die Eisenbahnplatte. Der „Trans Europa Express“ wartete am Bahnsteig. Als er älter wurde und stärker, ging er bei Wind und Wetter hinaus, um zu joggen, mit einem Ball Kunststücke zu vollführen oder auf Händen zu laufen in der Garageneinfahrt.
„… Ich bin noch jung, weißt du.“
Claudine kam aus Straßburg, sie hatte Politik, Anglistik und Germanistik studiert. Sie sprach vier Sprachen verhandlungssicher und ein wenig Georgisch. Sprachen faszinierten auch ihn. Er beherrschte Englisch fließend, hatte es im Rekordtempo perfektioniert, als Brandi aus Toronto eines Tages in der Pausenhalle seiner Schule aufgetaucht war.
Für Jorid hatte er begonnen, Schwedisch zu lernen. „Ich liebe Dich ….“ – „Jag älska Dig“. „Gifta sig“ – „Heiraten“.
Er hatte sie auf einer Silvesterparty in Luxemburg kennengelernt. Eine Schulfreundin hatte ihn eingeladen, die dort bei einer Bank arbeitete. Jorid machte ein Praktikum in der Personalabteilung. In Stockholm auf der Brücke, unter der das süße Wasser schäumend und sprudelnd vom Mälarsee in die salzige Ostsee floss, unter einem Reiseprospekt-Himmel, hatten sie sich das erste Mal geküsst: „Jag älska Dig.“
Sie sahen sich alle drei Wochen. Sie telefonierten jeden Abend, sie mailten jeden Mittag. Sie brauchten keine geprüfte Standsicherheit durch erfolgreiche Fernsehabende auf der Couch und stressfreien Hausputz. Jens kannte sich aus. „Stress analyst“, die englische Bezeichnung für Statiker. Nach einem halben Jahr trennten sie sich. Irgendwie schade, aber es war alles auch etwas anstrengend gewesen, Vorwürfe machen musste man sich jetzt ja nicht, es war wunderbar anders gewesen als bei so vielen Pärchen.
„If I can't love you tonight, maybe tomorrow …” Jorid hatte ihm kommentarlos das mp3 gemailt. Eine Live-Version von Willy DeVille, heimlich von ihr aufgenommen. Jens gefiel besonders das Saxophonsolo.