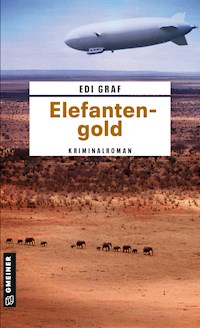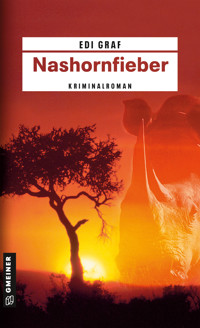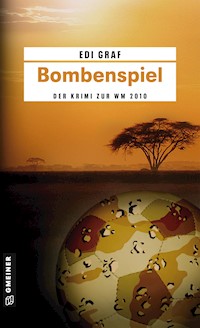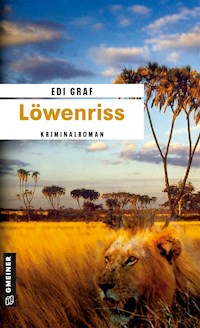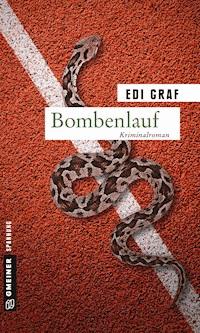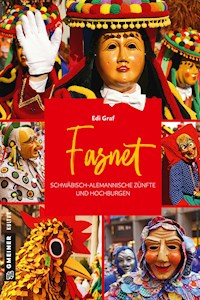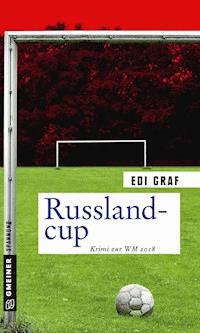Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Privatdetektiv Rainer Tsuval
- Sprache: Deutsch
Tatort Konzertbühne Ein Giftpfeil beendet die Karriere des erfolgreichen Posaunisten Langfried Schieber. Na ja, einer weniger, mag mancher denken, doch die massige Sängerin Constanze Voorte-Sing will es genau wissen und setzt den berühmten Kommissar Rainer Tsuval auf den Täter an. Bei seinen Ermittlungen stößt er auf Zyanid im Posaunenmundstück, und bald geschehen weitere merkwürdige Morde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edi Graf
Kriminalpolka
Kriminalroman
Impressum
Handlung und Namen sind frei erfunden. Jede zufällige Ähnlichkeit mit blasenden, singenden und schlagenden Personen entspringt allein der Fantasie des Lesers.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2013 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75/20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung und E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Edi Graf
ISBN >978-3-8392-4160-8
»Sprühende Spannung liegt in der Luft …«
Hazy Osterwald, Kriminaltango
Auftakt
»Gestatten, mein Name ist – nein, nicht ›Bond, James Bond‹ – obwohl wir sogar Jahrgänger sind und immerhin 50, der gute alte James und ich.
Und fast Kollegen. Na ja, zumindest so etwas Ähnliches wie Kollegen. Ich bin allerdings kein Doppelnullagent, im Gegenteil. Charlotte, meine Ex, würde mich eher als Dreifachnull bezeichnen.
Während Kollege James seine Fälle nach dem Willen seines Erfinders zwischen Solarplexus und Oberschenkelinnenseite löst, bin ich eher zwischen Ratzenried, Schnürpflingen und Onstmettingen unterwegs. Die kleine Lokalausgabe des globalen Agenten sozusagen.
Ein ›Bondle‹.
Verfilmt wurde ich noch nicht, doch so schön eine Filmkarriere wäre, sie hat auch Nachteile: Sehen Sie, der gebrauchte Bond wurde schon fünfmal ausgewechselt, ich laufe immer noch als Erstzulassung rum.
Übrigens, während die Produzenten von ihrem ersten Bonddarsteller nur sagten ›der sieht aus, als ob er Eier hat‹, habe ich wirklich welche! Und zwar täglich frische, von den freilaufenden Hühnern auf dem Bio-Hof meiner Nachbarin Felicitas Habergais-Büchdickmann.
Ach so, ich habe mich immer noch nicht vorgestellt. Aber das hat noch Zeit. Wir müssen jetzt los!
Das Konzert hat bereits begonnen …«
Sau tot, Has tot, Musikant tot!
Der Musikant hing krumm über dem Notenständer und machte einen ziemlich leblosen Eindruck, nachdem er live den plötzlichen Bühnentod gestorben war. Mag sein, dass es Wunschtraum vieler unsterblicher Schauspieler und anderer Bühnenhelden ist, auf offener Bühne zusammenzubrechen und ›coram publico‹ das siechende Leben auszuhauchen, den letzten Odem in den Souffleurkasten zu blasen und den schwindenden Blick noch einmal ins Rampenlicht zu tauchen, doch wirklich wollen will das keiner. Schon gar nicht ein Musikant in der zweiten Reihe des bekannten Orchesters Pepe Plasmas Blasmusik.
Der Erfolg dieser Band ließ sich an zahlreichen Preisen messen, die sie im In- und Ausland erspielt hatte. So hatte sie unter anderem den mit einem goldenen Alphorn dotierten First Official Award of Bohemian Rhapsody gewonnen. Überhaupt war böhmische Blasmusik derzeit ›in‹, vielleicht sogar ›inner‹ denn je. Polkabeat boomte, böhmische Besetzungen schossen wie Pilze im nassen Herbst aus dem Boden, junge Musikanten hatten mindestens so viel Freude an der ›Vogelwiese‹ und am ›Böhmischen Traum‹ wie an Rap und Hiphop. So war es nicht verwunderlich, dass Pepe Plasma sich mit einer kleinen Besetzung sogar für den Vorentscheid zum Eurovision Song Contest qualifiziert hatte.
Die erfolgreiche Band hatte ein Galakonzert in Friedrichshafen am Bodensee im Graf-Zeppelin-Haus gegeben, wo der Tod während der Polka ›Schorle voraus‹ die Bühne betrat.
Der erste Posaunist Langfried Schieber, solistisch blasend neben seinen Registerkollegen stehend, hörte auf zu spielen, sank auf seinen Stuhl, kippte nach vorn und blieb mit dem Oberkörper auf dem Notenpult liegen, das durch ein physikalisches Wunder sein Gleichgewicht hielt.
Das Blasorchester brachte die Polka noch schwungvoll zu Ende, während sich im Publikum unruhig die Köpfe reckten, um die seltsame Haltung des Musikanten, der in der zweiten Reihe erhöht saß, zu kommentieren. Einzelnen, überwiegend weiblichen Kehlchen entfleuchten ob der schaurig anmutenden Showeinlage schon unruhige Schreie.
Als nach Ende der Polka in klarem F-Dur die Band sich stehend im Applaus sonnte und sich der dahingegangene Posaunist immer noch nicht vom Notenpult erhob, verstärkte sich auch im Ensemble der Eindruck, dass mit dem Kollegen etwas nicht stimmte. Der Registernebensitzer des Leblosen packte ihn unsanft an der Schulter, als wollte er ihn wachrütteln, doch dann fuhr seine Hand zurück, und seine vor Entsetzen geweiteten und vom nächtlichen Gelage des Vortages noch geröteten Augen registrierten, dass der ausgeblasene Posaunist keinesfalls nur beim Nachschlagziehen eingenickt war. Der Mann war mausetot!
Ich saß als großer Freund zeitgenössischer Blasmusik im Publikum in der dritten Reihe und sah meine Zeit gekommen.
Gestatten Sie also, dass ich mich nun doch noch vorstelle: Ich bin Kommissar, na ja, eigentlich nur Privatdetektiv, aber ›Kommissar‹ macht sich in meinem Metier besser. Ich verwende den Titel ›Kommissar‹ allerdings nicht als Berufsbezeichnung, sondern quasi als Pseudonym, und das ist durchaus gestattet. Ich könnte mich nun ja in aller Ausführlichkeit beschreiben, doch was interessieren schon Größe, Gewicht und Toupetfarbe? Nehmen Sie eine Kreuzung aus Heinz Becker, Pierre Brice und John-Boy-Walton – dem jugendlichen Mr. Bean der 70-er Jahre des vergangenen Jahrhunderts – und fertig bin ich!
Mein richtiger Name ist Tsuval. Rainer Tsuval. Für den Nachnamen kann ich nichts. Altes Erbstück aus Belgien. Meinen Vornamen allerdings hat meine Mutter ausgesucht, und ihr außergewöhnlicher – um nicht zu sagen ausgefallener – Geschmack in solchen Dingen wollte es, dass die Konstellation aus Vor- und Zunamen geradezu meinen beruflichen Werdegang vorgab, dieser quasi schon vor meiner Geburt feststand.
Nun ja, meine Uraufführung fand am 25. Oktober 1962 im Kreißsaal des Zentralhospitals von St. Agath-Christi am Stein statt, und ich wurde danach auf den germanischen Namen Rainer getauft.
Als ich Jahre später – ich erinnere mich genau – in der Fernsehsendung ›Aktenzeichen XY-ungelöst‹ mit Ganoven-Ede Zimmermann erstmals vom genialen ›Kommissar Zufall‹ hörte, der schon wieder eine ganze Bande Verbrecher zur Strecke gebracht hatte, stand mein Ziel fest, ich wollte entweder Polizeimusiker werden oder Bullenreiter, sprich, zur berittenen Polizei.
Flöte spielte ich seit meinem siebten Lebensjahr, und meine Liebe zu Tieren aller Art (vor allem verstehe ich etwas von Terrarien und Vogelstimmen) hatte mich nicht nur in jugendlichen Jahren zum Spezialisten für schwäbisch-alemannische Spinatwachteln und Rückzüchter einer ausgestorbenen Amphibienart (der siamesischen Rüsselkröte) gemacht, sondern auch das Glück der Erde auf dem Rücken von transsibirischen Zwergponys finden lassen.
Allerdings stellte ich mir die Sache einfacher vor, als sie war: Mein Dienst bei der Polizei war nur von kurzer Dauer, ich kam beim Polizeimusikkorps als Flötist – wie leider auch sonst einige Mal in meinem Leben – nicht über das Vorspiel hinaus.
Die Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei quittierte ich nach drei Tagen Dienst ohne Pferd im Gelände, kopierte den Dienstausweis des Hauptkommissars und kam das erste Mal mit dem Gesetz in Konflikt, als ich mich bei der Anmeldung meiner Privatdetektei als Kommissar ausgab und entsprechende Visitenkarten auf Umwegen im örtlichen Polizeipräsidium landeten. Aua!
Dann kam mir die rettende Idee: Ein Pseudonym, so wurde mir beim Patentamt und bei der Bundesagentur für Datenschutz versichert, konnte niemand verbieten. Also kreierte ich aus meinem Traumberuf Kommissar und meinem Namen ein Pseudonym. Und so steht es bis heute – in Anführungszeichen – auf meiner Visitenkarte:
»Kommissar Zufall«
Rainer Tsuval.
Ihr Spezialist für ungelöste Fälle aller Art.
Ermittlungen nach Maß und Auftrag.
Diskret, erfolgreich, undercover.
Die meisten meiner Kunden, denen ich mich so vorstelle, nehmen sofort Haltung an und denken nur: Wow! Der berühmte Kommissar Zufall! – und schon habe ich den Auftrag … meistens.
An jenem trüben Oktoberabend des Jahres 2012 im wilden Süden unserer Republik, als der Posaunist Langfried Schieber beim zweiten Zug auf ›eins-und‹ (es war so genannter Nachschlag1 zu spielen) im dritten Takt des Trios der Schorle-Polka seinen allerletzten Zug tat – so wurde die Aussage seiner Registerkollegen von den Beamten der Kriminalpolizei zu Papier gebracht – kam ich durch meine zufällige Präsenz vor Ort zu meinem neuen Fall:
Als nämlich der langweilige Ansager von Pepe Plasmas Blasmusik stammelnd die Bühne betrat und von einem ›kleinen, unangenehmen Zwischenfall‹ stotterte, kam im Saal eine Stimmung auf, die die Kapelle während ihres ganzen Konzerts bislang nicht ein einziges Mal erzeugt hatte.
Natürlich wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass es sich um einen Mord handelte. Trotzdem war ich intuitiv und durch die jahrelange Erfahrung, die ich inzwischen mein Eigen nennen kann, davon ausgegangen, dass der Musikant nicht so plötzlich eines natürlichen Todes gestorben war.
Um Panik zu vermeiden, beschloss ich daher, das Hungergefühl, das jetzt so kurz vor der Konzertpause in mir keimte, zu unterdrücken, nach vorn auf die Bühne zu eilen und mein Inkognito zu lüften. Dies war einfacher gesagt als getan. Ich hatte die Wahl, mich entweder in meiner Reihe nach rechts oder links an lang ausgestreckten Beinen oder überhängenden Bierbäuchen vorbeizukämpfen oder den kürzeren, aber akrobatischeren Weg über die beiden Rotten2 vor mir zu wagen.
Mein Entschluss unterlag einer gewissen Eile, da sich im Publikum schon die ersten Verdächtigen aus den hinteren Rotten aufmachten, den Saal zu verlassen, was unter den gegebenen Umständen keinesfalls zuzulassen war. Also stieg ich meinem Vordermann, sehr zu dessen Missfallen, über die Rückenlehne seines Sitzes auf die Oberschenkel, hielt mich krampfhaft an seiner Schulter fest und tastete mich zum Kopf des vor ihm Sitzenden weiter.
Da das Licht im Saal noch gedimmt war, gewahrte ich zu spät, dass ich auf das zu einem vogelnestartigen Haarhelm gestylten Frisurmonster einer älteren Dame zusteuerte, als meine Finger auch schon im taftgeschwängerten Haupthaar festhingen, ihre spitzen Fingernägel sich kratzend in meinen Unterarm krallten, mich ihr Hintermann im selben Moment kraftvoll von seinen Schenkeln stieß, und ich so ohne jeden Halt, dafür von Schmerz durchbohrt nach vorn stürzte und eingekeilt zwischen gewölbtem Oberbau und abschüssigem Schoßhang bei der Helmfrisierten landete, wo ich abglitt und zum Boden durchrutschte.
Für eine Schrecksekunde war ich wie betäubt, dann bemerkte ich den unförmigen, fellartigen Gegenstand in meiner Hand und stellte entsetzt fest, dass sich ein Toupet in Fußballgröße zwischen meinen Fingern verfangen hatte. Ich rappelte mich auf, stülpte der jetzt Grauköpfigen die Kunsthaare über den Schädel, stammelte »sorry!«, weil ich die falsche Dame erwischt hatte, nahm ihr den Putz wieder ab, setzte den Skalp seiner wahren Besitzerin auf und hielt, ohne eine Reaktion abzuwarten, auf die Bühne zu. Mit gekonntem Schwung erklomm ich deren Rand und entwand dem verdutzten Ansager das Mikrofon.
»Türen abriegeln! Keiner verlässt den Saal! 110 rufen!«, befahl ich dem Haustechniker und ging zu dem leblos über dem Notenpult Hängenden, der von seinen Musikkameraden in einem doppelten Kreis umringt wurde. Die beiden Feuerwehrleute, die an diesem Abend Bühnendienst hatten, waren herbeigeeilt, um Erste Hilfe zu leisten. Doch ihrem Kopfschütteln entnahm ich, dass es dafür zu spät war.
Zwischen breiten Schultern und schweißtriefenden Achselhöhlen hindurch erkannte nun auch ich, was dem Posaunisten den Tod gebracht hatte: Das kleine Federbüschel eines schmalen, kurzen Pfeils ragte zwischen den Haaren aus dem Nacken wie aus einer Dartscheibe heraus.
Ich hatte vor Jahren den Amazonas befahren und wusste auf Anhieb, was ich vor mir hatte: Mit solchen Pfeilen, getränkt in Curare, einem Gift, das von einigen farblich höchst attraktiven Minifröschen im Regenwald produziert wird, töteten die Indios ihre Beute.
Ob der Pfeil im Nacken des Posaunisten vergiftet war?
Ich wandte mich dem Publikum zu und gab meiner Stimme den beruhigenden Klang eines Hypnotiseurs. So erreichte ich durch mein geschultes Auftreten und die professionellen Anweisungen binnen Sekunden die ungeteilte Aufmerksamkeit des Auditoriums. Ich stellte mich wie gehabt vor, und merkte am ungläubigen Kopfschütteln, dass man mich kannte.
»Achtung, hier spricht die Polizei! Kommissar Zufall, mein Name. Bitte bewahren Sie Ruhe, bis meine Kollegen da sind, und halten Sie Ihren Personalausweis oder den Führerschein bereit!«
Ich fand, ich klang über die professionelle Tonanlage wie die Synchronstimme von Columbo, und mein zerknittertes Gesicht verstärkte sicher diesen Eindruck. Schade, dass ich meinen Trenchcoat an der Garderobe abgegeben hatte.
»Und bis es soweit ist, machen wir noch etwas Musik«, zitierte ich einen bekannten Rundfunkmoderator und fasste den Bandleader ins Auge.
»Habt ihr vielleicht was in Moll oder was Getragenes?«, fragte ich.
»Wir spielen nur Polka, Marsch und Walzer«, entgegnete Pepe Plasma.
»Ein langsamer Walzer?«
»Ohne unseren ersten Posaunisten?«, fragte er.
»Oder ein Signal«, schlug ich vor. So wie in Winnetou III an der traurigen Stelle. Wo sogar Lex Barker geweint hat. Das hatte mich schon als Kind mitgenommen. Damals wollte ich unbedingt Trompete lernen. Doch da noch die Flöte vom Döte auf dem Dachboden lag, ging ich einen anderen Weg.
»Ich kenn’ nur ›Sau tot‹ von den Jagdhornbläsern aus Schwäbisch Halali!«, sagte der Trompeter jetzt. »Oder ›Has tot‹ – zur Not. Aber dazu braucht man Parforcehörner, und wir haben nur Tenorhörner und Waldhörner.«
»Vielleicht sein Lieblingsstück?«, half ich und deutete auf den Toten. Plasma gab seinem Orchester die Anweisung weiter.
Sie spielten den Bayrischen Defiliermarsch.
Langfried freute sich nicht mehr.
Mein Hungergefühl kehrte zurück, und ich ging aufs Klo.
1Musikalischer Fachausdruck für Töne auf der unbetonten Zählzeit
2 Fachausdruck aus der Marschordnung für nebeneinander stehende Musikanten im Unterschied zur hintereinander angeordneten Reihe
Backstage
Der LKW mit ABS3 duftete verlockend. Zwar waren Maultaschen – und zwar geschmälzt und nur mit Zwiebeln, nicht mit Ei – meine Leibspeise, aber Leberkäse war auch nicht zu verachten. Das Brötchen war frisch gebacken, der Leberkäse hatte durch Zutaten wie Paprika und Zwiebeln Farbe und Geschmack einer Pizza Napoli angenommen, und den Senf hatte ich mir auf die Unterseite des saftigen Fleischbrockens schmieren lassen, damit er die sensibelsten Stellen des Gaumens und der Zunge auf direktem Weg erreichen konnte.
Mir lief förmlich das Wasser im Mund zusammen bei der Vorstellung, gleich hineinzubeißen, ich sog den Geruch ein, der Appetit wuchs ins Unermessliche, und dann beging ich den verhängnisvollen Fehler, statt dem Mund meine Augen zu öffnen.
Das war ein unverzeihlicher Fauxpas, denn im selben Moment löste sich der Wunschtraum im Nichts auf. Futsch war der LKW samt ABS, und das einzige Wasser, das lief, war das der Klospülung in der Herrentoilette des Graf-Zeppelin-Hauses in Friedrichshafen am Bodensee.
Nur der Zwiebelduft war noch Realität. Er entströmte in einer schweren Wolke dem Odem des Mannes, der in dieser Sekunde neben mich ans Waschbecken trat, und dessen kantige Visage, die an den alten Ben Cartwright aus Bonanza erinnerte, mich jetzt aus dem Spiegel anstarrte. Der Mann war Polizist, das erkannte ich auf den ersten Blick.
Mein Gespräch mit dem Leiter der Kriminalinspektion 1, Kriminalhauptkommissar Sepp Donner – wie er sich mir vorstellte – auf dem Männerklo verlief nicht zu meinen Gunsten. Der in mehreren Ehen ergraute Bulle – ich erfuhr später, dass er kurz vor der dritten Scheidung stand – hatte offensichtlich schlechte Laune und sprach von Amtsanmaßung, Ämtermissbrauch und Freiheitsberaubung, nur weil ich veranlasst hatte, dass der Saal abgeschlossen wurde und niemand die Halle verlassen sollte.
Seine hohe, krächzende Stimme quietschte wie ein halbfeuchter Putzlappen, der über eine trockene Glasscheibe wischt. Genau die Frequenz, die bei mir unmittelbar Zahnweh erzeugt, weil sie genau den sirenenartigen Ton des Zahnarztbohrers trifft. Doch sein ›S‹-Fehler, der klang, als ob seine Oberkiefervorderzähne sich über die Unterlippe stülpten, machte ihn richtig sympathisch. Statt ›Z‹ brachte er nur ein ›Tf‹ heraus, und jedes ›S‹ klang wie ein ›F‹.
»Tfeugen!«, polterte er los. »Wie foll denn einer auf der letften Reihe waf gefehen haben?«
Ich zuckte die Schultern.
»Vielleicht Opernglas?«, versuchte ich.
»Fie Idiot! Fie können doch nicht fünfhundertfünfundviertfig Leute grundlof in einem Faal einfperren …!«
»600!«, korrigierte ich. »Und nicht 5- sondern 46. Ich bin schließlich auch geblieben.«
»Ffnautfe! Ob fechfhundertfechfundviertfig oder fünfhundertfünfundviertfig fpielt nicht die geringfte Rolle!«, herrschte er mich an. »Wie kommen Fie überhaupt datfu …?«
Ich hielt es zum einen für angebracht, mich vorzustellen, und ihm daher zum anderen meine Visitenkarte unter die Nase zu halten.
»Fofo«, kommentierte er, »ein Kollege alfo! Ab fofort halten Fie fich da rauf, ich bin hier der Kommiffar! Haben wir unf verftanden, Herr Tfufall?«
Er ließ mich stehen wie einen begossenen Pudel.
Ich verließ kurz nach ihm den Sanitärbereich, um trotz seines Befehls wieder aktiv ins Geschehen einzugreifen. Niemand kümmerte sich um mich. Das Getümmel auf der Bühne und im Saal als ein heilloses Chaos zu bezeichnen, wäre leicht untertrieben.
27 Musiker und ein Schlagzeuger – die Leiche des Posaunisten nicht mitgezählt – hingen tuschelnd auf ihren Stühlen, da der echte Kommissar das Verlassen der Plätze verboten hatte, bis durch die Kriminaltechnik alle verwertbaren Spuren gesichert waren.
Die Techniker des Unternehmens, der Hausmeister, die Sängerin und der Sänger, Meister Plasma und die Herren von der örtlichen Feuerwehr hatten sich in einem Pulk zusammengefunden und wurden von einem der Kriminalbeamten zu Einzelgesprächen gebeten.
Behandschuhte Beamte der Kriminaltechnik huschten umher, Fotoapparate und Taschenlampen blitzten auf, Letztere nach Spuren leuchtend, die Auskunft über die Herkunft des tödlichen und offensichtlich hinter der Bühne abgeschossenen Pfeils geben konnten.
Das Publikum hatte der Bühne größtenteils den Rücken zugewandt und strebte den beiden inzwischen wieder freigegebenen Ausgängen zu, wo sich lange Schlangen bildeten, denn der echte Kommissar hatte seine engsten Mitarbeiter um sich geschart und die Anweisung gegeben, jeden im Saal vor Verlassen zu dem Vorgang zu befragen und die Personalien aufzunehmen. Meine Rede!
»Alle 646?«, fragte eine junge Kriminalbeamtin und kassierte dafür nicht nur einen strengen Blick ihres Vorgesetzten, sondern einen formlosen Anschiss:
»Alle fechfhundertfechfundviertfig werden befragt. Wir nehmen von allen Telefonnummer und Namen auf, und dann fficken wir fie nach Haufe!«, herrschte er sie an.
Der begossene Pudel in mir wedelte erfreut mit dem Schwanz. Ich hob das Bein und stieg über die Kabeltrommel, die mir den Weg versperrte, um Langfried noch einmal näher zu betrachten, bevor er irgendwann von den Sanitätern eingetütet und als Sargkonserve aus dem Saal befördert werden würde.
Langfried hatte sich nicht bewegt. Stirn und Nase pressten sich auf den schweren schwarzen Notenständer oder genauer gesagt auf das Notenblatt der Polka ›Schorle voraus‹, deren Töne das Letzte waren, was er als Musikant von sich gegeben hatte, bevor er sein Leben im Mundstück seiner Posaune aushauchte.
Das Mundstück?
Ich betrachtete verwundert seine Posaune. Die linke Hand hielt sich noch verkrampft an seinem Instrument fest, während die Rechte, die im Posaunistendasein als Zugführer dient, sich vom Messingrohr gelöst und dafür an die Brust geworfen hatte. Die Finger krallten sich um den linken Hosenträger, und in dieser seltsamen Stellung auf den Stuhl zurückgesunken, hatte sich Langfried Schieber mit dem Oberkörper auf das Notenpult gelegt und war verschieden. Doch das Mundstück auf seiner Posaune fehlte! Wie sollte er aber so geblasen haben? Außer mir schien das jedoch noch niemand bemerkt zu haben. Ich beschloss, der Sache nachzugehen.
Da beim letzten Ton alle Luft und Lebensfreude aus dem Posaunisten gewichen war, würde der Gerichtsmediziner nichts weiter als den Tod attestieren, eingetreten offensichtlich durch plötzliches Ableben verursacht durch den kleinen Pfeil, dessen Spitze sicher mit einem noch nachzuweisenden Gift versehen war. Zu diesem Zweck wanderte der Pfeil aus dem Stiernacken des Ermordeten in die plastikbehandschuhten Finger eines Kriminaltechnikers und von dort in einem verschließbaren durchsichtigen Beutel direkt in das Labor.
Wie aber, so fragte ich mich, war der Pfeil – mit oder ohne Gift – während des Konzerts unbemerkt in den Nacken des Langfried Schieber gelangt? Die Lösung musste hier am Tatort zu finden sein. Mit der Routine des langjährigen Laienschauspielers, dessen Heimat an manchem Abend die Lustspielbühne von St. Agath-Christi am Stein war, inspizierte ich den Backstagebereich4.
Der schwere schwarze Vorhang war als Bühnenhintergrund im Rücken der Musikanten zugezogen worden. Keine Chance, von dort nach vorn auf die Bühne zu sehen. Der Stoff war zwar in die Jahre gekommen und an manchen Stellen porös und löchrig wie eine Scheibe Appenzeller Käse, und es war durchaus denkbar, durch eines der Löcher ein Blasrohr zu stecken und einen Pfeil abzuschießen, aber wie zielen?
Mein Blick wanderte am Vorhang entlang nach oben.
Da! Ein schmaler Laufsteg hoch über mir, direkt unter der Decke. Ein Metallgitter, nur etwa 30 Zentimeter breit, führte dort oben zwischen den Lichtleisten hindurch. Der Haustechniker oder Beleuchter konnte so bequem die Blenden der Lampen einstellen oder kaputte Leuchtmittel auswechseln. Aber konnte man von dort auf die Bühne schießen? Ich musste es herausfinden.
Eine kurvenreiche Wendeltreppe führte mich in einer engen Spirale nach oben. Meine Beine zitterten, und ich versuchte, das Schwindelgefühl in mir zu unterdrücken. Vorsichtig balancierte ich über den Steg in die Richtung, wo geschätzte fünf Meter unter mir der Posaunist saß. Fast stolperte ich dabei über eine Klarinette, die auf dem Gitterboden lag. Der Schussapparat?
Ich startete hier oben das Experiment: Ich hielt die Klarinette, deren Mundstück fehlte, wie ein Blasrohr schräg nach unten, ungefähr im selben Winkel, in dem ein Klarinettist sein schwarz verkohltes Instrument hält, rotzte etwas Spucke aus der Kehle, zielte kurz und spuckte hindurch.
Treffer!
Der Kriminalhauptkommissar, der sich neben dem Stuhl des Toten positioniert hatte, fuhr sich mit der rechten Hand ins Genick. Seine Finger fühlten den feuchten Schleim, er wirbelte herum und starrte den hinter ihm stehenden, kleinwüchsigen, offensichtlich rangniedrigeren und ahnungslosen Beamten an und wischte die schlonzigen Finger an dessen Hemdsoberarmärmel ab.
Was er dabei blaffte, verstand ich in meinem luftigen Versteck leider nicht. Ich nahm die Klarinette mit und kletterte nach unten. Den Beweis, dass der Schuss von dort oben möglich war, hatte ich erbracht, das Experiment war geglückt.
Dennoch konnte es auch anders gewesen sein. Ich untersuchte noch einmal den Vorhang. Irgendetwas störte mich. War es auf der Bühne? Im Saal? Ich versetzte mich zurück in das Konzert.
Die Musiker saßen noch immer auf der Bühne herum und wurden einzeln befragt. Das sparsame Licht erfasste betroffene Mienen. Die Schlangen im Saal waren noch nicht kleiner geworden. Hier war alles hell erleuchtet. Genau! Das war es, was mich störte! Die Lichtverhältnisse waren total andere als zur Tatzeit. Der Haustechniker stand tatenlos und etwas gelangweilt am Bühnenabgang.
Ich gedachte, ihm eine wichtige Aufgabe zu übertragen, trat auf ihn zu, baute mich vor ihm auf und gab meiner Stimme den Klang von John Wayne in Rio Bravo, als er Stumpy den Gefangenen übergibt. Die Dringlichkeit meiner Bitte wurde ihm daher sofort bewusst.
»Es ist für den Erfolg unserer Ermittlungen unabdingbar, dass wir noch einmal dieselben Lichtverhältnisse schaffen, wie während des Konzerts«, sagte ich.
»Jetzt?«, fragte er.
»Nein«, antwortete ich. »Zwischen Allerheiligen und Totensonntag!«
Er starrte mich an und hatte verstanden. Ich sah ihn nie wieder sich so schnell bewegen. Während er sich im Regieraum an den Lichtschaltern zu schaffen machte und im Saal die Beleuchtung langsam zurückgefahren wurde, huschte ich hinter den Vorhang.
»Welcher Arff macht denn im Faal daf Licht auf?«, hörte ich den Kommissar brüllen, als auch schon die Frontscheinwerfer in grellem Halogen die Bühne in gleißendes Weiß tauchten.
Das wollte ich sehen! Klar und deutlich konnte ich sogar durch den brüchigen Vorhang die Silhouetten der Leute auf der Bühne erkennen wie im Schattenspiel. Jede Kontur, jeder Körper hob sich als schwarze Figur vor dem Gegenlicht ab. Direkt vor mir erkannte ich den kantigen Leib des Hauptkommissars, der auf dem Podest der Posaunisten stand und befahl, das »Feifflicht im Faal wieder eintfuffalten!«
Ich stülpte meine Lippen wie zu einem Kuss über die obere Öffnung der Klarinette, steckte diese durch ein größeres Loch im Vorhang, fasste durch ein zweites Loch die Gestalt ins Auge, röchelte kurz und erfolgreich und spie den Schlonz gekonnt ins Ziel. Die Hand des Hauptkommissars schlug abermals wie eine Fliegenklatsche ins Genick und landete in der zähen Suppe.
Leider konnte ich seinen Gesichtsausdruck wegen des Gegenlichts auch beim Blick durch das Vorhangloch nicht erkennen. Aber der geblähte Hals verriet mir, wie sein Atem pumpte, und ich beschloss, die Klarinette aus dem Vorhang und mich mit sofortiger Wirkung zurückzuziehen.
Wehe, wenn der Kommissar erführe, wer der wahre Schütze war!
Ich duckte mich und hielt die Luft an. Wie zur Lebensrettung ging das Licht auf der Bühne plötzlich aus. Der Haustechniker experimentierte. Ich schlich auf allen Vieren zwischen die zahlreichen Equipmentkisten, die hinter der Bühne abgestellt waren, ließ die Klarinette, in deren Innerem sich sicher der genetische Fingerabruck des Mörders fand, dort zurück und machte mich klein. Von dort aus plante ich meine Flucht.
Nun wusste ich also, dass es möglich gewesen war, während des Konzerts sowohl hinter als auch über der Bühne den Pfeil mit der Klarinette abzuschießen. Blieb nur die Frage, warum der Mörder sich ausgerechnet Langfried Schieber zum Ziel auserkoren hatte?
Dass diese Frage, so gestellt, auch nicht zur Lösung des Falles führen wurde, war dem begossenen Pudel in mir zu dieser Zeit noch nicht klar. Sicher war hingegen eines: Wenn der Pfeil während des Konzertes hinter der Bühne, ob von oben oder von hinter dem Vorhang abgeschossen worden war, konnte keiner der Musikanten der Mörder sein.
Während ich darüber nachdachte, legte sich das nächste Problem wie eine Eisenklammer auf meine linke Schulter.
3 Schwäbischer Fachausdruck für: Leberkäsweck (Leberkäse in Brötchen, Stulle, Semmel oder Schrippe) mit a bissle (ein wenig) Senf (Mostrich).
4 Fachausdruck: vom Publikum aus nicht zugänglichen Bereich hinter der Bühne
Klammersängerin
»Hallo!«, flüsterte es zärtlich an meinem Ohr.
Ich vermutete sofort eine von Schauspiel oder Gesang geschulte Stimme, die beim ›O‹ die Lippen zu einem vollkommenen Kreis formt.
»Sie müssen mir helfen! Bitte!« Das Flöten des Pirols – eindeutig!
Kaum zu glauben, dass diese hauchzarte Gimpelstimme zu der schweren Hand gehörte, die meine linke Schulter kräftig niederdrückte, so kräftig, dass ich nicht einmal aufzustehen vermochte. Ich versuchte, die Klammer abzuschütteln, doch sie hatte sich wie ein Schraubstock in meinen Schulterknochen gebohrt, und als ich meinen Hals langsam nach hinten drehte, um den Besitzer der Dompfaffstimme und des Eisenklammergriffs zu identifizieren, blickte ich direkt auf eine hügelige Herbstlandschaft in den Zentralalpen.
Nur die indirekte Beleuchtung der Hinterbühne warf, zusammen mit dem Grün der Notausgangslampen und dem blauen Backstagelicht, einen diffusen Schimmer auf ein schattiges Massiv, eine schwarze Steilwand, die sich hinter mir erhob. Ganz weit oben, von meiner Tallage aus fast nicht zu erkennen, glänzte mattsilbern das Gipfelkreuz als Kettchenanhänger auf einer gewölbten Brust.
Als der Klammergriff an meiner linken Schulter etwas nachließ und fast zeitgleich die Leuchtstoffröhren an den Bühnengangwänden wieder flackernd zum Leben erwachten, erwachte auch ich aus meinem Alpentraum, erkannte in der schwarzen Steilwand den Abhang einer Dirndlschürze und in dem schattigen Massiv eine Wucht von Frau, was mir die Vorsilbe ›Mont‹ im Namen einer gigantischen Sängerin plausibel erklärte. Ich folgte den sanften Rundungen nach oben, am um den schneeweißen Hals gehängten Silberkreuz vorbei zum Gesicht der Dirndlträgerin.
Vor mir stand die Sängerin des Orchesters!
Knallig rot leuchtete der heftig geschminkte Mund inmitten des Vollmondgesichts. Diesem Mund waren heute Abend während des ersten Konzertteils Worte entfleucht, die aneinandergereiht so schöne Texte ergaben wie:
Wenn du mich küsst,
Beginnt mein Herz zu sumsen,
Ich träum davon, dich endlich mal zu
fragen,
Welch’ Pasta du für deine Zähne nützt …
Oder so ähnlich hatte sie gesungen. Na ja. Zu singen versucht. An der Saalakustik hatte es nicht gelegen. Während ihr beim Sprechen die Worte mit der Ausdrucksvielfalt unserer heimischen Vogelwelt entfleuchten, hatte ihre Singstimme bestenfalls jammernde Uferschnepfenqualität. Und der Klammerreim war obendrein mies. Ich löste mich aus meiner gebückten Haltung, stützte mich auf den Boxen ab und richtete mich zu meiner vollen Größe auf. Trotzdem wäre, um ihr Aug in Aug gegenüberzustehen, ein Sessellift nicht unpraktisch gewesen. Von unten, also aus der dritten Zuschauerreihe, hatte sie weniger bedrohlich auf mich gewirkt, die intensive Nähe und Abgeschiedenheit hier hinter der Bühne aber machten mir Angst.
Die Matrone hatte die Arme jetzt über ihrem Mieder verschränkt, was zugleich die atemberaubende Aussicht ein- und meine Gedanken nicht mehr so sehr be-schränkte.
Ihre unvergleichliche Stimme schließlich war es, die mich wieder zu 100 Prozent in die Wirklichkeit zurückkatapultierte.
»Sie müssen mir helfen!«, flehte die Waldohreule klagend.
»Sie sind doch die Sängerin?«, stammelte ich etwas hilflos.
»Ich bin von Ihrer Stimme sehr beeindruckt!«, log ich, und hoffte, dabei nicht rot anzulaufen.
»Nur von meiner Stimme, junger Frrreund?«, schnarrte die Wiesenralle und rollte dabei das ›R‹ wie einst Zarah Leander, die Unerreichte. Bildete ich es mir ein, oder schleuderten mir ihre Augen sanfte Blitze entgegen?
»Ich bin Kammersängerin. War drei Jahre in Stuttgart, zwei Jahre in Wien, Hamburg und Zürich.«
»An der Oper?« Meine dünne Stimme versprühte nur einen Hauch ihrer Gewalt.
»Oper?« Sie kolorierte auf dem ›O‹ wie ein Kockock mit Sprachfehler und hielt den Sopran am Ende der zweiten Silbe fragend oben.
»Ach iwo!«, klang es zeternd wie der Paarungsruf der Wacholderdrossel, »Musical!«
»Oh?« Ich spielte den Interessierten. »Welche Rolle?«
»Das spielt doch keine Rolle«. Gleichgültiges Schnarren des Schilfrohrsängers. »Wer will sich heute schon auf eine Rolle festlegen! Man wird dabei sofort in eine Schublade gepresst!«
Und die müsste Sarggröße haben, fügte ich in Gedanken hinzu.
»Ich habe die Oma in Ich war noch niemals in New York gespielt, die Schöne im Biest und die Gazelle im König der Löwen«, plätscherte die Gartengrasmücke.
Nicht gerade herausragende Gesangspartien, wusste ich als alter Musicalfreak, und die Gazelle musste mindestens ein Wasserbock gewesen sein, doch ich biss mir auf die Zunge.
Die Klammersängerin fragte, diesmal schwermütig flötend wie ein Fitislaubsänger:
»Und Sie sind von der Polizei, nicht wahr?«
Wenn diese singende Bergidylle Kammersängerin war, konnte ich getrost als Polizist durchgehen. Also nickte ich.
»Kommissar Zufall«, flüsterte ich geheimnisvoll und registrierte, wie sie vor Ehrfurcht erstarrte wie eine Rohrdommel im Schilf des westlichen Bodensees.
»Der berühmte Kommissar Zufall!«, gurrte die Ringeltaube, »Constanze Voorte-Singh, mit C wie Coloratur«, stellte sie sich vor, »mein verstorbener Mann war Chinese«, fügte sie noch erklärend hinzu und reichte mir ihre Rechte.
Da war sie wieder, die Klammer. Die Frau hatte den Händedruck eines Orang-Utans und konnte sicher wie der Seewolf Raimund Harmstorf selig eine rohe Kartoffel mit der bloßen Hand zerquetschen.
Mein zartes Detektivhändchen verschwand in ihrer Pranke wie ein Streichholz in einem Schraubstock. Ich fragte mich im Stillen, woran wohl ihr chinesischer Mann gestorben war.
»Ich bin Privatdetektiv«, führte ich noch geschäftstüchtig ergänzend an.
»Können wir uns treffen, in meinem Zimmer?«, schnickerte das Rotkehlchen in ihr und hielt noch immer meine Hand umklammert, als würde sie bei einer falschen Antwort mit der Folter beginnen. Ich überlegte daher nicht lang.
»Gern«, log ich.
»Gut«, sang sie. »Wir wohnen alle im ›Goldenen Geier‹. Ich habe Zimmer 106«, schnurrte der Ziegenmelker. Hatte es etwas Verruchtes, wie sie die ›6‹ aussprach, oder bildete ich mir das nur ein?
»Ich erwarte Sie zum ersten Akt in einer Stunde, vielleicht habe ich einen Auftrag für Sie«, hörte ich noch, ehe ich mich ihrem Klammergriff entwand und das Weite suchte.
Wal, da bläst er!
Das Wort ›Akt‹ klang noch negativ besetzt in meinem Ohr, als sich mein Magen wie ein angeketteter Hofhund zu Wort meldete: Er knurrte. Verzweifelt dachte ich an die verspielte Gelegenheit, mir in der Konzertpause ein Leberkäsweckle zu besorgen. Hätte der Mörder nicht erst im zweiten Teil zuschlagen können? Das hätte den dreifachen Vorteil gehabt, dass Publikum und Orchester den Tathergang gesättigt erlebt hätten, der Veranstalter nicht auf seinen LKWs sitzengeblieben, und der Pudel in mir nicht zum angeketteten Hofhund mutiert wäre.
Aber logische Überlegungen scheinen solchen Menschen fremd zu sein und ich tröstete mich mit dem Gedanken, dass der Täter ebenfalls Hunger leiden musste. Auch die Musiker, die noch immer in kleinen Gruppen auf der Bühne saßen und standen, machten einen ausgehungerten Eindruck, als ich das Ende des schwarzen Backstagevorhangs erreichte und dem echten Kommissar direkt in die Arme lief. Die Worte, mit denen er mich empfing, sprühten nicht gerade vor Heiterkeit.
»Da find Fie ja, Tfufall. Waf bilden Fie fich eigentlich ein? Warum haben Fie daf Licht aufmachen laffen?«
Ich erklärte ihm meine Beweggründe und führte ihm vor Augen, auf welche Weise der Pfeil den Weg in das Nackenstück seines Opfers gefunden hatte.
»Fo?«, zischte er, »Fie miffen fich alfo in die Arbeit der Politfei ein! Halten Fie fich da rauf! Und jettft verffwinden Fie! Und wenn ich Fie noch einmal fehe, laffe ich Fie wegen Behinderung der Ermittlungen verhaften. Verftanden?!«
Ich nickte und täuschte den Betroffenen vor. Wenn ich – was ich hoffte – von der Klammersängerin den offiziellen Auftrag bekam, mich des Falles anzunehmen, konnte dem Privatdetektiv kein Kommissar der Welt verbieten, zu ermitteln – ha!
Das weiße Schild mit dem Pfeil und der schwarzen Aufschrift ›Catering‹ leuchtete neben der Tür, die zu den Garderoben führte, und schien mich zu hypnotisieren. Der LKW tauchte wieder vor meinem geistigen Auge auf, diesmal nicht als Pizzafleischkäse, dafür in einer Größe, die ihn rings um das Brötchen zwei Zentimeter breit heraushängen ließ, während ABS heraustroff. Ich nahm den Anblick in mir auf, wurde aber kein bisschen satt davon.
Im Gegenteil.