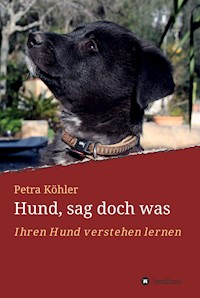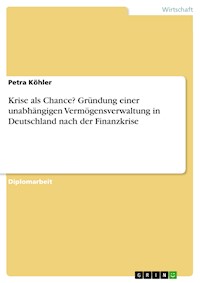
Krise als Chance? Gründung einer unabhängigen Vermögensverwaltung in Deutschland nach der Finanzkrise E-Book
Petra Köhler
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Diplomarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich BWL - Unternehmensgründung, Start-ups, Businesspläne, Note: 2,3, Universität Trier, Sprache: Deutsch, Abstract: Problemstellung und Relevanz der Arbeit: Die weltweite Finanzkrise, die im Jahr 2007 ausbrach, hat augenscheinlich die Realwirtschaft global in Mitleidenschaft gezogen. Doch die Krise hat mehr verursacht als einbrechende Börsenkurse, den Kollaps einst renommierter Banken und drohende Staatsbankrotte ganzer Volkswirtschaften. Sie hat sich zur weltumspannenden Vertrauens- und Reputationskrise des Wirtschaftssystems ausgeweitet. Die bisher vorherrschende Unternehmenskultur, insbesondere im Finanzsektor, die stark auf kurzfristiges Denken ausgerichtet, und sich an rein finanziellen Erfolgsgrößen zu orientieren scheint, führte zu Gier und Missbrauch von Vertrauen. Im Zuge der Finanzkrise sind Banken und Vermögensverwalter noch mehr in Verruf geraten. Es wird ihnen vorgeworfen, sie seien Produktverkäufer und nur auf den eigenen Profit bedacht. Gerade die Beratung von vermögenden Kunden ist als hochwissensintensive Dienstleistung aber auf Vertrauen angewiesen. Zunächst scheint das Verhältnis zwischen Kunde und Berater nach der Finanzkrise zerrüttet oder zumindest stark angeschlagen. Es scheint, als gehöre das Bild des reputierlichen Private Bankers der Vergangenheit an. Im Zentrum dieser Untersuchung steht die untersuchungsleitende Forschungsfrage, in wie weit die Finanzkrise, die auch als Vertrauenskrise bezeichnet wird, eine Chance zur Gründung einer unabhängigen Vermögensverwaltung in Deutschland darstellt? Dazu wird anhand eines dreigeteilten Hauptteils die Forschungsfrage eingehend beleuchtet. Im ersten Teil wird sich dem Konstrukt Vertrauen angenähert. Was genau ist Vertrauen, wie entsteht es und wie wird es nach einem Vertrauensbruch im organisationalen Kontext wieder aufgebaut? Auf Grundlage dieser theoretischen Ausführungen wird im darauffolgenden Teil erläutert, wie es zur Finanzkrise kam und welche Etappen sie zur globalen Vertrauenskrise machten. Diese beiden Teile bilden die Ausgangsbasis, um in einem dritten Schritt die Dienstleistung Vermögensverwaltung unter vertrauensspezifischen Aspekten und unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Finanzkrise zu beleuchten. Auf Basis dieser drei Teile soll eine Antwort auf die untersuchungsleitende Fragestellung gefunden werden. Zusätzlich soll in dieser Arbeit ein Unternehmenskonzept entwickelt werden, auf dessen Grundlage langfristig eine vertrauensvolle Berater – Kunden Beziehung entstehen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Page 1
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung und Verbreitung sowie Übersetzung. Kein Teil dieser Diplomarbeit darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung von Petra Köhler, der Autorin dieser Ausarbeitung reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Gründung einer unabhängigen Vermögensverwaltung in Deutschland
© Petra Köhler, 2010.
Page 4
Page 5
Abkürzungsverzeichnis
BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BF Behavioral Finance CDO Collateralized Debt Obligations CDS Credit Default Swaps CFA Chartered Financial Analyst CFP Certified Financial Planner CSR Corporate Social Responsibility EdW Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen EK Europäische Kommission EP Europäisches Parlament ETF Exchange - Traded Fund EU Europäische Union EZB Europäische Zentralbank Fannie Mae Federal National Mortgage Association Freddie Mac Federal Home Loan Mortgage Corporation HNWI High Net Worth Individual IuK Internet- und Kommunikationstechnologie LIBOR London Interbank Offered Rate SoFFin Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung S-O-R Modell Stimulus-Organism-Response-Modell SPV Special Purpose Vehicle TARP Troubled Assets Relief Program uVV unabhängiger Vermögensverwalter VuV Verband unabhängiger Vermögensverwalter
© Petra Köhler, 2010.
Page 6
Hinführung zum Thema1
A. Hinführung zum Thema
I. Problemstellung und Relevanz der Arbeit
Die weltweite Finanzkrise, die im Jahr 2007 ausbrach, hat augenscheinlich die Realwirtschaft global in Mitleidenschaft gezogen. Doch die Krise hat mehr verursacht als einbrechende Börsenkurse, den Kollaps einst renommierter Banken und drohende Staatsbankrotte ganzer Volkswirtschaften. Sie hat sich zur weltumspannenden Vertrauens- und Reputationskrise des Wirtschaftssystems ausgeweitet.1Die bisher vorherrschende Unternehmenskultur, insbesondere im Finanzsektor, die stark auf kurzfristiges Denken ausgerichtet, und sich an rein finanziellen Erfolgsgrößen zu orientieren scheint, führte zu Gier und Missbrauch von Vertrauen. Im Zuge der Finanzkrise sind Banken und Vermögensverwalter noch mehr in Verruf geraten. Es wird ihnen vorgeworfen, sie seien Produktverkäufer und nur auf den eigenen Profit bedacht. Gerade die Beratung von vermögenden Kunden ist als hochwissensintensive Dienstleistung aber auf Vertrauen angewiesen. Zunächst scheint das Verhältnis zwischen Kunde und Berater nach der Finanzkrise zerrüttet oder zumindest stark angeschlagen. Es scheint, als gehöre das Bild des reputierlichen Private Bankers der Vergangenheit an.2Im Zentrum dieser Untersuchung steht die untersuchungsleitende Forschungsfrage, in wie weit die Finanzkrise, die auch als Vertrauenskrise bezeichnet wird, eine Chance zur Gründung einer unabhängigen Vermögensverwaltung in Deutschland darstellt? Dazu wird anhand eines dreigeteilten Hauptteils die Forschungsfrage eingehend beleuchtet. Im ersten Teil wird sich dem Konstrukt Vertrauen angenähert. Was genau ist Vertrauen, wie entsteht es und wie wird es nach einem Vertrauensbruch im organisationalen Kontext wieder aufgebaut? Auf Grundlage dieser theoretischen Ausführungen wird im darauffolgenden Teil erläutert, wie es zur Finanzkrise kam und welche Etappen sie zur globalen Vertrauenskrise machten.
Diese beiden Teile bilden die Ausgangsbasis, um in einem dritten Schritt die Dienstleistung Vermögensverwaltung unter vertrauensspezifischen Aspekten und unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Finanzkrise zu beleuchten. Auf Basis dieser drei Teile soll eine Antwort auf die untersuchungsleitende Fragestellung gefunden werden. Zusätzlich soll in dieser Arbeit ein Unternehmenskonzept entwickelt werden, auf dessen Grundlage langfristig eine vertrauensvolle Berater - Kunden Beziehung entstehen kann.3
1Vgl.:Eisenegger,M. (2009), S. 16.
2Vgl.:Peterreins,H.,Märtin,D.,Beetz,M. (2010), S. 12, 16.
3Zur Gewährung der Übersichtlichkeit und Vereinfachung wird im weiteren Verlauf die männliche Form verwendet, wie bspw. ein Gründer. Dennoch sind sowohl Gründer als auch Gründerin angesprochen.© Petra Köhler, 2010.
Page 7
Hinführung zum Thema2
II. Methodisches Vorgehen
Während alle drei Teile größtenteils durch intensive Literaturrecherche entstanden, wurde jedoch in Bezug auf die Dienstleistung Vermögensverwaltung intensiv Kontakt zu verschiedenen Gruppen aufgenommen. Dazu zählen der Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV), Cortal Consors, JP Morgan sowie die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin). Das zur Verfügung gestellte Datenmaterial gibt Einblicke in den deutschen freien Vermögensverwaltermarkt und erörtert gründungsrelevante Fragestellungen. Um das oben angesprochene Konzept mit der Praxis abgleichen zu können, wurde ein Experteninterview mit einem unabhängigen Vermögensverwalter geführt. Er gehört dem VuV an und wurde in einem Telefoninterview befragt.
© Petra Köhler, 2010.
Page 8
Vertrauen3
B. Vertrauen
In den folgenden Ausführungen soll, thematisch eingegrenzt, der Vertrauensbegriff durch Literaturanalyse beleuchtet werden. Hauptfokus liegt auf dem organisationalen Vertrauen und der Vertrauensgenese sowie dem Vertrauensbruch und dem Wiederaufbau von zerstörtem Vertrauen im interorganisationalen Kontext. Dazu werden zuerst die unterschiedlichen Forschungsansätze, Definitionen, zentrale Komponenten sowie komplexe soziale Systeme erläutert. Die in diesem Kapitel erörterten Themen dienen dem Aufbau eines Grundlagenverständnisses, um die Wichtigkeit von Vertrauen im Rahmen der Forschungsfrage aufzuzeigen.4
I. Annäherung an das Konstrukt Vertrauen
Ursprünglich auf das gotische Worttrauanzurückgehend, ist das Wort Vertrauen seit dem 16. Jahrhundert bekannt. Es charakterisiert ein Phänomen, das in unsicheren und risikohaften Situationen auftritt, gleichzeitig aber auch ein positives, motivierendes Moment hat.5Der Umgangssprache entlehnt, beschreibt das Oxford Diktionär Vertrauen als
„Firm belief in the reliability, truth, ability, or strength of someone or something, acceptance of the truth of a statement without evidence or investigation [as well as] the state of being responsible for someone or something…”6
Anders ausgedrückt, ist es die Erwartung nicht durch Handlungen anderer benachteiligt zu werden, so dass Vertrauen eine unverzichtbare Grundlage einer jeden Kooperation darstellt. In Momenten der Interaktion steht Vertrauen auch stets im Zusammenhang mit Verantwortung, so dass der Vertrauensnehmer dafür verantwortlich ist, das ihm entgegengebrachte Vertrauen angemessen zu honorieren.7Allgemein herrscht Einigkeit darüber, dass Vertrauen ein wünschenswerter Zustand ist und dass der Existenz vertrauensvoller Beziehungen positive Korrelate bestätigt werden. So hegt der Vertrauende auch bestimmte Erwartungen hinsichtlich der vertrauensvollen Beziehung. Dennoch lässt sich dieser alltagspsychologische Konsens nicht unmittelbar auf die wissenschaftliche Analyse übertragen.8
4Aufgrund dieser Eingrenzung werden die theoretischen Ansätze, wie die Neue Institutionenökonomie explizit aufgrund des Fokus der Diplomarbeit nicht eingehend beleuchtet. Auch die ausgewählten Modelle der Vertrauensgenese stellen eine Auswahl des Autors dar. Zur Vertiefung der theoretischen Ansätze empfiehlt sichNaujox,K. (2009), S. 21-38, S. 39-56.
5Vgl.:Naujox,K. (2009), S. 9.
6O.V.:(2010d).
7Vgl.:o.V.(2010e).
8Vgl.:Schweer,M.,Thies,B. (2003), S. 3.© Petra Köhler, 2010.
Page 9
Vertrauen4
Auch wenn sich die Vertrauensforschung beginnt zu systematisieren, wird im weiteren Verlauf aufgezeigt werden, dass der Begriff des Vertrauens ein multifaktorielles und vielschichtiges Konstrukt ist, welches je nach Blickwinkel der Forschung unterschiedliche Definitionen, Erklärungsansätze und Herangehensweisen aufweist.9So sollen die folgenden Ausführungen das Konstrukt des Vertrauens interdisziplinär kurz systematisieren, ohne wissenschaftliche Vollständigkeit zu postulieren.
Vertrauen erfreut sich eines regen interdisziplinären Interesses, da unumstritten ist, dass ohne ein Mindestmaß an Vertrauen die einfachsten und alltäglichsten Dinge nicht möglich wären.10Ähnlich sieht dies Luhmann und beschreibt Vertrauen als
„…elementare[n] Tatbestand des sozialen Lebens [und verweist darauf, dass der Mensch] ohne jegliches Vertrauen … morgens sein Bett nicht verlassen [könnte]. Unbestimmte Ängste, lähmendes Entsetzen befielen ihn.“11
Grund genug, dass sich ursprünglich zur Philosophie, Soziologie, Psychologie nun auch vermehrt die Ökonomie, Verhaltensökonomie und Pädagogik mit der Beleuchtung des Konstrukts befassen.12
In der Philosophie hat Hobbes mit seinem Leviathan13die Grundlagen für die Beschäftigung mit dem Thema Vertrauen gelegt, welcher maßgeblich die rationalitätstheoretischen Theorien beeinflusst hat. Danach wird Vertrauen stets dann benötigt, wenn Personen im gegenseitigen Austausch, Leistungen oder Güter nicht zeitgleich übergeben. Motiv des gegenseitigen Vertrauens ist die Wahrung der eigenen Präferenzen und Interessen.14
Aus dem Blickwinkel der Soziologie betrachtet, stehen hier Vertrauen in Interaktionsbeziehungen sowie gesellschaftliche Auswirkungen des Vertrauensmechanismus im Fokus. Als wichtige Vertreter finden sich hier Luhmann15mit seinem systemtheoretischen Ansatz und Coleman16mit seinem Rational-Choice-Ansatz wieder. In der Ökonomie sind die von Coase17entwickelte und von Williamson18erweiterte Transaktionskosten- sowie die Pricipal-Agent-Theorie zu benennen, welche Vertrauen als wichtige
9Vgl.:Moranz,C. (2005), S. 7, 18.
10Vgl.:Zucker,L. (1986), S. 56.
11Luhmann,N. (2000), S. 1.
12Vgl.:Naujox,K. (2009), S. 9.
13Entstand 1651 und ist eines der bedeutendsten Werke der politischen Philosophie. Leviathan ist dem biblisch-mythologischen Seeungeheuer Leviathan entlehnt, vor dessen Allmacht jedweder menschliche Widerstand zuschanden werden muss. Ähnlich sieht Hobbes, mit seinem absolutistischen Politikverständnis, den Staat, welcher damit zum Gegenstück des durch das Ungeheuer Behemoth personifizierten Naturzustandes wird. Siehe auchHobbes,T. (1996).
14Vgl.:Hartmann,M.(2001), S. 10f,Naujox,K. (2009), S. 8.
15Vgl.:Luhmann,N. (2000).
16Vgl.:Coleman,J. S. (1995).
17Vgl.:Coase,R. (1937), S. 386-405.
18Vgl.:Williamson,O. E. (1975).© Petra Köhler, 2010.
Page 10
Vertrauen5
Komponente berücksichtigen. Hier wird postuliert, dass Vertrauen als rationales Kalkül Transaktionskosten senken kann.19
Als immer noch zentrale Theorie innerhalb der Psychologie, gelten die Ansätze von Erikson20, Rotter21und Deutsch22. Sowohl bei Erikson als auch bei Rotter gilt Vertrauen als personale Variable im Sinne einer stabilen Persönlichkeitseigenschaft. Nach Erikson muss ein Individuum bereits in der frühesten Kindheit ein Urvertrauen im Sinne eines sich auf die Welt verlassen können insgesamt sowie auf seine Bezugspersonen erwerben, um zur gesunden Persönlichkeit heranzuwachsen. Rotter hingegen setzt eine vertrauensvolle Grundhaltung als Ergebnis von Erfahrungen in der jeweiligen sozialen Lerngeschichte voraus. Danach ist Vertrauen eine generalisierte Erwartungshaltung gegenüber anderen, in der ein Individuum zunächst einen Vertrauensvorschuss gewährt. Die Hauptdimensionen sind hier demnach Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit.23Diametral entgegen steht Deutsch mit der Auffassung von Vertrauen als situativ bestimmte Handlungsentscheidung, die aus einer konkreten Situation erwächst. Er sieht vertrauensvolles Handeln als beobachtbares Verhalten, das die eigene Verwundbarkeit steigert und gegenüber jemandem erfolgt, der nicht der eigenen Kontrolle unterliegt. Das vertrauensvolle Verhalten wird nur dann gezeigt, wenn der Schaden, welcher erlitten würde, größer ist als der gewonnene Nutzen.24Beispielhaft kann hier das Gefangenendilemma25herangezogen werden. Wählt die Versuchsperson den kooperativen Zug und der Spielpartner den kompetitiven, tritt der größtmögliche Verlust ein. Daher ist die Wahl der Kooperation mit Vertrauen gleichzusetzen, da darauf vertraut wird, dass der andere ebenfalls kooperiert.26
Schweer widerspricht, aufgrund empirischer Befunde, der impliziten Annahme, Misstrauen sei das Gegenteil von Vertrauen. Er argumentiert, dass aufgrund der kognitiven Komplexität deutliche interindividuelle Unterschiede existieren, wonach zwischen Misstrauen und Nichtvertrauen unterschieden werden muss. So bedeutet einem Interaktionspartner nicht zu misstrauen nicht zwangsläufig, dass ihm vertraut wird. Wichtig
19Da die Theorien aus Platzmangel nicht weiter ausgeführt werden können, empfiehlt sich als Übersicht:Köszegi,S. (2001) für den systemtheoretischen und den Rational-Choice-Ansatz, sowieRippergerT. (2003) für die Transaktionskosten- sowie die Principal-Agent-Theorie sowieDoney,P.,Cannon,J. P.(1997), S. 36.
20Vgl.:Erikson,E. H. (1966).
21Die von ihm entwickelte soziale Lerntheorie untersucht menschliches Verhalten in komplexen Situationen und versucht es zu erklären und vorherzusagen, vgl.:Rotter,J. (1954), S. 85,Rotter,J. B. (1971), S. 443-452.
22Vgl.:Deutsch,M. (1958), S. 265-279,Deutsch,M. (1973).
23Vgl.:Schweer,M.,Thies,B. (2003), S. 5ff.
24Vgl.:Zand,D. (1977), S. 230.
25Zur Erklärung des Gefangenendilemmas siehe:Sieg,G. (2005), S. 4ff.