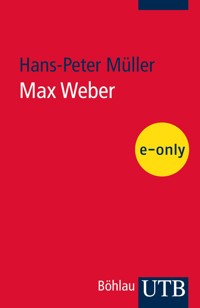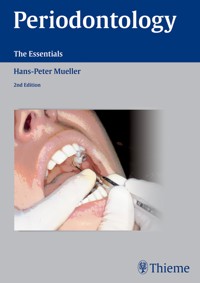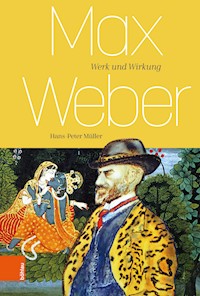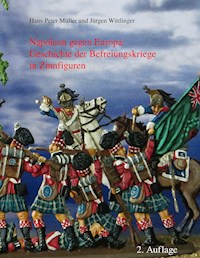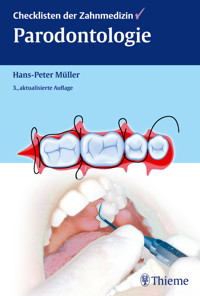23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Alle »klassischen« Soziologen des 19. und 20. Jahrhunderts versuchten, die große Transformation von der vormodernen zur modernen Gesellschaft zu verstehen und zu erklären. Sie beschritten dazu neue theoretische wie methodische Wege und legten paradigmatische Analysen vor, die in zündenden Zeitdiagnosen gipfelten. Ihre Stichworte lauten: Demokratie (Tocqueville), Kapitalismus (Marx), Moral (Durkheim), Kultur (Simmel) und Rationalisierung (Weber). Krise und Kritik stellt die Deutungsversuche dieser Klassiker in fünf Porträts vor, bettet sie in allgemeine Überlegungen zur Moderne ein und zeigt, dass ihre Problemlagen noch immer die unseren sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 661
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
3Hans-Peter Müller
Krise und Kritik
Klassiker der soziologischen Zeitdiagnose
Suhrkamp
Widmung
4Für Katrin
Übersicht
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Vorwort
1. Soziologie und Moderne
1.1 Die Entstehung der Soziologie und der Moderne
1.2 Der Begriff der Moderne
1.3 Die drei Revolutionen der Moderne
1.4 Die »Zeichen der Zeit« verstehen – Über soziologische Zeitdiagnostik
2. Alexis de Tocqueville und die politische Revolution
2.1 Tocqueville und die deutsche Soziologie
2.2 Tocqueville – Aristokrat zwischen allen Stühlen
2.3 Demokratie und die moderne Lebensweise
2.4 Die liberale Demokratie in den Vereinigten Staaten – Eine historisch-empirische Bestandsaufnahme
2.5 Die Revolutionierung des
Ancien Régime
– Der Versuch einer gesellschaftsgeschichtlichen Erklärung
2.6 Demokratie und Individualismus als moderne Lebensform
3. Karl Marx und die ökonomische Revolution
3.1 Sozialismus als wahrer Humanismus
3.2 Karl Marx – Rabbinerenkel, Protestant, Revolutionär und politischer Messias
3.3 Die Zeitdiagnose – Das Gespenst der kommunistischen Revolution
3.4 Das praxisphilosophische Grundmodell
3.5 Der entwicklungstheoretische Rahmen – Materialistische Geschichtsauffassung und gesellschaftliche Evolution
3.6 Die strukturtheoretische Analyse – Kapitalismus und Ausbeutung
3.7 Die Klassentheorie als handlungstheoretische Basis der ökonomischen Krisentheorie
3.8 Wissenschaftlicher Sozialismus und politischer Messianismus
4. Émile Durkheim und die moralische Revolution
4.1 Institutioneller Individualismus
4.2 Émile Durkheim – Rabbinersohn, Laizist und Soziologe
4.3 Die historische Krisensituation in Frankreich
4.4 Durkheims Forschungsprogramm
4.5 Arbeitsteilung und organische Solidarität
4.6 Das Unbehagen in der modernen Gesellschaft – Selbstmord und Anomie
4.7 Das Bild der wohlgeordneten Gesellschaft – Institutionelle Reformen und moralischer Individualismus
4.8 Grundformen menschlicher Existenz – Religion und Erkenntnis
4.9 Soziologie der Moral – moralisierende Soziologie?
5. Georg Simmel und die kulturelle Revolution
5.1 Simmel – ein soziologischer Klassiker?
5.2 Georg Simmel – Soziologie und Berlin
5.3 Soziologie als moderne Wirklichkeitswissenschaft
5.4 Gesellschaftliche Differenzierung, Geldwirtschaft und Urbanität
5.5 Moderne Kultur und Lebensstil
5.6 Erfüllte Individualität – Das individuelle Gesetz
5.7 Die Ambivalenz von Modernität und Individualität
6. Max Weber und die institutionelle Revolution der Rationalisierung
6.1 Max Webers Problemstellung
6.2 Max Weber – ein (groß-)bürgerlicher Marx?
6.3 Das Forschungsprogramm
6.4 Die strukturelle Konfiguration der Moderne
6.5 Die kulturelle Genealogie des Kapitalismus – Die protestantische Ethik
6.6 Die Rationalisierung der Welt – Wertsphären und Lebensführung
6.7 Ambivalenzen der Moderne und autonome Lebensführung
7. Die große Erblast der soziologischen Klassik: Gesellschaftstheorie, Gesellschaftsanalyse und Gesellschaftskritik heute
Literatur
Namenregister
Sachregister
Fußnoten
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
9Vorwort
Die klassischen soziologischen Theorien befassen sich mit drei grundlegenden Themenkomplexen: 1. Ihr zentrales Problem ist die »Große Transformation« agrarisch-feudaler Ständegesellschaften in industriell-kapitalistische Klassengesellschaften. Kurz gesagt: Es geht um das Verhältnis von Tradition und Moderne. 2. Um dieses Problem wissenschaftlich untersuchen zu können, werden Gegenstand (das »Soziale«), Begriffe (wie »Gesellschaft«), Theorien (Handlungs-, Organisations- und Ordnungstheorie) und Methoden (»Verstehen« und »Erklären«) entwickelt. So entsteht eine neue Wissenschaft: die Soziologie. Kurz gewendet: Es geht um das Verhältnis von Soziologie und Moderne. 3. Auf dieser Grundlage – zentrale Problemstellung und neue Wissenschaft – erfolgen Analysen der Großen Transformation, die in eine kritische Gesellschafts-, Kultur- und Zeitdiagnose einmünden und häufig mit Appellen zu »Revolution« oder »Reform« verbunden sind. Kurz gefasst: Es geht um das Verhältnis von Soziologie und kritischer Zeitdiagnose.
Dieses Programm der klassischen soziologischen Theorien wird im Folgenden an den Arbeiten von Alexis de Tocqueville, Karl Marx, Émile Durkheim, Georg Simmel und Max Weber illustriert. Diese fünf sozialwissenschaftlichen Klassiker haben in besonderem Maße zu unserem Grundverständnis der modernen Gesellschaft beigetragen. Im Vordergrund stehen Transformationsprobleme und -analysen, erst in zweiter Linie geht es um Begriffs- und Theoriebildung. In dieser Verknüpfung von Ideen- und Theoriegeschichte mit den jeweiligen Gesellschaftstheorien, Gesellschaftsanalysen und Gesellschaftskritiken wird die Aktualität der Klassiker besonders sichtbar. Denn sie untersuchen meist das Verhältnis von Wirtschaft, Politik und Kultur und reagieren auf die drei Revolutionen der Moderne: 1. die ökonomische Revolution und die Entstehung des Kapitalismus; 2. die politische Revolution und die Heraufkunft der Demokratie; 3. die kulturelle Revolution und die Genese des Individualismus. Kapitalismus, Demokratie und Individualismus umschreiben die Werte- und Institutionenkonstellation, die auch heute noch westliche Gesellschaftsformationen (und mittlerweile natürlich nicht nur diese) auszeichnet. Wer sich mit der Geschichte 10der soziologischen Klassik intensiv auseinandersetzt, wird deshalb viel über unsere heutige Gesellschaft verstehen lernen. Mein großer Dank gilt Florian Eyert, Cosima Langer, Steven Sello, Jakob Schultz und Laurin Schwartz für ihre Hilfe bei der Endredaktion des Bandes, der ursprünglich als Lehrbrief für die Fernuniversität Hagen (2017) verfasst und für die vorliegende Publikation gründlich überarbeitet worden ist. Eva Gilmer, Philipp Hölzing und Jan-Erik Strasser vom Team Suhrkamp Wissenschaft haben mit ihrer Expertise dem Band den letzten Schliff verpasst.
Hans-Peter Müller, im Oktober 2020
111. Soziologie und Moderne
1.1 Die Entstehung der Soziologie und der Moderne
Die Soziologie als Wissenschaft entsteht nicht im luftleeren Raum. Vielmehr ist sie selbst das Produkt jener »Großen Transformation«, in der jener Gesellschaftstyp sich allmählich herauskristallisieren sollte, den wir heute kurzerhand die Moderne nennen. Deshalb gilt die Soziologie, die sich akademisch erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts an den Universitäten durchzusetzen beginnt, nach wie vor als eine relativ junge Wissenschaft. Natürlich hat sie einen außeruniversitären Vorlauf und setzt als eigenständige Denkform in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein. Henri de Saint-Simon (1760-1825), August Comte (1798-1857) und Alexis de Tocqueville (1805-1859) in Frankreich, Karl Marx (1818-1883) in Deutschland und im englischen Exil sowie der Brite Herbert Spencer (1820-1903) haben Soziologie betrieben, aber eben nicht als Professoren an einer Universität. Saint-Simon war Ingenieur und Lebenskünstler, Comte erst sein Sekretär, dann als Privatgelehrter selbständig, Alexis de Tocqueville war Aristokrat, Politiker und Privatier, Karl Marx war Journalist und Revolutionär, Herbert Spencer war Eisenbahningenieur und Mitbegründer des Economist. Erst mit der Generation von 1890-1920 sollte die Soziologie langsam Eingang in die Universität finden: Émile Durkheim erhält an der Universität von Bordeaux als erster Franzose eine soziologische Stelle, Georg Simmel müht sich als Philosoph redlich an der Berliner Universität, bleibt aber 38 Jahre Privatdozent ohne Bezüge und muss einen Kurs in der ungeliebten Soziologie unterrichten. Max Weber ist Jurist und Nationalökonom und als solcher an den Universitäten Berlin, Freiburg, Heidelberg, Wien und München tätig – bezeichnenderweise aber erst einmal nicht als Soziologe, sondern als Nationalökonom, der erst in seiner letzten Tätigkeit in München neben den Denominationen Nationalökonomie und Wirtschaftsgeschichte Soziologie unter dem Titel Gesellschaftslehre aufnehmen ließ, obwohl gerade er neben Karl Marx das soziologisch bekannteste Werk hinterlassen haben dürfte.
Wenngleich die Institutionalisierung der Soziologie als Fach an der Universität schleppend und diskontinuierlich vorangeht, 12ist diese neue Wissenschaft doch von Anfang darauf gerichtet, die »Große Transformation« zu studieren. Der soziale Wandel wird auf diese Weise durch die Soziologie als Begleitforschung beobachtet und nolens volens tragen die Sozialwissenschaften ihrerseits zu dem Selbstverständnis moderner Gesellschaften bei, die sie als Gegenstand untersuchen.[1] Gesellschaftstheorie, -analyse und -kritik, vor allem soziologische Zeitdiagnosen, sickern als Aufklärungs-, Orientierungs- und Sinngeber in die Kultur und den Sprachgebrauch der Gesellschaft ein und erlangen auf diese Weise Bedeutung. Das ist natürlich ein schleichender Prozess, sozial unauffällig – keiner merkt’s – und allmählich – also alles andere als spektakulär oder revolutionär. Nur weil der Einfluss der Sozialwissenschaften unterhalb der gesellschaftlichen Aufmerksamkeitsschwelle verbleibt, heißt das jedoch keineswegs, dass dieser folgenlos oder gar unbedeutend gewesen wäre. Im Gegenteil: Die Sozialwissenschaften drücken zum einen aus, was in der Gesellschaft vor sich geht; sie prägen neue Begriffe und entwickeln neue Theoreme. Zum anderen drücken sie damit aber auch den Gesellschaften ihren Stempel auf und formen so ihr Selbstverständnis und damit das Gesellschaftsbild gleich mit. Die Soziologie ist ein Träger der Historizität, wie Alain Touraine das Phänomen nennt, dass moderne Gesellschaften große Anstrengungen unternehmen, sich selbst zu verstehen und ihren voraussichtlichen Gang in die Zukunft zu bestimmen.[2] Die Soziologie ist der Spiegel der Gesellschaft.
Man mache die Nagelprobe und sehe sich Begriffe an, die unser Verständnis und Selbstverständnis noch heute prägen. Man wird feststellen, dass die Sozialwissenschaften in der einen oder anderen Weise oft an ihrer Kreation mitgewirkt haben. Eine kleine Auswahl mag diesen Zusammenhang illustrieren: Industriegesellschaft nennt Saint-Simon die modernen Gesellschaften; Kapitalismus, nicht der Begriff, der auf Werner Sombart zurückgeht,[3] aber die Sache und ihre Theorie, wurde von Marx analysiert, und unter dem Kapitalismus leben wir noch heute; Demokratie ist nicht nur eine Regierungsform, sondern prägt auch eine moderne Gesellschafts- und Lebensform, wie uns Alexis de Tocqueville gelehrt hat. Er konzeptualisiert auch den Begriff des Individualismus, dessen Wertgehalt 13das moralische Selbstverständnis der Moderne noch heute informiert; Rationalisierung ist wohl der Motor der Modernisierung und ein Mechanismus sozialen Wandels, den Max Weber zum Kern seiner Theorie der Moderne gemacht hat; Solidarität gilt zwar als ein Kampfbegriff der Arbeiterbewegung, aber in Gestalt der von Émile Durkheim analysierten »organischen Solidarität« verweist sie auf die Integrationsprobleme moderner Gesellschaften, angesichts von wachsender Arbeitsteilung, technischem Fortschritt und beruflicher Spezialisierung noch so etwas wie gesellschaftlichen Zusammenhalt sicherzustellen. Industriegesellschaft und Kapitalismus, Demokratie und Individualismus, Rationalisierung und Solidarität sind heute längst Alltagsbegriffe geworden, ja Allerweltsvokabeln, die jeder im Munde führt, ohne sich noch groß Gedanken um deren Herkunft zu machen. Begriff und Sinngehalt stammen aber häufig aus der Soziologie und sind dort im Kontext einer Gesellschaftstheorie, Gesellschafsanalyse und Gesellschaftskritik entwickelt worden.
Das wird sich zeigen, wenn wir uns den soziologischen Klassikern zuwenden. Denn dann wird die Wechselwirkung zwischen Soziologie und Moderne vollends deutlich werden. Wer vom Rathaus kommt, ist bekanntlich schlauer. Von heutiger Warte, so scheint es, lassen sich die soziologischen Klassiker alle auf einen gemeinsamen, wenn auch hoch abstrakten Nenner bringen: das Projekt der Moderne.[4] So unterschiedlich die soziologischen Zeitdiagnosen im Einzelnen ausfallen mögen, so teilen sie doch den thematischen Bezugspunkt: »Die Moderne verstehen«.[5] Bevor jedoch die Gemein14samkeiten wie die Unterschiede der Ansätze zutage treten und damit das Verständnis der Klassiker rekonstruiert wird, sind jedoch drei weitere Schritte vonnöten.
Im ersten Schritt gilt es zu verstehen, was modern eigentlich heißt und welche Grundpfeiler der Modernität sich soziologisch ausmachen lassen. In gebotener Kürze ist deshalb zunächst ein knapper, begriffsgeschichtlicher Rückblick notwendig, um die verschiedenen Bedeutungs- und Verwendungsweisen von modern, Moderne und Modernität kennenzulernen. In einem zweiten Schritt gilt es sodann, die wesentlichen Modernisierungserfahrungen, auf die die klassischen Soziologen reagieren, in Grundzügen zu skizzieren. Mit der notwendigen Abstraktion und dem Mut zur Vereinfachung lässt sich daraus ein formaler Bezugsrahmen ableiten, der die nachfolgenden Kapitel systematisch anleiten soll. Im dritten und letzten Schritt werden die soziologische Zeitdiagnostik und ihr Handwerkszeug unter die Lupe genommen. Da die vorliegende Rekonstruktion der soziologischen Klassik an ihren Gesell15schafts-, Kultur- und Zeitdiagnosen ansetzt, muss genauer überlegt werden, wie man eigentlich Zeitdiagnosen stellt. Wie verfährt die Soziologie, um die »Zeichen der Zeit« zu verstehen?
1.2 Der Begriff der Moderne
Der Begriff »modern« ist interessanterweise keineswegs neu.[6] Erstmals 494 nach Christus nachgewiesen, taucht er in verschiedenen Bedeutungen in Spätantike und Mittelalter auf, wobei die wichtigste die Distinktion »antiqui/moderni« ausmacht. Meist geht es um die »Verteilung von Lob und Tadel«,[7] mit dem ein Autor je nach Gusto Philosophie oder Literatur bedachte.
Ohne in die Begriffsgeschichte en détail einzutauchen, lassen sich aus soziologischer Sicht drei Bedeutungen systematisch unterscheiden:
modern im Sinne von gegenwärtig, momentan dominierend, gerade gültig – dies verweist auf Moderne als Epochenbegriff;
modern im Sinne von neu als Gegenbegriff zu alt – dies verweist auf die Moderne als Programm oder, wie Habermas sagt, als »Projekt«;
modern im Sinne von vorübergehend – dies geht auf Charles Baudelaires Verwendungsweise zurück. In »Der Maler des modernen Lebens« aus dem Jahre 1859/1860 versucht Baudelaire modern via »modernité« zu fassen. »Die Modernität«, so definiert er, »ist das Vorübergehende, das Entschwindende, das Zufällige, ist die Hälfte der Kunst, deren andere Hälfte das Ewige und Unabänderliche ist.«[8] Damit liest Baudelaire in folgenreicher Weise zusammen, was bislang stets getrennt war: Einerseits verweist modern auf Mode und deren schnellen Wechsel, nicht auf die gerichtete Teleologie der Moderne und deren ein16zelne Stufen und Etappen – das meint »das Vorübergehende, das Flüchtige und das Kontingente« in der Kunst. Andererseits jedoch verschwindet das Traditions- und Ewigkeitsbedürfnis nicht einfach. Es heftet sich jetzt nur an den Träger des Flüchtigen, die Mode, und das Ewige wie das Unveränderliche blitzen bloß noch momenthaft auf. Baudelaires Bestimmung sollte vor allem für die kulturelle Moderne und dort an erster Stelle für die Kunst wichtig werden. In der Soziologie hat sich diese Lesart trotz der Bemühungen Georg Simmels und Walter Benjamins nicht durchsetzen können. Das ändert sich erst mit dem Diskurs über die Postmoderne,[9] die Baudelaires ästhetische Bestimmung aufnimmt und mit der Behauptung von einem »Ende der Metaerzählung« verbindet. Freilich – als performativer Selbstwiderspruch sollte der postmoderne Diskurs paradoxerweise selbst ein großes Narrativ anbieten,[10] das die klassische Moderne verabschieden sollte. Obgleich dieser französische Diskurs aus den 1980er Jahren 1989 mit dem Wiedereintritt in die Geschichte schlagartig verstummte, kann er zu analytischen Zwecken gut den erneuten Wandel der Modernität illustrieren. Im Bereich von Erkenntnis und Wissen markiert er den Wandel vom Universalismus zum Relativismus und den Übergang von der Wahrheit zu den Wahrheiten. Im Bereich von Ethik und Moral signalisiert er den Übergang von rechtfertigungsfähigen Werten und Normen zu ästhetisch vielfältigen Wertmaßstäben. In temporaler Hinsicht scheint an die Stelle vom ewigen Fortschritt des »Höher, schneller, weiter« die Zyklizität mit der ewigen Wiederkehr des Gleichen zu treten, so dass der Postmoderne ein ahistorisches Bewusstsein attestiert wurde.
Abbildung 1: Moderne und Postmoderne
Weder die historische Verwendungsweise – Moderne als Epoche – noch die künstlerische Verwendungsweise – Moderne als Durchgangsstadium –, so meine These, spielen in der Soziologie eine 18maßgebende Rolle. Vielmehr steht die Moderne als Programm im Mittelpunkt. Es stellt sich daher die Frage, auf welche Grundzüge der Moderne das soziologische Augenmerk hauptsächlich gerichtet ist und welche Felder der Modernisierung die soziologische Zeitdiagnostik vorzugsweise betrachtet.
1.3 Die drei Revolutionen der Moderne
Es ist in erster Linie die »Große Transformation« von der Tradition zur Moderne, die alle klassischen Soziologen umtreibt. Was versteht man unter einer Transformation, die so bedeutend zu sein scheint, dass man sie mit großem »G« schreibt? Und worauf spielt der Umbruch von der Tradition zur Moderne an? Wie immer, wenn es zu Großschreibungen, zu Substantivierungen und zur Singularisierung kommt – die Tradition, die Moderne statt Traditionen und Modernitäten –, scheint es sich um ein wirklich einschneidendes Ereignis oder einen gravierenden Prozess zu handeln. Nach diesem Ereignis oder Prozess ist nichts mehr so wie vorher, eine alte Welt ist untergegangen und eine neue Welt entstanden. Für Schlüsselereignisse oder -prozesse dieser Art hat sich der Begriff »Revolution« eingebürgert, vor allem wenn der Umbruch radikal, schnell und nachhaltig erfolgt.
Die Formel von der »Großen Transformation« stammt von Karl Polanyi, der damit eindringlich die Bedingungen und Voraussetzungen, die Prozesse und Mechanismen, den Verlauf und die Konsequenzen der Entstehung kapitalistischer Wirtschafts- und Lebensverhältnisse in England beschreibt. Wer die Vorgeschichte der Industrialisierung und die Heraufkunft des Kapitalismus verstehen will, kommt an Polanyi nicht vorbei.[11]
In der Soziologie hat sich diese Formel von der »Großen Transformation« durchgesetzt, um den Wandel von einer agrarisch-ländlich, feudal-ständisch bestimmten Gemeinschaft zu einer industriell-städtischen, klassenstrukturierten Gesellschaft zu charakterisieren. Wie sehr der konstruierte Gegensatz zwischen der Tradition und der Moderne durchschlägt, um die Wasserscheide zu markieren, zeigt schon die dichotome Begriffsbildung an: agra19risch-industriell, ländlich-städtisch, Stände versus Klassen, Gemeinschaft versus Gesellschaft.[12] In der Gründungsphase der Soziologie wird der Kern der Begrifflichkeiten bestimmt, der unser Selbstverständnis von Moderne einerseits und unser Verständnis von anderen, als traditional geltenden Formen von Gesellschaft andererseits bis auf den heutigen Tag informiert (siehe Abbildung 2). Eine dimensionale Auffächerung der Gesellschaft nach den beiden Säulen von Traditionalität und Modernität ergibt dann folgende zwei Gesellschaftsbilder: Die alte Sozialstruktur ist homogen und stabil, die moderne heterogen und mobil. Die soziale Kontrolle ist im ersten Fall direkt, im zweiten Fall indirekt. Das traditionale Werte- und Normensystem ist konsistent und einfach, das moderne dagegen inkonsistent und komplex. Die gesellschaftliche Position wird im ersten Falle durch die Tradition bestimmt, während sie im zweiten Fall durch Leistung erworben wird. Folglich fallen technische Innovationen in traditionalen Gesellschaften gering aus, werden obendrein negativ sanktioniert und sorgen kaum für eine erhöhte Produktivität. In modernen Gesellschaften dagegen fallen technische Innovationen zahlreich aus, sind erwünscht, also positiv sanktioniert, und ermöglichen eine hohe Arbeitsproduktivität. Der dominante Wirtschaftssektor in traditionalen gesellschaftlichen Verhältnissen ist agrarisch, die Siedlungsform ländlich und die dominante Sozial- und Lebensform die personal vermittelte Gemeinschaft. Demgegenüber dominiert der industrielle Sektor in modernen gesellschaftlichen Verhältnissen, die dominante Siedlungsform ist städtisch, und die vorherrschende Sozial- und Lebensform beruht auf der organisatorisch vermittelten Gesellschaft. Traditionale Herrschaftsverhältnisse werden vom Patrimonialismus auf der Basis der Heiligkeit von Traditionen (»Es war schon immer so!«) regiert, sei es der pater familias in der Gemeinschaft des Haushaltes, sei es der Fürst an seinem Hof. Moderne Herrschaftsverhältnisse beruhen auf einer rationalen Bürokratie, die sich durch die Legalität ihrer Satzungen legitimiert. Die Aggregation der Interessen in einem traditionalen Sozialraum fällt niedrig und lokal aus; politisch formierte Stände verfügen über geringe, und wenn, dann spontane Partizipation. In einem modernen Sozialraum sorgen ökonomisch formierte Klassen für eine hohe und zentralisierte Aggregation der 20Interessen sowie für eine starke und institutionalisierte Form der politischen Partizipation. In traditionalen Gesellschaftskonfigurationen werden Konflikte unterdrückt oder gewaltsam ausgetragen, die Kommunikation ist persönlich und direkt. In modernen Gesellschaftskonfigurationen werden Konflikte formalisiert und friedlich ausgetragen, und die Kommunikation ist medial vermittelt.
Tradition
Moderne
Agrarisch
Industriell
Ländlich
Städtisch
Stände
Klassen
Gemeinschaft
Gesellschaft
Homogene stabile Sozialstruktur
Heterogene, mobile Sozialstruktur
Direkte soziale Kontrolle
Indirekte soziale Kontrolle
Konsistentes und einfaches Werte- und Normensystem
Inkonsistentes und komplexes Werte- und Normensystem
Positionenvergabe nach Tradition
Positionenvergabe nach Leistung
Technische Innovation gering und negativ sanktioniert
Technische Innovation zahlreich und positiv sanktioniert
Geringe Arbeitsproduktivität
Hohe Arbeitsproduktivität
Traditionale Herrschaft
Rationale Herrschaft
Konflikte werden unterdrückt oder gewaltsam ausgetragen
Konflikte werden formal und friedlich augetragen
Personale und direkte Kommunikation
Medial vermittelte Kommunikation
Abbildung 2: Traditionalität und Modernität (nach M. Rainer Lepsius, Interessen, Ideen und Institutionen, Opladen 1990, S. 217 f.)
Es ist dieser bahnbrechende Prozess der »Großen Transformation« von der Tradition zur Moderne, der das Denken der soziologischen Klassik dominiert. Aber wie hat er sich vollzogen? Wenn man nicht historisch argumentiert, sondern soziologisch und damit strukturell, wird man auf drei Phänomene aufmerksam machen, um den revolutionären Charakter dieses Vorgangs systematisch zu verdeutlichen. Es sind drei struktur- und ereignisgeschichtliche Eckpfeiler 21der »Großen Transformation«,[13] drei bahnbrechende Revolutionen in drei verschiedenen Ländern, welche die Bezugsereignisse für die soziologische Klassik darstellen:
1. In England ist es die ökonomische Revolution. Der technologische Fortschritt (die Erfindung der Dampfmaschine), die Landreform und die Freisetzung von Arbeitskräften (vom arbeitslosen Landarbeiter zum beschäftigten Industriearbeiter oder Proletarier) mit der Folge der Entstehung eines Arbeitsmarktes, die Trennung von Kapital und Arbeit sowie die Trennung von Betrieb und Haushalt mit der Folge der Entstehung von Finanz- oder Kapitalmärkten, die Reorganisation der Arbeit (von der Manufaktur zur Fabrik), die Rationalisierung des Rechtssystems mit der Vorstellung von Eigentumsrechten, Vertragsrechten und der Kalkulierbarkeit wirtschaftlichen Handelns in einem nationalstaatlich garantierten Rechtsverband («Rechtsstaat«) – alle diese Entwicklungen zusammen genommen machten den modernen Industriekapitalismus möglich. Das impliziert die Umstellung von agrarischer zu industrieller Produktionsweise, aber auch den Übergang von ländlicher zu städtischer Lebensweise.
2. In Frankreich ist die politische Revolution und die Heraufkunft der Demokratie entscheidend. Die Französische Revolution stimmt auch auf dem alten Kontinent Europa das Hohelied der Demokratie an, welches in der neuen Welt von Amerika bereits so erfolgreich geprobt worden war. Aus Monarchien und Aristokratien werden in der Folge Republiken. Die Vorstellungen von »Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit« machen aus den Untertanen souveräne Bürger mit Menschen- und Bürgerrechten; Politik wird von einem arkanen Eliteunternehmen hinter verschlossenen Türen zur öffentlichen Angelegenheit aller Mitglieder der Gesellschaft; der Staat wird von einem königlichen oder fürstlichen Militär- und Polizeiinstrument zum vernünftigen institutionellen Rahmen der Demokratie. Trotz der egalitären Ideale von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit sind die souveränen Bürger freilich in Klassen, wenn auch nicht länger in Stände eingeteilt, die aber idealiter über gleiche »citizenship«-Rechte verfügen.
3. In Deutschland, dem Land der Dichter und Denker, ist 22schließlich die kulturelle Revolution und die Heraufkunft des Individualismus von zentraler Bedeutung. In der Literatur wird meist nur von einer Doppelrevolution – der ökonomischen: Industrialisierung und Kapitalismus, der politischen: Demokratisierung – gesprochen, um den Weg zur Moderne zu erläutern. Aus soziologischer Sicht erscheint es indes notwendig, auch die geistigen Voraussetzungen dieser Doppelrevolution zu untersuchen, wie sie durch das Christentum und die Aufklärung, die Renaissance und die Reformation vorbereitet wurden. Talcott Parsons nennt sie Bildungsrevolution, um auf den engen Konnex von Wissenschaft, Bildung und Universität hinzuweisen.[14] Ich ziehe den Begriff der kulturellen Revolution vor, um den Übergang vom Kollektivismus, wie er traditionale Gesellschaften auszeichnet, zum Individualismus, den wir in modernen Gesellschaften antreffen, zu bezeichnen. Zwar spielt die Wissenschaft eine entscheidende Rolle, vor allem für die Industrialisierung und ihre neuen Technologien. Neben dieser kognitiven Komponente von Kultur sollte man darüber nicht die moralisch-ethische Dimension und die expressiv-ästhetische Dimension vergessen. Das Selbstverständnis der Moderne speist sich aus einem spezifischen Verständnis von Moral und einem bestimmten Ideal des Menschen. Historisch und systematisch kommt die kulturelle Revolution in drei Dimensionen zum Ausdruck:
erkenntnisphilosophisch im »Sapere aude«, »Wage es, zu denken«, dem Motto der Aufklärung. »Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines andern zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! Das ist das Motto der Aufklärung.«[15]
moralphilosophisch im »kategorischen Imperativ«, der Forderung also: »Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zu23gleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde.«[16]
handlungspraktisch in dem Motto: »Werde der du bist.« Was Kant philosophisch ausarbeitet, setzt Goethe erstmals in einem deutschen Bildungsroman literarisch um. Wilhelm Meisters Lehrjahre bringen sinnfällig das Selbstentfaltungsideal des modernen Individualismus zum Ausdruck, denn Wilhelm sucht über Reisen und Bildung Erfahrungen zu machen, um zu sich selbst zu finden und über diese Selbstfindung auch einen seinen Talenten und Begabungen angemessenen sowie verantwortungsvollen Platz in der Gesellschaft einzunehmen. Goethes Wilhelm Meister markiert literarisch sinnfällig den Beginn der modernen Odyssee individueller Selbstverwirklichung.[17]
Wir haben es also mit drei Gleichungen zu tun, auf die sich alle soziologischen Klassiker in unterschiedlicher Akzentuierung beziehen: die ökonomische Revolution in England, Industrialisierung und Kapitalismus; die politische Revolution in Frankreich und die Durchsetzung der Demokratie; die kulturelle Revolution in Deutschland und die Entwicklung des modernen Individualismus.
Aus dieser Konfiguration der Moderne[18] entspringen die Arbeitsgebiete der Soziologie, denn diese untersucht Wirtschaft, Politik und Kultur der modernen Gesellschaft. Es sind die Probleme und Spannungen der Moderne, ihre Strukturen und Institutionen, 24ihre Zwänge und Chancen, die sie dem modernen Lebensstil und der individuellen Lebensführung aufdrückt – alles dies wird thematisch für die Soziologie in ihrer Entstehungszeit, aber beschäftigt uns auch heute noch. Wir können diese Überlegungen in einem Schema (Abbildung 3) zur »Großen Transformation« systematisch zusammenfassen:
Feld
Ökonomie
Politik
Kultur
Vorreiterland
England
Frankreich
Deutschland
Zeit
seit ca. 1750
1789
18. Jhd.
Prozess
Industrialisierung
Demokratisierung
Individualisierung
Institutionelle Gestalt
Kapitalismus
Staat und Nation
moderne Ethik und Ästhetik
technologischer Fortschritt (»Dampfmaschine«)
Landreform und Transformation von Landarbeitern in Proletarier
Kapital und Arbeitsmarkt
Trennung von Betrieb und Haushalt
vom Untertanen zum Bürger
von der Monarchie zur Republik
gleiches Wahlrecht und citizenship
vom Kollektivismus zum Individualismus
Aufklärung: »Sapere aude«kategorischer Imperativ
Theoretiker
Adam SMITH
David RICARDO
Karl MARX
Max WEBER
Alexis de TOCQUEVILLE
Max WEBER
Émile DURKHEIM
Immanuel KANT
Georg Wilhelm F. HEGEL
Émile DURKHEIM
Georg SIMMEL
Abbildung 3: Die Große Transformation
251.4 Die »Zeichen der Zeit« verstehen – Über soziologische Zeitdiagnostik
WAGNER: Verzeiht! es ist ein groß Ergetzen / Sich in den Geist der Zeiten zu versetzen, / Zu schauen wie vor uns ein weiser Mann gedacht, / Und wie wir’s dann zuletzt so herrlich weit gebracht.
FAUST: O ja, bis an die Sterne weit!/ Mein Freund, die Zeiten der Vergangenheit / Sind uns ein Buch mit sieben Siegeln; / Was ihr den Geist der Zeiten heißt, / Das ist im Grund der Herren eigner Geist, / In dem die Zeiten sich bespiegeln.
Goethe, Faust
Wer würde nicht gern die »Zeichen der Zeit«[19] zu deuten verstehen? Je offener die Geschichte, je dynamischer der Wandel und je unsicherer die Zeiten, desto größer wird das Bedürfnis, ja die Sehnsucht nach Selbstverständigung. Wo stehen wir? Wie ist es dazu gekommen? Wohin wird die Reise gehen? So lautet der stets wiederkehrende Fragenkreis, seit die Menschheit über sich nachzudenken begonnen hat. Fern und verblasst die Zeiten, in denen der Religion und ihrer Offenbarung ein unbestrittenes Deutungsmonopol zukam. Heute dagegen tummeln sich viele Anbieter auf den Märkten des Deutungsgeschäftes. Neben den alteingeführten Betrieben wie den Kirchen mit ihrem Glaubensangebot, der universitären Philosophie und Soziologie mit ihrem Aufklärungsversprechen, den solitären Intellektuellen mit ihren kritischen Dauerreflexionsversuchen haben sich neue Supermärkte und Profitcenter der kommerziellen Deutung mit Erfolg etabliert. Allen voran die alten und neuen Medien mit bewusstseinsfesselnder Omnipräsenz durch entertainment, infotainment, edutainment. Dazu treten Werbung und Marketing, Meinungs-, Konsum- und Marktforschung, Social Media und die Potentiale von Big Data, um auch noch die letzten Sinnprovinzen der Gesellschaft aufzustöbern und auf wertvolle Profitabilitätschancen hin zu durchleuchten. »Die Vermessung der Welt«[20] schreitet unaufhaltsam voran. Kurz: Noch nie haben wir so viel über uns gewusst oder doch im Prinzip über uns 26erfahren können: Unser Empfinden und Befinden, unsere Einstellungen und Werthaltungen, unsere Gewohnheiten und Vorlieben. Allein, es scheint nicht viel zu helfen, denn die vielen kleinen Probleme und petits faits beantworten nicht die zentralen Orientierungsfragen, legen nicht den vergangenen Erfahrungsraum frei und den zukünftigen Erwartungshorizont[21] offen. Die Ironie der Geschichte: Exzessive Selbsterforschung und permanente Selbstbeobachtung garantieren weder Selbstverständigung noch automatisch Selbstverständnis. Das Gegenteil scheint der Fall zu sein, denn die übermäßige Informationsflut untergräbt die Chance für eine verbindliche gesamtgesellschaftliche Orientierung. Überinformiert und unterorientiert – so lässt sich vielleicht die zeitgenössische Lage des modernen Menschen in einer pointierten Kurzformel zusammenfassen.
Plurale Deutungskonkurrenz und konstitutive Probleme sind es, welche die Kompetenz zur vorbildlichen und verbindlichen Wirklichkeitsinterpretation untergraben. Begriff, Funktionen und Probleme der Zeitdiagnostik[22] sollen daher genauer untersucht 27werden, bevor wir uns den einschlägigen Versuchen der soziologischen Klassik zuwenden.
Eine Zeitdiagnose umschreibt stets den Versuch, die »Zeichen der Zeit« zu verstehen. Wie macht man das? In aller Regel werden einige meist besonders augenfällige Grundzüge einer Epoche, einer Gesellschaft, einer Kultur oder eines Charakters hervorgehoben, in ihren Zusammenhängen diskutiert und als vorherrschende Trends oder Tendenzen der betrachteten Einheit ausgewiesen. Exemplarisch sei dies im Folgenden jeweils an einem Beispiel für Epoche, Gesellschaft, Kultur und Charakter verdeutlicht. Mit Hilfe dieser vier Illustrationen lassen sich die zentralen Funktionen, aber auch die typischen Probleme von Zeitdiagnosen diskutieren. Was ihre Logik (siehe Abbildung 4) angeht, so befinden sie sich einerseits im Fadenkreuz von vorherrschenden Kulturproblemen, die ihnen Sinn und Bedeutung verleihen, und dem zeitgenössischen philosophischen Diskurs wie z. B. Moderne versus Postmoderne. Andererseits rekurrieren sie auf wichtiges theoretisches Wissen wie auch auf historisch-empirische Erfahrungen, um der Zeitdiagnose Aktualität, Luzidizität und Wirksamkeit zu verleihen.
[»Kulturprobleme«]
kultureller Diskurs
[theoretisches Wissen]
theoretische Entwicklung
Soziologische Zeitdiagnosen
historisch-empirische Entwicklung
[empirisches Wissen]
philosophischer Diskurs
[paradigmatische Grundlagen]
Abbildung 4: Die Logik soziologischer Zeitdiagnosen
Ohne Historiker zu sein, können wir uns recht gut einen Reim darauf machen, was die wilhelminische Epoche[23] war. Die wilhelmi28nische Epoche ist gekennzeichnet durch den »Wilhelminismus« und dauerte von 1890, dem Jahr des Rücktritts von Kanzler Bismarck, bis 1914, dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges, oder wenn man so will, bis zur deutschen Kapitulation 1918, der Novemberrevolution und dem Exil von Kaiser Wilhelm in Holland. Was bezeichnet der Wilhelminismus? Auf der Ebene der Werte und Mentalität herrscht Aufbruchsstimmung, auf zu neuen Ufern, Deutschland auf dem Weg zur Weltmacht, der Kampf um den »Platz an der Sonne«, das deutsche Wesen – der »Rembrandt-Deutsche« – und die deutsche Kultur im Gegensatz zur welschen, verweichlichten westlichen Zivilisation werden betont. Auf der politischen Ebene geht die Zeit vorsichtig ausbalancierender Außenpolitik – das Signum der Bismarck-Ära – rasch zu Ende zugunsten des immer unverhohlener und lautstärker angemeldeten Weltmachtanspruchs der Deutschen. Symptomatisch dafür sind die Flottenpolitik und während des Krieges die ausufernden Kriegszielforderungen. Auf der sozialstrukturellen Ebene erhalten die angriffslustigen Weltmachtambitionen des »jungen Deutschland« ökonomisch Nahrung durch kräftige Wachstumsraten und eine langanhaltende Periode des konjunkturellen Aufschwungs, demographisch durch den enormen Bevölkerungszuwachs. Die literarische Figur der wilhelminischen Epoche ist der »Untertan«: Heinrich Manns[24] Diederich Heßling bringt Habitus und Mentalität dieser Zeit einer »satisfaktionsfähigen Gesellschaft«,[25] die seltsame Mischung aus Allmachtsphantasien und Ohnmachts- wie Inferioritätskomplexen sinnfällig auf den Begriff. Heßling, der Untertan, ist die »wilhelminische Persönlichkeit«; er ist der hässliche Deutsche, der nicht einmal zwanzig Jahre später erneut ins Dritte Reich, die nationalsozialistische Epoche, aufbrechen wird.
Ohne Marxist zu sein, können wir uns lebhaft vorstellen, was gemeint ist, wenn von der kapitalistischen Gesellschaft[26] die Rede ist. Die kapitalistische Gesellschaft ist durch den »Kapitalismus« 29gekennzeichnet. Der Kapitalismus umschreibt eine ökonomische Produktionsweise, die privatwirtschaftliche Verwertung nach dem Profitprinzip, also gesellschaftliche Produktion, aber private Aneignung der Gewinne, vorsieht. Die kapitalistische Produktionsweise bringt typischerweise zwei antagonistische Klassen hervor, Kapitalisten und Lohnarbeiter, und zeichnet die wesentlichen Konfliktfronten und -linien zwischen Bourgeoisie und Proletariat vor. Eine vergleichbare Charakterisierung würde die Rede von der »industriellen Gesellschaft«[27] mit ihrem Prinzip des Industrialismus nach sich ziehen.
Wenn wir von amerikanischer Kultur sprechen, so stehen dahinter nicht nur Coca-Cola, Hamburger, Disneyland und Hollywood – es sei denn, man verengt den Begriff auf Trink-, Ess-, Freizeit- und Filmkultur. Vielmehr ist mit dem Amerikanismus der Versuch verbunden, global die Konturen des neuzeitlichen anglo-amerikanischen Volkscharakters zu bestimmen. Akzentuiert man das puritanische Erbe, so ist von »God’s new Israel« die Rede. Denkt man an das republikanische Erbe, so ist die Freiheit und Gleichheit der Staatsbürger wie auch die Idee demokratischer Gewaltenteilung und das System der »checks and balances« gemeint. Bezieht man amerikanische Kultur auf die individuelle Persönlichkeit, so steht ein Wert wie »self-reliance« im Vordergrund – die Fähigkeit, auf eigenen Füßen zu stehen, für sich selbst sorgen zu können und nicht auf die Hilfe anderer oder gar des Sozialstaates angewiesen zu sein. Kurz, die Rede von amerikanischer Kultur[28] bezieht sich hauptsächlich auf vorherrschende Werte und Ideale, auf Lebensformen und Lebensstile.
Ähnliches lässt sich sagen, wenn wir im psychologischen Sinne vom typischen Charakter sprechen. Die »narzisstische Persönlich30keit« etwa bezeichnet einen neuen Sozialisationstyp der sich dem enormen Wohlstand, den überwiegenden Ein-Kind-Familien, der Labilität dieser Familien und noch einigen anderen Bedingungen mehr verdankt. Narzissmus meint dann mehr als eitle Selbstbespiegelung, wie es Kulturkritiker gerne sehen. Vielmehr scheint der Narzissmus[29] die letzten Entwicklungen unseres gegenwärtigen Individualismus widerzuspiegeln. Freilich: Auch hier bleibt es stets möglich, von dem vorherrschenden Ideal auf eine ganze Sozialformation hochzurechnen, und dann ist man schnell bei der Rede von der »narzisstischen Gesellschaft«.[30]
Was haben diese Beispiele zu Epoche, Gesellschaft, Kultur und Charakter gemeinsam? In allen vier Fällen läuft die Zeitdiagnose auf den Versuch hinaus, ein Bündel von zusammenhängenden Eigenschaften zu beschreiben und mit der Behauptung zu verbinden, dass es die vorherrschenden Struktur- und Entwicklungslinien, die Trends und Tendenzen der jeweiligen Epoche, der Gesellschaft, der Kultur oder des Charakters ausmacht. Idealiter lässt sich dieses Bündel von Eigenschaften auf eine Formel oder ein Prinzip bringen, so dass wir abgekürzt häufig auch von »Wilhelminismus«, »Kapitalismus«, »Amerikanismus« und »Narzissmus« sprechen, ohne die Bezugseinheit – Epoche, Gesellschaft, Kultur und Charakter – überhaupt noch mitzunennen.
Zeitdiagnosen machen also den Versuch, die »Zeichen der Zeit« auf den Begriff zu bringen. Dieser Begriff umschreibt in der Regel ein Struktur- und Entwicklungsprinzip, das nicht nur die in Frage stehende Wirklichkeit ausdrückt, sondern dieser Wirklichkeit auch seinen Stempel aufdrückt: Der Wilhelminismus überstrahlt die Epoche von 1890-1918, der Kapitalismus strukturiert nicht nur die Wirtschaft, sondern die gesamte Gesellschaft – und das bis zum heutigen Tag. Der Amerikanismus dürfte längst global geworden sein. Der Narzissmus markiert wohl die typische Sozialisationserfahrung unseres gegenwärtigen Individualismus.
Abbildung 5: Die Funktionen soziologischer Zeitdiagnosen
So verstanden, haben Zeitdiagnosen, welche die »Zeichen der Zeit« in Struktur- und Entwicklungsbegriffe fassen, gleich mehrere Funktionen. Man kann vier Funktionen (siehe Abbildung 5) unterscheiden: die konstitutive, kognitive, evaluative und expressive Funktion. Ihre konstitutive Funktion besteht darin, dass sie ganz elementar zur gesellschaftlichen Orientierung beitragen. Denn sie bieten insofern Orientierungswissen, als sie zur »denkenden Ordnung des Wirklichen«[31] beitragen. Zeitdiagnosen sind begriffliche Klassifikationen zur Selbstbeschreibung von Gesellschaften. Wann lebst du – im wilhelminischen Zeitalter; wo lebst du – in einer kapitalistischen Gesellschaft; wie lebst du – in der amerikanischen 32Kultur; als was lebst du – als narzisstische Persönlichkeit. In diesem konstitutiven Sinne können Zeitdiagnosen dann zur fundamentalen Orientierung in der Gesellschaft beisteuern, wenn sie als anerkannte Begrifflichkeit die Klassifikation der gesellschaftlichen Erfahrungen anleiten und tatsächlich leisten.
Das gelingt am ehesten durch ihre kognitive Funktion. Denn Zeitdiagnosen bringen gesellschaftliche Erfahrungen nicht nur auf den Begriff, im Sinne eines allgemeinen Struktur- und Entwicklungsprinzips. Das ist ja – wenn man so will – nur die Spitze des Eisberges. Vielmehr verbergen sich dahinter nicht selten eine ausgearbeitete Theorie der Gesellschaft und eine detaillierte historisch-empirische Analyse, die der sinnhaften Interpretation und Deutung eines Phänomens erst ihr solides wissenschaftliches Fundament verleihen. Neudeutsch gewendet: Es sollte sich um eine evidenzbasierte Zeitdiagnose handeln. Dementsprechend verweist der Kapitalismus auf die Marxsche Gesellschaftstheorie, die als Entwicklungs-, Struktur-, Krisen-, Klassen- und Transformationstheorie angelegt und empirisch teilüberprüft ist: als Evolutionstheorie, die eine gerichtete Abfolge von Gesellschaftsformationen unterscheidet – von der Antike über den Feudalismus zum Kapitalismus und schließlich zum Sozialismus; als Strukturtheorie, welche die Gesetze der kapitalistischen Warenproduktion aufstellt; als Krisen- und Klassentheorie, die das Ineinander der beiden Hauptkonflikte, des systemischen Grundwiderspruchs zwischen Produktionsverhältnissen und Produktivkräften einerseits und des sozialen Widerspruchs zwischen Bourgeoisie und Proletariat andererseits, beschreibt; und schließlich als Transformationstheorie, die die Mechanismen sozialen Wandels von einer Gesellschaftsformation zur nächsten Gesellschaftsformation angibt. Es ist diese kognitive Funktion, die das wichtigste Merkmal soziologischer Zeitdiagnosen markiert.
Ferner zeichnet Zeitdiagnosen eine expressive Funktion aus. Zeitdiagnosen bannen so den »Zeitgeist« in ihre Begrifflichkeit. Die Diskussion um die Postmoderne[32] ist ein gutes Beispiel. Obgleich moderne Errungenschaften wie kapitalistische Marktwirt33schaft und politische Demokratie unzweideutig fortbestehen, scheinen die kulturellen Erfahrungen »postmodern« zu werden: Die radikale Differenz, der Verlust der kollektiven Sinn verbürgenden Metaerzählung wie etwa der Hoffnung auf Vernunft und Fortschritt, der Pluralismus, die Vielfalt und der Eklektizismus der Stile in Kunst, Malerei und Architektur – alle diese Erscheinungen nähren das Gefühl, in der Postmoderne zu leben. Was für die Kultur, ihren Postmodernismus, indes angebracht sein mag, erweist sich als unangemessen für die übrigen gesellschaftlichen Lebensbereiche. Wer würde schon ernsthaft von der »postmodernen Wirtschaft« oder der »postmodernen Politik«[33] sprechen wollen? Die geschichtsträchtige Zäsur von 1989 jedenfalls hat die Rede von der Postmoderne rasch wieder verstummen lassen.
Ihrer vierten, evaluativen Funktion nach beurteilen Zeitdiagnosen Epochen, Gesellschaften, Kulturen oder Charaktere. Der Maßstab, der zugrunde gelegt wird, ist meist ein Ideal, von dem aus die jeweilige Epoche, Gesellschaft, Kultur oder der jeweilige Charakter betrachtet werden. Die vorfindbare Wirklichkeit weicht häufig in trauriger Weise von dem idealen Maßstab ab, was den Zeitdiagnostiker leicht dazu verleitet, von einer Krise[34] zu sprechen. Kri34se im ursprünglich griechischen Wortsinn meint »Wendepunkt«: Man kann so weitermachen wie bisher – dann wird man endgültig und irreversibel in die Katastrophe oder den Untergang getrieben; oder man kehrt um bzw. besser auf den Pfad der Tugend zurück und wird so dem als Maßstab zugrunde gelegten Ideal wieder näher kommen. Auf jeden Fall drängt die Zeit zu einer Entscheidung. Es ist diese normative Dimension moralischer Kritik,[35] die oft genug die stärkste Motivation zur »Zeitdiagnostik« darstellt. Zeitdiagnosen sind also nicht nur der Versuch zu einem Abbild der Gesellschaft, einem Gesellschaftsbild oder Image; das ist nur eine Seite. Die Kehrseite der Medaille, »Kritik und Krise« (Koselleck), verweist auf die Notwendigkeit der Kurskorrektur, ja der unbedingten Umkehr. Wenn man eine Unterscheidung von Clifford Geertz bemühen will, die von »model of« und »model for society«,[36] dann könnte man sagen, dass Zeitdiagnosen ein ungeschminktes Abbild der Gesellschaft und ein Vorbild für eine andere, neue und vermeintlich bessere Gesellschaft enthalten.
Drei Probleme (siehe Abbildung 6) sind es, die das Geschäft der Zeitdiagnostik ungemein erschweren und zu einem zwar notwen35digen, aber höchst riskanten Unternehmen machen: 1. das Problem der Adäquanz; 2. das Problem des Zeitgeistes und der Ideologie; 3. das Problem des Normativen.
Abbildung 6: Die Probleme soziologischer Zeitdiagnosen (SZD)
Das Problem der Adäquanz stellt sich regelmäßig dort ein, wo ein Gegenstand durch einen Begriff charakterisiert werden soll. Ist der Begriff angemessen, um den Gegenstand voll und ganz zu erfassen? Im Falle von Zeitdiagnosen geht es schließlich darum, mit einem Begriff eine Epoche, eine Gesellschaft, eine Kultur oder einen Charakter zu bezeichnen. Es ist aber eine Sache, die Relevanz dieser Struktur- und Entwicklungsprinzipien zu behaupten, eine andere Sache ist es, ihre Dominanz zu unterstellen. Wer wollte die Geschichtsmächtigkeit des Kapitalismus ernsthaft leugnen? Aber 36sind deshalb alle Lebensverhältnisse und -äußerungen durchgängig »kapitalistisch« geprägt? Wenn man das behauptet, überzieht man leicht die heuristische Fruchtbarkeit der Zeitdiagnose und überdehnt die gewählte Grundbegrifflichkeit. Das logische Gegenstück zu Überdehnung und Überstrapazierung der Begrifflichkeit ist die begriffliche Unterbestimmung, die zu einer regelrechten »Hermeneutik des Verdachts«[37] führt. Begriff und politische Kampfformel in eins scheint etwa das Konzept des Rassismus zu sein, mit dem alle mögliche Kommunikation und perhorresziertes Verhalten etikettiert werden können. Freilich: Wenn potentiell alles und jedes unter Rassismusverdacht geraten kann, dann wird der Begriff unscharf und die Kampfformel wohlfeil. In beiden Fällen bleibt das Adäquanzproblem ungelöst.
Es ist leicht zu erkennen, wie sich das Problem mit jeder weiteren gesellschaftlichen Entwicklung verschärft. Je differenzierter, komplexer und pluralistischer eine Gesellschaft wird, desto weniger gelingt es, ihre Struktur- und Entwicklungslinien in einem Begriff unterzubringen. Begriff und Begriffenes klaffen immer weiter auseinander. Die Folge ist eine ganze Korona von Begriffsaspiranten, die für sich reklamieren, gesellschaftliche Erfahrungen konzeptuell erfassen zu können. Nehmen wir nur einige unserer »Gesellschaftsbegriffe« heute: Spätkapitalismus, Industriegesellschaft, Dienstleistungsgesellschaft, Arbeitsgesellschaft, Freizeitgesellschaft, Informationsgesellschaft, Wissensgesellschaft, Risikogesellschaft, Erlebnisgesellschaft, Netzwerkgesellschaft usw.
Eine zweite Schwierigkeit tut sich mit dem Problem des modischen Zeitgeistes und der Ideologie auf. Im einen Fall erfolgt eine Diagnose, ohne dass eine umfassende und sorgfältige Analyse vorangegangen wäre. Wir alle können ein Lied von dieser Schnellschussdiagnostik singen. Medien, Werbung, die Konsumindustrie und die kommerzielle Sozialforschung gehen da eine unheilvolle Allianz ein. Eine rasch hingeworfene empirische Studie kommerzieller Sozialforschung findet Eingang in Marketingstrategien, die »sensationellen« Ergebnisse werden unverzüglich von den Medien aufgegriffen, und die Konsumindustrie reagiert rasch mit den entsprechenden Produkten. Auf diese Weise wird aus einer fragwürdigen empirischen Studie flugs ein unumstößlicher, »wahrer« Trend, 37der in dem Maße, wie von gesellschaftlicher Seite darauf reagiert wird, sich tatsächlich empirisch bewahrheitet.[38]
Das logische Gegenstück zur raschen Alterung von flinken Zeitgeistmoden sind ideologische Dauerbrenner wie der Kapitalismus. Seit Beginn der Industriellen Revolution – und in England begann sie schließlich schon 1750 und ist somit über zweihundertfünfzig Jahre alt – wird eine Gesellschaft allen ihren mannigfachen Wandlungen und Transformationen zum Trotz als »kapitalistische Gesellschaft« gefasst. Wie kann das gehen? Nun, in der Regel bedarf es enormer, fast akrobatischer Ableitungs- und Interpretationsarbeit. Je mehr sich die gesellschaftliche Realität von dem Bild des Kapitalismus entfernt, das Karl Marx am britischen Vorbild abgelesen hatte, desto kunstvoller werden die begrifflichen Rekonstruktionen, um die neu entstandenen Phänomene unter einen begrifflichen Hut zu bringen. Selbst wenn man also durchaus die ungeheure Geschichtsmächtigkeit des Kapitalismus anerkennt, stellt sich doch grundsätzlich die Frage, ob auch noch die letzte Faser unserer Lebensführung tatsächlich am Kapitalismus hängt oder, Karl Marx paraphrasierend, ob auch die letzte Pore unserer Gesellschaft vom Kapitalismus durchdrungen wird.
Zeitgeistmoden und Ideologie repräsentieren spiegelbildliche Probleme: Dort werden das Manko theoretischer Begriffsbildung und unzureichende empirische Analysen zu weitreichenden Deutungen missbraucht, die unter Umständen ihren eigenen Trend hervorbringen. Hier ufert die Theoriebildung aus, um mit der Realität mitzuhalten, darüber kommt die historisch-empirische Analyse häufig zu kurz; es wird aber an der weitreichenden traditionellen Deutung festgehalten, obwohl die gesellschaftlichen Entwicklungen immer weniger Anhaltspunkte für den revolutionären Zusammenbruch des Kapitalismus und die Heraufkunft des Sozialismus geben. Das Gegenteil scheint mittlerweile eingetreten zu sein. Trotz endemischer Krisenhaftigkeit und aufgrund mangelnder Alternativen, also des »TINA-Syndroms« («there is no alternative«, Margaret Thatcher), hält sich der global gewordene Kapitalismus zäh am Leben.
38Eine letzte Schwierigkeit betrifft das Problem des Normativen. Da Zeitdiagnosen nicht nur eine radikale Kritik enthalten, sondern häufig genug auch eine normative Alternative, besteht die Gefahr, dass die Grenze zwischen Soziologie und Sozialphilosophie verwischt wird. Die Soziologie als rationale, positive und empirische Wirklichkeitswissenschaft, so heißt es, hat nur »Wirklichkeitsurteile« abzugeben, also theoretisch angeleitete, historisch-empirisch informierte Deutungen der Gesellschaft. Demgegenüber hat sie sich in Fragen von »Werturteilen«, also moralischen Empfehlungen zur wünschenswerten Entwicklung der Gesellschaft, strengste Zurückhaltung aufzuerlegen. Da Versuche der Zeitdiagnose stets Gefahr laufen, in das sozialphilosophische Fahrwasser moralischer Kritik zu geraten, sollte eine an diesem Wissenschaftsideal orientierte Soziologie auf die Anfertigung von Zeitdiagnosen am besten gleich ganz verzichten. Das ist die Position, wie wir sie von Max Webers Postulat der Werturteilsfreiheit[39] bis hin zur einen Fraktion im Positivismusstreit[40] kennengelernt haben. Die Gegenposition verweist jedoch auf die Schwierigkeit, immer sorgfältig Wirklichkeits- und Werturteile im wissenschaftlichen Alltag voneinander trennen zu können. Da Soziologie und Sozialphilosophie ohnehin unauflöslich miteinander verbunden sind, kommt es vor allem darauf an, die soziologische Behandlung moralischer Fragen so weit wie möglich zu treiben. In diesem Sinne gehören die adäquate Beschreibung, die sorgfältige Erklärung und die evaluative Beurteilung sozialer Phänomene, die Zeitdiagnose, zum ureigensten Geschäft der Soziologie. Das ist die Position, wie sie von Émile Durkheim bis Jürgen Habermas vertreten wird.
Wie auch immer man sich in dieser Grundfrage positionieren mag: Zeitdiagnostik ist und bleibt Soziologie mit beschränkter Haftung. Auch eine noch so vollkommene wissenschaftliche Durchdringung der sozialen Wirklichkeit lässt das Risiko der Deutung bestehen. Deutung heißt stets, das analytisch und empirisch gewonnene Wissen zu synthetisieren und die Erkenntnisse interpretativ zu verdichten. In dieser interpretativen Verdichtung, der Arbeit der Zuspitzung, liegt ein untilgbarer Rest von Spekulation, ja von Metaphysik, den eine noch so gründliche Durchforschung der Welt 39nicht zu beseitigen vermag. Sicher, die »Metaphysizität« der Zeitdiagnose kann durch Verwissenschaftlichung gebändigt werden, wie die Rede von der Evidenzbasierung anzeigt. Evidenzbasierung meint dann eine empirisch gesättigte Zeitdiagnose. Aber nur die alte positivistische Auffassung, dass die Soziologie der »Spiegel der Gesellschaft« sei, so wie die Naturwissenschaften der »Spiegel der Natur«,[41] wird glauben machen wollen, dass ihre Zeitdiagnose ein Abbild der Gesellschaft vermitteln könne. Denn die Gesellschaft gibt es nicht; Gesellschaften sind komplexe Gebilde, weshalb ein Abbild gar nicht möglich ist. Nicht ein Gesellschaftsbild, sondern Gesellschaftsbilder sind es, welche die Soziologie je nach gewählter Perspektive zu entwickeln vermag. Und die gelingen, wie bei Fotografien auch, mal besser, mal schlechter. Häufig erscheint ein Gesellschaftsbild als verwackelt, dann werden die Konturen unscharf. Oder der Schnappschuss fokussiert einen Ausschnitt so stark, dass der Kontext aus dem Blickfeld gerät; oder aber man verliert vor lauter neutralem Überblick den Einblick in den Charakter einer Gesellschaft, ihre Eigenart und Kulturbedeutung. Niklas Luhmann etwa hat daraus die Konsequenz gezogen, neben dem sozialstrukturellen Wandel stets auch die Variationen der Semantik zu untersuchen.[42] Als Resultat aus einem solchen Programm des Studiums von funktionaler Differenzierung und historischen Semantiken ergeben sich multiperspektivisch angelegte Selbstbeschreibungen[43] der modernen Gesellschaft.
Gelingt es dennoch einmal, die verschiedenen Blickwinkel zu synthetisieren und die Zeichen der Zeit als Momentaufnahme sub specie aeternitatis zu verstehen, bleibt die Zeitpunkt-, Stimmungs- und Vermittlungsabhängigkeit bestehen. Ein Blick in das soziologische Familienalbum der alten Bundesrepublik ist da instruktiv. Kommt eine Zeitdiagnose zu früh, bleibt sie weitgehend unbeachtet. In der ersten Hälfte der achtziger Jahre diskutierte die Soziologie die Krise der Arbeitsgesellschaft,[44] in den neunziger Jahren 40und noch bis ins 21. Jahrhundert hinein war sie da. Umgekehrt, erscheint die Zeitdiagnose zu spät auf der Bildfläche, landet sie auf dem Müllhaufen der Geschichte. Als die Erlebnisgesellschaft[45] und die Multioptionsgesellschaft[46] als Endmoräne der Überflussgesellschaft[47] Anfang der neunziger Jahre aus der Taufe gehoben wurden, ließ die Rückkehr der Knappheit dieses Szenario als unangemessen, ja fast zynisch erscheinen. Pünktlich, just in time – das ist die beste Gewähr, dass die zeitdiagnostische Stimme die kollektive Stimmung trifft und breite öffentliche Anerkennung erntet. Nur wer den gesellschaftlichen Gemütszustand und die kollektive Seelenlage richtig einschätzt, hat Erfolg. Diese »irrationale« Seite der Zeitdiagnostik verleitet besonders zur thetischen Verdichtung, zumal im Zeitalter einer medialen Konstruktion sozialer Wirklichkeit. »Der Untergang des Abendlandes«,[48] das »Ende der Geschichte«,[49] der »Kampf der Kulturen«[50] – das lässt aufhorchen. Angesichts der pluralen Deutungskonkurrenz, der medialen Aufmerksamkeitsfilter und des Erfolgsgebots »Stimme trifft Stimmung« ist die Verführung besonders groß, den Wahrheitswert einer Zeitdiagnose, ihre Solidität und Seriosität, zugunsten ihres Spektakularitätswertes, ihrer Sensationalität und Emotionalität zurückzudrängen, um sich durchzusetzen und Gehör zu finden.
Wer behält also am Ende recht, der junge Wagner oder der alte Faust? Ist die Zeitdiagnostik, wie der optimistische Studiosus enthusiastisch meint, ein Instrument der Aufklärung und eine Illustration des Fortschritts? Oder ist sie, wie der skeptische Professor dagegenhält, nur ein Akt der Selbstbespiegelung, der etwas über unser Bewusstsein, nicht aber über das Sein aussagt? Die Soziologie, nicht mehr ganz jung, aber auch noch nicht sehr alt, wird sich zu dieser Ambivalenz bekennen und ihre Herausforderung annehmen müssen.
41Genau das macht das wertvolle Erbe der soziologischen Klassik aus, dass sie mit großer wissenschaftlicher Phantasie, theoretischer Kühnheit und methodischer Raffinesse die Zeichen der Zeit, wie sie für moderne Gesellschaften gelten, zu erkennen und auf den Begriff zu bringen versucht hat. Das werden die Zeitdiagnosen von Tocqeville («Demokratie als moderne Gesellschafts- und Lebensform«), Marx («Sozialismus als wahrer Humanismus«), Durkheim («Institutioneller Individualismus«), Simmel («Soziale Differenzierung und Individualität«) und Weber («Rationalisierung als Gesellschafts- und Lebensform«) zeigen.
422. Alexis de Tocqueville und die politische Revolution
Je n’ai pas de traditions, je n’ai pas de parti, je n’ai point de cause, si ce n’est celle de la liberté et de la dignité humaine. Alexis de Tocqueville[1]
2.1 Tocqueville und die deutsche Soziologie
Alexis de Tocqueville (1805-1859) wird gemeinhin nicht zu den Klassikern der Soziologie gezählt.[2] Das gilt vor allem hierzulande. So wird man etwa vergeblich nach dem Namen Tocqueville in der kanonischen zweibändigen Ausgabe Klassiker des soziologischen Denkens[3] oder in Lepenies’ vierbändiger Geschichte der Soziologie[4] suchen. In beiden spielt Tocqueville keine Rolle. Wenn, dann gilt er als Politikwissenschaftler, nicht aber als Soziologe.
Dabei hatte Wilhelm Dilthey schon 1910, in seinen Studien über den Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften,[5] eine emphatische Würdigung Tocquevilles vorgenommen: »Der dritte unter den originalen historischen Köpfen der Zeit Rankes war Tocqueville. Er ist der Analytiker unter den geschichtlichen Forschern der Zeit, und zwar unter allen Analytikern der politischen Welt der größte seit Aristoteles und Machiavelli.« Was stellt Tocqueville auf eine Stufe mit Aristoteles und Machiavelli? In den Augen Diltheys ist es seine theoretische Perspektive, die heute wohl als Gesellschafts- oder Strukturgeschichte bezeichnet werden würde. Im Lichte dieser Perspektive gewinnt das historisch-empirische Material aus den Archiven eine völlig neue Bedeutung.
43Er [Tocqueville, H.-P. M.] sucht in ihnen [den Archiven, H.-P. M.] das Zuständliche, das für das Verständnis der inneren Struktur der Nationen Bedeutsame: seine Zergliederung ist auf das Zusammenwirken der Funktionen in einem modernen politischen Körper gerichtet, und er zuerst hat mit der Sorgfalt und Peinlichkeit des sezierenden Anatomen jeden Teil des politischen Lebens, der in der Literatur, den Archiven und dem Leben selbst zurückgeblieben ist, für das Studium dieses inneren und dauernden Strukturverhältnisses verwertet. Er hat die erste wirkliche Analyse der amerikanischen Demokratie gegeben. Die Erkenntnis, dass in dieser ›Bewegung‹ ›die kontinuierliche, unwiderstehliche Tendenz‹ bestehe, eine demokratische Ordnung in allen Staaten hervorzubringen, erhob sich in ihm aus der Entwicklung der Gesellschaft in den verschiedenen Ländern. Diese seine Erkenntnis hat sich seitdem durch die Vorgänge in allen Teilen der Welt bestätigt.[6]
Obgleich Dilthey Bedeutung und Tragweite von Tocquevilles Werk klar erkennt und überzeugend charakterisiert, hat diese Würdigung keinerlei Rezeption in Deutschland ausgelöst. J. P. Mayers[7] Urteil aus dem Jahre 1955 trifft auch heute noch beinahe uneingeschränkt zu. »Niemand hat sich in Deutschland«, so der Herausgeber der Tocqueville-Schriften, »eine Analyse des Tocquevilleschen Werkes zum Gegenstand gemacht.«[8]
44Woher kommt diese weitgehende Nichtachtung des französischen Denkers und seiner beiden bahnbrechenden Werke Über die Demokratie in Amerika (1835/40) und Der alte Staat und die Revolution (1856)? Woraus resultiert diese Ignoranz, vor allem in der deutschen Soziologie?
Über die Beantwortung dieser Frage lässt sich trefflich streiten. Nach meiner Auffassung sind wenigstens drei Gründe dafür verantwortlich, dass uns Tocqueville aus dem soziologischen Gedächtnis entschwunden zu sein scheint. Da ist zunächst die Rezeptionslage in Deutschland anzuführen. Wir haben Karl Marx und Max Weber, wozu brauchen wir Alexis de Tocqueville? Wenn man bedenkt, dass Marx vom ökonomischen Primat (Kapitalismus) und Weber vom politischen Primat (politisch-administrative Herrschaft) und zuweilen vom soziokulturellen Primat (die Wirtschaftsethik der Weltreligionen) ausgeht, so sind die wesentlichen Ansatzpunkte bereits abgedeckt, um die »Große Transformation« zu erklären: Ökonomie, Politik und Kultur. Also nochmals: Wozu Tocqueville und sein demokratietheoretischer Ansatz? Tocqueville erscheint von dieser Warte als früher Protosoziologe mit einzelnen, durchaus fruchtbaren Einsichten, aber eben als Vorläufer der eigentlichen Soziologie, die wir meist mit Durkheim, Weber und Simmel beginnen lassen.
Ferner ist Tocqueville eine Stilfrage: Wer sich durch Marx’ komplizierte Abhandlung über Das Kapital durchgearbeitet oder den verschlungenen Konstruktionspfaden der komplexen Begriffsarchitektonik von Webers Wirtschaft und Gesellschaft nachgespürt hat, dem werden Tocquevilles Werke wie bessere Reisebeschreibungen vorkommen. Im Lande von Kant und Hegel, wo die schwere Verständlichkeit eines Textes noch immer zu den bevorzugten Gütekriterien von Wissenschaftlichkeit zählt, gilt Tocqueville als 45zu leichte Kost. Kurz: Seine Werke sind Literatur, aber keine Wissenschaft.[9] Eine solche Einschätzung kommt hierzulande einem Todesurteil gleich, denn es legitimiert dazu, sein Werk getrost vergessen zu dürfen.
Während die besondere Rezeptionslage in Deutschland und die Stilfrage à conto der deutschen Soziologie gehen, liegt der dritte Grund für die weitgehende Nichtbeachtung bei dem Autor selbst. Tocqueville, der sich eines verständlichen Stils und lockerer Begrifflichkeit befleißigt hat, wird gerade deswegen sehr unterschiedlich rezeptiert. Robert Nisbet,[10] der den Wandel der Rezeption des französischen Klassikers und seiner Bibel des Amerikanismus, der Demokratie in Amerika, in den Vereinigten Staaten untersucht hat, spricht daher nicht zu Unrecht von »many Tocquevilles«. Lässt sich angesichts dieser Mannigfaltigkeit aber nicht doch eine gewisse Kohärenz des Tocquevilleschen Werkes ausmachen? Durchaus. Denn seine zentralen Begriffe geben zweifelsohne die wichtigsten Richtungen der Interpretation vor: Demokratie, Gleichheit und Individualismus.
Für die einen ist Tocqueville der frühe Zeitdiagnostiker, der die Entwicklung moderner Gesellschaften zur Demokratie in ihren Grundzügen analysiert und prophetisch vorausgeahnt hat. Kurz: Tocqueville als Diagnostiker der demokratischen Revolution.[11] Gleichzeitig entgehen dem nüchternen Blick des französischen Aristokraten und Weltmannes keineswegs die Kehrseite und die Gefahren der Demokratie. In der demokratischen Republik herrscht zum einen eine gewisse Durchschnittlichkeit, ja Mediokrität, wenn das gesamte gesellschaftliche Streben nur auf das Wohlergehen der größten Zahl gerichtet ist. Zum anderen ist mit diesem seichten Hedonismus politisch die Gefahr des Despotismus verbunden. Wenn jeder nur an sein privates Glück ohne Sorge um das 46öffentliche Wohl denkt, verwandelt sich die genuin demokratische Regierungsform leicht in ein despotisches Regime. Tocqueville gilt vielen deshalb auch als früher Vorläufer der Totalitarismustheorie.[12]
Für andere wiederum ist Tocqueville »der große Prophet des Massenzeitalters der abendländischen Welt«,[13] der den Anbruch des Zeitalters der Gleichheit untersucht hat, mit allen Vorzügen und Gefahren wie der Tendenz zur Massengesellschaft[14] etwa. In diesem Zusammenhang wird Tocqueville gern als Konservativer angesehen, scheinen doch Vortrefflichkeit und Exzellenz nur auf dem Boden der Ungleichheit und mit Hilfe aristokratischer Eliten zu gedeihen.
Eine dritte, neuere Interpretationsrichtung indes erblickt in Tocqueville den scharfsichtigen Diagnostiker des Zeitalters des Individualismus.[15] Die Kultur der amerikanischen Gesellschaft bietet einzigartige Voraussetzungen zur Ausbreitung des modernen Individualismus. Der Begriff, der in der Tat von Tocqueville erstmalig theoretisiert wurde, steht für ein Wertsystem, das es dem Einzelnen in einem historisch ungekannten Maße erlaubt, sich von gesellschaftlichen Verpflichtungen freizumachen, seinen eigenen, unverwechselbaren Lebensstil zu entwickeln und eine eigenständige Lebensführung zu verwirklichen.
Ohne die drei skizzierten Interpretationsrichtungen näher zu diskutieren, soll im Folgenden die These vertreten werden, dass alle drei Lesarten zwar nicht falsch, aber einseitig sind. Infolge dieser einseitigen Interpretation verkennen sie den konstitutiven Zusammenhang zwischen Demokratie, Gleichheit und Individualismus, den Tocqueville im Auge hat. Hier wird deshalb eine vierte Lesart vorgeschlagen, die gerade auf den Zusammenhang von Demokratie, Gleichheit und Individualismus gerichtet ist. Nach meiner Auffassung ist Tocqueville der Soziologe, der die »Große Transformation« über die politische Revolution und den Übergang von der Aristo47kratie zur Demokratie zu verstehen sucht. Den Übergang von der Tradition zur Moderne als Wandel von der Aristokratie zur Demokratie zu konzeptualisieren, setzt ein neuartiges, soziologisches Verständnis von Demokratie voraus. Es heißt, Demokratie nicht nur als politische Regierungsform anzusehen, sondern sie als moderne Gesellschafts- und Lebensform zu begreifen. Genau das ist Tocquevilles Projekt: Demokratie als moderne Regierungs-, Gesellschafts- und Lebensform. Im Folgenden soll daher entlang dieser Leitthese Tocquevilles Argumentation rekonstruiert werden: Er versucht, die »Großen Transformation« über die politische Revolution, d. h. den Wandel von der Aristokratie (Tradition) zur Demokratie (Moderne), im Lichte der zeitdiagnostischen Formel der Demokratie als moderner Regierungs-, Gesellschafts- und Lebensform zu verstehen.
Das legt folgende Vorgehensweise nahe: Nach einem knappen Überblick über Tocquevilles Leben und Werk im Allgemeinen wird seine Analyse der amerikanischen Demokratie beleuchtet, wie er sie im ersten Band seiner Amerika-Studien unterbreitet. In einem zweiten Schritt wird die demokratische Gesellschaft der aristokratischen Gesellschaft gegenübergestellt und Tocquevilles Erklärung der revolutionären Transformation skizziert, wie er sie in Der alte Staat und die Revolution entwickelt. Schließlich soll im dritten Schritt zusammenfassend die zeitdiagnostische Formel »Demokratie als moderne Regierungs-, Gesellschafts- und Lebensform« beleuchtet sowie der Idealtypus der demokratischen Gesellschaft dargestellt werden, wobei vor allem der zweite Band seiner Amerika-Studien im Zentrum steht.
2.2 Tocqueville – Aristokrat zwischen allen Stühlen
Tocqueville wird am 29. Juli 1805 in Verneuil als dritter Sohn der Familie Hervé de Tocqueville geboren. Während der Französischen Revolution werden seine Eltern eingekerkert und nur durch den Sturz Robespierres am 9. Thermidor vor der Guillotine gerettet. In der Restaurationsära ist sein Vater Präfekt mehrerer Départements. Alexis de Tocqueville besucht das Gymnasium in Metz und studiert Jurisprudenz in Paris. 1827 wird er Hilfsrichter in Versailles, das sein Vater seit 1826 als Präfekt regiert. 1831 erhalten er 48und sein Freund Gustave de Beaumont vom französischen Innenminister den Auftrag, das amerikanische Gefängniswesen zu untersuchen. Was als Studium des Gefängniswesens intendiert war, wird eine Studie über die amerikanische Demokratie. Von Mai 1831 bis Februar 1832 reisen Beaumont und Tocqueville durch die Vereinigten Staaten und besuchen Neuengland, Québec, New Orleans im Süden und den Westen bis zum Michigansee. Auftragsgemäß erscheint kurz darauf die Studie Du système pénitentiaire aux États Unis et de son application en France (1833). Bedeutsamer ist freilich der erste Band von Über die Demokratie in Amerika