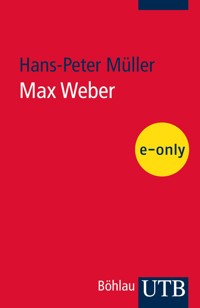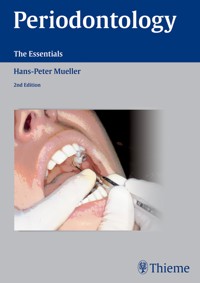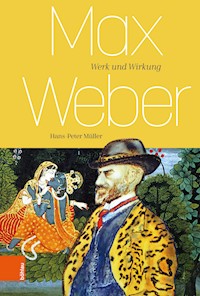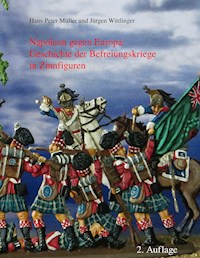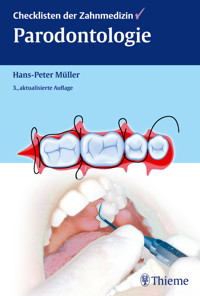25,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Max Weber gilt heute vielen als der bedeutendste Kultur- und Sozialwissenschaftler überhaupt, das Genie mit eigener Briefmarke ist weltweit in aller Munde. Warum? Was macht seine Größe aus? Wie hat er es in seiner Disziplin auf ein Niveau gebracht, das mit dem Goethes in der Literatur und Kants in der Philosophie vergleichbar ist? Zu Webers 100. Todestag begibt sich Hans-Peter Müller auf die Spurensuche nach der Botschaft des herausragenden Soziologen und stellt fest: Seine Genealogie der Moderne lässt uns begreifen, wie wir wurden, was wir sind – warum die von Weber beschriebenen Probleme des Kapitalismus, der Demokratie und des Individualismus also auch heute noch die unsrigen sind. Mit anderen Worten: Wer Weber liest, wird sein Leben in der Moderne besser verstehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 783
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
3Hans-Peter Müller
Max Weber
Eine Spurensuche
Suhrkamp
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Inhalt
Vorwort
Einführung
1. Max Weber in seiner Zeit
2. Die mühsame Suche nach einer Methode: Grundzüge einer soziologischen Wissenschaftslehre
3. Der Geist des Kapitalismus: Die »Protestantismus-These«
4. Besichtigungstermin in der Moderne: Max Weber in Amerika
5. Religion und Kapitalismus im globalen Maßstab
6. Wirtschaft und Gesellschaft
7. Politik und Gesellschaft: Herrschaft und Bürokratie als Schicksal, Nation und Demokratie als Chance?
8. Klasse, Stand und »Rasse«: Spielarten sozialer Ungleichheit
9. Die dunkle Seite der Moderne: Krieg, Sozialismus, Zusammenbruch und Revolution
10. Das Weber-Paradigma
11. Wirtschaft und Geschichte: Die Genealogie des Kapitalismus
12. Die Dämonen: Wissenschaft und Politik als Beruf
Schlussbetrachtung: Max Weber und wir
Literaturverzeichnis
Namenregister
Fußnoten
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
3
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
7Vorwort
Wozu denn noch ein Buch über Max Weber? Wer die ausufernde Sekundärliteratur zu Werk und Person konsultiert – sie füllt mittlerweile ganze Bibliotheken –, den beschleicht sogleich das Gefühl, zu Weber sei bereits alles gesagt. Das stimmt auch. Denn viel, in manchen Augen allzu viel, ist über Weber geschrieben worden. Was in der unerschöpflichen Rezeption und kleinteiligen Interpretation dabei leicht verloren zu gehen droht, ist die Botschaft Max Webers, die Eigenartigkeit und Einzigartigkeit seines Werks. Was wollte uns der mittlerweile zum Klassiker erhobene Autor mit diesem riesenhaften Torso, diesem Werkungetüm eigentlich sagen?
Eine Antwort darauf fällt erklärtermaßen schwer, hat sich Weber doch mit einer schier überbordenden Vielfalt von Themen und Problemen auseinandergesetzt, die einen roten Faden durchaus vermissen lassen. Denn was könnte wohl der kleinste gemeinsame Nenner sein von Themen wie der römischen Agrargeschichte nebst der Eigenart antiker Feldmesstechniken, dem Schicksal von ostelbischen Landarbeitern, dem Geschehen an der Börse und dem Schicksal von Industriearbeitern, der Fideikommissfrage und der Psychophysik der Arbeit, dem Einfluss des asketischen Protestantismus auf eine methodisch rationale Lebensführung und Studien zur Wirtschaftsethik der Weltreligionen, den Aussichten auf eine politische Revolution in Russland, der Eigenart okzidentaler Musik, einer Typologie von Herrschaftsformen oder der Säkularisierung und Entzauberung der Welt sowie dem Schicksal Deutschlands in der Weltpolitik? Themen über Themen, Probleme über Probleme, Fragen über Fragen.
Das vorliegende Buch begibt sich deshalb nochmals auf eine Spurensuche, um in der Fülle der Themenvielfalt Webers zentrale Überlegungen und Einsichten herauszuarbeiten. Angesichts der komplexen Sachlage bietet es sich an, diese Spurensuche über die verschiedenen Argumentationsstränge hinweg zu verfolgen. Freilich, eine kohärente Interpretation als geschlossenes Ganzes wird nicht das Ergebnis sein. Sicher, Einheit ist zwar das Ziel, Vielfalt indes die Werkwirklichkeit. Selbst wenn eine Präsentation von Einheitlichkeit gelänge, wäre sie womöglich falsch; zu fragmentarisch 8und zerrissen präsentiert sich Webers Werk. Das macht auch die fulminante Max Weber-Gesamtausgabe mit ihren 47 Bänden, die kurz vor der Vollendung steht, nochmals mit Nachdruck deutlich. Stil und Form seines Werkes sind einer leichtfüßig-flüssigen Darstellungsweise ebenfalls nicht gerade zugänglich. Weber lässt sich nicht erzählen – er ist narrativ widerborstig. Das Leben, wissenschaftliches Arbeiten und Leiden, Forschen und Erkennen, das Denken und Schreiben ergeben keine schöne Erzählung. Wenn doch, dann ist es häufig genug eine Interpretation des Biographen, denn flotte Erzählungen lassen sich besser verkaufen, als mühselige und mühsam zu lesende Werkrekonstruktionen. Je tiefer und komplexer der Denker, desto flacher und verständlicher muss er gemacht werden. Das könnte man »narrative Anschlussfähigkeit« nennen.
Was ist nun seine Botschaft, um das Geheimnis gleich am Anfang ein wenig zu lüften? Auf seine Weise versucht sich Weber an einer Genealogie der Moderne, ohne dass er eigens und explizit so etwas wie ein klar geschnittenes Forschungsprogramm auflegen würde. Weber hat keine Gesellschaftstheorie vorgelegt, sondern bestenfalls eine Gesellschaftsgeschichte. Er hat kein System entwickelt, sondern allenfalls eine Systematik, darin seinem Kollegen und Freund Georg Simmel vergleichbar. Gerade diese Unabgeschlossenheit und Fragmentarität sind es eben, die immer wieder zur Rezeption und Interpretation des Werks reizen.
Diese Spurensuche soll kein Buch für Max-Weber-Spezialisten sein. Die Experten der Weber-Interpretationsindustrie werden wohl gelangweilt registrieren, dass hier »nichts Neues unter der Weber-Sonne« dargeboten wird, keine sensationelle Entdeckung einer neuen Quelle, keine bahnbrechend originelle Deutung, kein ganz »neuer Weber«. Das Buch richtet sich an eine Leserschaft, die einen Zugang zu dem übermächtigen Klassiker finden will. Webers »Größe« flößt Respekt ein, ja macht Angst, so dass manche vor einer eigenständigen Auseinandersetzung am Ende zurückscheuen mögen. Max Weber ins 21. Jahrhundert zu holen, heißt, seine Lektionen jeder Generation aufs Neue zur Verfügung zu stellen. Am 14. Juni 2020 begehen wir seinen 100. Todestag, dies mag als Hinweis dafür gelten, dass uns Weber immer ferner rückt. Es gilt, ihn uns wieder näher heranzuholen.
Dieses Buch macht aus der Not eine Tugend. Mit dem Anspruch eines verständlichen Stils versucht es zugleich, keinerlei Abstriche 9an der Komplexität und Verquertheit des Werkes zu machen. Was dabei an narrativer Geschlossenheit vielleicht verloren gehen mag, hofft es zu kompensieren, indem es wieder neugierig auf Werk und Autor selbst macht. Gerade wenn am Ende nicht alles restlos verständlich wird, könnte es die Leserschaft durchaus reizen, sich selbst ein Bild zu verschaffen. So viel sei eingangs versprochen: Max Weber eröffnet das wohl größte Lektüreabenteuer für jene, die die Moderne verstehen wollen. Auch wenn wir heute in der Spätmoderne leben mögen – mit dem Kollaps am Horizont kann es nicht schaden, nochmal den rumorenden Vulkan zu inspizieren, auf dem wir alle nervös sitzen.
Mein Dank gilt Freunden, Kollegen und Studierenden, die in den letzten Jahren mit mir das Leseabenteuer Weber immer wieder gewagt haben und nicht verzagt sind. Michael Makropoulos und Ingrid Gilcher-Holtey haben einzelne Partien des Buches in hilfreicher Weise kritisch kommentiert. Henri Band und Laurin Schwarz waren eine große Hilfe bei der zügigen Fertigstellung und Endredaktion des Bandes. Eva Gilmer, Philipp Hölzing und Jan-Erik Strasser teilten mit mir den Enthusiasmus, Max Weber auch im 21. Jahrhundert als lebendigen Klassiker zu lesen. Wie gewohnt, war die Zusammenarbeit mit ihnen vorzüglich, wofür ich mich sehr bedanke.
Hans-Peter Müller, im November 2019
11Einführung
Als Max Weber am 14. Juni 1920 unerwartet stirbt, sind die Zeitgenossen zutiefst bestürzt. Wie ein Blick auf die zahlreichen Nachrufe[1] offenbart, wird vor allem der eindrucksvollen Persönlichkeit, dem patriotischen Deutschen und dem großen Intellektuellen nachgetrauert. Über sein Werk fällt kaum ein Wort. Sicher, man kannte die Diskussion um die »Protestantische Ethik«. Wirtschafts- und sozialpolitisch informierte Kreise im Kaiserreich hatten seine Enqueten zu den Land- und Industriearbeitern verfolgt. Ökonomisch interessierte Kreise waren mit seinen Schriften über die Börse vertraut. Dass Max Weber jedoch ein Werk verfasst hatte, das ihn dereinst zu dem Klassiker der Kultur- und Sozialwissenschaften machen sollte, blieb den Zeitgenossen verborgen.
Selbst Menschen, die sich ihm nah fühlten und die mit ihrer eigenen Forschung in die Fußstapfen dieser eindrucksvollen Person treten wollten, waren recht ahnungslos. So bemerkte Karl Jaspers[2] in seiner Gedenkrede auf Max Weber vor Heidelberger Studenten im Jahre 1920:
Sieht man sein Werk an, wie es vorliegt, so findet man eine Fülle einzelner Arbeiten. Aber eigentlich sind alle Fragmente. […] Es ist kaum je ein Buch von ihm erschienen, früher einmal die Römische Agrargeschichte, eine Broschüre über die Börse, in den letzten Jahren einige Vorträge als Hefte, sonst nichts. Alles andere steckt in Zeitschriften, Archiven, Zeitungen.
Vor diesem Hintergrund wirft Jaspers die entscheidende Frage auf: »Ist es möglich, angesichts dieses fragmentarischen Charakters Max Weber als den geistigen Gipfel der Zeit zu empfinden?«[3] Seine weiteren Überlegungen machen sofort klar, dass dies einer 12rein rhetorischen Frage gleichkommt. Denn Jaspers sieht in Weber einen Philosophen, der den Geist der Zeit in seiner Person regelrecht verkörpert hat. »Einen existentiellen Philosophen aber haben wir in Max Weber leibhaftig gesehen. Während andere Menschen wesentlich nur ihr persönliches Schicksal kennen, wirkte in seiner weiten Seele das Schicksal der Zeit. […] Der Makroanthropos unserer Welt stand in ihm gleichsam persönlich vor uns.«[4]
Zu Beginn der Rezeption kurz nach seinem Tod überlagert die große Persönlichkeit das Werk. Zu dünn, zu verstreut und zu fragmentarisch wirken Webers Schriften auf seine wissenschaftliche Umwelt. Was bleibt, ist die Erinnerung an den charismatischen Genius mit kompetenter Urteilskraft, enzyklopädischem Wissen, überlegener Weitsicht und bemerkenswerter Ausstrahlung auf seine Mitmenschen. Weber gilt als der »Mythos von Heidelberg«,[5] dessen mächtige Stimme nun ein für alle Mal verstummt ist.
Dieses Weber-Bild, das ganz an seiner Persönlichkeit ausgerichtet war, sollte sich mit der Herausgebertätigkeit von Marianne Weber, von Johannes Winckelmann und den heutigen Herausgebern der Gesamtausgabe[6] ändern. Mit der Edition seiner Schriften in den Jahren nach seinem Tod wurden Güte und Umfang des Werkes von Max Weber einer größeren wissenschaftlichen Öffentlichkeit im In- und Ausland bekannt. Langsam, aber sicher trat die Person hinter das voluminöse Œuvre zurück, auch wenn die Neugier auf sein Leben und Leiden bis zum heutigen Tag kaum gestillt scheint. Davon zeugen gleich drei neuere Biographien,[7] die zu seinem 150. Geburtstag im Jahre 2014 erschienen sind und die sein Leben in 13allen Facetten ausleuchten. Außerdem macht ein Handbuch,[8] welches nun in der zweiten Auflage erscheint, den Versuch einer ersten Vermessung von Werk und Person.
Dieses eminente Interesse an Weber hängt auch mit seinem zwischenzeitlich gewonnenen Status als Aushängeschild wissenschaftlicher Schaffenskraft und intellektueller Redlichkeit zusammen. Der Name einer Person wird zur Programmatik eines Landes. Das begann bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in den Zeiten des Ost-West-Gegensatzes zwischen der Bundesrepublik und der Deutschen Demokratischen Republik. Max Weber wird im Kampf der politischen Systeme als Antipode zu Karl Marx in einer Art Kalter Krieg der Kulturen genutzt. Die 1973 beschlossene Max Weber-Gesamtausgabe, deren erster Band 1984 erscheint, wartet mit ähnlich eindrucksvollen Band-Zahlen[9] auf wie die Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA) in der Sowjetunion und die Marx-Engels-Werke (MEW) in der DDR. Im Schlepptau des Marx-Weber-Gegensatzes wird Max Weber zur Lichtgestalt des Westens als liberale Figur, gleichermaßen kapitalismus- wie demokratietauglich und hochgradiger Individualist. Was der Politik recht war, dem musste die Wissenschaft nicht folgen. Denn der Marx-Weber-Gegensatz interessierte hüben wie drüben, die wissenschaftliche Neugier ließ sich nicht aufhalten, und so setzte auch eine Weber-Rezeption im Osten ein wie zuvor eine Marx-Rezeption durch den Neomarxismus im Westen. Und je weiter der Vergleich getrieben wurde und das Wissen um die beiden Denker wuchs, desto eher stellten die Protagonisten verblüfft fest, dass sich allen Unterschieden in Philosophie und Kapitalismusanalyse zum Trotz doch auch viele Gemeinsamkeiten zwischen den beiden scharfsinnigen Denkern feststellen ließen. Christian Gneuss und Jürgen Kocka hatten noch vor dem Mauerfall 1989 eine Funkserie im Norddeutschen Rundfunk veranstaltet, die sie anschließend aufgrund der hohen Resonanz 14auch in Buchform[10] vorlegten. Schon dort wird die hohe Wertschätzung für die wissenschaftlichen und intellektuellen Leistungen Max Webers deutlich, die im wiedervereinigten Deutschland noch einmal wachsen sollte. Im Jahre 2014 wird Weber der erste Soziologe, dessen Kopf eine deutsche Briefmarke ziert mit seinem berühmten Ausspruch: »Der Einfall ersetzt nicht die Arbeit.« Auch die 2002 gegründete Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland schmückt sich ab 2012 mit seinem Namen. Die Max Weber Stiftung (MWS) unterhält zehn Institute in Beirut, Istanbul, London, Moskau, Paris, Rom, Tokio, Warschau und Washington D.C. »Weber 2.0« heißen die wissenschaftlichen Blogs der Institute. So wird eine Person nicht nur zur Institution gemäß dem klassischen Diktum von Arnold Gehlen: »Eine Persönlichkeit: das ist eine Institution in einem Fall.«[11] Vielmehr wird auf diese Weise über Länder- und Disziplingrenzen hinweg Webers Name verbreitet und bleibt so in aller Munde. Welchem Soziologen, außer Karl Marx vielleicht, wäre je eine solche Ehre und Auszeichnung widerfahren? Im digitalen Zeitalter zeigt sich in der Tat, dass Marx und Weber die Soziologen mit der größten globalen Prominenz[12] sind. Keine Autoren unter den ersten zwanzig Soziologen weltweit werden so häufig »angerufen«, weil am häufigsten zitiert.
Was aber mit wachsendem zeitlichem Abstand immer undeutlicher wird, ist die »Klassizität« dieses Klassikers: Wozu eigentlich Max Weber? Was hat er uns heute noch zu sagen? Wie steht es um ein »Weber-Paradigma«,[13] also ein Forschungsprogramm, dem 15heutige Kultur- und Sozialwissenschaften folgen sollten? Und wenn es eins gibt, warum existiert dann keine weberianische Soziologie mehr? Warum arbeitet man gern über Weber, wie die nicht abreißende Flut an Sekundärliteratur national und international beweist, aber weniger mit Weber? Ist uns Weber als Klassiker historisch geworden? Erleidet er also das gleiche Schicksal, wie der von ihm bewunderte Goethe? Also der unzweideutige Status als deutscher Nationaldichter, aber kaum noch gelesen, so dass es schon der Jugendfilme mit drastischem Titel[14] bedarf, um an seinen Namen ohne Kenntnis seines Werkes zu erinnern? Wird also, wie es M. Rainer Lepsius[15] ausdrückte, Max Weber zum Vertreter der »Maximen und Reflexionen« von Kultur- und Sozialwissenschaften ohne nähere Auseinandersetzung mit seinem Denken?
Tatsächlich ist Max Weber längst nicht mehr der »Makroanthropos unserer Welt«. Vieles von dem, was er wohl abgelehnt hätte, scheinen wir heute realisiert zu haben: eine Massendemokratie ohne politische Führung, einen umfassenden Sozialstaat mit ausgebauter Sozialpolitik von der Wiege bis zur Bahre, ein kapitalistisches Wirtschaftssystem, dem es nur um die drei »Ws«, also Wachstum, Wohlstand und Wohlfahrt geht und nicht mehr um die Bildung von Menschen, die »den Adel unserer Natur«[16] ausmachen sollen. Max Weber scheint in der gegenwärtigen ideologischen Großwetterlage in Deutschland der berühmt-berüchtigte »alte, weiße Mann« zu sein: Ein Mensch mit ausgeprägter Männlichkeit, der sich in alle möglichen »Ehrhändel« verwickeln ließ, ein glühender Nationalist und Patriot mit Interesse an den Weltmachtambitionen Deutschlands, ein – wenn auch ambivalenter – Befürworter des Kapitalismus als vermeintliche Gegenmacht zu ausuferndem Staat und wuchernder Bürokratie, ein titanischer Mensch, der nach Größe strebte und sich zur methodisch-rationalen Lebensführung regelrecht zwingen musste, ganz im Dienste des eigenen Werkes. Ein entschiedener Befürworter einer Kultur der Freiheit und nicht der Gleichheit, zu der 16sich eine geistesaristokratische »Moral der Vornehmheit«[17] gesellte. Kein Zweifel: Max Weber würde heute weltanschaulich und politisch wohl eher im konservativen Lager verortet und nicht mehr in der (links-)liberalen Mitte, der er sich zeitlebens verbunden wusste.
Freilich ist das nur die eine Seite Webers, in der er uns fremd und regelrecht »unzeitgemäß« geworden ist. Die andere Seite würde seine Sorge um Deutschland hervorheben, sein Interesse an der Parlamentarisierung der Politik, der Einhegung der Bürokratie, ja der Weltoffenheit und des kosmopolitischen Weitblicks für das, was einst »Universalgeschichte« hieß. Neben dem bildungsbürgerlichen Kanon zieht ihn alles an, was modern und unkonventionell zu sein scheint. Seien es die erotischen Radierungen von Max Klinger, die er seiner Frau schenkt. Sei es sein Einsatz für die bürgerliche Frauenbewegung, in der sich Marianne Weber engagiert. Weber tritt dezidiert für Wissenschaftler jüdischer Abstammung in der deutschen Hochschule ein, wie etwa Georg Simmel, dessen Berufung nach Heidelberg er vergeblich betreibt. Im Kaiserreich, in dem die deutsche Jugend rechts und national eingestellt ist, provoziert er mit dem Gedanken, dass die Universität durch Sozialisten und Kommunisten durchaus bereichert werden könnte, wenn sie sich an das Postulat der Wertfreiheit in Forschung und Lehre halten würden. Weber lädt den Rassentheoretiker Alfred Ploetz zum Vortrag auf den Soziologentag ein, nur um ihm dann minutiös nachzuweisen, dass sein Rassenbegriff wissenschaftlich unbrauchbar, weil zu undifferenziert ist. Die weitreichenden Erklärungsansprüche der Rassenbiologie auch für gesellschaftliche Zustände seien völlig ungedeckt und die von ihm konstatierten Rassenunterschiede seien eher das Ergebnis von sozialen Vorherrschaftsansprüchen der Weißen denn biologischer Natur. In Berlin lernt er W. E. B. Du Bois kennen, den er auf seiner Amerikareise wiedertreffen wird. Du Bois hatte mit The Philadelphia Negro die erste brauchbare empirische Studie über das soziale Schicksal der Schwarzen vorgelegt. The Souls of Black Folk[18] begeistert Weber so sehr, dass er – ebenfalls vergeblich – eine deutsche Übersetzung anregt.
17Bei alledem ist Weber kein typischer Theoretiker der Moderne, der mit einem Begriff die Welt erklären will. Denn von Großtheorien hält er nichts, weil sie ein überlegenes Wissen vorspiegeln, wo es sich um wilde Spekulationen handelt. Diese fast instinktive Ablehnung von Gesellschaftstheorie und Weltanschauungsproduktion hat ihn lange vor dem seinerzeit und auch heute noch normativen Fach »Soziologie« zurückschrecken lassen. Mit Dilettanten und ideologischen Virtuosen wollte er nichts zu tun haben. Steril aufgeregtes Literatengeschwätz, also Aufmerksamkeit bloß um der Aufmerksamkeit willen, war ihm ein Gräuel.
Gleichwohl hat er sich für alle möglichen Visionen und Utopien interessiert, sofern sie neue geistige Horizonte zu erschließen versprachen. Überall da, wo er nicht Schau in der Selbstdarstellung gewittert, sondern metaphysische Leidenschaft im Denken gespürt hat, hat er sich sofort mit ihnen auseinandergesetzt. So diskutiert er im Februar 1920 eineinhalb Tage lang mit Oswald Spengler über dessen Untergang des Abendlandes im Münchner Rathaus, wie er überhaupt noch die radikalsten Ideensysteme erst einmal ernstgenommen hat, um sie dann mit überzeugenden Argumenten umso klarer kritisieren zu können. Nach Beendigung der Diskussion, in der Spengler sich über Nietzsche und Marx als veraltete Figuren des 19. Jahrhunderts lustig gemacht hatte, sagte Weber zu seinen Studenten:
Die Redlichkeit eines heutigen Gelehrten, und vor allem eines heutigen Philosophen, kann man daran messen, wie er sich zu Nietzsche und Marx stellt. Wer nicht zugibt, daß er gewichtigste Teile seiner eigenen Arbeit nicht leisten könnte, ohne die Arbeit, die diese beiden getan haben, beschwindelt sich selbst und andere. Die Welt, in der wir selbst geistig existieren, ist weitgehend eine von Marx und Nietzsche geprägte Welt.[19]
Weber steht auf den Schultern der Riesen Marx und Nietzsche,[20] nicht weil er Marxist oder Nietzscheaner ist, sondern weil sie ihn 18die Grundkonfiguration der Moderne besser verstehen lassen. Weber ist Marxianer insofern, als er methodisch die Hypothese der materialistischen Geschichtsauffassung als Kontrastfolie für seine eigene Arbeit nutzt und sachlich den Kapitalismus ebenfalls als die »schicksalsvollste[ ] Macht unsres modernen Lebens«[21] ansieht. Weber ist kein Nietzscheaner, aber methodisch folgt er den Spuren des großen ikonoklastischen Destrukteurs aller »-ismen« wie Materialismus, Historismus, Naturalismus, Evolutionismus und Positivismus. Sachlich teilt Weber Nietzsches Diagnose vom Tod Gottes. Marx und Nietzsche liefern Weber methodisch und theoretisch die Mittel zur Kritik der bürgerlichen Gesellschaft. Seine Kritik des Kapitalismus folgt in ihrer Ambivalenz ganz der Marx’schen Linie: technischer und ökonomischer »Fortschritt« ja, aber um den Preis der Seelenlosigkeit der wirtschaftlichen Maschinerie. Nietzsche gibt ihm die Stichworte zur Auseinandersetzung mit und Kritik an der bürgerlichen Moral. Die Entzauberung und Säkularisierung der Welt untergräbt das alte Pathos des Christentums, ohne dass eine neue Religion und Moral es ersetzen könnte. Die Moderne wird eine »Gesellschaft ohne Baldachin«.[22]
Auch wenn Marx und Nietzsche zur grundlegenden Orientierung von Webers Denken beigetragen haben mögen, geht er doch seinen eigenen Weg. Ihn interessiert die Entstehung der modernen Welt, die verschlungenen Pfade und Verästelungen vieler Entwicklungen, die sie dann als überraschendes Ergebnis hervorgebracht haben. Die »okzidentale Moderne« – wie er sie nennt und eben nicht »Abendland« wie Spengler – lässt sich nicht durch eine geschlossene Gesellschaftstheorie verstehen, wie es Marx in seiner politökonomischen Kapitalismusanalyse versucht hat. Vielmehr hilft nur eine offene Gesellschaftsgeschichte, die nicht von einem System und seinen Gesetzen ausgeht, sondern den Entwicklungen auf vielen Feldern nachgeht, um dann die »Verkettung von Umständen« anzugeben, die zum Take-off der Moderne im Westen geführt haben. Wie Marx findet auch Weber spät zu seinem Lebensthema, und ähnlich wie bei Nietzsche spielen Fragen der Religion und Moral eine zentrale Rolle. Deshalb interessiert ihn nicht der Kapitalismus 19per se, sondern die Kulturbedeutung des Kapitalismus. Diese Anlage seines Denkens bringt es mit sich, dass er die moderne Gesellschaft in ihren zahlreichen Verzweigungen und Verästelungen historisch-empirisch untersucht und in komplexen Konstellationsanalysen zu fassen versucht. Und wie in einem guten Kriminalroman wird er die Auflösung seines »Falls der Moderne«[23] ganz auf das Ende seines Lebens verschieben und dann in der »Vorbemerkung« seiner Religionssoziologie buchstäblich verstecken.
Webers Weg zur Darstellung der Genealogie der Moderne zu erzählen ist deshalb gar nicht so einfach. Es ist ein krummer Weg, der bei ihm zum Ziel führt. Deshalb soll einerseits der konventionellen Dreiteilung seines Werkes gefolgt werden, andererseits werden jeweils Tiefenbohrungen in den folgenden Kapiteln vorgenommen. Die erste Phase reicht von seinen Qualifikationsarbeiten Dissertation und Habilitation bis zu seinem Nervenzusammenbruch im Jahre 1898. In seiner Dissertation »Entwickelung des Solidarhaftprinzips und des Sondervermögens der offenen Handelsgesellschaft aus den Haushalts- und Gewerbegemeinschaften in den italienischen Städten« (1889), danach als Buch Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter[24] publiziert, studiert Weber die Trennung des Firmenvermögens von der Familiengemeinschaft als eine wichtige Voraussetzung für die Entstehung des Kapitalismus. Die Habilitation Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats- und Privatrecht[25] diskutiert den umkämpften »ager publicus« und wie Gemein- in Privateigentum umgewandelt wurde. Bereits in den Qualifikationsarbeiten demonstriert Weber nicht nur den analytischen Scharfsinn des Juristen, sondern das Interesse des Historikers an den Wurzeln des Kapitalismus. Gleich danach stürzt er sich in empirische Enquetearbeiten. Er beteiligt sich an der Studie über »Die Verhältnisse der Landarbeiter in Deutschland« und wird sich mit Ostdeutschland beschäftigen, wo er die Transformation von einer patriarchalischen zu einer kapitalistischen Arbeitsorganisati20on aufzeigt. Hier demonstriert der junge Weber seine enorme Arbeitskraft, denn innerhalb eines Jahres erstellt er eine 891-seitige Studie,[26] die ihn schlagartig im Deutschen Reich bekannt machen sollte. 1894 steuert er seine Studie über Die Börse[27] für Friedrich Naumanns Reihe Göttinger Arbeiterbibliothek bei, um auch der Arbeiterschaft zu zeigen, wie notwendig eine solche Institution als Finanzbasis für einen dynamischen Kapitalismus ist. Fachlich strebt der gelernte Jurist in die Wirtschafts-, Rechts- und Sozialgeschichte mit dem thematischen Schwerpunkt »Kapitalismus«, ist aber trotz soziologischer Färbung seiner Studien von seiner »Soziologie« noch ziemlich weit entfernt. Das wird sich mit seiner Genesung ändern.
Mit dem Beginn der zweiten Phase im Jahre 1903/1904 tritt er mit methodischen und universalgeschichtlichen Arbeiten hervor, die ihn weiter bekannt und heute berühmt machen sollten. Er schreibt die wichtigen Texte, die dann Marianne Weber nach seinem Tod als Wissenschaftslehre herausgeben sollte. Er verfasst die »Protestantische Ethik«, die eine langanhaltende Diskussion auslösen sollte, die er 1910 mit einem »antikritischen Schlußwort« beendet. Zugleich betätigt er sich weiter in empirischer Sozialforschung und beteiligt sich an einer Enquete zu den Industriearbeitern. Das Thema der Arbeit lässt ihn nicht mehr los und deshalb schreibt er eine »Psychophysik der Arbeit«,[28] um die psycho-physiologischen Bedingungen und Folgen der Arbeitsproduktivität aufzudecken. In dieser zweiten Phase legt Weber die methodischen und sachlichen Grundlagen seiner »Soziologie«.
In der dritten Phase von 1910 bis 1920 widmet er sich schließlich seinen beiden, innerlich eng zusammenhängenden Großprojekten: seinem eigenen Beitrag zum Grundriss der Sozialökonomik Wirt21schaft und Gesellschaft, dessen ersten Teil er noch selbst zum Druck bringen kann, sowie den Gesammelten Aufsätzen zur Religionssoziologie, die seine Überlegungen zur Kulturbedeutung des Kapitalismus und des Aufstiegs der »okzidentalen Moderne« in eine vergleichende Religions- und Gesellschaftsgeschichte der Weltregionen einbetten. Beide Großprojekte sollten ihn bis zu seinem Tod 1920 beschäftigen, ohne dass er sie wirklich zu Ende bringen konnte.
Diese konventionelle Erzählung anhand der drei Phasen seiner Werkbiographie wird gebrochen durch Tiefenbohrungen in sein Werk, die vielleicht auch die bleibenden Einsichten und Erkenntnisse Webers zutage fördern können. Sie werden die Spuren offenlegen, die Weber in seinen zahlreichen Studien hinterlassen hat. Die Schlussbetrachtung »Max Weber und wir« wird am Ende nochmals die Frage aufnehmen, was wir mit diesem großen und großartigen Werk, mit diesem Riesentorso eines »Stoffhubers« und »Sinnhubers«[29] heute noch anfangen können. Der vorliegende Ein- und Ausblick soll zeigen, dass auch in der Gegenwart noch viel von Weber für das Studium und das Verständnis heutiger Gesellschaften zu lernen ist. Die Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland hatte wohl die richtige Intuition, sich diesen Namenspatron auszusuchen.
221. Max Weber in seiner Zeit
Max Weber lebt zwischen zwei Welten und gleichsam zwischen den Zeiten.[1] Er wird kurz vor Beginn des Kaiserreichs geboren und sein Tod fällt in die Zeit des turbulenten Übergangs nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg, des Zusammenbruchs und der Revolution, die dann zur Geburt der ersten demokratischen Republik von Weimar führen sollten. Prägend für sein Leben und sein Wirken wird das Kaiserreich.[2] Das wilhelminische Zeitalter fußt auf der autoritären Einigung des deutschen Reichs durch Otto von Bismarck, der dem sich modernisierenden Deutschland einen konservativ-militärischen Traditionscharakter verleiht mit einem Kaiser an der Spitze, seinem Hof und dem Militär als ›Staat im Staate‹. Nach drei erfolgreichen Kriegen und der Reichseinigung unter preußischer Vorherrschaft vermag der durchsetzungsstarke Bismarck seine charismatische Herrschaft bis in das Jahr 1890 durchzuhalten. Nach außen gelingt ihm durch seine geschickte, vermittelnde Bündnispolitik, das verunsicherte Europa mit der Idee eines saturierten, weil endlich geeinigten Deutschland zu versöhnen. Hier glänzt der »Eiserne Kanzler« als »ehrlicher Makler«. Nach innen hingegen lässt er jegliches diplomatische Geschick vermissen, zettelt erst einen Kulturkampf gegen die Katholiken an, um dann mit seiner Sozialistengesetzgebung gegen die Sozialdemokraten als angeblich ›innere Reichsfeinde‹ vorzugehen. Deutschland zeigt sich nach außen stark, bleibt aber innerlich tief gespalten, weil Katholiken und Arbeiterschaft gleichsam als Bürger zweiter Klasse außerhalb des Reiches[3] zu stehen scheinen. Das ist Bismarcks ambivalentes Erbe. Schon seit 1888 schickt sich der junge Kaiser Wilhelm II. an, selbst regieren zu wollen mit willigen Kanzlern seiner Wahl. Seine 23Regentschaft läutet das Ende einer ausgewogenen, friedensorientierten Balance- und Bündnispolitik ein – mit fatalen Folgen für Deutschland und die Welt.
Seither treiben die Modernisierungskräfte von Wirtschaft, Wissenschaft und Technik und die reaktionären Traditionsmächte von Kaiser, Adel und Militär immer weiter auseinander. Tradition und Moderne stehen sich in der wilhelminischen Gesellschaft unversöhnlich gegenüber, worin Größe und Elend des Kaiserreichs zugleich zum Ausdruck kommt. Wohin soll die Reise in Zukunft gehen? Wieder stärker zurück zu Tradition und feudalen Verhältnissen oder weiter voran Richtung Modernisierung und Industrialisierung? So lauten die unvereinbaren Alternativen im Kampf zwischen preußischem Adel, dem erstarkenden Bürgertum und der Arbeiterklasse. Deutschland hatte sich längst zu einer wirtschaftlichen Großmacht gemausert, die ihre europäische Konkurrenz überholt hat und sich auf Augenhöhe mit der anderen aufstrebenden Großmacht, den Vereinigten Staaten von Amerika, befindet. Politisch unsicher, ist dieses deutsche Kaiserreich noch auf der Suche nach seiner Position im Konzert der anderen, viel erfahreneren Nationen und seiner eigenen, exponierten Stellung in der Welt. Gern hätte der Novize auch einen »Platz an der Sonne«, schwadroniert lauthals von Lebensraum und Vorherrschaft in Mitteleuropa. Das Ende vom Lied sind die falschen Bündnisse in den kommenden militärischen Auseinandersetzungen. Deutschland setzt ein letztes Mal auf Tradition und liegt falsch. Der fatale Dreibund mit Italien und mit dem seinem Untergang geweihten Habsburgerreich zieht am Ende auch Deutschland in den historischen Abgrund.
Das Finale dieser dilettantischen Politik läutet der Beginn des Ersten Weltkrieges ein, die europäische Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Die Kriegsniederlage führt zu einer Achsendrehung von Deutschlands Schicksal: Von einer angehenden Großmacht in Europa zum Pariavolk der Welt – so zumindest die Wahrnehmung vieler Zeitgenossen. Immerhin wirft die Revolution von 1918 und die Weimarer Republik den Ballast der Monarchie ab, der den Hiatus von Tradition und Moderne in Deutschland begründet hatte. Nach der Flucht des Kaisers nach Holland findet damit die Hohenzollerndynastie ihr unrühmliches Ende – mit der Folge, dass die Monarchie in Deutschland nie wieder in der Geschichte eine Chance bekommen sollte.
24Max Weber als eminent politischer Mensch,[4] der schon im Elternhaus auf die Größen der nationalliberalen Partei trifft, ist ein glühender Patriot, dem Größe und Schicksal Deutschlands zur Leitlinie politischen Denkens wird. Seine politische Sozialisation fällt in die Zeit der beiden zentralen Führungsfiguren des Kaiserreichs: des eisernen Kanzlers mit seinen charismatischen Stärken und seinen unübersehbaren Schwächen sowie des jugendlich-nervösen Kaisers mit seinen unausgegorenen Weltmachtambitionen.
Diese Spannungsgeladenheit der Politik kehrt in Webers Wirklichkeitsverständnis wieder: In soziologischer Hinsicht vertritt er eine agonale Wirklichkeitsauffassung, denn Leben heißt ihm unaufhörlicher Kampf um Lebenschancen, Macht und Herrschaft. Zentral für seinen Ansatz ist seine Herrschaftssoziologie, die sich für die Prinzipien und Konstellationen von Machtbeziehungen samt ihren Institutionalisierungsformen, Rechtsverordnungen und Verwaltungsapparaten in Geschichte und Gesellschaft interessiert. Flankiert werden Politik, Herrschaft und Verwaltung durch Wirtschaft, Technik und Kapitalismus einerseits, Kultur, Religion und Wissenschaft andererseits. Der Kapitalismus als dynamische Antriebskraft gilt Weber, wie bereits erwähnt, als »schicksalsvollste[ ] Macht unsres modernen Lebens«,[5] weshalb der Kapitalismus wie bei Karl Marx vor ihm und bei seinem Zeitgenossen Werner Sombart zu seinem Kardinalthema wird. Religion, Wissenschaft und Kultur verkörpern die Mächte, die dem sozialen Leben wie der individuellen Lebensführung überhaupt erst Sinn und Bedeutung geben. ›Was ist gut, was ist böse?‹, ›Was macht Sinn, was hat Bedeutung?‹ und ›Wie soll ich leben?‹ – das genau sind die Fragen, worauf die Religion als oberste geistige wie geistliche Lebensführungsinstanz Antworten zu geben verspricht. Die moderne Wissenschaft unterstützt diese Orientierungssuche durch ihre rasant wachsenden neuen Erkenntnisse und Technologien, indem sie immer mehr Bereiche der Natur und der Gesellschaft kontrollier- und berechenbar zu machen versucht. Angesichts dieser komplexen Sachlage betrachtet Weber Wirtschaft, Politik und Kultur in Antike, Mittelalter und Moderne. Seine Studien umfassen daher einen denkbar weit ge25spannten Forschungskosmos: Weber thematisiert »Welt«, um die »Moderne« zu verstehen.
Gleichwohl war er ein Kind seiner Zeit. Heute erscheint Weber uns als ein durchweg wilhelminisch geprägter Mensch – trotz seiner fundamentalen Kritik am Kaiserreich. Dirk Kaesler, der die wohl umfassendste Biographie zu Weber verfasst hat, nennt ihn »Preuße, Denker, Muttersohn«.[6] Angesichts seines weiten Horizonts ist er zugleich besonders sensibel für die Ambivalenzen und Konflikte der Moderne. Als »Wilhelminer« steht er uns fern und mutet uns fremd an, als »Moderner« wirkt er uns nah und vertraut. Fern und fremd sind uns die Konflikte des wilhelminischen Kaiserreichs gerückt, die nur noch von historischem Interesse sind. Nah und vertraut bleiben uns die typischen Probleme der Moderne, weil wir auch heute noch in der Spätmoderne unter ihnen leben und leiden. Gerade weil Weber sich einer Genealogie der Moderne widmet, um zu zeigen, wie wir geworden sind, was wir sind, ist er unser Zeitgenosse, dessen Wort nach wie vor zählt.
Bevor wir Schritt für Schritt seine Genealogie der Moderne untersuchen, sei kurz und knapp die Biographie von Person und Werk vorgestellt.
Stationen eines Gelehrtenlebens
Als erstes von acht Kindern wird Max Weber am 21. April 1864 in Erfurt in die großbürgerliche Familie von Max Weber sen. und Helene Fallenstein geboren. Sein Vater, ein gelernter Jurist, entstammt dem Bielefelder Handelspatriziat, arbeitet zunächst als Magistrat in Erfurt, um dann im Jahre 1869 zum Stadtrat in Berlin ernannt zu werden und zugleich eine Karriere in der Nationalliberalen Partei im Preußischen Abgeordnetenhaus zu starten. Webers Vater ist ein typisch bürgerlicher Politiker, pragmatisch, am politischen Tagesgeschäft ausgerichtet; er verkörpert das, was Wolfgang Mommsen »selbstzufriedenen Honoratiorenliberalismus«[7] nennt. Seine hedonistische Lebensführung prallt immer wieder mit der pietistisch 26ernsthaften Lebensauffassung der Mutter zusammen. Denn Helene Fallenstein, hoch gebildet – für Frauen in dieser Zeit eher die Ausnahme als die Regel –, beschäftigt sich mit religiösen sowie sozialen Fragen gleichermaßen und setzt sich für die Bedürftigen ein, was zur Einrichtung einer Armenverwaltung innerhalb der Charlottenburger Stadtverwaltung führt. Sie stammt aus einer sehr guten Familie, denn ihr Großvater wirkte schon als Regierungsrat und später als geheimer Finanzrat im Berliner Ministerium.
Der junge Max ist ein Sorgenkind. Schon mit vier Jahren leidet er an Meningitis, hat einen mächtigen Schädel, was Angst vor einem Wasserkopf auslöste, genießt infolgedessen eine überprotektive Erziehung durch die Mutter. Und gerade Sorgenkinder im Jugendalter werden oft zu Lieblingskindern bis weit in deren Erwachsenenzeit. Helene wird ihrem Max zeit ihres Lebens, man könnte sagen, ihre Höchstaufmerksamkeit schenken. In der Praxis sieht das so aus, das sie stets und ständig am liebsten alles wissen möchte, was »ihren Max« betrifft. Kein Wunder, dass Kaesler angesichts dieser symbiotischen Nähe Max Weber als »Muttersohn« bezeichnet. Max als Kronprinz pocht schon früh auf sein Recht als Erstgeborener und setzt sich gern als Vermittler zwischen Eltern und Kindern in Szene. Eine »Jugend in Berlin«[8] wie gemalt, mit der Residenz in der Charlottenburger Villa vor den Toren von Berlin, so dass man der lauten und grellen Großstadt jederzeit in die bürgerliche Vorstadtidylle entfliehen kann, was die Melancholie des jungen Weber jedoch nicht recht aufhellen will. Er wird als verschlossen angesehen und scheint die Welt vorwiegend durch die Brille von Familie und Verwandtschaft wahrgenommen zu haben. Weber wirkt emotional gehemmt, ja schüchtern und zurückhaltend, denn ihm fällt es denkbar schwer, Gefühle zu offenbaren. Dafür ist seine intellektuelle Entwicklung umso beeindruckender. Mit 13 Jahren hat er bereits Schopenhauer, Spinoza und Kant gelesen. Goethe wird heimlich unter der Schulbank studiert. Mit 15 Jahren hat er sämtliche antike Klassiker verschlungen wie Homer, Herodot, Vergil, Lucius, Cicero und Sallust. Wie er selbst von sich meinte: »Ich bin intellektuell früh, in allem übrigen aber sehr spät reif geworden«.[9]
27Im Jahr 1882 macht er sein Abitur am Königlichen Kaiserin-Augusta-Gymnasium in Charlottenburg und nimmt das Studium der Jurisprudenz, Geschichte, Philosophie, Theologie und Nationalökonomie auf. Zunächst verbringt er drei Semester in Heidelberg, 1883 absolviert er seine einjährige Militärzeit in Straßburg, wo er die Nähe zur Familie Baumgarten sucht. Sein Onkel Hermann, ein alter 48er, wird zum Ersatzvater und Mentor für den politisch interessierten Max. Was er mit seinem eigenen Vater nicht diskutieren kann, das Schicksal des Liberalismus in Deutschland, das gelingt ihm mit Hermann Baumgarten. 1883/1884 studiert er zwei Semester Jura in Berlin, um dann noch ein Vorbereitungssemester in Göttingen draufzusatteln.
Max Weber ist ein vielseitig interessierter und denkbar fleißiger Studiosus. Dem Wunsch seines Vaters folgend, tritt er in die Burschenschaft Alemannia in Heidelberg ein, holt seine ›Satisfaktionsfähigkeit‹ auf dem Paukboden ein und lernt das harte Trinken im Kreis der Burschenschaft. Der exzessive Alkoholkonsum wird eine Leidenschaft, denn noch als junger Professor in Freiburg ist er sichtlich stolz darauf, seine Studenten »unter den Tisch trinken« zu können. 1886 legt er sein juristisches Staatsexamen erfolgreich ab und muss schon des lieben Geldes halber bis 1893, dem Jahr seiner Heirat, ins Elternhaus nach Berlin zurückkehren. Mit dreißig Jahren noch immer unter dem Dach des patriarchalischen Vaters und der moralisch dominanten Mutter leben zu müssen, dürfte den Stolz des jungen Weber kräftig verletzt haben. Das passiert ausgerechnet ihm, dem »Kronprinzen« und ältesten Sohn, der dabei ist, eine bemerkenswerte Universitätskarriere zu machen.
Im Jahre 1889 promoviert er sich bei Levin Goldschmidt mit einer Dissertation über »Die Entwickelung des Solidarhaftprinzips und des Sondervermögens der offenen Handelsgesellschaft aus den Haushalts- und Gewerbegemeinschaften in den italienischen Städten«. Zwei Jahre später folgt die Habilitation bei August Meitzen mit der Schrift »Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats- und Privatrecht«.
1891 kommt die junge Marianne Schnitger, eine Bielefelder Cousine zweiten Grades, nach Berlin und wird von Helene Weber wie ihre eigene Tochter in die Familie aufgenommen. Max und 28Marianne verstehen sich auch ganz gut, so reift der Plan einer Heirat bei den beiden Frauen[10] heran. Da es Weber aufgrund seiner emotionalen Zurückhaltung wohl kaum gelingen wird, sich selbst eine Ehefrau zu suchen, muss man ein wenig nachhelfen. Immerhin hatte Weber in seiner Straßburger Zeit Emmy Baumgarten ein Verlobungsversprechen gemacht, auch um seiner bevorzugten Zweitfamilie nahe zu sein. Bevor er heiraten kann, muss er dieses Versprechen lösen, was ihm nicht leichtfällt. Helene hat diese Liaison eingefädelt, weil sie glaubt, dass es für ihren ältesten Sohn an der Zeit ist, in den Stand der Ehe einzutreten. Entsprechend nüchtern geht es zwischen den beiden »Liebenden« zu, denn freundschaftliche Sympathie sollte nicht mit erotischer Liebe verwechselt werden. Ein Auszug aus seinem Werbungsbrief um Marianne gibt einen Eindruck von dem Umgangston zwischen den beiden wie auch der Tönung ihrer Beziehung. Weber schreibt:
Hoch geht die Sturmflut der Leidenschaften und es ist dunkel um uns, – komm mit mir, mein hochherziger Kamerad, aus dem stillen Hafen der Resignation, hinaus auf die hohe See, wo im Ringen der Seelen die Menschen wachsen und das Vergängliche von ihnen fällt. Aber bedenke: im Kopf und Busen des Seemanns muß es klar sein, wenn es unter ihm brandet. Keine phantasievolle Hingabe an unklare und mystische Seelenstimmungen dürfen wir in uns dulden. Denn wenn die Empfindung Dir hoch geht, mußt Du sie bändigen, um mit nüchternem Sinn Dich steuern zu können.[11]
Das ist der Kern seines Heiratsantrages, der von Marianne liebend gern angenommen wurde. Sie nimmt billigend in Kauf, dass leidenschaftliche Liebesempfindungen als »mystische Seelenempfindungen« auf den Verbotsindex des zukünftigen ehelichen Zusammenlebens kommen. Nach der Hochzeit am 20. September 1893 in Oerlinghausen nimmt es wenig Wunder, dass diese Verbindung, die ein Leben lang halten sollte, den Charakter einer Kameradschaftsehe annahm, die sexuell wohl niemals wirklich vollzogen wurde. Weber litt schließlich nach wie vor unter seinen emotionalen Hemmungen. Es wird dauern, bis er die Erotik und den Zauber der 29Liebe entdeckt. Dieses Erlebnis wird er dann aber nicht mit seiner Frau, sondern außerhalb der Ehe erfahren.
»Max Weber und die Frauen« ist ein Thema für sich, wie Ingrid Gilcher-Holtey[12] eindrucksvoll aufgezeigt hat. Vier Frauen sind für Webers Leben entscheidend. An erster Stelle steht die Mutter Helene und sie bleibt es fast ein Leben lang, denn sie stirbt erst 1919, nur ein Jahr vor dem Tod ihres Lieblingssohnes. Als ethisches Vorbild unantastbar, hat Weber seine Mutter stets vor den patriarchalischen Zumutungen des Vaters in Schutz genommen. Die Kehrseite dieser engen Bindung ist die lückenlose Überwachung der Lebensführung des Sohnes Max, der zwar etwas Distanz zwischen sich und sie zu bringen versucht, indem er ihr eben nicht mehr alles aus seinem Leben berichtet. Diese Berichtsfunktion übernimmt dafür bereitwillig Marianne, die sogar die an sie selbst gerichteten persönlichen Briefe von Max der Mutter ohne dessen Kenntnis von Freiburg und Heidelberg nach Berlin weiterleitet. Aus lauter Sorge wird Max Weber ein Leben lang von den beiden Frauen streng überwacht, eine fürsorgliche Belagerung. An zweiter Stelle steht die Ehefrau, mit der er eine lebenslange Beziehung in Gestalt einer unverbrüchlichen Gefährtenschaft pflegen sollte: »1893 bis ins Pianissimo des höchsten Alters«, wie die Widmung im ersten Band der Gesammelten Aufsätze zur Religionssoziologie am Ende seines Lebens lauten sollte. Obgleich nicht berufstätig, ist Marianne wissenschaftlich sehr interessiert und engagiert sich aktiv in der bürgerlichen Frauenbewegung.[13] Drittens lernt Weber Mina Tobler kennen, eine Schweizer Pianistin, die sich als Klavierlehrerin in Heidelberg niederlässt und in den Kreisen der Webers verkehrt. Seit 1910 wird sie nicht nur 30seine erotische Muse, sondern ihr verdankt Weber die Entdeckung, dass auch die okzidentale Musik einem Prozess der Rationalisierung[14] unterliegt. In diesem Zusammenhang verfasst er seine Musiksoziologie, die erst posthum[15] erscheinen wird. Seine große Liebe freilich gilt der vierten Frau in seinem Leben: Else Jaffé-von Richthofen. Sie ist die erste Studentin von Weber, promoviert Ende Juli 1900[16] bei ihm und wird die erste Fabrikinspektorin in Baden. Da sie »zur ersten höheren Staatsbeamtin Deutschlands ernannt« wird, »schlägt sie eine Bresche in ein Berufsfeld, das bisher den Frauen hierzulande völlig verschlossen war«.[17] Dennoch hält es sie nur zwei Jahre im Beruf, dann heiratet sie den vermögenden Edgar Jaffé und bekommt drei Kinder von ihm und ein Kind von Otto Gross, dem Psychiater, Anhänger der erotischen Bewegung und Propagandist der »freien Liebe«. Sie beginnt außereheliche Liebesbeziehungen, zunächst mit dem Privatdozenten für Chirurgie und späteren berühmten Urologen Friedrich Voelcker, dann ab 1909 mit Max Webers Bruder Alfred. Das sollte zur Entfremdung zwischen Max und Else führen, da er zum einen zu diesem Zeitpunkt wohl bereits selbst ein Auge auf sie geworfen hatte, zum anderen die beginnende »Ménage à trois« zwischen dem Ehemann Edgar, seinem Bruder Alfred und Else scharf kritisierte. Erst 1916 sollte es zur Aussöhnung kommen, 1918 wird sie auch die Geliebte von Max Weber. Nach dessen Tod und nach dem Tod von Edgar Jaffé 1921 wird sie ihr Leben gemeinsam mit Alfred Weber verbringen.
Dank Mina Tobler und Else Jaffé-von Richthofen wird Weber einen emotionalen Lernprozess durchlaufen, der ihn schließlich die 31Erotik als eigenständige Wertsphäre begreifen lässt. Ein Auszug aus der »Zwischenbetrachtung« der Religionssoziologie, die er 1919 auch mit Else Jaffé-von Richthofen[18] diskutiert, liest sich etwas anders als sein Heiratsantrag:
Gerade darin: in der Unbegründbarkeit und Unausschöpfbarkeit des eigenen, durch kein Mittel kommunikablen, darin dem mystischen ›Haben‹ gleichartigen Erlebnisses, und nicht nur vermöge der Intensität seines Erlebens, sondern der unmittelbar besessenen Realität nach, weiß sich der Liebende in den jedem rationalen Bemühen ewig unzugänglichen Kern des wahrhaft Lebendigen eingepflanzt, den kalten Skeletthänden rationaler Ordnungen ebenso völlig entronnen wie der Stumpfheit des Alltags.[19]
Gegen Ende seines Lebens trifft Max Weber Verabredungen mit seiner Frau Marianne über die Widmungen für die Gesammelten Aufsätze zur Religionssoziologie: Der erste Band über Protestantismus und Konfuzianismus ist ihr gewidmet. Der zweite Band über Hinduismus und Buddhismus wird Mina Tobler zugeeignet. Den dritten Band über das antike Judentum widmet Weber Else Jaffé-Richthofen.
Nach der Heirat mit Marianne 1893 legt Weber einen rasanten wissenschaftlichen Aufstieg hin. Mit gerade einmal 29 Jahren wird er Extraordinarius für Handelsrecht an der Berliner Universität, bevor er ein Jahr später, 1894, einem Ruf als Ordinarius für Nationalökonomie nach Freiburg folgen wird. Wiederum nur zwei Jahre später, 1896, erhält er einen Ruf nach Heidelberg und wird Nachfolger des berühmten Nationalökonomen Karl Knies. Vergleicht man Webers atemberaubende Karriere mit den beiden anderen Klassikern der Soziologie, Ferdinand Tönnies und Georg Simmel, dann wird deutlich, was für ein »Götterliebling« Weber in der wilhelminischen Kultusbürokratie war. Ferdinand Tönnies macht bereits mit 16 Jahren in Husum Abitur, ist mit 22 an der Universität Tübingen promoviert und mit 25 habilitiert er sich an der Universität Kiel mit seiner bekannten Hobbes-Studie. 1887 schreibt er sein Hauptwerk Gemeinschaft und Gesellschaft und wird zu einem Begründer der deutschen Soziologie. Aber er muss dortselbst 27 Jahre als Pri32vatdozent zubringen, weil die preußische Kultusbürokratie den Ruf auf eine Professur blockiert. Ganz ähnlich ergeht es Georg Simmel, auch er ein Wunderkind an der Berliner Universität, der ebenfalls ein langes Leben als Privatdozent und Extraordinarius vor sich hat, bevor er im zarten Alter von 56 Jahren endlich 1914 eine Professur in Straßburg erhält. Freilich kann er dort nicht wirklich lehren, bricht doch im August der Erste Weltkrieg aus. Sicher, Weber hat schon Recht, wenn er die Universitätskarriere ganz einfach als »Hasard«[20] bezeichnet, in dem in einem hohen Grade Zufall und Glück dieses Würfelspiels das Avancement beherrschen würden. Denn nicht alle, die berufen sind, können aufgrund des extrem hierarchischen Zuschnitts der deutschen Universitätslandschaft damit rechnen, auch einen Ruf zu erhalten. Doch Zufall und Glück sind es nicht allein, die dem jungen Weber so rasch eine Professur bescheren, sondern dank seines hohen sozialen Kapitals wird er eben durch das »System Althoff«[21] entscheidend gefördert.
Webers Bilderbuchkarriere erhält indes einen jähen Riss, als es zum fatalen Konflikt mit seinem Vater kommt. Webers Eltern besuchen das junge Paar in Heidelberg. Weber, der die Autorität des Vaters stets respektiert und mit Kritik an dessen patriarchalem Gebaren sich zurückgehalten hat, wagt die Auseinandersetzung mit ihm, um der Mutter mehr Freiraum zu eröffnen. So darf sie nur in Begleitung ihres Mannes reisen und muss sich stets dessen Zeitplänen unterordnen. Der Disput mit dem Vater eskaliert und führt zum Zerwürfnis, so dass der Sohn den Vater vor die Tür setzt. Max Weber sen. fährt allein nach Berlin zurück. Einige Wochen später auf einer Reise nach Riga verstirbt Weber sen. unerwartet, so 33dass Vater und Sohn für immer unausgesöhnt voneinander scheiden. Dieses unglückliche Ende einer Vater-Sohn-Beziehung lastet schwer auf dem ohnehin chronisch überarbeiteten und angespannten Sohn, mit der Folge, dass Weber 1898 völlig zusammenbricht. Seine schwere Krankheit, eine psycho-physische Nervenkrise,[22] setzt ihn außer Gefecht, so dass er letztlich gezwungen ist, sich aus der Universität ganz zurückzuziehen. Das einzige Mittel, das ein wenig zu helfen scheint, ist das Reisen, so dass er zwischen 1900 und 1902 kaum in Heidelberg weilt. In seinem Krankheitsleben wechseln sich in der Folge längere Aufenthalte in Sanatorien, vielfältiges Reisen und »stumpfes Brüten« ab. Angesichts der langsamen und schleppend einsetzenden Genesung ist an wissenschaftliches Arbeiten nicht mehr zu denken. Das Jahr 1903 bringt den endgültigen Ausstieg aus der Professur. Weber wird von der Universität Heidelberg zum Honorarprofessor mit Lehrauftrag, aber ohne Promotions- und Mitspracherecht in seiner Fakultät gemacht.
Aus heutiger Sicht ist nur sehr schwer vorstellbar, dass Max Weber, der eines der größten Werke in den Kultur- und Sozialwissenschaften vorlegen sollte und als großer Denker meist in einer Reihe mit Marx, Nietzsche und Freud genannt wird, zu privatisieren gezwungen ist. Er wird Privatgelehrter – und genau dieser Rückzug in das eigene Arbeitszimmer eröffnet ihm die Chance, ein großes Werk zu schaffen. Seelischer Rückhalt und das Vermögen seiner Frau sowie ab 1910 die Villa am Neckarufer mit Blick auf das Heidelberger Schloss bieten Weber ordentliche Arbeitsbedingungen. Krankheit als Lebensform, ja Krankheit als Privileg zum legitimen Rückzug aus den vielfältigen Zumutungen von Universität und Gesellschaft kann, falls kreativ genutzt, auch eine Chance sein. Und doch stellte die Krankheit eine tiefe Zäsur in Webers Leben dar. Nichts ist mehr so wie vorher, ist doch die Welt der Kranken durch eine unsichtbare, aber wirksame Scheidemauer von der Welt der Gesunden getrennt. Dem rasanten Aufstieg folgte der jähe Absturz 34in Krankheit und Depression, von dem er sich allmählich erholen konnte, ohne jemals wieder völlig zu genesen. Die Angst vor der Rückkehr der Krankheit wird ihn in steter Sorge um sein labiles Nervenkostüm halten und immer wieder die bange Frage aufwerfen, was und wie viel er sich zumuten darf.
Und doch wird das Jahr 1903/1904 den Beginn einer neuen Wirkungsphase anzeigen, die gleich wieder von einem unglaublichen Arbeits- und Schaffensdrang zeugt. Trotz seiner Angst vor jeder Art gesundheitsgefährdender Belastung nimmt Weber die Einladung von Hugo Münsterberg zu einem wissenschaftlichen Kongress im Rahmen der Weltausstellung nach St. Louis, Missouri, sehr gerne an. Nach mehr als sechs Jahren hält er wieder einen Vortrag über »Kapitalismus und Agrarverfassung«.[23] Wie wir sehen werden, wecken die Vereinigten Staaten von Amerika seine Lebensgeister und ihm imponieren die USA als paradigmatisch moderne Gesellschaft.
Gemeinsam mit Edgar Jaffé und Werner Sombart gibt er die Zeitschrift Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik heraus, beteiligt sich am Geleitwort und platziert seinen berühmtesten Methodenaufsatz über »Die Objektivität sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis«[24] gleich als ersten Artikel der neuen Zeitschrift. Hier publiziert Weber 1904/1905 ebenfalls seinen ersten universalgeschichtlichen Aufsatz über die »Protestantische Ethik«,[25] der – darauf wird nachfolgend zurückzukommen sein – langanhaltende Diskussionen auslösen sollte.
Als im Jahre 1909 die Deutsche Gesellschaft für Soziologie formiert wird, gehört er zu den Gründungsmitgliedern. Er betätigt sich als Kassenwart und beginnt einen hartnäckigen Kampf um die »Werturteilsfreiheit« dieser neuen Wissenschaft. Trotz seines 35unbändigen Einsatzes für die Gesellschaft wird er 1914 wieder austreten, hatte sich dieses Prinzip als unerlässliche Voraussetzung für die »Wissenschaftlichkeit« der Soziologie doch nicht durchsetzen lassen. Im Frühjahr 1913 und 1914 reist Weber gleich zwei Mal nach Ascona am Lago Maggiore und wird am Monte Veritá Zeuge der Lebensführung von Naturmenschen, Vegetariern und Anarchisten. Er möchte eine Fastenkur einlegen und zugleich Frieda Gross, der geschiedenen Ehefrau von Otto Gross, in ihrem Sorgerechtsstreit mit ihrem ehemaligen Schwiegervater Peter Gross beistehen. Auch wenn seine Briefe an Marianne stets bemüht sind, die Distanz zwischen ihrer bürgerlichen Existenz und der alternativen Lebensweise der »Aussteiger« zu betonen, scheint sein Verständnis für die lebensreformerischen Bewegungen durch die Begegnungen mit dieser Form alternativer Lebensführung zu wachsen. Außenseiter unter sich – er, der chronisch Nervenkranke und die Anhänger neuer Lebensformen.
Eine historische Zäsur für Person und Werk ist der Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Sofort lässt Weber die wissenschaftliche Arbeit an seinen beiden Großprojekten – Wirtschaft und Gesellschaft und der Wirtschaftsethik der Weltreligionen – ruhen. Sehr zum Leidwesen seines Verlegers, denn Paul Siebeck hatte auf eine Fortsetzung des Handbuchs für Sozialökonomik gehofft. Weber sucht sich eine Tätigkeit, um dem Vaterland wenigstens an der Heimatfront zu dienen, und wird als Reserveoffizier zum Dienst in das Lazarett von Heidelberg eingezogen. Als aufrechter Patriot stimmt er zunächst in die allgemeine Kriegsbegeisterung ein. Als aber die Ultrarechten mit ihren immer höher gesteckten Kriegszielforderungen aufwarten, wächst seine Skepsis und er hofft auf einen glimpflichen Friedensschluss.
Nach Beendigung seines Lazarettdienstes kehrt er zu den Studien über die Wirtschaftsethik der Weltreligionen zurück und tröstet seinen Verleger damit, dass die ersten Aufsätze im Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik erscheinen. Zu Wirtschaft und Gesellschaft sollte er erst gegen Ende seines Lebens zurückkehren.
Die endgültige Kriegsniederlage kommt ihn hart an, weckt aber auch sein politisches Engagement für die Neuordnung Deutschlands nach dem Krieg. So wie Lord Keynes auf englischer Seite ist auch Max Weber Mitglied der deutschen Friedensdelegation und nimmt an den Verhandlungen zum Versailler Vertrag teil. Ähnlich 36wie Keynes, der die Härte des Friedensschlusses in seinem Buch The Economic Consequences of the Peace (1919) mit scharfen Worten geißelt, ist auch Weber voller Sorge um die Zukunft Deutschlands. Der Gelehrte versucht Politiker zu werden, tritt gleich 1918 in die Deutsche Demokratische Partei ein, beteiligt sich an der Ausarbeitung der Weimarer Reichsverfassung und plädiert für die Parlamentarisierung Deutschlands unter Führung eines vom Volk gewählten Reichspräsidenten.
Seine politischen Pläne zerschlagen sich jedoch und Weber nimmt seine Lehrtätigkeit probeweise in Wien wieder auf. 1919 nimmt er einen Ruf an die Universität München als Nachfolger von Lujo Brentano an, zumal Else Jaffé-von Richthofen nach Wolfratshausen gezogen war. Die brisante erotische Konstellation[26] – Max Weber weiß sich seiner Ehefrau und Mina Tobler zutiefst verpflichtet, Else ihrem kranken Ehemann und Alfred Weber – muss weder offengelegt noch gelöst werden. Max Weber stirbt am 14. Juni 1920 unerwartet an einer zu spät behandelten Lungenentzündung in München.
Ein solch knappes biographisches Stenogramm kann weder Leben noch Persönlichkeit von Max Weber erschöpfend behandeln. Das gelingt ja selbst den umfassenden Biographien nicht recht, die seit Marianne Webers Lebensbild mit über 700 Seiten nunmehr auf jeweils 1000 Seiten angeschwollen sind, wie bei Joachim Radkaus Leidenschaft des Denkens und Dirk Kaeslers Preuße, Denker, Muttersohn. Da nimmt sich Jürgen Kaubes Ein Leben zwischen den Epochen[27] mit knapp 500 Seiten fast asketisch schmal aus. Eine komplexe Persönlichkeit wie Max Weber ergibt kein ausgeklügeltes Buch, sondern scheint eher Kants Definition des Menschen zu bestätigen: »aus so krummem Holze, als woraus der Mensch gemacht ist, kann nichts ganz Gerades gezimmert werden«.[28] Und noch ein zweiter Gewährsmann kann angerufen werden, um Webers Persönlichkeit gerecht zu werden: Goethes Faust. »Zwei Seelen wohnen, 37ach!, in meiner Brust«[29] – das drückt auch gut die Antinomien in Webers Persönlichkeit aus. Einerseits entspricht er dem Ideal des asketischen Puritanismus, wie er es selbst in seiner »Protestantischen Ethik« gezeichnet hat: sachlich, arbeitsam, nüchtern und diszipliniert ist er ein eifriger Diener im Weinberg des Herrn der Wissenschaft. Weber kämpft für Wertfreiheit, plädiert wie Nietzsche für wissenschaftliche Redlichkeit, sieht sich nur einem Wert verpflichtet, dem der Wahrheit. Die »politische Korrektheit«, wie sie heute von den Medien, der Politik sowie den Geistes- und Sozialwissenschaften als »anständige«, weil vermeintlich diskriminierungsfreie Redeweise eingefordert wird, hätte er als unerträglichen Angriff auf die Freiheit der Wissenschaft verstanden und wäre auf die Barrikaden gegangen. Was ihn auszeichnet, ist ein ungeheure wissenschaftliche und politische Urteilskraft als unbestechlicher Beobachter von Gesellschaft und Politik.
Andererseits rumort eine vulkanische Leidenschaft in ihm, die sich kognitiv zwar gebändigt, aber in der Wucht doch elementar in Debattenbeiträgen und öffentlichen Diskussionen entlädt. Sie äußert sich auch in seinem Alkohol- und Drogenproblem: ersteres als Erbe seiner couleurstudentischen Burschenschaftsexistenz, letzteres als Folge seiner Krankheit, scheint doch jedes Mittel gerechtfertigt, solange es ihm nur etwas Linderung in Aussicht stellt. Und als in späteren Jahren seine emotionale Verschlossenheit und Kargheit aufgebrochen ist, schießt auch seine erotische Leidenschaft empor und erschüttert die Grundfesten seiner bürgerlichen Lebensführung. Ähnlich wie Goethe, der auch erst in einem gewissen Alter seine erotische Erfüllung erlebt hatte, überschritt Max Weber bewusst die Grenzen der Gefährtenehe in seinem erotischen Verhältnis zu Mina Tobler und Else Jaffé. Was er persönlich als Befreiungsakt erlebt und genossen haben mag, musste gleichwohl mit einem gehörigen Anflug von »schlechtem Gewissen« vor Mutter und Ehefrau streng geheim gehalten werden.
Die Ambivalenz seiner Einschätzung der Moderne spiegelt sich 38in der Antinomie seiner Persönlichkeit wider. Zum einen verkörpert Max Weber mit seiner bürgerlich-erfolgsorientierten Lebensführung, seinem atemberaubenden Aufstieg in der wilhelminischen Wissenschaftswelt, seinen Studien und Forschungen, aber auch seiner großbürgerlichen Ehe ganz die protestantisch-rationalen Werte und Lebensformen. Das ist der »Hochglanz-Weber«, auf dessen Spuren uns Marianne Weber mit der emphatischen Biographie ihres Mannes gesetzt hat. Es ist der heroische Mensch und Wissenschaftler, wie er in der Rede vom »Mythos von Heidelberg« verehrungsvoll zum Ausdruck kommt. Zum anderen – und das ist die Kehrseite der Medaille – ist da der andere Weber, nicht die Lichtgestalt, sondern der Schattenmann, der seine »Sehnsüchte« ausleben, das Gehäuse der bürgerlich-beruflichen Hörigkeit aufbrechen und aus dieser geordneten, routinisierten Welt ausbrechen will. Daher sein Interesse für die Lebensreform, für den neuen erotischen Diskurs, für den Anarchismus,[30] für Ascona,[31] aber auch für die russische Revolution und Tolstoi,[32] der das einfache Leben propagiert und selbst realisiert. Das ist der tiefere Grund seines Faibles für das Charisma, dessen Macht und Anziehungskraft ganze wohl etablierte Ordnungen aus den Angeln zu heben vermag.
So wundert es nicht, dass bis heute der Person fast genauso großes Interesse entgegengebracht wird wie dem komplexen und komplizierten Werk. Das ›Faszinosum Weber‹,[33] seine Größe und Antinomie, hatten schon die Zeitgenossen[34] notiert. Genie und 39Dämonie liegen bei ihm nun mal ganz nah beieinander. Dieser ständige Kampf mit sich selbst: Askese und Leidenschaft lassen sich nicht ohne weiteres in einer souveränen Lebensführung vereinbaren. Seine Person durchzieht deshalb ein tragischer Grundzug,[35] der sich auch in seinem Werk beobachten lässt.
402. Die mühsame Suche nach einer Methode: Grundzüge einer soziologischen Wissenschaftslehre
Weber als methodologischer Kritikaster
Eigentlich konnte Max Weber Diskussionen über Methoden und Methodologie recht wenig abgewinnen. Statt Wissenschaftstheorie zu betreiben, wollte er lieber Wissenschaft machen. In seinen Augen wurde eine neue Wissenschaft noch nie durch eine Methode begründet, sondern stets durch die Eigenart der Probleme,[1] die sich mit den gängigen Disziplinen nicht ohne weiteres lösen ließen. Wir werden sehen, dass ihn genau diese Erfahrung am Ende auf die Bahn der so wenig geliebten Soziologie bringen sollte. Für ihn steht jedenfalls fest, dass die Methodologie »sowenig Voraussetzung fruchtbarer Arbeit [ist, HPM], wie die Kenntnis der Anatomie Voraussetzung ›richtigen‹ Gehens. Ja, wie derjenige, welcher seine Gangart fortlaufend an anatomischen Kenntnissen kontrollieren wollte, in Gefahr käme zu stolpern, so kann das Entsprechende dem Fachgelehrten bei dem Versuche begegnen, auf Grund methodologischer Erwägungen die Ziele seiner Arbeit anderweit zu bestimmen.«[2]
Worüber geriet denn dann Max Weber ins »Stolpern«? Vor Ausbruch seiner Krankheit hatte er jedenfalls eifrig geforscht und geschrieben, ohne große Gedanken an methodische Probleme zu verschwenden. Weshalb beginnt er ausgerechnet im Zuge seiner Genesung mit komplizierten Erwägungen methodologischer Grundsatzfragen, die auch heute noch, nach über hundert Jahren, der Leserschaft regelmäßiges Kopfzerbrechen bereiten? Man ma41che die Nagelprobe und schlage eine x-beliebige Seite der Wissenschaftslehre auf, wie Marianne Weber die »Gesammelten Aufsätze zur Logik und Methodik der Sozialwissenschaft«[3] in Anlehnung an Fichte genannt hat. Man wird überrascht sein, mit welch hartnäckiger Leidenschaft und welch kleinteiligem Furor sich Weber in Fragen der Methodologie vertieft. Kaum genesen, schwingt er sich sogleich zum methodischen Richter auf und liest den Größen von Nationalökonomie und Geschichtswissenschaft seiner Zeit die Leviten. Er beginnt mit der historischen Nationalökonomie und macht Wilhelm Roscher und Karl Knies, dessen Lehrstuhlnachfolger er in Heidelberg geworden war, den Prozess[4] und das in drei Folgen: 1903, 1905 und 1906. Dann legt er mit seinem Artikel »Die ›Objektivität‹ sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis«[5]