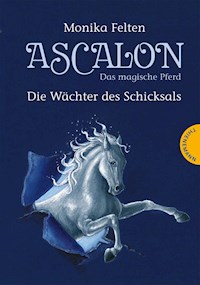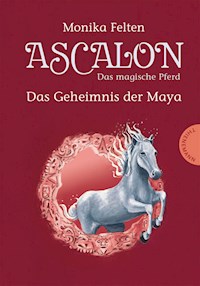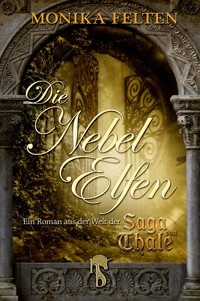6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein jahrtausendealter Dämon droht zu erwachen und ein ganzes Volk zu vernichten: Noelani, die Priesterin der Insel Nintau, ist die Hüterin des Steinkreises, der über den Schlaf eines uralten und abgrundtief bösen Dämons wacht. Aber der Preis, den sie für den Schutz ihres Volkes zahlt, ist hoch: Noelani darf keinen Kontakt zu ihrer Familie haben. Eines Tages wird das Dorf durch eine verheerende Katastrophe zerstört. Noelani beginnt zu zweifeln: War es wirklich das Werk des Dämons, oder verbirgt sich in den Kristallen eine ganz andere Macht? Als Noelani die Macht der Kristalle selbst erproben muss, erkennt sie deren schreckliches Geheimnis – und die Aufgabe, der sie sich zu stellen hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 625
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Monika Felten
Kristall der Macht
Roman
Prolog
Noelani sah den Luantar kommen.
Vor dem Hintergrund der untergehenden Sonne rauschte er über das Meer heran. Schnell, zornig, todbringend. Seine mächtigen Schwingen peitschten das Wasser, die Augen glühten wie Kohlenstücke in dem wuchtigen Schädel. Noelani spürte, dass etwas Furchtbares geschehen würde, aber obwohl sie sich ängstigte wie noch nie in ihrem Leben, konnte sie sich nicht von der Stelle rühren.
Sie wollte schreien und die Menschen unten im Dorf warnen, doch es kam kein Laut über ihre Lippen. Von ihrem erhöhten Standpunkt auf der Klippe aus musste sie hilflos mit ansehen, wie der Luantar das Maul aufriss und dem Dorf eine Wolke aus tödlichem gelbem Atem entgegenschickte. Wie eine düstere Woge rollte sie heran, verschlang den Horizont, das Meer und den Strand mit seinem Brodeln und löschte schließlich sogar das Sonnenlicht aus.
Aus dem Dorf waren Schreie zu hören, verzweifelte Schreie – Todesschreie. Der Dunst nahm Noelani die Sicht, aber sie musste nichts sehen, sie wusste, was dort unten vor sich ging, wusste, dass ihr Volk in diesem Augenblick ausgelöscht wurde.
Ihr Herz hämmerte wie wild.
Kaori, ich muss Kaori retten! Der Gedanke löste die Starre, die das Grauen in ihre Glieder getragen hatte. Aber so sehr sie sich auch mühte, sie konnte den Platz auf der Klippe nicht verlassen. Als sie an sich herunterblickte, erkannte sie, dass ihren Füßen Wurzeln entsprossen, die sich tief in den Boden gegraben hatten. Panik stieg in ihr auf. Mit bloßen Händen versuchte sie, sich aus dem Erdreich zu befreien, grub, wühlte und zerrte unter Tränen an den Wurzeln, bis ihre Finger blutig waren – doch vergeblich.
Kaori! Noelani schluchzte auf, als etwas ihre Wange streifte … ein Windzug, der sie innerlich zu Eis erstarren ließ. Sie spürte die Nähe der dämonischen Bestie, noch ehe sie den Kopf hob und den Luantar erblickte, der mit kraftvollem Flügelschlag nur wenige Schritte vor der Klippe in der Luft zu stehen schien, den blutüberströmten Leichnam Kaoris wie eine Trophäe im halb geöffneten Maul …
»Kaori?«
Mit einem Schrei fuhr Noelani aus dem Schlaf auf. Sie keuchte. Schweiß rann ihr über die Stirn, und obwohl es in der Hütte drückend heiß war, zitterte sie am ganzen Körper. Die Bilder des Albtraums und die damit verbundene Angst hallten noch in ihr nach und machten es ihr schwer, in die Wirklichkeit zurückzufinden.
»Ich bin hier.« Kaori, die neben ihr geschlafen hatte, setzte sich auf, schloss sie in die Arme und strich ihr über das zerzauste schwarze Haar. »Ich bin hier«, raunte sie Noelani zu. »Schscht, schscht … Es ist alles gut.«
Noelani zögerte, unsicher noch, ob sie wachte oder träumte. Dann lehnte sie den Kopf an Kaoris Schulter, starrte auf den schmalen Lichtstreifen, den der Mond durch das kleine Fenster in den Raum warf, und wartete darauf, dass sich der Aufruhr in ihrem Innern beruhigte. Kaori war bei ihr. Alles war gut.
»Hast du wieder von dem Dämon geträumt?«, fragte Kaori sanft, ohne die Umarmung zu lösen.
Noelani nickte, sprechen konnte sie noch nicht.
»Der Luantar kann uns nicht mehr gefährlich werden, das weißt du doch.«
»Ja.« Noelanis Lippen bebten, als sie mühsam das eine Wort formte. Kaori sagte die Wahrheit. Der schreckliche Dämon, der die Insel einst heimgesucht und die Bewohner von Nintau fast alle getötet hatte, war besiegt, sein Körper zu Stein erstarrt. Solange die Maor-Say über ihn wachte, würde er niemals wieder Unheil über die Insel bringen können. Keiner fürchtete ihn mehr, außer vielleicht die Kinder, wenn sie zum ersten Mal den Berg zum Tempel hinaufstiegen, um am Fuße des Dämonenfelsens die Geschichte des großen Unheils zu hören, das die versteinerte Bestie über Nintau und seine Bewohner gebracht hatte.
Obwohl ihr Weg zum Dämonenfels schon mehr als fünf Jahre zurücklag, erinnerte sich Noelani daran, als sei es gestern gewesen. Auch sie hatte sich gefürchtet. Auch sie hatte gelitten. Jedes Wort der Maor-Say, die den Kindern von der längst vergangenen Katastrophe erzählt hatte, hatte in ihrem Kopf Bilder entstehen lassen, ganz so als ob sie selbst dabei gewesen wäre. Bilder von Tod, Leid und Zerstörung und so entsetzlich, dass ihre junge Seele daran zu zerbrechen drohte. Sie hatte stark sein wollen an diesem Tag, aber sie hatte es nicht vermocht. Als sie es nicht mehr ausgehalten hatte, hatte sie zu weinen begonnen.
Es war ein Glück, dass Kaori damals bei ihr gewesen war. Unerschütterlich in dem Glauben verhaftet, dass Nintau sicher war, hatte Kaori sie getröstet, so wie sie es auch heute noch tat, wenn der Luantar ihr im Traum auflauerte. Und wie schon so oft in den vergangenen Jahren gelang es Kaori auch jetzt, ihr ein wenig von der Zuversicht zu schenken, die sie selbst spürte.
»Es war nur ein Traum«, sagte Kaori leise und löste die Umarmung ein wenig, damit Noelani sich aufrichten konnte. »Der Dämon wird uns niemals wieder ein Leid antun. Nicht, solange die Maor-Say über ihn und die fünf Geweihten wacht.«
»Ich weiß.« Noelani nickte tapfer, wischte eine Träne fort und fügte entschuldigend hinzu: »Ich sage es mir immer wieder, aber der Traum will nicht weichen.«
»Das nächste Mal nimm im Traum einen Bogen zur Hand und schieß ein paar Pfeile auf den Luantar«, riet Kaori. »Die alte Magobe sagt immer: Nur wer seine Ängste bekämpft, wird sie am Ende besiegen.«
»Ich werde es versuchen.« Noelani nickte tapfer. Kaoris Worte und ihre Nähe taten ihr gut. Solange sie bei ihr war, würde ihr nichts geschehen.
Der Mond wanderte weiter. Während die furchtbaren Traumbilder allmählich verblassten, legten sich die beiden Mädchen nieder, um noch ein wenig zu schlafen. Noelani entspannte sich. In dieser Nacht würde ihr der Luantar nicht mehr auflauern.
Aber er würde wiederkommen.
1. Buch
Der Atem des Todes
1
Sorgsam darauf bedacht, kein Wasser zu verschütten, stellte Noelani die tönerne Schale auf dem niedrigen Tisch in der Mitte des Raums ab.
Als sich die Wasseroberfläche beruhigt hatte, zog sie ein Kissen heran und kniete vor dem Tisch nieder. Sodann kreuzte sie die Arme vor der Brust, schloss die Augen und nahm einen tiefen Atemzug. Die schwülwarme Luft des Abends trug den Duft der Mondlilien in ihr Schlafgemach. Die Nachtblüher wuchsen überall an den Hängen des geweihten Bergs und öffneten ihre Kelche erst im Mondschein, damit sich die daumengroßen Nachtschweber an ihrem Nektar laben konnten. In den Legenden ihres Volkes hieß es, der Luantar selbst habe die Samenkörner der Lilie in seinen Exkrementen auf die Insel getragen, und keiner auf Nintau zweifelte daran, dass es genau so gewesen war.
Für Noelani und all die anderen Frauen, die vor ihr als Maor-Say im Tempel über den Schlaf des Luantar gewacht hatten, waren die Lilien von unschätzbarem Wert. Der betörende Duft machte es ihnen leicht, den Geist vom Körper zu lösen und Dinge zu sehen, die ihren Augen sonst verborgen geblieben wären.
Die Gabe, den eigenen Geist ohne die Beschränkungen des Körpers auf die Reise zu schicken, war das Zeichen der Maor-Say und nur wenigen auf der Insel angeboren. Oft gab es über Jahre hinweg keine Nachkommen mit dieser Gabe, aber wie durch ein Wunder hatte noch niemals eine Maor-Say dem Ende ihrer Lebensspanne entgegengesehen, ohne dass zuvor eine würdige Nachfolgerin oder ein Nachfolger geboren worden waren.
Kaori …
Der Name ihrer Zwillingsschwester tauchte unvermittelt in Noelanis Gedanken auf, und für einen Augenblick geriet ihre innere Ruhe ins Wanken. Ein leiser Seufzer entfloh ihren Lippen, während sie versuchte, den Schmerz und die Schuldgefühle zu verdrängen, die sie immer dann heimsuchten, wenn sie an ihre Schwester dachte. Obwohl sie seit Jahren dagegen ankämpfte und sich äußerlich nichts anmerken ließ, hatte sie die Nöte nie wirklich überwunden, die ihr die Wahl zur Maor-Say ins Herz getragen hatte.
Sie selbst war immer die Zurückhaltende und Ängstliche gewesen, schüchtern und still. Nicht so stark wie Kaori, die mutig und selbstbewusst voranschritt und sich jeder Herausforderung stellte. Hatte jemand die beiden Mädchen angesprochen, war es immer Kaori gewesen, die geantwortet hatte, und wenn eine Entscheidung getroffen werden musste, hatte Noelani den Entschluss ihrer Schwester stets dankbar angenommen.
Nachdem ihre Mutter die Gabe der Geistreise im Alter von fünf Jahren bei ihren Töchtern entdeckt hatte, waren alle überzeugt gewesen, dass Kaori es sein würde, die eines fernen Tages im Tempel leben und über den Schlaf des Luantar wachen würde. Wie selbstverständlich hatte man damit begonnen, Kaori auf die wichtige Aufgabe vorzubereiten, und wie selbstverständlich hatte Noelani es akzeptiert.
Im Schatten ihrer viel beachteten Schwester hatte sie fast sechzehn Jahre lang ein unauffälliges Leben geführt. Ein angenehmes Leben ohne Zwänge und Erwartungen, das ihrem scheuen Gemüt entsprach und an das sie sich gern zurückerinnerte.
Ihr Weg schien vorgezeichnet. Eines Tages würde sie heiraten und wie ihre Mutter das Leben einer Fischerfrau führen, während Kaori der alternden Maor-Say in den Tempel folgen und deren Erbe antreten würde. Alles war gut und richtig gewesen – bis zu dem Morgen vor vier Jahren, als die greise Maor-Say mit ihrem Gefolge in das Fischerdorf gekommen war und sie – Noelani – entgegen allen Erwartungen zu ihrer Nachfolgerin bestimmt hatte.
Schweigend hatte die Alte bei der feierlichen Zeremonie mit ihrem dürren Finger auf Noelani gedeutet und sich auch durch den Dorfältesten, der ihr in höflich-eindringlichen Worten hatte zu verstehen geben wollen, dass sie die beiden jungen Frauen wohl versehentlich verwechselt habe, nicht von ihrer Entscheidung abbringen lassen.
Heute wusste Noelani, dass die Maor-Say sie damals ganz bewusst erwählt hatte. Die Gründe dafür aber kannte sie nicht. Die alte Priesterin hatte sie mit ins Grab genommen, als ihr Geist vor einem Jahr die Reise in das Reich der Toten angetreten hatte.
Noelani presste die Lippen fest zusammen, schob die bedrückenden Gedanken zur Seite und zwang sich, ihr Augenmerk wieder auf die Wasserschale zu richten. Ein leichter Windzug strich durch die geöffneten Fenster, und der Duft der Lilienblüten erinnerte sie daran, was zu tun war.
Morgen würden die ersten Waitun am Südstrand der Insel an Land gehen, um dort im warmen Sand ihre Eier abzulegen. Die Ankunft der großen Schildkröten wurde seit Generationen mit einem feierlichen Fest begangen, denn es bedeutete, dass sich die Regenzeit ihrem Ende zuneigte.
Es war die Aufgabe der Maor-Say, den richtigen Tag für das Fest zu bestimmen. Sie allein konnte die Schildkröten im Meer durch eine Geistreise ausfindig machen und so den Zeitpunkt ihrer Ankunft bestimmen. Noelani seufzte und nahm einen tiefen Atemzug. Im vergangenen Jahr hatte die alte Maor-Say sie in das Ritual eingeweiht, als sie die Ankunft der Schildkröten viele Tage im Voraus bestimmt hatte. Diesmal musste sie es allein vollziehen. Konzentriert blickte Noelani in die Wasserschale und erschuf vor ihrem geistigen Auge das Bild des Ozeans, dessen türkisblaues Wasser die Insel von allen Seiten umgab. Wie schon in den Tagen zuvor machte es ihr der Geruch der Lilien leicht, sich auf das Wasser zu besinnen, und ehe sie sich versah, war sie auch schon im Meer.
Mondlicht flutete durch die Wasseroberfläche und ließ die Korallen des Riffs in magischem Silber erstrahlen. Dazwischen bewegten sich schläfrig ein paar Fische hin und her. Der Anblick war so friedlich, dass eine Woge aus Glück und Stolz durch Noelanis Körper flutete.
Der Dämon hatte ihre Heimat dereinst zerstört. Für eine Weile mochte er sein Ziel erreicht haben, die Insel und alles Leben auf ihr zu vernichten – besiegt hatte er es nicht.
Sein todbringender Atem hatte nicht alles auslöschen können. Einige wenige Menschen, Tiere und Pflanzen hatten die Katastrophe überlebt. Ihrem Mut und ihrer Beharrlichkeit war es zu verdanken, dass das Leben im Lauf der Jahre vielfältiger und schöner auf die Insel zurückgekehrt war. Nintau war zu einem Paradies geworden, und Noelani war glücklich, ein Teil davon zu sein. Gern wäre sie länger am Korallenriff geblieben, um sich an dem Anblick zu erfreuen, aber es waren nicht die Fische, die zu suchen sie aufgebrochen war.
Sie suchte die Schildkröten.
Irgendwo jenseits des Riffs, weit draußen im Ozean, hatte sie zwei Abende zuvor die ersten der großen Waitun-Schildkröten entdeckt, die sich rasch auf die Insel zubewegten. Sie mussten Nintau schon sehr nahe sein. Doch wohin Noelani auch blickte, nirgends konnte sie die Umrisse einer Waitun entdecken.
Noelani war verunsichert, gab aber nicht auf. Entschlossen lenkte sie ihren Geist gegen die Strömung. Dies war ihr erstes Waitunfest als Maor-Say. Die Vorbereitungen hatten den ganzen Tag angedauert und waren fast abgeschlossen. Es durfte nicht sein, dass sie sich geirrt hatte.
»Ich irre mich nicht!« Noelani spürte, wie sich ihre Hände zu Fäusten ballten. So schnell würde sie die Suche nicht aufgeben. Sie hatte die Schildkröten gesehen, dessen war sie gewiss. Es waren zwei gewesen und beide hatten zielstrebig auf den Strand von Nintau zugehalten. Noelani presste die Lippen fest aufeinander und setzte die Reise in die Tiefen des Ozeans fort. Längst hatte sie das Riff hinter sich gelassen und auch den Ort, an dem sie die Schildkröten zuvor gesehen hatte. Ringsumher gab es nichts als Wasser, doch so sehr sie ihre Sinne auch anstrengte, nirgends fand sie eine Spur der Waitun.
Halte ein! Du gehst zu weit!
Die mahnende Stimme in ihrem Bewusstsein erinnerte sie daran, dass sie die Grenzen der Geistreise zu überschreiten drohte. Selbst unter dem Einfluss der Liliendüfte durfte sie sich nicht weiter als einen Tagesmarsch von ihrem Körper entfernen. Die Gefahr, dass die Verbindung abriss und Körper und Geist für immer getrennt blieben, war zu groß.
Nur ein kleines Stück noch.
Noelani keuchte vor Anstrengung.
Sie müssen hier sein. Ich weiß es.
Verbissen kämpfte sie sich voran. Stück für Stück, ohne auf die Stimme zu achten, die sie immer lauter drängte, endlich kehrtzumachen. Die unsichtbaren Bande, die Körper und Geist zusammenhielten, spannten sich und machten ihr jede Bewegung doppelt schwer. War sie zunächst noch mühelos durch das Wasser geglitten, hatte sie nun das Gefühl, kaum noch voranzukommen.
Kehr um! Du wirst sterben.
Noelani wusste, dass die Stimme recht hatte, aber die Furcht zu versagen ließ sie alle Vorsicht vergessen. Sie hatte das Waitunfest für den kommenden Abend ausrufen lassen. Alle würden kommen, um das Ende der Regenzeit zu feiern. Alle!
Noelani schluchzte auf. Ihr Blick irrte umher, aber wohin sie auch sah, welche Richtung sie auch einschlug, überall bot sich ihr das gleiche Bild: nachtblaues Wasser, vom Mondlicht durchflutet – verlassen.
Panik stieg in ihr auf, als ihr bewusst wurde, dass keine Schildkröten kommen würden. Sie hatte sich geirrt. Zehn Jahre hatte man sie auf diesen Augenblick vorbereitet, und nun hatte sie versagt. Versagt. Versagt!
Noelani schnappte nach Luft. Ihr Herz raste. Das Bild, das sie im Geist heraufbeschworen hatte, begann zu verschwimmen.
Nein, nein! Nicht jetzt. Ich muss die Schildkröten suchen.
Noelani nahm all ihre Kraft zusammen und rang die aufkommende Schwäche nieder. Obwohl sie zu Tode erschöpft war, gelang es ihr noch einmal, in den Ozean zurückzukehren und ein Stück weit gegen den Strom zu schwimmen. Dann durchzuckte ein beißender Schmerz ihr Bewusstsein, ließ das Bild vor ihren Augen erlöschen und raubte ihr die Sinne.
Die Ohnmacht dauerte nur wenige Augenblicke. Als Noelani die Augen öffnete, fand sie sich am Boden liegend vor dem Tisch wieder. Die tönerne Schale war heruntergefallen und zerbrochen, das geweihte Wasser über den ganzen Lehmboden verspritzt. Ihr Kleid aus feinem Gewebe war nass und schmutzig. Ihr Kopf schmerzte, und doch konnte sie sich sofort wieder daran erinnern, was geschehen war. Und sie begriff, welch ein Glück sie gehabt hatte.
Ich hätte tot sein können! Der Gedanke jagte ihr einen Schauder über den Rücken. Die alte Maor-Say war nicht müde geworden, sie vor den Gefahren einer Geistreise zu warnen. Zum einen führte der Weg durch eine Sphäre, in der sich die Seelen Verstorbener aufhalten konnten, zum anderen mochte es den Tod bedeuten, wenn man sich bei einer solchen Reise zu weit von dem eigenen Körper entfernte. Noelani hatte den Ermahnungen aufmerksam gelauscht und verstehend genickt, doch erst jetzt, da sie dem Tod so nahe gewesen war, verstand sie wirklich, warum ihre Lehrmeisterin das getan hatte.
Ermattet hob Noelani den Kopf und blickte zum Fenster. Der Morgen war noch nicht angebrochen. Sie erwog, Jamak zu wecken, um ihm zu berichten, was sie gesehen hatte, verwarf den Gedanken aber gleich wieder. Solange es noch die Spur einer Hoffnung gab, dass die Waitun kommen würden, wollte sie ihn nicht mit ihren Sorgen belasten.
Noch war nichts verloren. Das Fest sollte erst am Abend stattfinden. Wenn sie geschlafen und sich ausgeruht hatte, würde sie sich noch einmal auf die Suche nach den Schildkröten begeben. Wenn sie auch dann keinen Erfolg hatte, war es immer noch früh genug, mit ihm darüber zu sprechen.
Jamak. Ein dünnes Lächeln umspielte Noelanis Lippen, als sie an ihren treuen Diener dachte, der doppelt so alt war wie sie. Seit sie im Alter von zehn Jahren in den Tempel gekommen war, war er Tag und Nacht für sie da. Die verstorbene Maor-Say hatte ihr den rundlichen, wortkargen Diener, dessen Gesicht sich schon bei der geringsten Anstrengung rötete, als Lehrer und Beschützer zur Seite gestellt. Seither war er nicht von ihrer Seite gewichen und hatte auch dann nicht die Beherrschung verloren, wenn sie mal wieder groben Unfug angestellt hatte. Mit den Jahren war er für sie unentbehrlich geworden.
Er war ihr Lehrer, Freund und Vater zugleich, aber auch ihr engster Vertrauter. Er hatte nie daran gezweifelt, dass sie die rechtmäßige Nachfolgerin der Maor-Say war. Bestimmt würde er einen Rat wissen, wenn sich herausstellte, dass sie sich mit der Ankunft der Schildkröten getäuscht hatte. Er würde sie dafür weder schelten noch verspotten.
Noelani seufzte. Er nicht …
Ermattet richtete sie sich auf, ging zu ihrer Liegestatt und machte es sich dort bequem. Eine kurze Weile grübelte sie noch darüber nach, was der nächste Tag wohl bringen würde, dann fielen ihr die Augen zu. Und während der Schlaf sie auf samtenen Schwingen davontrug, hörte sie im Geiste schon die Stimmen der Spötter, die immer gewusst haben wollten, dass der Platz im Tempel allein Kaori zustand.
*
»Du musst das Schilf fester ziehen.« Kaori nahm dem Jungen die kleine Schilfmatte aus der Hand, an der er gerade arbeitete, und zeigte ihm die nötigen Handgriffe. »Siehst du, so ist es schön fest, und es kann kein Wasser eindringen.« Lächelnd gab sie ihm die Matte zurück und richtete das Wort dann an alle. »Ihr dürft nicht vergessen, dass die Flöße heute Abend die Sonnenlichter auf das Meer hinaustragen sollen. Wenn ihr sie zu locker flechtet, werden sie unter dem Gewicht der Lichter sinken. Habt ihr das verstanden?«
Die acht Mädchen und fünf Jungen, die Kaori bei Sonnenaufgang zum Weiher gefolgt waren, nickten eifrig. Sie hatten gut achtgegeben und versuchten es Kaori gleichzutun, indem sie die Schilffasern noch straffer zogen. Kaori lobte sie und wandte sich wieder ihrem eigenen Floß zu. Während die jüngeren Kinder noch an dem ersten Floß arbeiteten und die älteren bereits mit dem zweiten begonnen hatten, hatte sie das fünfte Floß beinahe fertig. Es war eine alte Tradition, der Sonne in der Nacht des Waitunfestes mit dem ablaufenden Wasser einen Gruß hinter den Horizont zu schicken. Die vielen Hundert Sonnenlichter waren ein Ausdruck der Freude darüber, dass die kühle Regenzeit endlich ein Ende hatte und die Sonne für viele Monate wieder trockene Wärme und Licht auf die Insel bringen würde.
Kaori arbeitete sehr geschickt. Schon als Kind hatte sie es geliebt, die kleinen Flöße für die Sonnenlichter zu flechten, und nun, da sie erwachsen war, bereitete es ihr große Freude, zu sehen, dass sich die Jüngsten der Insel mit ebenso großem Eifer an den Vorbereitungen für das Fest beteiligten, wie sie es damals getan hatte.
Einige Mädchen summten bei der Arbeit ein Lied, während ringsumher der Dschungel langsam erwachte. Vögel begrüßten den beginnenden Morgen mit ihrem Gesang, Insekten schwirrten surrend umher, und hin und wieder verrieten knackende Äste, dass sich ein dürstendes Tier auf dem Weg zum Weiher befand.
»Pssst!« Kaori legte mahnend den Finger auf die Lippen und deutete auf eine Monkasikuh, die mit ihrem Kalb vorsichtig aus dem Dickicht trat, um ihren Durst am Weiher zu löschen. Die Kinder hielten den Atem an. Monkasi waren scheu und kamen nie in die Nähe des Dorfes. Eine Kuh mit ihrem Jungen hatte noch keines der Kinder gesehen. Gebannt verfolgten sie, wie das Muttertier mit hoch aufgerichteten Ohren an das Wasser trat und die Umgebung aufmerksam mit allen Sinnen erkundete, während das Kalb neben ihr stand und von dem Wasser trank. Nach einer Weile schien die Kuh zu dem Schluss zu kommen, dass ihnen keine Gefahr drohte. Sie senkte ergeben den Kopf, um zu saufen, als hoch oben in den Baumkronen Hunderte von rotköpfigen Naras wie auf ein geheimes Kommando hin lärmend aus ihren Schlafbäumen aufstiegen und unter aufgeregtem Gekreische nach Norden davonflogen.
Als das Kreischen in der Ferne verklang, waren die Monkasikuh und ihr Kalb verschwunden. »Schade.« Eines der Mädchen blickte zum verlassenen Weiher hinüber und zupfte sich ein paar Blätter und kleine Äste aus den Haaren, die der plötzliche Aufbruch der Naras auf die Gruppe hatte herabregnen lassen.
»Warum sind sie fortgeflogen?«, wollte einer der Jungen wissen.
»Ich weiß es nicht.« Kaori gab sich gelassen. »Vielleicht hat sie etwas erschreckt.«
»Ich habe noch nie einen so großen Schwarm Naras gesehen.«
»Du bist ja auch zum ersten Mal mit am Weiher.« Kaori lachte und fuhr dem Jungen neckend durch das lockige schwarze Haar. »Kommt, lasst uns weitermachen«, sagte sie und wandte sich wieder ihrem Floß zu. »Wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns.«
Weit kamen sie nicht.
Kaum dass alle wieder mit dem Flechten begonnen hatten, brach erneut ein Tumult in den Bäumen aus. Schlimmer noch als zuvor regneten Äste und Blätter auf die kleine Gruppe herab, während die Luft von einem so panischen Zetern und Schreien erfüllt war, wie Kaori es niemals zuvor gehört hatte.
Affen!
Kaori legte den Kopf in den Nacken und schaute blinzelnd nach oben. Wo eben noch beschauliche Ruhe geherrscht hatte, wogten die Äste der Baumkronen nun wie von einem mächtigen Wind gepeitscht hin und her. Affen jeder Größe und Gattung bahnten sich in wilder Panik ihren Weg ins Innere der Insel. Die kleinen und wendigen nutzten dabei nicht selten die Körper der größeren Affen als Sprungbrett oder Brücke, um noch schneller voranzukommen.
Eine Horde von Schwarznasenäffchen überrannte rücksichtslos einen großen grauzottigen Baumbrüller, der nach einem Ast gegriffen und eine Verbindung zwischen zwei Bäumen geschaffen hatte. Baumbrüller galten als aggressiv und gefährlich. Nicht nur die anderen Affen der Insel, sondern auch die Menschen hatten großen Respekt vor den klugen und unberechenbaren Tieren, die ausgewachsen leicht die Größe eines Mannes erreichen konnten. Die kleinen Schwarznasenäffchen nahmen für gewöhnlich sofort Reißaus, wenn ein Baumbrüller auftauchte, denn wer unachtsam war, landete nicht selten im Magen der alles fressenden Artgenossen. An diesem Morgen aber schienen sie ihre angeborene Vorsicht vergessen zu haben. Ein Umstand, für den es nur eine Erklärung geben konnte: Ganz gleich, wovor die Affen flohen, es musste schlimmer sein als der Tod.
Kaori erschauderte. Als sie in sich hineinhorchte, glaubte auch sie, eine Veränderung zu spüren. Es war nichts, das wirklich greifbar war, kaum mehr als eine Ahnung von Gefahr, ausgelöst durch die Panik der Tiere.
Vielleicht zieht ein Sturm auf?
Unsinn. Kaori schüttelte den Kopf und verdrängte das unheilvolle Gefühl, das sich in ihrer Magengegend ausbreitete. Die Zeit der Stürme lag hinter ihnen, und außerdem hatte es keinerlei Anzeichen für das Nahen eines Unwetters gegeben.
»Warum sind die Tiere so ängstlich?« Eines der Mädchen zupfte ungeduldig an Kaoris Kittel. Offenbar hatte sie die Frage nicht zum ersten Mal gestellt.
»Das … das weiß ich nicht.« Kaori schüttelte den Kopf und seufzte. Gern hätte sie den Kindern eine bessere Antwort gegeben, aber es war die einzige, die sie hatte.
»Ich will nach Hause.« Minou, die Jüngste der Gruppe, fing an zu weinen.
»Vielleicht … zieht ein Sturm auf«, wagte eines der älteren Mädchen zu vermuten. »Wir sollten zurückgehen und nachsehen, was los ist.«
»Und die Flöße?« Kaori spürte, wie unruhig die Kinder waren. Ihr selbst ging es ja auch nicht anders. Andererseits hatten sie hier eine Aufgabe zu erfüllen. Hin- und hergerissen zwischen Neugier und Pflicht überlegte sie fieberhaft, wie sie die Kinder beruhigen könnte. »Wisst ihr was, wir …«
Gellende Schreie, die der Wind vom fernen Dorf bis in den Wald hineintrug, ließen ihr die Worte auf den Lippen gefrieren. Am Strand musste etwas Furchtbares vor sich gehen! Sie verfluchte das Dickicht des Dschungels, das es ihr unmöglich machte, etwas zu sehen. So schloss sie die Augen, nahm einen tiefen Atemzug und versuchte, ihren Geist dorthin zu schicken, gab den Versuch aber sogleich wieder auf. Eine Geistreise war ihr nur im Zustand großer innerer Ruhe möglich. Furcht, Sorge oder auch nur eine kleine Aufregung stellten für ein solches Unterfangen ein unüberwindliches Hindernis dar. Sie hatte keine Wahl. Wenn sie wissen wollte, was am Strand vor sich ging, musste sie hinuntergehen und nachsehen.
»Mama!« Minou schluchzte bitterlich, und auch zwei andere Mädchen hatten Tränen in den Augen. Die Jungen blickten bleich und stumm in die Richtung, aus der die Schreie kamen, während die älteren Mädchen Kaori besorgt und fragend anschauten. Diese zögerte nicht. Sie stand auf und bedachte die Kinder mit einem langen, ernsten Blick. »Ihr bleibt hier«, ordnete sie in einem Ton an, der keine Widerrede duldete. »Nenele und Shui, ihr kümmert euch um die Kleinen. Ich laufe zum Dorf und sehe nach, was dort los ist.«
»Kommst du wieder?«, fragte ein Junge mit dünner Stimme.
»Natürlich.« Kaori zwang sich zu einem Lächeln und strich ihm aufmunternd über die Wange. »Macht euch keine Sorgen. Es wird alles gut.« Mit diesen Worten drehte sie sich um und rannte in den Dschungel hinein.
Dornige Ranken streiften ihre nackten Beine, als sie den schmalen Pfad entlanghetzte, der vom Weiher zum Dorf hinunterführte. Äste fuhren ihr peitschend übers Gesicht, verfingen sich in ihren Haaren und zerrten daran, aber all das kümmerte sie nicht. Die entsetzlichen Schreie wurden mit jedem Schritt lauter und ließen das Schlimmste befürchten. Obwohl Kaori die Angst wie einen eisernen Ring um die Brust spürte, hielt sie nicht inne, sondern beschleunigte ihre Schritte noch.
Im Geist kämpfte sie gegen Bilder von Riesenwellen an, die das Fischerdorf zu verschlingen drohten, gegen die Erinnerung an die zerstörerische Wucht einer Wasserhose, die Nintau gestreift hatte, als sie noch ein kleines Mädchen gewesen war, und gegen die alten Legenden, die von riesigen Seeungeheuern erzählten, welche schon so manches Fischerboot in die Tiefe gerissen haben sollten.
Sie hatte das Ende des Dschungels fast erreicht, als ihr die ersten Flüchtenden entgegenkamen. In blinder Panik stürmten sie durch das Unterholz, als ob sie von etwas verfolgt würden. Kaori wollte sie aufhalten und rief sie mit Namen an, aber keiner der Flüchtenden achtete auf sie. Kaori fluchte leise, dann setzte sie ihren Weg in entgegengesetzter Richtung fort und wäre dabei fast mit einem jungen Mann zusammengestoßen, der ihr vertraut war.
»Tamre!«
»Kaori?« Tamre schnappte nach Luft. »Verdammt, Kaori, was tust du hier? Du musst fliehen! Schnell!« Er packte ihre Hand und wollte sie mit sich ziehen, aber Kaori blieb standhaft und hielt ihn fest. »Warum?«, fragte sie. »Warum soll ich fliehen? Was geht da unten vor sich?«
»Der Luantar!« Tamres Blick flackerte irr, als er die beiden Worte keuchend hervorstieß. Er entwand sich ihrem Griff mit einem Ruck, spurtete los und rief: »Flieh, Kaori! Der Dämon ist erwacht!«
»Der Dämon?« Kaori glaubte, sich verhört zu haben. Ihre eigene Zwillingsschwester wachte als Maor-Say über den Luantar. Er konnte nicht erwacht sein. »So warte doch!« Ihr Ruf ging im Lärmen und Schreien der Flüchtenden unter. Tamre hörte sie nicht.
Kaori zögerte. Hin- und hergerissen zwischen der Verantwortung, die sie für die Kinder am Weiher trug, und dem Wunsch, den Grund für die Panik in Erfahrung zu bringen, erwog sie einen Augenblick lang, Tamres Rat Folge zu leisten. Dann setzte sie den Weg zum Strand fort.
Der Luantar kann nicht erwachen, machte sie sich selbst Mut, während sie sich einen Weg gegen den Strom der Flüchtenden bahnte. Tamre irrt. Alle irren sich! Der Dämon kann uns nicht gefährlich werden, solange eine Maor-Say über ihn wacht. Wir sind sicher! Sicher …
Wie angewurzelt blieb Kaori an der Grenze zwischen Dschungel und Strand stehen, starrte auf den furchtbaren Anblick, der sich ihren Augen bot – und verstand.
Nicht Tamre war es, der sich irrte. Sie irrte sich. Der Luantar war nicht mehr gefangen, er war erwacht, und seine Rache war fürchterlich. Wie eine alles verschlingende Woge fegte sein gelber Atem über das Meer auf die Küste zu. Schnell, lautlos, todbringend.
Den Horizont hatte er bereits verschlungen. Nur Bruchteile eines Augenblicks trennten ihn vom Strand und dem kleinen Fischerdorf, in dem sich immer noch Menschen aufhielten. Kaori hörte sie schreien, verzweifelt und so voller Angst, wie sie noch niemals Menschen hatte schreien hören. Sie sah sie fliehen. Eine Mutter mit ihrem Kind an der Hand, einen Säugling fest an sich gepresst. Kinder, die weinend umherstolperten – verlassen und vergessen. Und die Alten, Gebrechlichen, die nicht schnell genug waren, den Jungen zu folgen. Sie alle strebten dem Wald zu, der Schutz verhieß und ihnen doch keinen Schutz würde bieten können.
Kaori sah sie näher kommen und wusste noch im selben Augenblick, dass sie sterben würden. So wie alle. Ihre Freunde, ihre Familie, Tamre, die Kinder am Weiher – und sie selbst. Es gab keine Rettung, keinen Ort der Zuflucht, so wie es auch damals keinen gegeben hatte. Der Dämon war erwacht. Es war vorbei. Dies und anderes ging ihr durch den Kopf, als sie die schmutzig gelbe Wolke unaufhaltsam näher kommen sah. Gedanken und Erkenntnisse folgten einander rasend schnell, verblüffend scharf und von einer schonungslosen Eindringlichkeit, wie es sie wohl nur im Angesicht des Todes gab. Nicht ein einziger Gedanke galt der Flucht. Weder in dem Moment, da die Wolke den Strand überrollte, noch dann, als sie das Dorf und die Menschen verschlang und die Schreie der Flüchtenden erstickte. Kaori stand einfach nur da, starrte auf das Grauen und dachte an ihre Schwester, die all das nicht hatte verhindern können.
2
Die Festung brannte.
Rauch und Asche verdunkelten die aufgehende Sonne. Es roch nach schwelendem Holz und verbranntem Fleisch, nach geronnenem Blut und dem Schweiß der Krieger, die sich den Angreifern mit dem Mut der Verzweiflung entgegenwarfen, weil nicht verloren gegeben werden durfte, was doch längst schon verloren war.
Prinz Kavan stand auf der Brustwehr des inneren Rings aus hölzernen Palisaden und starrte auf das, was noch vor zwei Tagen das Herzstück der westlichen Verteidigungslinie gewesen war. Vor ihm, jenseits der lodernden Feuerstürme, die mit ihren glutheißen Flammenzungen in den Unterkünften der Krieger und über den Resten der äußeren Palisaden wüteten, lagen das grüne Schwemmland des Gonwe und dahinter die unfruchtbare Steppe Baha-Uddins; hinter ihm schlängelte sich der Gonwe hin zum fruchtbaren Land seiner Ahnen, das zu beschützen er bei seinem Leben geschworen hatte.
Bei seinem Leben …
Kavan ballte die Fäuste. Er hatte versagt, und das Wissen darum nährte den Hass auf die Rakschun, die sein Volk seit vielen Jahren bedrängten und ihm keinen Frieden gönnten. Tausende tapferer Krieger hatten in den zermürbenden Scharmützeln und heimtückischen Überfällen entlang der Grenze bereits ihr Leben gelassen. Gesunde und kräftige Männer, die nun nicht länger für ihre Familien sorgen und keinen Nachwuchs zeugen konnten.
König Azenor würde die Augen nicht mehr lange vor der Wahrheit verschließen können. Baha-Uddin blutete aus, und selbst wenn dieser Kampf doch noch gewonnen werden konnte, schien es nur eine Frage der Zeit, bis man gezwungen war, auch Frauen und Kinder zu den Waffen zu rufen.
Kavan seufzte und dachte zurück an die Zeit, als alles begonnen hatte. Damals, als die ersten Rakschun in kleinen ungeordneten Rebellentruppen gegen die Herrschaft des Königs aufbegehrt und die Brücke über den Fluss zu zerstören versucht hatten, waren es ausschließlich Freiwillige gewesen, die die Straßen und die Brücke gesichert hatten, auf der kostbare Erze und Minerale aus den Bergen zu den Städten an der Küste transportiert wurden. Abenteurer und Söldner, die es für ihre Bestimmung hielten, ihre Heimat zu beschützen.
In den vergangenen Jahren waren die Angriffe immer heftiger geworden. Die Brücke musste mit einer Festung geschützt werden, und die Erztransporte erhielten eine Eskorte der königlichen Truppen. Gleichzeitig war aber auch die Stärke der Angreifer sprunghaft gestiegen, und die Zahl der Verteidiger war fast so rasch dahingeschmolzen wie der Schnee im Frühling. Angesichts der schrecklichen Verluste hatte König Azenor keinen anderen Ausweg gesehen, als alle jungen Männer des Landes zur Sicherung der Grenze zu verpflichten – ein Entschluss, der die Rakschun zunächst überrascht hatte.
Das massive Aufgebot an frischen Truppen hatte den Angreifern empfindliche Verluste eingebracht. Es war den königlichen Kriegern sogar gelungen, die Rakschun aus ihren Lagern in der Steppe zu vertreiben und den fortwährenden Angriffen ein Ende zu bereiten.
Einige Offiziere hatten sich schon siegreich gewähnt, aber bald erfahren müssen, dass sie sich geirrt hatten. Nur ein halbes Jahr später hatten die Kundschafter in der Steppe das gewaltigste Rakschunheer entdeckt, das jemals gegen Baha-Uddin aufgeboten worden war, und obwohl die Generäle in aller Eile mit den Vorbereitungen zur Verteidigung begonnen hatten, hatten die Truppen des Königs der Wucht und dem Zorn der heranstürmenden Rakschun kaum etwas entgegensetzen können.
Und nun das Ende … Kavan seufzte.
Über das Knistern und Fauchen der Flammen hinweg lauschte er dem Klirren der Waffen und den Todesschreien seiner Mannen. Die Gewissheit, dass er versagt hatte und dass sein Vater einen Rückzug niemals dulden würde, bewegte seine Gedanken. Im Königreich Baha-Uddin gab es keinen Platz für Feiglinge und Versager, auch dann nicht, wenn sie von königlichem Blut waren. Wer sein Leben in diesen dunklen Zeiten nicht auf dem Feld der Ehre für seine Heimat hingab, den erwarteten daheim Schande und Verachtung. Wer vor dem Feind floh, wurde gnadenlos verfolgt und dem Henker übergeben.
Kavan seufzte. In einer unbewussten Bewegung hob er die Hand und tastete nach seinem Schwert, wohl wissend, dass es für ihn keine Rückkehr gab. Er würde sterben, so wie seine Männer. Sterben …
Erschaudernd fragte er sich, wie es wohl sein würde, wenn das Ende kam. Würde es schnell gehen? Würde es qualvoll sein? Die Rakschun waren für ihre Grausamkeit bekannt. Als Prinz konnte er keine Barmherzigkeit erwarten. Sie würden ihn foltern und ihren Forderungen an den König mit dem Übersenden einzelner Teile seines Körpers Nachdruck verleihen. Ein Finger, ein Ohr, ein Auge … Stück für Stück würden sie ihn nach Baha-Uddin zurückschicken. So wie sie es mit seinem Bruder Marnek getan hatten. Und wie bei Marnek würde sein Vater auch diesmal nicht auf die Forderungen eingehen und am Ende eher den entsetzlich verstümmelten Kopf seines Sohnes in Empfang nehmen, als den Rakschun auch nur einen Fingerbreit entgegenzukommen.
Prinz Kavan betrachtete seine Hände und spürte, wie sich Übelkeit in seinem Magen ausbreitete. Er wusste, was sein Vater von ihm erwartete. Die Worte, die Azenor vor seinem Aufbruch zur Festung freundlich, aber bestimmt gewählt hatte, waren eindeutig gewesen. »Was auch geschieht«, hatte er mit strengem Blick gesagt und ihm einen schlanken Dolch in die Hand gedrückt, »du darfst den Barbaren nicht in die Hände fallen. Denk an deinen Bruder. So etwas darf nicht noch einmal vorkommen.« Dann hatte er Kavans Finger fest um den Dolch geschlossen, genickt und hinzugefügt: »Trage diesen Dolch stets verborgen bei dir. Du weißt, was du zu tun hast. Ich verlasse mich auf dich.«
Kavans Hand zitterte, als er unter sein Gewand griff, um den Dolch hervorzuholen. Er wusste, dass dies der Augenblick war, von dem sein Vater gesprochen hatte, wusste, was er tun musste. Jetzt. Sofort. Solange noch Zeit dazu war … Kavan zog die Luft scharf durch die Zähne und presste die Lippen fest aufeinander. Das Metall des Dolches war warm.
Als ob er lebt …
Nur mit einer enormen Willensanstrengung gelang es ihm, die Waffe unter dem Gewand hervorzuziehen. Ein Sonnenstrahl durchbrach die Rauchwolken über der Festung und ließ die Klinge aufblitzen, als wolle das Licht Kavan verspotten.
»Stirb, Nichtswürdiger«, schien es zu höhnen. »Du hast versagt. Niemand wird dir nachtrauern. Das Leben wird ohne dich weitergehen …« Dann war das Licht fort. Der Dolch lag grau und stumpf in seiner Hand.
»Du weißt, was du zu tun hast.« Wieder glaubte Kavan, die Stimme seines Vaters zu hören. Und wieder zögerte er. Fast war ihm, als wären die Finger nicht die seinen, die sich da um den Dolch schlossen und die Spitze auf sein Herz richteten …
Kavan hielt den Atem an.
»Tu es!« Die Stimme seines Vaters dröhnte in seinem Kopf. Drängend, fordernd, befehlend …
Kavan umklammerte den Dolch so fest, dass die Knöchel weiß hervortraten. Er schwitzte und zitterte, während der Atem seinen Lungen keuchend entwich. Sein ganzes Leben lang hatte er getan, was sein Vater von ihm verlangt hatte. Nie hatte er aufbegehrt, nie widersprochen.
»Tu es jetzt!« Im Geiste sah Kavan König Azenor vor sich. Schlohweißes Haar umrahmte das hagere Gesicht, dessen stechend blaue Augen ihn in der von ihm so gefürchteten Strenge fixierten.
Kavan wand sich innerlich unter dem Blick wie ein geprügelter Hund, so wie er es immer tat, wenn er seinem Vater gegenüberstand und dieser ihn seine Macht spüren ließ. Die Furcht vor Azenors Zorn war allgegenwärtig. Selbst hier und jetzt, im Angesicht des Todes, auf dem letzten verlorenen Außenposten Baha-Uddins.
»Bring es zu Ende und stirb wie ein Mann!«
»Ja, Vater.« Kavan schloss die Augen, nahm all seinen verbliebenen Mut zusammen, krallte die Finger um den Griff des Dolches und machte sich bereit.
Jetzt!
Mit angehaltenem Atem wartete er auf den Schmerz, der das Eindringen der Klinge begleitete – aber nichts geschah.
Seine Arme gehorchten ihm nicht. Obwohl sein Verstand ihm sagte, dass es keinen anderen Weg gab, dass er gehorchen musste, konnte er die Tat nicht vollbringen. Etwas, das größer war als die Angst vor seinem Vater, ja sogar größer als die Furcht vor Folter und Schmerz durch die Rakschun, hielt ihn zurück und forderte seine Muskeln zum Ungehorsam auf. Es war dieselbe Kraft, die Helden in der Not über sich hinauswachsen lässt und Menschen dazu befähigt, das Unmögliche zu vollbringen. Diese Kraft versagte ihm nun einen ehrenhaften Tod.
Weil er Angst hatte.
Weil er ein Feigling war.
Weil er leben wollte.
»Mein Prinz!« Eine Hand legte sich auf seine Schulter und riss Kavan aus seinen Gedanken. Erschrocken ließ er den Dolch sinken und versuchte, ihn unauffällig unter seinem Gewand verschwinden zu lassen, während er sich straffte und umdrehte, als sei nichts geschehen.
»Du?« Kavan musterte sein Gegenüber mit einer Mischung aus Erstaunen und Missbilligung.
General Triffin war ein Krieger, der einem Heldenepos entsprungen schien. Ein Mann wie ein Bär, groß, mit breiten Schultern und Oberarmen, die man selbst mit beiden Händen nicht umfassen konnte. Eine lange Narbe zog sich von seinem rechten Ohr bis hinab zum Kinn und verlieh ihm ein verwegenes Aussehen, ein Eindruck, der von der Klappe über dem rechten Auge noch verstärkt wurde. Dabei war Triffin alles andere als ein Barbar. Er galt als klug und besonnen, und wenn er sich den Rakschun gegenüber auch unbarmherzig zeigte, stand das Wohl seiner Männer für ihn immer an erster Stelle. Die Krieger verehrten ihn und folgten ihm bedingungslos – wenn es sein musste, bis in den Tod.
»Was gibt es?« Prinz Kavan spürte, dass seine Stimme bebte, und ärgerte sich. Er konnte nur hoffen, dass Triffin es vor dem Hintergrund des immer lauter werdenden Kampfgetümmels nicht bemerkte. »Dein Platz ist nicht hier, meine ich.«
»Verzeih, aber wir können die Festung nicht länger halten.« Triffin gab sich keine Mühe, den Schmerz über die schmähliche Niederlage zu verbergen. Zum ersten Mal in seinem Leben sah Kavan den Hünen bestürzt, mutlos und erfüllt von Sorge.
»Das ist mir nicht entgangen.« Kavan hob die Stimme gerade so weit an, dass es verwundert klang. Auf unbestimmte Weise fühlte er sich dem General in diesem Augenblick überlegen. Nicht, weil er mutiger war, und auch nicht, weil er noch an einen Sieg glaubte. Schon die Tatsache, dass er seine Gefühle besser verbergen konnte, verschaffte ihm Genugtuung.
»Und?« Triffin ballte in mühsam beherrschter Ungeduld die Hände zu Fäusten.
»Was und?« Kavan zog eine Augenbraue in die Höhe, ein Mienenspiel, das er von seinem Vater übernommen hatte. Er wusste, dass der Zeitpunkt mehr als unpassend für lange Diskussionen war, aber gerade deshalb genoss er es, den General auf die Folter zu spannen. Es war vielleicht das letzte Mal, dass er dem Mann gegenüberstand, dem das Volk die Achtung und Bewunderung entgegenbrachte, nach der Kavan sich immer gesehnt hatte, und er genoss es, ihm in diesem letzten Moment zeigen zu können, wer von ihnen die größere Macht besaß.
»Prinz Kavan!« Triffin nahm einen tiefen Atemzug, trat einen Schritt vor und suchte den Blick des Prinzen. »Die Rakschun haben den inneren Ring durchbrochen. Unsere Männer sterben wie die Fliegen. Du musst den Rückzug befehlen, sonst sind wir verloren.«
»Rückzug?« Kavans Stimme klang hell und schrill, als er das Wort auf eine Weise wiederholte, die keinen Zweifel daran ließ, wie sehr er den Gedanken verabscheute. »Du kennst die Befehle«, sagte er von oben herab. »Von einem Rückzug ist darin nicht die Rede.«
»Aber die Krieger …«
»Erfüllen ihre Pflicht.« Kavan bemerkte selbstgefällig, dass er dem wütenden Blick des Älteren mühelos standhielt. Da es für ihn keine Rückkehr gab, erschien es ihm nur gerecht, wenn auch die anderen ihr Leben ließen. Beflügelt von dem Gefühl der Überlegenheit, neigte er den Kopf leicht zur Seite und fügte spitz hinzu: »Solltest du als ihr Anführer nicht an ihrer Seite sein?«
»Sie sterben, Hoheit«, wiederholte Triffin finster und packte den Prinzen grob am Arm. »Sie sterben um eines Befehls willen, der so widersinnig ist wie der Versuch, die Flut vom Strand fernzuhalten. Die Rakschun überrennen uns. Wir müssen die Festung aufgeben, über die Brücke fliehen und sie zerstören. Am anderen Ufer sind wir in Sicherheit. Die Rakschun haben keine Boote. Es wird Monate dauern, bis sie uns folgen können.«
»Du wagst es, die Hand gegen deinen Prinzen zu erheben und die Befehle deines Königs infrage zu stellen?« Kavan löste sich aus dem Griff des Generals und rieb sich den Arm. »Es tut mir leid«, sagte er wohl wissend, dass Triffin die Lüge durchschauen würde. »Aber es steht mir nicht zu, die Befehle meines Vaters zu ändern. Und selbst wenn, ich würde es nicht tun. Die Brücke soll gehalten werden. Ich muss dir nicht sagen, wie wichtig sie ist. Deshalb wird die Festung verteidigt. Bis zum letzten Mann – verstanden? Jetzt verschwinde und …« Weiter kam er nicht.
Das Letzte, was er sah, war Triffins Gesicht, das zu einer ausdruckslosen Maske erstarrt schien. »Vergebt mir, mein Prinz«, hörte er den General murmeln, dann traf ihn ein wuchtiger Schlag am Kopf und ließ das Bild vor seinen Augen erlöschen.
*
»Maor-Say! Maor-Say!« Die Tür flog auf und prallte so heftig gegen die Wand, dass der farbige Putz abblätterte und helle Flecken zurückblieben.
Das Geräusch riss Noelani aus dem tiefen Erschöpfungsschlaf, in den sie nach der erfolglosen Geistreise der Nacht gefallen war. Verwirrt blickte sie auf und versuchte, die Ursache für den Lärm ausfindig zu machen.
Neben ihrem Bett stand Semirah, ihre Dienerin. Ihr Haar war zerzaust, die Augen vor Furcht und Anspannung weit aufgerissen. Sie atmete schnell und zitterte trotz der Wärme, die die Strahlen der Morgensonne in den Raum trugen. Als sie bemerkte, dass Noelani erwacht war, legte sie die geöffneten Handflächen hastig wie zum Gebet gegeneinander, hob sie zum Zeichen der Ehrerbietung an die Stirn und senkte demütig das Haupt.
»Was fällt dir ein, hier solch eine Unruhe zu veranstalten?« Noelani ärgerte sich, dass Semirah sie geweckt hatte, und machte sich nicht die Mühe, ihren Unmut zu verbergen.
»Verzeih, Maor-Say! Verzeih!« Semirahs Stimme bebte vor Aufregung. »Ich … ich … Es ist …«
»Nun sag schon: Was ist los?«, fragte Noelani eine Spur sanfter. »Wenn man dich so sieht, könnte man meinen …«
»Der Luantar! O ehrwürdige Maor-Say, der Dämon ist erwacht«, rief Semirah mit wildem Blick. Ihre Stimme überschlug sich fast, als sie fortfuhr. »Er … er hat das Dorf angegriffen, als die Sonne aufging … Ich habe es gesehen … Sein Atem hüllt die Küste ein … Es … es ist furchtbar.« Ein Schluchzen drang aus Semirahs Kehle und machte es ihr unmöglich weiterzusprechen. Überwältigt von Kummer und Schmerz schlug sie die Hände vor das Gesicht, sank auf die Knie und krümmte sich schluchzend zusammen.
»Der Dämon? Erwacht?« Noelani runzelte die Stirn. »Aber das ist unmöglich. Ich habe ihn erst gestern …«
»Es ist wahr, Noelani!« Jamak kam durch den Raum auf die beiden Frauen zugeeilt. Mit versteinerter Miene trat er vor Noelanis Bett und sagte: »Gerade sind zwei Bedienstete zurückgekehrt, die an der Klippe nach Möweneiern suchen wollten. Sie sind völlig verängstigt. Auch sie berichten, dass der Luantar über das Meer gekommen sei und das Dorf mit seinem Giftatem angegriffen habe.«
»Nein. Nein. Nein.« Noelani schüttelte nachdrücklich den Kopf, während sie das Wort wie eine Beschwörungsformel flüsternd wiederholte. Ihr war schwindelig. Das Bett, der Raum, ja das ganze Gebäude, alles schien sich um sie zu drehen, während sie verzweifelt versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen. Die Hände fest in die bunt gewebte Decke gekrallt, schaute sie zuerst Jamak und dann Semirah an und flüsterte: »Das kann nicht sein.«
Jamak schwieg lange, als müsse er das, was er als Nächstes sagen wollte, erst abwägen. Dann schüttelte er fast unmerklich den Kopf und erwiderte leise: »Aber es ist so.«
Die Worte lösten die Starre, die Noelani ergriffen hatte. Plötzlich hatte sie es eilig. Ohne ein Wort schwang sie die Beine aus dem Bett, griff noch in derselben Bewegung nach ihrem seidenen Morgenmantel und schlüpfte mit bloßen Füßen in die Zehsandalen, die vor ihrem Bett bereitstanden. Mit aufgelöstem Haar, den Mantel nur halb geschlossen, eilte sie auf die Tür zu.
»Wo willst du hin?« Jamak vertrat ihr den Weg und hielt sie fest.
»Lass mich los!« Noelani versuchte, sich zu befreien, hatte damit aber keinen Erfolg.
»Was immer du vorhast, du darfst nicht überstürzt handeln«, mahnte Jamak. »Wenn es stimmt, was sie berichten …«
»Es stimmt nicht! Es kann nicht stimmen«, fuhr Noelani ihn an. »Und jetzt lass mich los!« Ihre langen Fingernägel krallten sich in seinen bloßen Unterarm und hinterließen kleine rote Halbmonde auf der Haut.
»Dann sag mir, was du vorhast.« Jamak schien den Schmerz nicht zu spüren.
»Ich bin die Maor-Say. Ich bin dir keine Rechenschaft schuldig.«
»Und ich bin der, der über dich wacht.« Jamak machte keine Anstalten, den Weg freizugeben.
»Das ist vorbei.« Noelani funkelte Jamak an, als trüge er die Schuld an dem, was an diesem Morgen geschah. Dieser zeigte sich davon jedoch völlig unbeeindruckt.
»Das wird nie vorbei sein«, sagte er bestimmt. »Ich werde immer über dich wachen und dich mit meinem Leben beschützen.«
»Ich bin kein Kind mehr. Schon lange nicht. Vergiss das nicht.«
»Ein Kind nicht – aber eine Frau.«
Noelani seufzte. So kam sie nicht weiter. Jamak konnte sehr beharrlich sein, und sie hatte keine Zeit für lange Streitgespräche. »Ich gehe hinunter«, sagte sie knapp.
»Ins Dorf?«
»Wohin sonst?«
»Nein, Noelani. Das ist …«
»… der einzige Weg, die Wahrheit zu erfahren.«
»Die erfährst du auch, wenn du deinen Geist auf Reisen schickst.«
»Mein Geist ist erschöpft.«
»Dann schicke einen der Dienstboten.«
»Wenn du glaubst, dass ich hier sitze und darauf warte, was andere mir berichten, irrst du dich.« Noelani reckte das Kinn vor, um ihren Worten Nachdruck zu verleihen. »Der Dämon schläft, so wahr ich hier stehe. Wer etwas anderes behauptet, lügt. Ich bin die Maor-Say, die Wächterin des Luantar. Ich würde spüren, wenn er sich regt. Aber ich habe nichts gespürt. Es gibt nicht einen einzigen Lebensfunken unter dem Gestein.« Sie schaute Jamak aufgebracht an. »Was immer heute Morgen geschehen ist, der Luantar kann es nicht gewesen sein. Die Dienstboten sind abergläubisch und ängstlich. Vermutlich werfen sie in ihrer Furcht die Wirklichkeit und die Legenden durcheinander. Ich bin sicher, dass alles halb so schlimm ist. Vielleicht ist das, was sie gesehen haben, ein ungewöhnlicher Nebel oder Sand aus der fernen Wüste, den der Wind über den Ozean trägt. Was auch immer, ich werde hinuntergehen, nach der Ursache forschen und die Menschen beruhigen. So wie es meine Pflicht ist.« Sie verstummte und maß Jamak mit einem Blick, der keinen Zweifel daran ließ, dass sie von ihm Gehorsam erwartete.
Jamak ließ sie los und seufzte. »Also gut. Aber du gehst nicht allein.«
»Deine Sorge ehrt dich.« Noelani schenkte Jamak ein Lächeln zum Zeichen, dass sie ihm nicht böse war. »Aber ich kann sehr wohl auf mich aufpassen. Kümmere du dich um Semirah und die anderen. Wir müssen verhindern, dass sich die Gerüchte im Tempel herumsprechen. Nichts ist schlimmer als eine grundlose Panik.« Mit diesen Worten schob sie sich an Jamak vorbei und verließ den Raum.
3
Begleitet von krachenden Donnerschlägen stiegen in kurzer Folge fünf Rauchpilze über den reißenden Wassern des Gonwe auf. Die gewaltigen Explosionen rissen die Brücke, die sich noch vor wenigen Augenblicken über den Fluss gespannt hatte, so mühelos in Stücke, als wäre sie aus Pergament erbaut. Planken, Pfähle und Stämme wurden wie Spielzeug in die Luft geschleudert, wo sie sich mit den Leibern der nachrückenden Rakschun mischten, um einen Atemzug später ins Wasser zu stürzen und von den Fluten fortgespült zu werden.
Als sich der Rauch verzog, war von dem imposanten Bauwerk nichts geblieben. Nur drei schwarz verkohlte Stämme, die wie abgebrochene Finger aus der Mitte des Flusses aufragten, erinnerten noch an die hölzerne Lebensader, über die der befestigte Außenposten Baha-Uddins am westlichen Ufer seinen Nachschub erhalten hatte.
General Triffin hörte die Krieger hinter sich jubeln und atmete auf.
Die Rakschun konnten ihnen nicht folgen. Der Gonwe war breit, tief und von einer reißenden Strömung durchzogen, die den verhassten Feinden ein Überqueren unmöglich machte. Sie waren – zumindest vorerst – in Sicherheit.
Keiner von ihnen hatte wirklich daran geglaubt, dass der Mechanismus, der die Brücke zerstören sollte, nach all den Jahren noch funktionieren würde. Triffin selbst hatte den Hebel betätigt, der die Sprengung einleiten sollte, während die letzten Krieger die Brücke verlassen hatten und die Rakschun am anderen Ufer in blindem Siegestaumel herangestürmt waren.
Er hatte gehofft und gebetet, aber einige bange Augenblicke lang war nichts geschehen. Dann endlich hatten die Sprengladungen gezündet.
Triffin war erleichtert, wusste aber auch, dass er sich schuldig gemacht hatte. Er hatte den Prinzen niedergeschlagen und schutzlos in der Festung zurückgelassen. Allein dafür gebührte ihm der Tod. Danach hatte er die überlebenden Krieger um sich geschart und ihnen entgegen den königlichen Anweisungen den Rückzug befohlen – auch das war eine Entscheidung, für die König Azenor ihn, ohne mit der Wimper zu zucken, dem Henker übergeben würde. Für all diese Vergehen, derer er sich in den vergangenen Stunden nach dem Kriegsrecht Baha-Uddins schuldig gemacht hatte, hatte er mehr als einmal den Tod verdient, doch das war ihm gleichgültig. Er hatte mehr als fünfhundert Leben gerettet. Das allein zählte.
Seite an Seite mit seinem Freund Prinz Marnek hatte General Triffin die Festung am Gonwe viele Monate gegen die fortwährenden Angriffe der Rakschun verteidigt und die Wege zu den Erzvorkommen in den Bergen gesichert, bis Marnek eines Tages auf einem Erkundungsritt von den Rakschun gefangen genommen und zu Tode gefoltert worden war.
Nach dem grausamen Mord an dem Thronerben hatte der König den Kampf gegen die Rakschun zu seinem persönlichen Rachefeldzug erklärt und verkünden lassen, dass es von nun an kein Erbarmen geben würde. Für jeden getöteten Rakschun hatte er ein hohes Kopfgeld ausgelobt, das für die zumeist aus armen Verhältnissen stammenden Krieger mehr als verlockend war. Die Jagd auf die Rakschun war dadurch zu einem Wettbewerb geworden, der immer grausamere Blüten getrieben hatte, und lange hatte es so ausgesehen, als könne die Rache des Königs die Feinde tatsächlich einschüchtern.
Aber der Schein trog, und was als Ansporn gedacht war, entwickelte sich schon bald zu einem Verhängnis für Baha-Uddin. In den beiden Jahren, die seit Prinz Marneks Tod vergangen waren, hatten mehr Krieger als jemals zuvor ihr Leben verloren. Immer öfter hatten Gruppen von Kriegern die Festung verlassen, um die Feinde zu überfallen, doch irgendwann hatten die Rakschun das Spiel durchschaut und sich auf die Überfälle vorbereitet. Die Jäger waren zu Gejagten geworden, und kaum einer, der ausgezogen war, die verhassten Feinde zu töten, war heil zurückgekehrt …
General Triffin seufzte, als er an die vielen Männer dachte, die ihr Leben durch die Gier nach dem Gold verloren hatten. Tapfere Krieger, deren Schwerter kaum zu ersetzen waren, weil es in Baha-Uddin kaum noch wehrfähige Männer gab. Wie oft hatte er versucht, den König davon zu überzeugen, dass das Kopfgeld allein den Rakschun zuspielte, weil es die eigenen Männer unvorsichtig machte? Wie oft hatte er ihn angefleht, zu den bewährten Taktiken zurückzukehren? Aber Azenor hatte das alles nicht hören wollen. Statt einzulenken, hatte er ihm mit Prinz Kavan seinen jüngsten Sohn zur Seite gestellt, der nicht nur die Einhaltung der Befehle, sondern, wie General Triffin hinter vorgehaltener Hand erfahren hatte, auch seine eigenen Anweisungen überwachen sollte.
Triffin ballte die Fäuste und schaute zu den schwelenden Ruinen der Festung hinüber, die er mehr als zehn Jahre seine Heimat genannt hatte und die nun für so viele – viel zu viele – zu einem feurigen Grab geworden war.
In den mehr als zwanzig Jahren, die er Baha-Uddin nun gegen die Rakschun verteidigte, hatte er nicht ein einziges Mal gegen die königlichen Befehle aufbegehrt. Selbst dann nicht, wenn diese ihm absonderlich erschienen waren und hohe Verluste unter seinen Männern gefordert hatten.
An diesem Morgen aber hatte er das sinnlose hundertfache Sterben nicht länger mit ansehen und mit seinem Gewissen vereinbaren können. An diesem Morgen, der so vielen Freunden und Gefährten einen grausamen Tod beschert hatte, hatte er zum ersten Mal auf sein Herz gehört. Und hier und jetzt, im Angesicht der zerstörten Brücke, wusste er, dass er richtig gehandelt hatte.
Die Festung war verloren, seiner Heimat aber wurde eine Gnadenfrist zuteil, die genutzt werden konnte, um die am Boden liegende Verteidigung neu aufzustellen. Mehr als fünfhundert Kriegern, die laut Befehl des Königs in der Festung hätten sterben sollen, war die Flucht geglückt; zudem hatte die Sprengung der Brücke den Rakschun empfindliche Verluste zugefügt. Alles in allem war der Rückzug als ein Erfolg zu werten. Ein Erfolg, der sogar den Tod des Prinzen rechtfertigte.
Den Tod des Prinzen …
Hastig schob Triffin den bedrückenden Gedanken beiseite. Er wusste, dass er von nun an mit der Schuld würde leben müssen, den Prinzen getötet zu haben. Niemand hatte gesehen, was zwischen ihnen vorgefallen war, und niemand würde ihn verdächtigen, aber er wusste, dass ihn die Schuld sein Leben lang begleiten würde.
Er hatte das Leben des jungen, unfähigen und zudem schwächlichen Prinzen gegen das von fünfhundert Kriegern getauscht. So betrachtet erschien Kavans Tod nur gerechtfertigt, und Triffin entschied, nicht weiter darüber nachzudenken.
Dennoch. Jemand würde dem König die Nachricht überbringen und ihm von dem Verlust der Festung und der zerstörten Brücke berichten müssen. Für einen Augenblick war Triffin versucht, einen Boten zu schicken, verwarf den Gedanken aber gleich wieder. Es war nicht vorauszusehen, wie König Azenor auf die Nachricht und deren Überbringer reagieren würde. Triffin zögerte kurz, dann entschied er, sich selbst auf den Weg zum Palast zu machen. Er war der Letzte, der Prinz Kavan lebend gesehen hatte. Allein. Es war ein Leichtes, dem Prinzen den Befehl zum Rückzug in die Schuhe zu schieben, auch wenn dieser ihn nicht hatte aussprechen wollen. So konnte Triffin die Ehre seiner Männer und die seine retten, ohne Gefahr zu laufen, den Zorn des Königs auf sich zu ziehen. Aber die Worte wollten gut gewählt sein. Einem Boten wollte er eine so wichtige Mission auf keinen Fall anvertrauen.
Triffin nickte selbstzufrieden. Sobald die Männer am Ufer ein provisorisches Lager errichtet hatten und die Aufgaben neu verteilt waren, würde er zum König reiten.
*
Das Dorf lag am Fuß der Klippe, dort, wo die schroffen Felsen flacher wurden und in den Dschungel mündeten. Es war ein einfaches Dorf mit einfachen Rundhütten, die aus dem errichtet worden waren, was der Dschungel zu bieten hatte. Und wie das Dorf und die Hütten waren auch die Menschen einfach, die dort lebten.
Die meisten von ihnen waren Fischer, die mit ihren Kanus tagaus, tagein auf das Meer hinausfuhren, um im seichten Wasser der Korallenriffe ihre Netze zu legen oder nach Muscheln zu tauchen. Einige wenige beherrschten ein Handwerk wie Weben oder Töpfern. Zwei von ihnen verstanden sich auf die Kunst des Heilens. Die Menschen auf Nintau waren arm, aber glücklich. Die Natur schenkte ihnen alles, was sie zum Leben benötigten, und obwohl Stürme und Fluten dem Dorf und seinen Bewohnern schon oft hart zugesetzt hatten, so waren sie doch immer wieder zurückgekehrt und hatten einen neuen Anfang gewagt.
Das Dorf trug keinen Namen; es brauchte keinen, denn es war die einzige Siedlung auf der Insel. Hier lebten die Nachkommen derer, die einst das Grauen überlebt und den Dämon besiegt hatten, und obwohl seit Generationen niemand mehr am Leben war, der den Tag der Zerstörung miterlebt hatte, war die Furcht, dass es eines Tages wieder geschehen könnte, in ihnen tief verwurzelt, denn in ihren Legenden lebte die Erinnerung an den Luantar weiter.
Es war der Glaube an die Macht der Maor-Say, der die Bewohner der Insel des Nachts ruhig schlafen ließ, kannte sie doch den geheimen Zauberspruch, der den Dämon aufs Neue zu Stein würde erstarren lassen, wenn der Bann zu brechen drohte. So war es immer gewesen und so hätte es auch in Zukunft sein sollen. Doch an diesem Morgen hatte das Schicksal entschieden, eine neue Seite im Buch des Lebens aufzuschlagen.
Noelani spürte es, lange bevor sie das Plateau auf der Klippe betrat, von dem aus sie auf das Dorf hinunterblicken konnte. Die Ahnung von Unheil begleitete sie und wurde mit jedem Schritt stärker. Zunächst konnte sie das Gefühl nicht in Worte fassen. Sie spürte nur, dass etwas fehlte. Etwas, für das sie noch keinen Namen hatte, das aber schon immer da gewesen war, so selbstverständlich, dass sie es nicht beachtet hatte.
Wie oft schon war sie den schmalen Pfad zum Plateau hinuntergegangen, um allein zu sein oder über das Meer zu blicken? Wie oft schon hatte sie ihre Sinne von dort aus der aufgehenden Sonne entgegengeschickt? Aber nie, nicht ein einziges Mal, hatte sie so wie an diesem Morgen empfunden, niemals eine solche Leere gespürt.
Eine Leere? – Nein!
Noelani blieb stehen. Das Erste, was ihr auffiel, war der Wind – oder besser der Nicht-Wind. Selbst hier oben auf der Klippe war es so windstill, dass es schon fast unheimlich war. Dann bemerkte sie die Stille, so bedrückend und vollkommen, wie sie nicht einmal die Nacht hervorbringen konnte.
Noelani lauschte angestrengt. Im Rauschen der Wellen hatte stets das Lied der Muschelmöwen mitgeklungen, die auf den kleinen Inseln des Riffs brüteten. Und Stimmen! Stimmen, die aus dem Dorf heraufschallten, Lachen oder Rufe, vom Wind zu unverständlichen Lauten verzerrt, aber so voller Fröhlichkeit und Leben, dass einem das Herz aufging.
Jetzt hörte sie nichts.
Nichts.
Außer dem leisen Rauschen der Wellen, die sanft über den Strand strichen, waren keine Laute zu hören. Nirgends gab es ein Zeichen von Leben. Eine Stille wie der Tod.
Noelani erschauderte. Nicht einmal hundert Schritte trennten sie noch vom Plateau. Hundert Schritte, um die Gewissheit zu erlangen, nach der es sie verlangte. Ihr Verstand drängte sie, hinunterzugehen und nachzusehen, aber ihre Beine gehorchten ihr nicht. Zu groß war die Angst vor dem, was sie vorfinden würde, zu unfassbar das mögliche Ausmaß ihres Versagens.
Kaori …
Noelani spürte, wie ihr beim Gedanken an ihre Zwillingsschwester die Tränen kamen. Energisch zwang sie sich zur Ruhe.
»Noch ist nichts gewiss«, murmelte sie leise vor sich hin und betete im Stillen darum, dass alles nur ein furchtbarer Irrtum war. Dann lief sie los.
Was immer sie erwartet hatte, als sie auf das Plateau hinaustrat, das gewiss nicht. Die endlose blaue Weite des Ozeans, der breite weiße Strand, der der Küste ein malerisches Aussehen verlieh, das Dorf mit seinen Hütten und den Booten, die an Stegen im flachen Wasser vertäut waren … von alldem war nichts zu sehen.
Noelani stockte der Atem, als sie den Blick über den schmutzig-gelben Dunst schweifen ließ, der die Welt zu ihren Füßen wie ein Bahrtuch bedeckte. Soweit das Auge reichte, gab es nichts als diesen Dunst, aus dem der Dämonenfels, auf dem der Tempel errichtet worden war, wie ein einsamer Riese ragte. Noelani richtete den Blick wieder nach unten, wo sich die wogende Masse keine fünfzig Schritt unter ihr an die Klippe schmiegte, als wären die Wolken selbst zur Erde hinabgesunken und hätten alles mit einem Mantel aus zähem Nebel bedeckt.