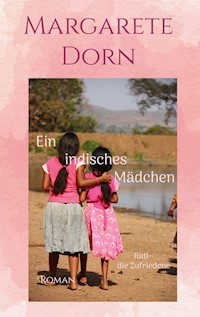Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Eine stürmische Nacht. Regina war bei einer Freundin und ist auf dem Weg nach Hause. Im Park stürzt sie über ein schemenhaftes Gebilde. Es ist Kristel, mit der sie auf eine gefahrvolle Mission geht. Bald ist ihr ein Berufskiller auf den Fersen. Altbekanntes wird mysteriös, Selbstverständliches außergewöhnlich und Regina wächst über sich hinaus. Etwas ist auf dieser Erde, unter uns, in uns und das ist nicht von dieser Welt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt:
Eine stürmische Nacht. Regina war bei einer Freundin und ist auf dem Weg nach Hause. Im Park stürzt sie über ein schemenhaftes Gebilde: Es ist Kristel, mit der sie auf eine gefahrvolle Mission geht. Bald ist ihr ein Berufskiller auf den Fersen. Altbekanntes wird mysteriös, Selbstverständliches außergewöhnlich und Regina wächst über sich hinaus. Etwas ist auf dieser Erde, unter uns, in uns und das ist nicht von dieser Welt.
Über die Autorin:
Die Diplom-Sozialarbeiterin Margarete Dorn lebt und arbeitet seit vielen Jahren in Mönchengladbach. Nach ihrem Studium, einer Ehe, einer Scheidung und vier Jahrzehnten Karate vollendete sie ihren ersten Roman.
„Ich bin ohne Farbe und doch wunderschön. Ich bin ohne Geschmack und doch schmecke ich köstlich. Ich bin unglaublich weich und doch hart wie Stein. Ich bin harmlos und doch bedrohlich. Ich spende Leben und doch nehme ich Leben. Ich bin flüssig, gasförmig, flockig- weich oder fest. Ich bin explosiv und doch sanft. Zu wenig von mir bringt den Tod, zu viel ebenso. Ich bin eine Konstante und doch bringe ich Veränderung. Ich bin das Leben.“
Von Margarete Dorn
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1 Bahnhof
Kapitel 2 Bei Siegried
Kapitel 3 Sechs Monate vorher
Kapitel 4 Die Militärbasis
Kapitel 5 Bei Siegried II
Kapitel 6 Im Flugzeug
Kapitel 7 Auf der Hundewiese
Kapitel 8 Gefangen im Basislager
Kapitel 9 Im Schreibwarengeschäft/ in der Wohnung
Kapitel 10 Die Militärbasis II
Kapitel 11 Regina auf der Militärbasis
Kapitel 12 Der Dschungel
Kapitel 13 Waldarbeiter
Kapitel 14 Dunkle Vorahnung
Kapitel 15 Begegnung von Knobel und Siegried
Kapitel 16 Nach dem Dschungeleinsatz
Kapitel 17 Siegried und Wolfgang beim Abendessen
Kapitel 18 Begegnung mit Kevin Gute
Kapitel 19 Erster Mordanschlag
Kapitel 20 Bei Siegried III
Kapitel 21 Zweiter Mordanschlag
Kapitel 22 Verrat
Kapitel 23 Regina im Café
Kapitel 24 Pápa
Kapitel 25 Dritter Mordanschlag
Kapitel 26 Der Ex-Bürgermeister
Kapitel 27 Zuschlag
Kapitel 28 Samuel
Kapitel 29 Ende
Kapitel 1 Bahnhof
Warum riecht man eigentlich auf jedem Bahnhof so penetrant die Gleise? Ja, man schmeckt sogar die mechanischen Geräusche, die einem in diesen immer zugigen Gebäuden das Warten vergraulen! Manche Bahnhöfe stinken, aber alle, alle, die ich kenne, sind ungemütlich. Gedankenversunken philosophierte Regina über die metallischen Züge. Wie sollte man es sonst bezeichnen, wenn die Wahrnehmung von dem schrillen Quietschen der Bremsen eines einfahrenden Zuges nicht nur im Ohr schmerzte, sondern sich als metallischer Geschmack auf der Zunge ablegte? Sie kuschelte sich, so gut es ging, in ihre viel zu dünne Jacke. Arschkalt war es hier! Dunkle Wolken türmten sich immer bedrohlicher auf und der triefend nasse Wind peitschte scheinbar aus allen Richtungen gleichzeitig auf sie ein. Fulminante Blitze zuckten und drohende, bis ins Mark gehende Donnerschläge erfüllten die in Schwärze getauchte baufällige Umgebung. Regina schreckte jedes Mal zusammen und hatte das Gefühl eines blutleeren Magens, obwohl sie innerlich auf dieses Geräusch, durch den vorausgehenden Blitz, vorbereitet war. Ein Donner war wie das Weihnachtsfest. Jeder wusste, dass es kommen würde, und doch waren sie beide jedes Mal plötzlich da.
„Der Zug nach Diestelhofen hat zirka 55 Minuten Verspätung“, blecherte es kaum verständlich aus den Lautsprechern. Hatte der jetzt 55 oder 45 Minuten gesagt? Scheiße, der Sturm schwoll jetzt noch mehr an. Erneut kam ein Donnerschlag, sodass Regina einen Adrenalinstoß erster Klasse erhielt und zusammenzuckte. Sie war nun hellwach. Das Gewitter war nahe, sehr nahe. Auf dem düsteren, regennassen Bahnsteig wurde es zunehmend unangenehmer. Mit wachsender Verzweiflung versuchte sie das Ziffernblatt ihrer alten Armbanduhr zu erkennen. Obwohl mit der Nase am Handgelenk, sah sie durch ihre dicke, durch die Regentropfen arg verschmierte Brille, nichts. Es gab wohl nichts Ungemütlicheres als ein offenes Bahnhofsgelände während eines nächtlichen Unwetters.
Scheiße, Scheiße, Scheiße, ich glaube, ich fahre besser mit dem Bus, wenn ich mich beeile und die Abkürzung durch den Park nehme, kriege ich ihn noch. In zehn Minuten fährt er ab, das muss zu schaffen sein! Regina lief los. Warum habe ich mir keine Regenjacke angezogen, wenigstens die gelbe mit der Kapuze. Nein, stattdessen nur die dünne blaue Übergangsjacke, ohne Kapuze.
Abermals ein Blitz. Der Donner ließ danach nicht lange auf sich warten. Regina lief rhythmisch die Treppenstufen hinunter und wurde am Ende des Tunnels von einem Regenschauer überrascht, der besser „Eimer ausleeren“ hätte heißen sollen. Wie aus Kübeln goss es, wie es schien, genau auf sie herab. „Ausgerechnet heute habe ich meine Kontaktlinsen nicht eingesetzt!“
Regina versuchte erfolglos, die Regentropfen von ihren Glasbausteinen, zu wischen. Den winzigen Kragen hochgeschlagen, den Kopf tief gesenkt, lief sie leichtfüßig und konzentriert weiter. Ihre Stirn schmerzte vom eiskalten Regen, der erbarmungslos auf sie niederprasselte. Sie fror am kompletten Körper entsetzlich. Ihre Zähne klapperten fürchterlich. Das Wasser bahnte sich zweifelsfrei seinen Weg vom mittlerweile klatschnassen Kopf runter in den Rücken. „Uuhaar!!“, entschlüpfte ihr ein nicht zu definierender Laut, eine Mischung aus Entsetzen und Kälteempfinden.
Grässlich, warum bin ich nicht bei Siegried über Nacht geblieben? Die Schuhe waren bereits hoffnungslos aufgeweicht, die Füße patschnass. Auf einmal wurde die Vorstellung einer Luftmatratze mit einer alten Decke, die sie bei Siegried bekommen hätte, richtig einladend und kuschelig. Zu sehen, wohin sie rannte, war Regina so gut wie nicht mehr möglich. Aber wo der Park sich befand, konnte sie am riesigen schwarzen Tor erkennen. Dahinter gab es viele große, alte Bäume, Büsche und Wiesenflächen zum Grillen und Spielen sowie eine Hundewiese. Ungewöhn-licherweise stand das Tor einen winzigen Spalt offen.
Seltsam, normalerweise ist der Eingang zum Park nie verschlossen, schoss es ihr durch den Kopf. Na ja, vielleicht wollte man den Stadtpark wegen dem Wolkenbruch schließen, aber warum sollte jemand das tun? Bei dem Wetter einen Hausmeister herausjagen, um abzusperren? Bei dem Gewitter tritt eh keiner vor die Türe, das verkneifen sich sogar die Hunde. Regina schmunzelte über ihre Gedanken. Nun, vor die Tür hatte sie ja niemand gejagt, aber – ist ja auch egal! Wieder konzentrierte sie sich auf ihren Weg. Ohne weiter tiefgreifend über das Eingangsportal nachzudenken, bog Regina in den schmalen Weg zur Hundewiese ein, um daraufhin querfeldein über diese hinweg, zur gegenüberliegenden Seite zu sprinten. Die Schuhe waren eh zu nichts mehr nutze, ihre Füße ohnehin nass. Der Regen rauschte nichtsdestominder weiterhin wie ein Wasserfall herab. Blitze, Donner und – was ereignete sich denn da? Handelte es sich um ein Gewitterleuchten? Aber dies half ihr bei der Orientierung auch nicht. Regina sah nicht die Wachleute, bemerkte nicht die gelbroten Beleuchtungslampen, nicht das Absperrband, das sie bei ihrem Lauf über die Rasenfläche in Hüfthöhe zerriss. Sie hatte keine Ahnung, in was für ein Abenteuer sie schnurstracks hineinrannte.
Ups, seit wann gibt es mitten auf der Wiese Sträucher?, dachte sie, während scheinbar das Absperrband mit einem dezenten „Ritsch!“ An ihrem Körper zerriss. Um so was Belangloses kümmerte sie sich aber nicht, sie wollte so schnell wie möglich zur Bushaltestelle gelangen. Die peitschenartig daherkommenden Donnerschläge vermischten sich jetzt mit den Warnschüssen der Soldaten. Doch auch diese vernahm Regina nicht. Sie hörte nur den Donner, während sie versuchte, dem Unwetter zu entkommen. Den Kopf immer noch tief gesenkt, den mickrigen Kragen der Jacke so hoch wie möglich geschlagen, rannte sie, als ob ihr Leben davon abhing. Um sie herum kam Hektik auf, sie jedoch fokussierte sich weiterhin auf ihren Lauf. Die Soldaten schossen noch einmal in die Luft und schrien ihr zu: „Stehen bleiben, sofort stehen bleiben oder wir schießen! Stehen bleiben!!“ Eine weitere Stimme rief: „Hinlegen, sofort hinlegen!“ Rufe, ja sie vernahm sehr wohl Rufe, die aber weit weg zu sein schienen. Regina kamen entlaufende Hunde in den Sinn. Bei diesem Gedanken schmunzelte sie unwillkürlich. „Weglaufende Hunde – pah, bei dem Wetter. Wie können die nur so blöd sein? Klar, dass die Kläffer in Panik geraten bei dem Gedonner. Noch fünf Minuten habe ich, bis der Bus losfährt, wenn ich gleich auf dem geraden Weg einen Spurt einlege, schaffe ich es noch rechtzeitig.“ Mit diesen Worten versuchte sie ihr rhythmisches Lauftempo zu erhöhen. Die Wiese war nur schemenhaft zu erkennen. Der starke Regen, zusammen mit ihrer total verschmierten Brille, halfen nicht, ein klares Urteil über die Geschehnisse zu erhalten. Die freie Fläche bis zu dem am Rande mit Bäumen bepflanzten Weg zeichnete sich aber leidlich gut ab. Rums! Regina saß, unvermittelt, ohne Vorwarnung, ohne ersichtlichen Grund und ohne ein Hindernis auszumachen, auf ihren Hintern! Definitiv saß sie! Sprachlos, faktisch auf ihren Allerwertesten. So aus heiterem Himmel, dass sie erst mal fassungslos nach Luft schnappte, während sie mit großen Augen ins Nichts glotzte.
„Was? Wie? Scheiße, scheiße, scheiße“, fluchte sie. Sie bemerkte die Feuchtigkeit des Rasens – hoffentlich nur des Rasens –, die durch ihre Hose sickerte. Jetzt waren nicht nur ihre Schuhe, Socken und ihr Rücken, nein auch ihr Hintern war klatschnass.
„Wäre ich doch bei Siegried geblieben, so ein Mist.“ Sie rollte ihre Augen nach oben und fluchte weiter vor sich hin. Siegried, warum bin ich nicht bei dir geblieben, ich blöde Kuh. Bloß keine Hundescheiße!!! Mann, Mann, Mann, wenn ich es mal eilig habe. Soll ich mich so dreckig in den Bus setzen? Na, ich werde wohl nicht der einzige Fahrgast sein, der sickenass ist, dachte sie bei sich, aber die Einzige, die vor Dreck steht. Vor ihren Augen sah sie das missmutige Gesicht des Busfahrers. Hoffentlich würde er sie, so tropfend nass und verdreckt, wie sie war, überhaupt in den Bus hineinlassen. Verwirrt, aber energisch sprang sie auf und guckte angestrengt nach vorne. Wertvolle Minuten verstrichen. Entschlossen setzte sie an, um einen erneuten Sprint hinzulegen. Aber – es gelang ihr nicht! Da stand etwas! Sie war, definitiv, vor einen Gegenstand gelaufen. Aber sie vermochte nichts zu entdecken. Verdattert schaute sie angestrengt nach vorne, versuchte durch ihre völlig verschmierte Brille etwas zu erkennen, aber da war nur eine gähnende Leere. Oder existierte da doch was? Aber was? Wo? Wieso?
Warum habe ich meine Kontaktlinsen nicht eingesetzt? Warum nur? Ich bin so eine doofe Kuh, stellte sie fest.
Kapitel 2 Bei Siegried
Ein paar Stunden vorher war Reginas Welt noch in Ordnung. Die Sonne schien durch die bleigrauen Wolken und sie saß bei ihrer Arbeitskollegin und besten Freundin Siegried zu Hause. Sie ließ sich von ihr die Tarotkarten legen. Ihre Zukunft wollte sie (wie schon so oft) in Erfahrung bringen. Sie glaubte nicht wirklich an diese Art der Vorhersage, aber es war ein friedlicher Zeitvertreib für die Mädels. Zusätzlich bot er immer viel Gesprächsstoff. Siegried Graber war eine schlanke, hochgewachsene Mittfünfzigerin. Sie legte ihrer besten Freundin schon seit vielen Jahren die Karten. Das Wahrsagen mit Hilfe von Tarotkarten war ihr großes Hobby. Kartenlegen, Sternzeichen deuten und ähnlichen okkulten Kram, zählte sie zu ihrem liebsten Zeitvertreib. Als gute Verkäuferin verstand sie es geschickt, die Wünsche der Kundinnen in dem Schreibwarengeschäft, in dem sie beide arbeiteten, auszumachen. Diese Fähigkeit, zu erahnen, was die Kundin wollte, so glaubte zumindest Regina, wandte ihre gute Freundin auch bei ihren Vorhersagen an. Sie empfand jedes Mal, dass die Karten ihr genau das zeigten, was sie anstrebte. So ergab sich, dass die Prophezeiungen immer stimmten und Regina jedes Mal vollauf zufrieden war. Sie fand es dennoch rührend, wie ihre Freundin daran glaubte. Sie wollte diese Illusion auf keinen Fall zerstören, aber heute war alles etwas anders als üblich. Regina und ihre beste Freundin saßen, wie so oft, an dem kleinen runden Tisch. Siegried zündete zwei Kerzen an. Sie setzte sich, während sie behutsam die großen Karten mischte. Dabei schloss sie ihre Augen, um sich besser konzentrieren zu können.
„Schauen wir mal, was die Karten dir weissagen. Ich habe heute ein etwas schummriges Gefühl“, säuselte die Freundin. Sie stoppte das Mischen abrupt und legte mit Bedacht eine Karte nach der anderen auf der Tischplatte ab. Die Erste, die Hauptkarte, war für Regina, die Nachfolgenden gruppierte sie kreisförmig um die Hauptkarte herum. „Oh“, war ihr kurzer überraschter Kommentar bei der ersten Karte. „Na, was mag das wohl bedeuten?“, war ihre zweite und vorerst letzte Äußerung. Ruhig legte sie alle weitere Karten ab. Dazwischen machte sie immer wieder kleine Pausen. Mit ihren rotlackierten Fingernägeln tippte sie zwei-, dreimal auf jede Tarotkarte. Als alle notwendigen Karten dalagen, senkte Siegried ihren Kopf und blickte lange schweigend darauf. Regina tat es ihr gleich und schaute ebenfalls auf das Resultat. Ehrlich gesagt, schielte sie eher auf Siegried. Die Zeit schien sich auszudehnen und Regina begann ungeduldig zu werden. „Was ist? Wenn ich das richtig interpretiere, kommen da doch gleich drei Männer auf mich zu. Sieht für mich doch ganz gut aus, ich und gleich drei Männer“, sprudelte es aus ihr heraus. Grinsend lehnte sie sich in ihrem Stuhl zurück und verschränkte die Arme vor der Brust. Provozierend streckte sie ihr Kinn nach vorne und funkelte Siegried herausfordernd an.
„Oder? Dann habe ich doch endlich mal die freie Auswahl! Sag schon was, spann mich nicht so auf die Folter.“
„Warte, warte, nicht so schnell, ich muss noch mal in mich gehen.“ Bei diesen Worten schloss Siegried bühnenreif die Augen.
„Na, du machst es aber heute mal wieder spannend.“ Ihre Freundin ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Langsam öffnete sie ihre Augen wieder und ihr Blick schweifte von einer Karte zur nächsten. Um Siegried aus der Reserve zu locken, meinte Regina: „Na toll, ich werde bestimmt Drillinge bekommen und weiß nicht, von wem.“
„Tja, meine Liebe, dazu müsstest du erst einmal eine intime Herrenbekanntschaft haben“, konterte Siegried hochnäsig. Sie räusperte sich und fasste sich wieder. „Ja, da bist du“, dabei tippte sie mit ihrem Zeigefinger auf die mittlere Karte. „Unzweifelhaft in einer Art Machtposition.“„Ja, klar, ich und Macht!“, pampte Regina Siegried an. Welche Ironie! Im realen Leben war kein Mann auch nur auf Kilometer in Sicht, während die Karten gleich drei stattliche Kerle in der nahen Zukunft versprachen. „Ich kann dir nur sagen, was die Karten dir voraussagen. Es werden drei Männer in dein Leben treten. Leider kann ich nicht erkennen, ob sie Gutes oder Böses wollen. Dann werden Verwirrungen, Chaos oder so was dein Leben in Unruhe bringen. Nach diesen Verwirrungen wird ein vierter Mann erscheinen, der aber schon vorher da war. Ich verstehe das nicht so richtig“, ratlos zuckte Siegried mit den Schultern. „Wie? Versteh ich erst recht nicht.“ Enttäuscht und irritiert stemmte Regina ihre Hände in die Hüfte. Unzufrieden guckte sie ihre Freundin an. „So jedenfalls interpretiere ich das hier.“ Mit einer ausschweifenden Geste zeigte Siegried kreisförmig über den ganzen Tisch. „Außerdem sagen die Karten noch viel Unruhe, Neues, Unbekanntes voraus, auch so was wie ein Geschenk, etwas Unerwartetes.“ Natürlich blieb sie mit ihren Erläuterungen äußerst knapp, keine auch noch so vage Zeitangabe kam über ihre Lippen. Ob bald, sehr bald – nichts Genaues teilte sie mit. „Bekomme ich eine Gehaltserhöhung? Um etwas zu gewinnen, müsste ich erst bei einem Glücksspiel mitmachen. Wird der Laden (so bezeichneten sie das Schreibwarengeschäft, in dem sie beide arbeiteten)umgebaut? Oder ziehen wir um? Vielleicht bekomme ich eine schöne neue Wohnung“, sprudelte es aus Regina heraus. Leider hielt sich Siegried mit weiteren Aussagen zurück. Vielleicht war sie ja auch einfach nur müde, sie hatten schließlich einen langen Tag hinter sich. Aber so etwas hatte Siegried noch nie vorausgesagt! Bisher waren ihre Wahrsagungen nie so chaotisch gewesen. Nach ein paar Momenten des Schweigens kehrte Siegrieds unbeugsam optimistische Einstellung zurück. Mit ihrer gewohnten sonoren Businesstimme erläuterte sie: „Ob es sich um männliche Kinder, junge Männer oder alte Herrschaften handelt, kann ich dir leider nicht sagen. Warum lässt du mich hier überhaupt mit den Karten arbeiten, wenn du sowieso nicht daran glaubst?“
„Ach, Siegried, sei doch nicht gleich eingeschnappt. Wir werden schon sehen, was passiert.“
„Ich bin mir diesmal wirklich nicht sicher, ob das alles so gute Voraussagungen sind“, sagte Siegried, diesmal mit ernster Besorgnis in der Stimme.
„Sei doch nicht gleich so traurig, aber sag selbst, dieses Blatt ist nun nicht gerade für mich bestimmt. So viele Männer würde ich doch nur treffen, wenn ich zu einem Fußballspiel gehen würde. Und du weißt, da kriegen mich keine zehn Pferde hin.“
„Die Karten lügen nicht“, mahnte Siegried etwas hoheitsvoll, jetzt doch ein wenig beleidigt.
„Ja, ja, womöglich hab ich morgen drei Kunden, die meckern, anschließend kommt die Chefin und feuert mich. Oder ich werde gleich am Bahnhof von zwei Punks überfallen und schaffe nur einen, dann kommt ein Retter und schwupp…“
„Schwuppdiwupp hast du Drillinge von dem“, fiel Siegried ihrer Freundin lachend ins Wort. Nachdem beide noch ein bisschen herumgealbert hatten, wurde der Fernseher eingeschaltet. Eine Diskussion über die Rentenkürzungen für Kinderlose entzündete sich, aber nur kurz. Eine große Schüssel Chips, gelbe, viel zu süße Limonade und belgische Pralinen mit geschätzten 10 000 Kalorien rundeten den gemeinsamen Abend ab. Siegried war 53 Jahre alt, absichtlich – wie sie immer betonte – kinderlos und in ihrer 65 Quadratmeter kleinen Eigentumswohnung überaus zufrieden. Sie war single. Dieser Zustand kam ihrer Selbstständigkeit und Unabhängigkeit sehr zugute. Sie war häufig alleine, aber nie einsam. Siegried vermisste nichts. Lover, sofern es ihr nach körperlicher Liebe verlangte, gab es bei den Ü40- und Ü50-Partys zuhauf. Und welche Verkäuferin konnte sich zwei Urlaube im Jahr leisten? Sie entschied, wohin ihre Reisen gingen, wie lange sie unterwegs war und mit wem. Siegried würde für nichts in der Welt ihre Unabhängigkeit aufgeben. Gab es etwas Besseres, als selber zu entscheiden, wo sie wann, wie, und mit wem, sie wohin auch immer wollte? Regina hingegen war immer nahe an der Pleite. Sie hatte ein Monatsticket für Bus und Bahn, mit dem sie in der Stadt überall hinkam. Große Ansprüche stellte die kleine, nur 158 Zentimeter große Frau mit ihren 70 Kilo nicht. Kurze, schokoladenbraune Haare, die ihr etwas Burschikoses gaben, machten Regina nicht zu einem Typ Frau, dem die Männer zu Füßen lagen. 32 Jahre alt, drei gescheiterte „längere“ Beziehungen und ein paar flüchtige Affären, das war ihre bisherige Ausbeute, was Männerbekanntschaften anging. Nicht zu vergessen, auch sie war kinderlos. Aber das sollte sich ja, laut den Karten, alles sehr bald ändern. Also, wo waren die drei Adonisse? Regina musste zugeben, dass an diesem Abend die Karten absolut ungewöhnlich lagen, komplett anders als an den vielen Sonntagabenden zuvor. So einen Unsinn hatte Siegried noch nie verzapft. Aber es sollten ja noch Wunder geschehen. Tief in Gedanken machte sie sich in der düsteren und unwirklichen Nacht auf den Weg zum Bahnhof. Der Sturm verscheuchte jedoch all ihre Überlegungen sofort. Und als sie auf dem Rasen zu sitzen kam, waren die Tarotkarten längst vergessen.
Kapitel 3 Sechs Monate vorher
Ein schöner, wenn auch etwas windiger Sommertag im August, ideal zum Wandern, sinnierte Wolfgang Knobel, seines Zeichens Oberst bei der Bundeswehr. Hier, an der Ostsee, machte er fast jedes Jahr Urlaub. Seit dem Tod seiner Frau vor fünf Jahren zog es ihn immer öfter in diese einsam-schöne Gegend. Er hielt sich nicht am Strand auf, wie die meisten Touristen, sondern an der slawischen Grenze. Wie oft er bei seinen Wanderungen die grüne Grenze überschritten hatte, vermochte er nicht mehr zu zählen. Heute suchte er einen versteckten Pfad durch ein dicht bewachsenes Wäldchen. Er konnte sich gut vorstellen, dass es in diesem ursprünglichen Terrain noch, oder wieder, Wölfe und Bären gab. Jedoch hatte er, keines dieser Tiere je zu Gesicht bekommen. Nach zirka drei Stunden einsamer Streife durch den Wald erschien eine kleine Hütte zwischen den Bäumen. Die verwitterten Holzwände waren löchrig und schief und das Dach stark reparaturbedürftig. Der bescheidene Verschlag wirkte unbewohnt. Um jedoch nicht für einen Dieb gehalten zu werden, rief er laut und deutlich: „Hallo, Haaallooo, ist jemand da? Ist jemand zu Hause?“ Das Knarren der windschiefen Tür zeigte ihm an, dass ihn tatsächlich jemand gehört hatte. Aus dem Gebäude, das bestenfalls als Stallung dienen konnte, trat ein kleines, dünnes, dreckiges Männlein. Ja, Männlein war die richtige Bezeichnung. Zirka 1,50 Meter groß, in schmutzigen braunen Hosen, die schon seit Wochen kein Wasser geschweige denn Seife gesehen hatten. Wie auch sein Besitzer. „Bin ich in ein schlechtes Märchen geraten?“, dachte Knobel bei diesem Anblick. Als er sich dem Männlein näherte, musste er den starken Impuls, sich die Nase zuzuhalten, mit aller Willenskraft unterdrücken. Ein schneidend scharfer Gestank von Alkohol, Urin, Dreck, Schweiß sowie etwas Unaussprechlichem schnitt ihm die Luft ab. Diese Komposition tauchte sein Geruchszentrum in einen scharfen Schmerz. Der offenbar verwirrte Obdachlose stank zum Himmel, Sodas Oberst Knobel das Atmen schwerfiel. Aber da er nun mal laut gerufen hatte, wollte er nicht unhöflich erscheinen und sich angeekelt abwenden. Doch noch bevor der dünne kleine Mann sein erstes Wort sprechen konnte, bereute Knobel sein Rufen schon. „Ah, ein Deutschmann, da, da, komm, komm“, sagte der Mann und winkte Knobel in die Hütte. „Nein, danke, ich wollte nicht ins Haus, ich bin auch schon wieder weg“, sprach Oberst Knobel und wandte sich zum Gehen, um möglichst schnell aus dem penetrant stinkenden Dunstkreis dieses Mannes zu kommen. Aber der kleine Kerl war wieselflink bei ihm und zupfte ihn am Ärmel. So viel Nähe war Knobel zuwider. Vorsichtig löste er die Hand von seinem Arm und legte eine kleine Drohung in seinen Blick, der deutlich machen sollte, halte dich auf Distanz! Aber der Waldbewohner schien dies nicht zu bemerken. „Setzen, hier auf Baum“, einladend zeigte der stark Alkoholisierte auf einen umgefallenen Baumstamm, der vor ihm lag und so verrottet war wie die Hütte. So wie die Kleidung des Alten, moderte wohl alles im Umkreis der windschiefen Baracke vor sich hin. In der Hoffnung, dass der kleine Mann möglichst schnell wieder in seine Hütte verschwinden würde, um weiter dem Wodkakonsum zu frönen, setzte sich Knobel frustriert auf den modrigen Stamm. Gewalt wollte er diesem klapprigen Greis nun wirklich nicht antun. In diese erbärmliche Hütte bekamen ihn keine zehn Pferde, das war klar. Den Gestank, der darin herrschen würde, wollte er sich nicht ausmalen. „Warten hier, warten, ich haben, ich zeigen, ganz billig, Stein, schöner.“ So ein Bockmist, jetzt will der mir noch was aufschwatzen, nur um sich die nächste Flasche Wodka kaufen zu können. Na klar, ein Penner will mir einen Edelstein für ̒n Appel und ̒n Ei verkaufen. Mann – hätte ich mal nicht gerufen. Wenn ich mich vorbeigeschlichen hätte, wäre ich jetzt schon über alle Berge. Nun, später ist man immer klüger, überschlugen sich Knobels Gedanken. Resigniert und von der Wanderung erschöpft, blieb er auf dem bröselnden Baumstamm sitzen und harrte der Dinge, die da kommen sollten. Tatsächlich kam der Mann mit einem schmutzigen Stoffbeutel zurück und holte mit theatralischer Geste einen riesigen Bernstein daraus hervor. Ein wunderbares, sehr helles Exemplar, fast zwei Pfund schwer. Einfach wunderschön. Die Form erinnerte an einen Faustkeil aus der Steinzeit, ein sehr großes Exemplar. Was Knobel aber sofort gefangen nahm, war das helle, durchscheinende Leuchten, das aus dem Inneren des Bernsteins zu kommen schien. Etwas war in ihm eingeschlossen. Keine Pflanze, kein Tier, sondern irgendetwas Mineralisches, schwer zu Beschreibendes. Fasziniert betrachtete Knobel den wundervollen Halbedelstein von allen Seiten. Er konnte seinen Blick nicht abwenden. Schwer wog der Bernstein in seiner Hand, schwerer, als er bei einem Bernstein geschätzt hätte. Den entsetzlichen Geruch, den der Obdachlose verströmte, nahm er schon gar nicht mehr wahr. „Gefunden, ich gefunden, vor Jahren, schön, sehr schön, teuer, sehr teuer“, lächelte der zahnlose Alte. „Du Freund, du billig, sehr billig kaufen?“ Knobel wollte sein irrsinniges Interesse nicht allzu deutlich zeigen. Von diesem Bernstein ging eine unwiderstehliche Faszination aus. Sobald er ihn erblickt hatte, war er ihm verfallen. „Nein, nein, zu großer Stein, kein Geld“, versuchte er dem Verkäufer glaubhaft zu machen. Aber der schien die deutschen Touristen besser zu kennen. „50 Euro“, prustete er heraus. Immer wieder fasste er sich dabei an den Hinterkopf oder hielt sich die Schläfe. Der Mann schien einen Brummschädel und das Geld bitternötig zu haben. „50 Euro?“, stieß Knobel etwas heftig hervor. Nicht weil das zu teuer war, sondern weil er nicht glauben konnte, dass der Alte so wenig für diesen außergewöhnlichen Stein haben wollte. Er musste ihn unbedingt besitzen. Er würde auch 500 Euro zahlen. Der gänzlich verzweifelt erscheinende Kerl hielt sich mit zwei Fingern die Nasenwurzel fest und schrie richtiggehend: „50 Euro, nicht weniger! Mehr kostet sonst, viel mehr. Du billig, sehr billig.“
„Gut, gut, ich kaufe Ihnen den Stein ab. 50 Euro in kleinen Scheinen, ist das okay?“
„Ja, ja, das okay.“ Knobel fummelte etwas ungeschickt an seiner Jacke herum, bis er an seine Börse gelangte. Drei Zehner, zwei Fünfer, den Rest suchte er in Münzen zusammen. Erleichtert gab er dem Mann das Geld und steckte den Stein in den Rucksack, ohne zu ahnen, was dadurch auf ihn zukommen würde. Ein Gefühl des Triumphes überkam ihn. Der kleine Mann jedenfalls verließ fluchtartig und überglücklich das Gelände. Flink wie ein Wiesel verschwand er im Gehölz. Was für ein außerordentlich schöner Stein! Knobel saß immer noch auf dem verfaulten Baumstamm, kramte den Halbedelstein aus seinem Rucksack wieder hervor und betrachtete andächtig den riesigen Bernstein mit der Faszination eines Kindes. Zufrieden mit sich und der Welt, machte sich Knobel auf den Rückweg. Das helle pulsierende Glühen aus seinem Rucksack konnte er nicht sehen.