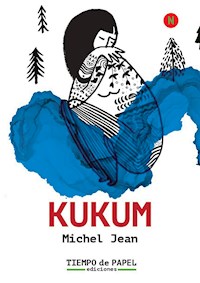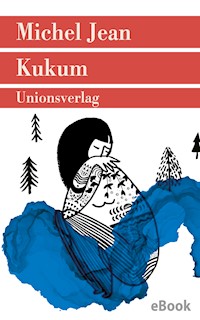
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Almandas Blick auf den jungen Mann in dem Kanu fällt, beginnt für sie eine neue Zeitrechnung. Sie folgt dem ruhigen, freundlichen Thomas in ein neues Leben, zu seiner Familie und dem Volk der Innu. Geborgen in einer Gemeinschaft, die ganz zu der ihren wird, lernt sie zu jagen, zu lieben und zu überleben. Der Rhythmus des Waldes und die Wege des Flusses bestimmen die Schritte der Innu, doch nach und nach beanspruchen immer mehr Siedler das Land für sich. Die Sägewerke vernichten die Wälder, die Flößerei verstopft die Flüsse, und die Innu werden in eine Welt gezwungen, in der sie sich nicht zurechtfinden. Einfühlsam erzählt Michel Jean die Geschichte seiner eigenen Urgroßmutter, seiner Kukum, und die Geschichte der Ersten Völker, die in den offiziellen Berichten nicht vorkommt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 216
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch
Almanda folgt dem ruhigen Thomas zu seiner Familie und dem Volk der Innu. Geborgen in ihrer Gemeinschaft, lernt sie zu jagen und zu lieben, doch bald breiten sich die Siedler aus und zwingen die Innu in ein fremdes Leben. Einfühlsam erzählt Michel Jean die Geschichte seiner Urgroßmutter, seiner Kukum, und die Geschichte der Ersten Völker.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Michel Jean (*1960) ist einer der wichtigsten indigenen Autoren Québecs. Nach dem Studium der Geschichte und Soziologie arbeitet er seit 1988 als Journalist und Moderator für verschiedene französisch-kanadische Fernsehsender.
Zur Webseite von Michel Jean.
Michael von Killisch-Horn, geboren 1954 in Bremen, studierte Romanistik, Germanistik und Deutsch als Fremdsprache. Er lebt in München als Übersetzer aus dem Französischen, Italienischen, Spanischen, Portugiesischen und Englischen.
Zur Webseite von Michael von Killisch-Horn.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Michel Jean
Kukum
Roman
Aus dem Französischen von Michael von Killisch-Horn
E-Book-Ausgabe
Wieser Verlag @ Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book des Wieser Verlags erscheint in Zusammenarbeit mit dem Unionsverlag.
Die Originalausgabe erschien 2019 bei Libre Expression, Montreal, Kanada
Die deutsche Erstausgabe erschien 2021 im Wieser Verlag GmbH, Klagenfurt/Celovec
Originaltitel: Kukum
© der deutschen Ausgabe by Wieser Verlag, Klagenfurt 2021
Diese Ausgabe erscheint mit freundlicher Genehmigung des Wieser Verlags
© by Wieser Verlag, Klagenfurt 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Phillip Hailperin
ISBN 978-3-293-31152-7
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 23.06.2024, 21:57h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
KUKUM
Pekuakami, Mai 1977NishkWaisePekuakamiDer IndianerPointe-BleueVerpflichtungPéribonkaDie WinchesterPileuDie Passes-DangereusesTerritoriumFallenNadelnInnu-aimunDer heilige BergDie große JagdRückkehrDie Fourche ManouaneDas Geschäft in der Hudson BayTraurige TurteltaubenDie HochzeitErzählungDer KanuhöckerTobbogansWiedersehenNaskapiFrüherAllein auf der WeltSüßigkeitenSilvesterPerlenAnne-MarieDie HütteEntscheidungAbwesenheitenPessamitMistookÜbelkeitDie FlößerBoomtownDie EisenbahnBruchDie KrankheitDas Haus mit vierzehn WohnungenBürgersteigeDer ChefUntergängeKreisCobh (Queenstown), Irland, 1875Nachwort des AutorsMehr über dieses Buch
Über Michel Jean
Über Michael von Killisch-Horn
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Zum Thema Kanada
Zum Thema Arktis
Zum Thema Indianer
Dem Andenken an France Robertson
Apu nanitam ntshissenitaman
anite uetuteian
muku peuamuiani
nuitamakun
e innuian kie eka nita
tshe nakatikuian.
Ich erinnere mich nicht immer
woher ich komme
in meinem Schlaf
erinnern mich meine Träume
wer ich bin
niemals werden meine Ursprünge
mich verlassen.
Joséphine Bacon
Bâtons à message
Tshissinuatshitakana
Pekuakami, Mai 1977
Nishk
Ein Meer inmitten der Bäume. Wasser, so weit das Auge reicht, grau oder blau, je nach Laune des Himmels, durchzogen von eisigen Strömungen. Dieser See ist zugleich schön und beängstigend. Maßlos. Und das Leben ist ebenso zerbrechlich wie leidenschaftlich.
Die Sonne geht im Morgennebel auf, doch der Sand ist immer noch von der nächtlichen Kühle durchdrungen. Wie lange sitze ich schon vor Pekuakami?
Tausend dunkle Flecken tanzen zwischen den Wellen und tratschen ungeniert. Der Wald ist eine Welt des Sichverbergens und der Stille. Beute- und Raubtiere rivalisieren darin, sich möglichst unauffällig zu verhalten. Dennoch trägt der Wind den Lärm der Zugvögel heran, lange bevor sie sich am Himmel zeigen, und nichts scheint ihrem Gekreisch Einhalt gebieten zu können.
Diese Trappgänse tauchen am Beginn meiner Erinnerungen an Thomas auf. Wir waren seit drei Tagen unterwegs und ruderten in nordöstlicher Richtung, ohne uns von den sicheren Ufern zu entfernen. Rechts das Wasser. Links ein Sandstreifen und Felsen, die vor dem Wald emporragten. Ich bewegte mich zwischen zwei Welten, in einem Rausch, den ich nie zuvor empfunden hatte.
Als die Sonne sich neigte, gingen wir in einer windgeschützten Bucht an Land. Thomas schlug das Lager auf. Ich half ihm, so gut ich konnte, und bombardierte ihn mit Fragen, aber er begnügte sich mit einem Lächeln. Mit der Zeit begriff ich, dass man, um zu lernen, schauen und hören muss. Fragen war sinnlos.
An dem Abend setzte er sich auf seine Fersen und legte den Vogel, den er gerade geschossen hatte, auf seine Knie, ein recht fettes Tier, das er rupfte, wobei er zuerst die größten Federn ausriss. Das ist eine Arbeit, die große Sorgfalt verlangt, denn wenn man zu ungeduldig ist, bricht der Kiel ab und bleibt im Fleisch stecken. Sich Zeit nehmen. Das muss man häufig in den Wäldern.
Nachdem das Tier von seinem Federkleid befreit war, hielt er es ins Feuer, um den Flaum abzusengen. Anschließend kratzte er mit dem Messer über die Haut, ohne sie zu beschädigen, sie und ihr wertvolles Fett. Dann hängte er die Trappe über die Flammen, um sie zu braten.
Ich bereitete Tee, und wir aßen auf dem Sand im Angesicht des Sees unter einem bestirnten Himmel. Ich hatte keine Ahnung, was uns erwartete. Aber in genau diesem Augenblick war ich überzeugt, dass alles gut gehen würde, dass ich recht gehabt hatte, meinem Instinkt zu vertrauen.
Er sprach kaum Französisch und ich noch nicht Innu-aimun. Aber an jenem Abend am Ufer, gehüllt in den Duft von gegrilltem Fleisch, fühlte ich mich mit meinen fünfzehn Jahren zum ersten Mal in meinem Leben an meinem Platz.
Ich weiß nicht, wie die Geschichte unseres Volkes enden wird. Aber für mich beginnt sie mit dieser Mahlzeit zwischen dem Wald und dem See.
Waise
Ich wuchs in einer bewegungslosen Welt auf, in der die Jahreszeiten den Lauf der Dinge bestimmten. Einer Welt der Langsamkeit, in der das Wohl von einem Stück Land abhing, das man unermüdlich bearbeiten musste.
Meine ältesten Erinnerungen reichen bis zu der Hütte zurück, in der wir lebten, kaum mehr als ein einfaches Siedlerhaus aus Holz, viereckig, mit einem Satteldach und einem einzigen Fenster in der Fassade. Davor ein Sandweg. Dahinter ein Feld, das mit bloßer Muskelkraft dem Wald abgerungen war.
Es ist ein steiniger Boden, und doch behandeln die Menschen ihn wie einen Schatz, pflügen ihn um, düngen ihn, entfernen die Steine. Und er vergilt es ihnen mit fadem Gemüse, etwas Weizen und Heu, um die Kühe zu füttern, die Milch geben. Ob die Ernte gut oder schlecht wird, hängt vom Wetter ab. Darüber entscheidet der Himmel, sagte der Pfarrer. Als hätte Gott nichts anderes zu tun.
An meine Eltern habe ich keine Erinnerung. Ich habe oft versucht, mir ihre Gesichter vorzustellen … Mein Vater war groß, stark und entschlossen. Er hatte kräftige Hände. Meine Mutter war blond mit blauen Augen, wie meine. Sie hatte feine Gesichtszüge und war herzlich und liebevoll. Natürlich existierten diese beiden Personen nur in meiner kindlichen Vorstellung. Wer weiß, wie meine Erzeuger wirklich waren. Im Grunde ist es egal. Aber ich möchte gern glauben, dass Stärke und Sanftmut sie auszeichneten.
Ich wuchs bei einer Frau und einem Mann auf, die ich »Tante« und »Onkel« nannte. Ich weiß nicht, ob sie mich geliebt haben, aber sie haben sich um mich gekümmert. Sie sind vor langer Zeit gestorben, und das Haus am Ende der Rivière à la Chasse ist niedergebrannt. Das Land aber ist noch da. Die Felder beanspruchen nun den ganzen Platz. Die Bauern, die an ihrem kleinen Stück Land kleben, umschließen jetzt Pekuakami.
Wind kommt auf und streichelt mein verlebtes Gesicht. Der See ist unruhig. Ich bin nur eine alte Frau, die zu lange gelebt hat. Zumindest dir, mein See, können sie nichts antun. Du bist unwandelbar.
Pekuakami
Die Pfeife schrillt durch die milde Luft, unaufhörlich.
Sobald der Zug in die Gemeinde einfährt, heult er, solange er sie nicht wieder verlassen hat, ganz egal zu welcher Tages- und Nachtzeit. Seit sie nicht mehr zu ihren Jagdgebieten gehen können, haben viele mit dem Trinken angefangen. Es ist vorgekommen, dass manche auf den Gleisen eingeschlafen sind. Es hat Unfälle gegeben. Daher verringern die Lokführer die Geschwindigkeit und betätigen die Sirene, damit die Innu die Gleise frei machen und sie weiterfahren lassen.
Ich ziehe es vor, sie zu ignorieren. Ich konzentriere mich auf den See vor mir, seine Wellen, die über den Sand rollen und flüsternd zu meinen Füßen ersterben. Heute Morgen bringt der Wind Sprühregen, und meine Haut wird nass. Auf diese Weise werden wir eins, Pekuakami, der Himmel und ich.
Ich habe fast ein Jahrhundert an seinen Ufern gelebt. Ich kenne jede Bucht und alle Flüsse, die in ihn münden oder aus ihm herausfließen. Sein Gesang überdeckt den Lärm der Metallpferde, lindert die Demütigung. Und wenn er mal böse wird, verfliegt seine Wut jedes Mal wieder.
Wir respektieren ihn, fürchten seine Gewalt, und niemand würde sich trauen, auf ihn hinauszufahren, denn der Wind, der ohne Vorwarnung zu blasen beginnt, kann die unvorsichtigen Kanus verschlingen. Heute ist er zu einer Art Tummelplatz geworden, und die Menschen amüsieren sich auf ihm mit ihren großen Motorbooten. Sie haben das Wasser verschmutzt, und die Fische sind aus ihm verschwunden. Sie durchschwimmen ihn sogar und haben ihm den Namen eines Heiligen gegeben. Sie respektieren seine Größe nicht.
Dennoch ist er der einzige See in Nitassinan, den der Blick nicht überqueren kann. Wie bei einem Ozean muss man sich das andere Ufer vorstellen. Ich kann es noch. Wenn ich die Lider schließe, taucht auf, was die Alten Pelipaukau nannten: der Fluss, in dem der Sand wandert. An seiner Mündung scheint das Wasser regungslos inmitten der hellen Sandbänke zu stehen, so langsam fließt es, als wäre es erschöpft von seiner langen Reise von den Monts Otish hierher.
Die Bilder meiner Begegnung mit ihm kommen hoch, und wie vor fast hundert Jahren krampft mein Herz sich zusammen. Immer. Ich sehe mich wieder im Kanu mit ihm. Wir gleiten schweigend über die glatte Oberfläche. Ich schicke mich an, in eine Welt einzutauchen, von der ich nur das weiß, was er mir gesagt hat. Die ersten Schwindelgefühle sind die stärksten.
Er war kaum älter als ich. Doch sein Blick drückte bereits eine Weisheit und eine Kraft aus, die mich eroberten. Thomas erzählte mir vom Péribonka mit dieser Sparsamkeit der Worte, die ich zu schätzen lernen sollte. Seine singende Stimme konnte bisweilen zögerlich wirken, aber ich habe nie jemanden gesehen, der seiner selbst sicherer gewesen wäre. Als das Kanu losfuhr und der Péribonka sich vor mir öffnete, machte mein Herz einen Satz.
Heute haben sie eine Stadt gebaut, aber damals beherrschten die Sandbänke den Horizont. Wie der Ashuapmushuan und der Mistassini öffnete der Péribonka einen Weg nach Norden. Er führte uns zum Jagdgebiet der Siméons.
Die Ruhe seiner Mündung war trügerisch. Bald würden die Fluten anschwellen, die Strömung würde schneller, und vor uns würden sich unüberwindbare Wasserfälle erheben, die man zu Fuß würde umgehen müssen. Dieser Fluss hat mehrere Gesichter.
Am Ende des Weges befand sich der lange, schmale See, den Thomas mir beschrieben hatte, jenseits der Berge, deren Gipfel sich am Horizont abzeichneten. Mit fünfzehn ist Träumen noch leicht. Aber was ich entdecken sollte, war majestätischer als alles, was ich mir vorgestellt hatte.
Der Indianer
Mein Onkel gehörte zu den Männern, die jeden Tag vor Tagesanbruch aufstanden, ein Stück Galette aßen, ihren glühend heißen Tee tranken und hinausgingen, um auf dem Feld zu arbeiten. Klein, gedrungen, hatte er ein verlebtes Gesicht, das immer sorgenvoll wirkte. Seine riesigen Hände, übersät mit Flecken, die von den in der Sonne verbrachten Stunden herrührten, zeigten die Spuren eines harten Arbeitslebens.
Meine Tante knotete ihr bereits graues Haar zu einer Art Haube zusammen, die ihr, wie sie glaubte, ein vornehmes Aussehen verlieh. Zierlich von Gestalt, verrieten ihre abgezehrten Gesichtszüge ihre Erschöpfung. Sie war fromm und opferte sich voll und ganz für Gott auf, da er uns das Land gegeben hatte, damit wir uns darum kümmern, wie sie sagte.
Das Leben auf dem Hof hatte etwas Priesterliches. Die Bauern stellen sich vor, dass ihr Land sie vor der Grausamkeit schützt. In Wirklichkeit macht es sie zu Sklaven. Die Kinder arbeiten wie die Erwachsenen. Ich kümmerte mich um die Tiere, bevor ich zur Schule ging, und ebenso, wenn ich am Ende des Tages zurückkam. Ich liebte es, mich um die Kühe zu kümmern. Ich sprach mit ihnen, während ich sie melkte. Wir verstanden uns gut, sie und ich. Im Sommer führte ich sie auf das Feld. Dieses lag an einem kleinen Fluss, und im Norden, jenseits der Hügel, war der See zu erahnen.
Sonntags gingen wir in die Kirche von Saint-Prime. Damals war sie nur ein einfaches Gebäude aus Brettern mit Fenstern auf beiden Seiten und einem silberfarbenen Glockenturm, in dem man im Winter erbärmlich fror und in der schönen Jahreszeit erstickte. Wir hatten keine feinen Kleider, wie manche, aber unsere Kleidung war sauber. Aus Respekt vor dem Haus Gottes.
Ich hatte gute Noten in der Schule, und meine Tante hätte es gern gesehen, dass ich Lehrerin würde. Aber sie und mein Onkel hatten nicht die Mittel, mich auf die normale Schule zu schicken. Und ich konnte mir auch nicht vorstellen, mich am Ende einer ländlichen Gemeinde mit einer Bande von Jugendlichen einzuschließen, für die ich verantwortlich war. Und ich sah mich auch nicht einen Bauern aus Saint-Prime heiraten und eine kinderreiche Familie auf einer steinigen Parzelle aufziehen. Ich zog es vor, nicht an die Zukunft zu denken.
Das Dorf entwickelte sich nach und nach. Neue Siedler ließen sich nieder, angelockt von den kostenlosen Böden, die sie allerdings urbar machen mussten. Die Gemeindemitglieder sprachen davon, die kleine Kirche durch ein imposanteres steinernes Gebäude zu ersetzen, mit einem schwindelerregend hohen Glockenturm, den man schon aus der Ferne erkennen konnte. Der Bürgermeister sprach von Fortschritt. Dieses Wort war in aller Munde. In Wirklichkeit passierte nicht viel. Mehr Einwohner bedeutete nur mehr vor ihre Pflüge gespannte Männer und mehr Frauen am Herd.
Manchmal beobachtete ich abends nach getaner Arbeit die Sonne, wie sie hinter dem Wald unterging. Was war hinter den Bäumen? Wer lebte auf der anderen Seite des großen Sees? Unterschied diese Welt sich von meiner? Oder war sie nur eine Folge von Dörfern, die ebenso trist waren wie unseres? Wenn ich nach Hause kam, schimpfte meine Tante mit mir.
»Warum kommst du so spät nach Hause? Es ist gefährlich im Dunkeln. Wilde könnten dich überfallen.«
»Also wirklich, Tante. Hier ist doch niemand. Hier gibt es nichts zu stehlen, nichts zu fürchten.«
An einem dieser Abende, an denen ich die Kühe im gedämpften Licht der untergehenden Sonne melkte, sah ich ihn zum ersten Mal. Es war Sommeranfang, und ein warmer Wind fegte über das hohe Gras. Ein Kanu tauchte auf und fuhr geräuschlos die Rivière à la Chasse hinunter. Ein Mann mit nacktem Oberkörper und kupferfarbener Haut ruderte ohne Eile und ließ sich von der Strömung treiben. Er schien kaum älter als ich zu sein, und von meiner Position aus konnte ich sehen, dass auf dem Boden seines Boots aus Birkenrinde fünf Trappgänse lagen. Unsere Blicke begegneten sich. Er lächelte nicht. Und ich hatte keine Angst. Der Jäger verschwand in einer Biegung hinter einem Hügel.
Wer war dieser junge Indianer? Vermutlich hatte ein Vogelschwarm ihn hierhergelockt, denn in dieser Gegend sah man niemals welche. Ich beendete das Melken der Kühe und kehrte auf dem Weg zwischen den Feldern nach Hause zurück. Der Wind verstreute die schwarzen Fliegen, die zu dieser Jahreszeit sehr zahlreich waren. Ich achtete darauf, die Milch nicht zu verschütten. Wir brauchten sie, denn der Regen hatte die Aussaat verzögert. Mein Onkel und meine Tante machten sich Sorgen. Unser Leben hing an so wenig.
Am folgenden Tag tauchte das Boot um die gleiche Zeit wieder auf, erneut gefüllt mit Trappgänsen, die fächerförmig auf dem Boden lagen. Der Junge mit den Schlitzaugen sah mich an. Ich winkte ihm zu, und er antwortete mit einem Nicken. Aufrecht in seinem zarten Boot sitzend, ruderte er selbstsicher, schön in seinem Schweigen. Die Handflächen an das Euter einer Kuh gepresst, blickte ich ihm nach.
Als ich am nächsten Tag bei Tagesanbruch aufstand, ging mir das Bild des geheimnisvollen Jägers, der mit einer solchen Noblesse in seinen Bewegungen über das Wasser glitt, immer noch im Kopf herum. War er jeden Tag auf Beutejagd? Wechselte er das Revier, oder bestellte er wie der Bauer immer dasselbe Feld? Diese Fragen beschäftigten mich den ganzen Tag, während ich meiner Tante beim Brotbacken, beim Zubereiten der Mahlzeiten und beim Bügeln half.
Nach dem Abendessen machte ich mich mit meinem Eimer auf den Weg zur Weide, in der heimlichen Hoffnung, denjenigen wiederzusehen, der mir so anders zu sein schien als alle, die ich bis jetzt kannte, und der mir wie eine Art Vagabund vorkam, der sich vom Wind führen ließ. Ich war jung, klar. Umgeben von Menschen, die Gefangene ihrer Böden waren, entdeckte ich jemanden, der frei war. Das war also möglich.
Als ich an diesem Sommerabend auf die Weide kam, erwartete er mich, auf dem Zaun sitzend, mit der Geduld desjenigen, dem die Zeit egal ist. Der Wind spielte in seinem Haar und betonte noch den Eindruck eines schüchternen Kindes. Genau das waren wir beide. Er beobachtete mich, während ich auf ihn zuging. Ich sprach ihn als Erste an.
»Guten Tag.«
Er antwortete mit einem Nicken, mit konzentriertem Blick. Ob er wohl lächeln konnte?
»Wie heißt du?«
Er zögerte einen Augenblick.
»Thomas Siméon.«
Er hatte eine sanfte, singende Stimme.
»Ich bin Almanda Fortier.«
Er nickte erneut. Die Sicherheit und die Stärke, die er ausstrahlte, kontrastierten mit seiner Zurückhaltung. Als lebten zwei Personen gleichzeitig in ihm.
»Bist du mit dem Kanu gekommen?«
»Heute nicht.«
Er suchte seine Worte.
»Der Wind …«
»Du bist zu Fuß von Pointe-Bleue gekommen?«
Er nickte.
»Das ist aber eine ganz schöne Strecke.«
»So schlimm ist es gar nicht.«
Es waren mehr als zehn Kilometer bis Pointe-Bleue. Für mich war es unvorstellbar, eine solche Entfernung zu Fuß zurückzulegen. Aber wenn der Wind bläst wie an diesem Tag, traut sich niemand aufs Wasser. Er hatte laufen müssen, um mich zu sehen. Ich fand das schön.
Wir unterhielten uns und schafften es mit großer Mühe, uns zu verständigen. Seine natürliche Freundlichkeit gefiel mir sofort. Thomas erklärte mir, dass er die Rivière à la Chasse hinaufgefahren war, weil er den Trappgänsen gefolgt war.
»Magst du Trappgänse?«
Ich hatte nie welche gegessen.
»Mein Onkel jagt nicht. Er bestellt sein Land. Schmeckt es gut?«
Einen Augenblick wirkte er verwirrt.
»Schmeckt es wie Huhn?«
Er zuckte die Achseln, dann fügte er hinzu: »Nie Huhn gegessen.«
Wir brachen in Gelächter aus.
»Dein Zuhause ist Pointe-Bleue?«
»Ja und nein.«
Er wiegte den Kopf hin und her, während er danach suchte, wie er seine Gedanken in meiner Sprache ausdrücken konnte.
»Pointe-Bleue ist, wo wir den Sommer verbringen. Und wo wir die Felle im Geschäft der Hudson Bay verkaufen. Mein Zuhause ist dort.«
Er streckte seine Hand in nordöstliche Richtung aus.
»Du wohnst auf dem See?«
Ich lachte, und sein Gesicht verfinsterte sich. Ich hatte Angst, ihn verärgert zu haben.
»Das war ein blöder Witz. Tut mir leid.«
Diese Intensität, die ich hinter seiner Schüchternheit spürte, verwirrte mich.
»Zuhause«, fuhr er fort, »ist auf der anderen Seite von Pekuakami.«
Pekuakami. Ich hatte noch nie gehört, dass der Lac Saint-Jean so genannt wurde. Ich mochte dieses Wort sofort.
»Auf der anderen Seite gibt es den Fluss Péribonka und weiter oben den See, der genauso heißt. Es gibt unüberwindliche Wasserfälle, die Passes-Dangereuses. Das ist mein Zuhause.«
Thomas beschwor mit seinen stockenden Worten eine unbekannte Welt. Und das Bild dieses ungestümen Flusses, der durch den Wald floss, faszinierte mich.
Beim Abendessen fragte ich meinen Onkel, was es auf der anderen Seite des Lac Saint-Jean gäbe.
»Nichts. Es gibt dort nichts. Nur Wald und Fliegen.«
»Kennst du den Fluss Péribonka?«
»Ich habe ihn nie gesehen, aber es heißt, er sei ein großer Fluss. Da oben gibt es keine Siedler. Das ist weit weg.«
»Und die Passes-Dangereuses? Sagt dir das was?«
Mein Onkel dachte einen Augenblick nach, während er seinen Bart strich.
»Nein. Nie davon gehört.«
Als ich an dem Abend schlafen ging, hatte ich den Kopf voll von Bildern endloser Wälder, die die Berge bedeckten, und in der Ferne hörte ich das Grollen der bedrohlichen Wasserfälle.
Am nächsten Tag legte Thomas an und zog sein Boot auf das Ufer. Mit einem Vogel in seiner rechten Hand kletterte er mit langsamem und sicherem Schritt den Hügel hinauf. Bei ihm gab es keine Eile.
»Hier, nishk. Du wirst mir sagen können, ob du es magst.«
Mein Herz weitete sich. Ich hatte noch nie ein Geschenk bekommen.
»Danke, Thomas. Das ist wirklich nett von dir. Das musstest du nicht.«
Er lächelte.
»Nishk ist dieses Jahr spät dran. Der Winter ist lang gewesen.«
Ich betrachtete seine Gesichtszüge, sein ovales Gesicht mit den hervorspringenden Wangenknochen. Seine Augen, die eng beieinanderliegende Schlitze waren, gaben ihm einen eindringlichen Blick, und seine fleischige Unterlippe verlieh seinem Mund eine gewisse Sinnlichkeit. Er war größer als ich mit seinen breiten und kräftigen Schultern, sehr dichtem schwarzem Haar und einer glatten, dunklen Haut.
»Du? Hast du gejagt?«
»Nein. Ich weiß nicht, ob ich ein Tier töten könnte.«
»Magst du Fleisch?«
»Natürlich. Ich weiß. Das ergibt keinen Sinn.«
»Ich töte niemals zum Vergnügen. Immer zum Essen.«
Er nahm die Trappe in seine Hände und glättete die zerzausten Federn.
»Nishk gibt ihr Leben. Man darf nur nehmen, was man braucht.«
Diese mit einfachen Worten ausgedrückte Weisheit zeugte von Thomas’ Güte und Großherzigkeit.
Als ich mit der riesigen Trappgans nach Hause kam, riss meine Tante die Augen auf.
»Was ist das, Manda?«
»Ein Huhn.«
»Wo hast du das her, Tochter?«
»Ich habe sie im Flug gefangen, mit meinen Händen. So.«
Ich machte Anstalten zu springen und streckte die Arme zum Himmel aus. Meine Tante blickte mich streng an.
»Man hat es mir gegeben.«
Sie stemmte die Hände in die Hüften.
»Ein Indianer hat es mir gegeben. Er ist schon ein paar Mal im Kanu an der Weide vorbeigefahren auf der Rückkehr von der Jagd.«
»Ein Indianer hat dir eine Trappgans gegeben?«
»Ja, Tante, er ist nett. Er hatte ganz viele. Das ist mal was anderes als die ewige Galette.«
Sie nahm den Vogel, trug ihn in die Küche und fing sofort an, ihn zu rupfen.
»Du hast recht, Manda. Dein Onkel wird sich freuen. So eine Trappgans schmeckt gut.«
Es mangelte uns oft an Fleisch, vor allem im Sommer, wo man es salzen und in Fässern lagern musste, um es zu konservieren. Thomas’ Geschenk kam gerade recht. Es verbreitete einen Geruch nach Fest in unserer verräucherten Hütte. Weder meine Tante noch mein Onkel stellten mir Fragen über ihn.
In den folgenden Tagen kam Thomas jeden Abend zur Weide. Meist mit dem Kanu, manchmal zu Fuß, wenn die Umstände es erforderten. Er erzählte mir von seinem Land und ich ihm vom Leben im Dorf und von der Schule, die er nie besucht hatte. Er versuchte, mir ein paar Worte seiner Sprache beizubringen, aber ich war keine gute Schülerin, und das brachte ihn zum Lachen.
Sein Französisch verbesserte sich ebenso wenig wie mein Innu, aber er erklärte mir geduldig seine Welt. Die Wanderung mit der Familie zu ihrem Gebiet am Péribonka, das für den Winter im Wald errichtete Lager und die Karibujagden in der großen Ebene des Nordens. Und all die Arbeit, die nötig war, um das Fleisch und die Felle der Tiere zu konservieren und zu lagern. Es gab auch die Abende am Lagerfeuer, wo die Alten die Legenden erzählten, die die Kinder amüsierten und bildeten. Im Frühjahr schließlich der Abstieg zum See und das Wiedersehen mit denen, die wie sie lange Monate im Wald verbracht hatten.