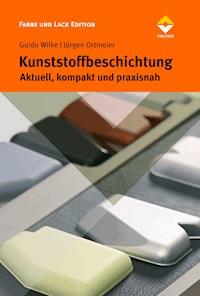
149,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Vincentz Network
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: Farbe und Lack Edition
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Das Buch von Guido Wilke und Jürgen Ortmeier stellt klassische und moderne organische Beschichtungstechnologien für Kunststoffe vor und widmet sich dem Zusammenwirken von Substrat und Beschichtung sowie den dabei auftretenden Wechselwirkungen, Eigenschaftsbildern und Funktionen. Ferner werden die wichtigsten spezifischen Basiseigenschaften der Kunststofferzeugnisse und Beschichtungsfehler behandelt. Dem Entwickler von Kunststofflacken, dem Mitarbeiter im technischen Service von Lack- und Rohstoffherstellern, und dem Lackierer von Kunststoffteilen vermittelt es das notwendige Wissen der Fakten und das Verständnis für die Zusammenhänge, welches zur erfolgreichen Beschichtung von Kunststoffen notwendig ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 209
Ähnliche
Vincentz Network GmbH & Co KG
Guido Wilke und Jürgen Ortmeier
Kunststoffbeschichtung
Aktuell, kompakt und praxisnah
Cover: Karl Wörwag Lack- und Farbenfabrik GmbH & Co. KG
Bibliographische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Guido Wilke und Jürgen Ortmeier
Kunststoffbeschichtung: aktuell, kompakt und praxisnah
Hannover: Vincentz Network, 2009
(FARBE UND LACK EDITION)
ISBN 3-86630-817-5
ISBN 978-3-86630-817-6
© 2009 Vincentz Network GmbH & Co. KG, Hannover
Vincentz Network, P.O. Box 6247, 30062 Hannover, Germany
Das Werk einschließlich seiner Einzelbeiträge aus Abbildungen ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urhebergesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar.
Dies gilt insbesondere für die Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Das Verlagsverzeichnis schickt Ihnen gern:
Vincentz Network, Plathnerstr. 4c, 30175 Hannover, Germany
Tel. +49 511 9910-033, Fax +49 511 9910-029
E-mail: [email protected], www.farbeundlack.de
Satz: Vincentz Network, Hannover, Germany
ISBN 3-86630-817-5
ISBN 978-3-86630-817-6
eBook-Herstellung und Auslieferung: readbox publishing, Dortmundwww.readbox.net
Farbe und Lack Edition
Guido Wilke und Jürgen Ortmeier
Kunststoffbeschichtung
Aktuell, kompakt und praxisnah
Auf ein Wort
In der Lackindustrie finden die Innovationen heute nicht mehr allein durch die Entwicklung von Beschichtungsstoffen mit spezifischen technischen Vorteilen statt, sondern in der gemeinschaftlichen Werkstückentwicklung mit den Lack verarbeitenden Kunden und den Endanwendern.
Ein Beispiel ist die Entwicklung der Außenhaut von Automobilen. Hier ist der Kunststoffanteil in der Vergangenheit kontinuierlich gestiegen. Waren in den Siebziger Jahren Kunststoffteile noch als solche erkennbar, so gibt es mittlerweile an Kraftfahrzeugen kaum noch Kunststoffteile, die nicht beschichtet sind.
Im gleichen Maße hat sich die Verwendung von Kunststoffen im häuslichen Bereich und bei den Gegenständen des täglichen Gebrauchs etabliert. Aus dekorativen und funktionellen Gründen sind viele dieser Oberflächen lackiert. Um das ganze Potenzial der Lackierung von Kunststoffbauteilen nutzen zu können, ist ein vertieftes Verständnis der Zusammenhänge wichtig. Dabei soll dieses Buch unterstützen.
So wie das Spektrum der Beschichtungskonzepte sich in diesem Sinne ausweitet, wird es immer weniger ausreichen, funktionsfähige Lackmaterialien für Kunststoffe im Trial and Error-Verfahren aufzufinden. Erfolgreiche Entwicklungen werden daher mehr als bisher vorangetrieben durch intensive Kooperationen der Teilnehmer aus Kunststoff-, Bauteil-, Halbzeug-, Vorbehandlungs-, lackherstellende und lackverarbeitende Industrie. Das Buch richtet sich deshalb an alle Beteiligten im Prozess der Herstellung lackierter Kunststoffteile. Dem Entwickler von Kunststofflacken, dem Mitarbeiter im technischen Service von Lack- und Rohstoffherstellern und dem Lackierer von Kunststoffteilen mag es das notwendige Wissen der Fakten und Verständnis für die Zusammenhänge vermitteln, welches zur erfolgreichen Beschichtung von Kunststoffen notwendig ist.
Dekorativ beschichtete Bauteile und Halbzeuge aus Kunststoff sind geometrisch definierte Kunststoff-Verbundsysteme. Die Applikationstechnik für die Kunststoffbeschichtung wird in diesem Buch bewusst knapp gehalten. Schwerpunkte des Buches bilden zunächst der in der Kunststofflackierung nicht zu unterschätzende materialtechnische Überblick inklusive der Kunststoffvorbehandlung; dann die Eigenschaften und Funktionen von Kunststoffen und Beschichtungsmaterialien, schließlich ihre gegenseitige Zuordnung und ihr Zusammenwirken. Zur Abrundung sollen die wichtigsten spezifischen Basiseigenschaften der beschichteten Kunststofferzeugnisse und Beschichtungsfehler behandelt werden.
Esslingen und Stuttgart, im März 2009
Dr. Guido Wilke und Jürgen Ortmeier
Vorbemerkung zu den Rezepturen
Die ausgewählten Rezepturen stellen repräsentative Beispiele für die jeweiligen Anwendungen dar und sind aus den Empfehlungen von Rohstoffherstellern oder der Patentliteratur entnommen. Sind keine Rezepturen angegeben, so hat sich unter Umständen noch kein repräsentativer Stand der Technik etabliert. Die Rezepturen können nicht ohne eigene Prüfung und Weiterentwicklung übernommen werden. Jegliche Haftung aus Beratung wird hiermit ausgeschlossen. Einschränkungen durch Schutzrechte können nicht ausgeschlossen werden. Auf Markenzeichen (z.B. ® oder ™) wird nicht ausdrücklich hingewiesen. Markennamen und Bezugsquellen sind Veränderungen unterworfen.
Inhaltsverzeichnis
1Einleitung
1.1Historie und Marktentwicklung
1.2Aufgaben von Beschichtungen auf Kunststoff
1.2.1Schutz
1.2.2Dekoration
1.2.3Spezielle Eigenschaften
1.3Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft
1.3.1Erhöhen der Prozesssicherheit
1.3.2Emissionsarme Lacke
1.3.3Wirtschaftlichkeit
1.3.4Design
2Kunststoff in der Beschichtungstechnik
2.1Allgemeines zu Kunststoffen
2.1.1Klassifizierung nach technischen Kriterien
2.1.2Ökonomische und beschichtungstechnische Bedeutung
2.1.3Ursachen für die wachsende Bedeutung von Kunststoff
2.1.3.1Ökonomische und ökologische Aspekte
2.1.3.2Technik und Design
2.2Werkstoffeigenschaften
2.2.1Mechanisches Verhalten
2.2.2Thermisches Verhalten
2.2.3Löslichkeit und Quellbarkeit von Kunststoffen
2.2.4Elektrische Eigenschaften
2.2.5Oberflächeneigenschaften
2.2.5.1Oberflächenstruktur
2.2.5.2Oberflächenspannung
2.3Kunststoffe erfolgreich beschichten
2.3.1Allgemeines
2.3.2Substrateinflüsse
2.3.3Einfluss von Kunststoffverarbeitung,
2.3.3.1Ursache und Wirkungszusammenhänge
2.3.3.2Tipps
3Vorbehandlung von Kunststoffoberflächen
3.1Reinigung
3.2Aktivierung
3.2.1Wirkungsweise der Aktivierung
3.2.2Analytik der Aktivierung
3.2.3Aktivierungsverfahren
3.2.3.1Beflammung
3.2.3.2Prinzipien der Plasmabehandlung
3.2.3.3Plasmabehandlung bei Niederdruck
3.2.3.4Plasmabehandlung bei Atmosphärendruck
3.2.3.5Gasphasenfluorierung
3.2.3.6Weitere Verfahren
4Beschichtungsmaterialien
4.1Industrielle Kunststofflackierung
4.2Haftvermittler
4.3Grundierungen, Primer, Füller
4.4Decklacke und Einschichtlacke
4.4.1Filmbildner für Decklacke
4.4.2Pigmente und Füllstoffe
4.4.3Additive für Deck- und Einschichtlacke
4.5Basislacke
4.5.1Lösemittelhaltige Basislacke
4.5.2Wasserbasislacke
4.5.2.1Filmbildner für Hydrobasislacke
4.5.2.2Rheologiesteuerung von Hydrobasislacken
4.5.2.3Effektpigmente für Hydrobasislacke
4.6Klarlacke für die Kunststofflackierung
4.6.1Eigenschaftsprofil von Klarlacken
4.6.1.1Härte, Kratzfestigkeit, Schleif- und Polierbarkeit
4.6.1.2Chemikalienbeständigkeit
4.6.1.3Bewitterungsbeständigkeit
4.6.2Formulierung von Klarlacken
4.6.2.2Wässrige Klarlacksysteme
4.6.2.3UV-Klarlacke
4.6.2.4Nanoklarlacke
4.7Softfeel-Lacke
4.8IMC-Lacke
4.8.1IMC-Slush-Verfahren
4.8.2SMC-IMC
4.8.3High-Pressure-IMC
4.9Lackfolien
4.10Pulverlacke
5Applikation
5.1Zerstäubungsverfahren
5.2Lackierprozesse
5.2.1Flächenspritzautomaten
5.2.2Großlackieranlagen
6Beschichtungen auf Kunststoff
6.1Allgemeines
6.2Haftung
6.2.1Versagensarten
6.2.2Adhäonstheorien und -mechanismen
6.2.3Haftfestigkeit
6.2.3.1Qualitative Prüfverfahren
6.2.3.2Quantitative Prüfverfahren
6.3Mechanisch-technologische Eigenschaften
6.3.1Elastizität bei Stoß- und Schlagbeanspruchung
6.3.2Härte, Abriebfestigkeit und Kratzbeständigkeit
6.3.3Chemikalien- und Wetterbeständigkeit
7Fehler erkennen und vermeiden
7.1Einschlüsse/Verunreinigungen
7.1.1Einschlussarten
7.1.2Einschlussanalyse
7.1.3Blasenbildung
7.1.4Mikroblasen
7.1.5Benetzungsstörungen
7.2Störungen der Wechselwirkungen im Gesamtaufbau
7.2.1Lackenthaftung
7.2.2Rissbildung
7.2.3Runzelbildung
7.3Verlaufsstörungen
7.3.1Orangenschaleneffekt
7.3.2Läuferbildung
7.3.3Substratmarkierungen
7.4Farbton-, Effekt- und Glanzabweichungen
7.5Checkliste für Reklamationen
Lebensläufe
Index
Marktübersicht
1Einleitung
1.1Historie und Marktentwicklung
Beginnend mit der Beschichtung von Fernsehgehäusen, Sportgeräten, Automobil-Heckspoilern und Kleiderknöpfen in den 60er und 70er Jahren des 20ten Jahrhunderts hat sich das Beschichten von Kunststoffen nach dem Überstehen ihrer Kinderkrankheiten zu einer ausgereiften Technik entwickelt. Als Verfahren zur Oberflächenveredelung und -dekoration ist die Kunststofflackierung besonders fest etabliert. Wegweisend hierfür war und ist vor allem die Entwicklung im Automobilbau. Nahezu alle sichtbaren Kunststoffbauteile eines Autos werden heute beschichtet, wobei neben der Lackierung auch die Metallisierung von Bedeutung ist. Am aktuellen Entwicklungsstand der Kunststoffbeschichtung waren spezifische Innovationen und Anpassungen in verschiedenen Segmenten der Fertigungstechnik für Bauteile beteiligt. Hierzu gehören die Verarbeitung von Kunststoffen zu beschichtbaren Formteilen, die an Kunststoffbauteile adaptierte Lack-Applikationstechnik und schließlich auch die Entwicklung von speziell auf Kunststoffen haftenden Beschichtungssystemen. Anfänglich dominierten hier lösemittelhaltige Materialien, doch eroberten sich emissionsarme Systeme allmählich ihren Platz. So ist beispielsweise die Beschichtung großflächiger Karosserieanbauteile mit Wasserlacken im Karosserie identischen Farbton und Effekt heute Stand der Technik. Die Fortschritte in der Kunststoffbeschichtung sind nicht auf das Automobil beschränkt (Tabelle 1.1).
Tabelle 1.1: Anwendungsgebiete und -beispiele für die Kunststoffbeschichtung
Branche
Beispiele
Fahrzeug: Kfz, LKW, Nfz
Stoßfänger, Spiegelgehäuse
Elektronik
Mobiltelefone, Computergehäuse, TV-Geräte, Elektrogeräte
Haushaltsgeräte
Waschmaschinen
Medizin
Brillengläser, Aseptic Packaging
Informationstechnologie
CDs, Magnetbänder, Chipkarten
Verpackung
Lebensmittelbehälter, Folien
Bauwirtschaft
Bodenbeläge, Fensterrahmen, Türen, Möbel
Sport
Ski, Bootsbau, Sportbrillen, Rennwagen
Verlässliche und detaillierte Daten über den Markt für Kunststoffbeschichtungssysteme sind kaum publiziert. Die Abbildungen 1.1 und 1.2 stellen die Branchenaufteilung des Marktes für Kunststofflacke in Nordamerika und Deutschland dar.
Abbildung 1.1: Markt für Kunststofflacke in Nordamerika (Quelle: The ChemQuestGroup [1])
Abbildung 1.2: Markt für Kunststofflacke in Deutschland (Quelle: Jahresbericht 2005/2006; Verband der deutschen Lackindustrie, aus [2])
1.2Aufgaben von Beschichtungen auf Kunststoff
Die Aufgaben von Beschichtungen auf Kunststoff lassen sich in drei Gruppen zusammenfassen: Schutz, Dekoration und spezielle Eigenschaften.
1.2.1Schutz
Die meisten Kunststoffe sind nicht bewitterungsstabil. Das Aussehen ihrer Oberfläche verschlechtert sich im Laufe der Zeit bedingt durch das komplexe Zusammenspiel klimatischer Faktoren wie UV-Licht, Sauerstoff, diverser anderer Schadstoffe sowie Schwankungen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Lackschichten, die mit UV-Absorbern und Radikalfängern ausgerüstet sind, helfen Kunststoffen diese Belastungen schadlos zu überstehen, ohne dass die gesamte Substratmasse mit den teuren Lichtschutzmitteln ausgerüstet werden muss.
Viele thermoplastische Kunststoffe haben eine nur eingeschränkte Beständigkeit gegen Abrieb, Verkratzung, Lösemittel- und Chemikalieneinwirkung. Bedruckte und metallisierte Kunststoffe werden oft durch eine Lackschicht gegen Abrieb und Korrosion geschützt. Beschichtungen aus polymeren Netzwerken verleihen den betroffenen Teilen die erforderlichen Chemikalienbeständigkeiten und Härte. Einwandfreie Haftung der Beschichtung vor und nach Alterung, Bewitterung, mechanischer Beanspruchung und Medienbelastung ist für die Aufrechterhaltung ihrer Schutzfunktion eine notwendige, von den Endabnehmern lackierter Kunststoffartikel verlangte Voraussetzung.
Bei Kunststoffen handelt es sich um mechanisch ganz unterschiedlich beschaffene Werkstoffe. Eine Lackierung kann unter anderem nur dann haften, wenn sie der Flexibilität des Substrates einigermaßen angepasst ist, was sich mittlerweile dank einer genügend großen Auswahl maßgeschneiderter Bindemittel in der Regel gut realisieren lässt.
Der Stellenwert der Schutzfunktion spiegelt sich in aktuellen Entwicklungstrends wider:
•Einen Schwerpunkt der Entwicklung moderner Beschichtungsstoffe bilden Hybridmaterialien aus organischen Polymeren, die mit anorganischen Komponenten oder nano-skalierten Füllstoffen modifiziert sind. Mit derartig keramisch modifizierten organischen Schichten lassen sich die Vorteile anorganischer Hartstoffe mit denjenigen organischer Polymere nahezu beliebig kombinieren und zur hochwertigen, schützenden Veredelung von Kunststoffoberflächen ideal nutzen.
•UV-gehärtete kratzfeste Beschichtungen auf Kunststoffen wie Polycarbonat und Plexiglas sind seit langem Stand der Technik. Neben der Möglichkeit auf Lösemittel ganz zu verzichten bietet die UV-Härtung einige prozesstechnischen Vorteile wie die Schnelligkeit der Härtung und einen geringen Platzbedarf für die notwendigen Anlagen.
1.2.2Dekoration
Mit beeindruckender Vielfalt werden Kunststoffbauteile heute farbig, matt wie glänzend und mit Effekt lackiert. Die farbige Dekoration von Mobiltelefonen bringt dies ebenso zum Ausdruck wie das Automobil, bei dem der Laie keinen coloristischen Unterschied mehr erkennt zwischen Anbauteil und restlicher Karosse. Diese als selbstverständlich hingenommene Farbtonübereinstimmung muss jedoch immer wieder neu erarbeitet werden. Während das Beschichten mit pigmentierten Lacken die Kaschierung der Naturfarbe eines Kunststoffteils ermöglicht, verwendet man zur Erhöhung des Glanzgrades von massegefärbten Kunststoffteilen lediglich Klarlacke.
Die Tatsache, dass Kunststoffformteile überhaupt hochwertig lackiert werden können, ist das Ergebnis langjähriger Bemühungen, Kunststoffe in einen lackierfähigen Zustand zu überführen. Bei der Kunststoffverarbeitung zu Formteilen wird längst nicht immer eine Class A-Oberfläche erzielt. So ist es bei problematischen Substraten erforderlich, zunächst Oberflächenfehler zu beseitigen, bevor die eigentlich dekorative Beschichtung aufgebracht werden kann.
Bei thermoplastischen Spritzgussteilen markieren sich vorhandene Fließlinien und Bindenähte durch eine dekorative Lackschicht hindurch. So genannte Lunker und andere Fehlstellen von Langfaser verstärkten Duroplasten gehören ebenfalls egalisiert. Bauteile aus verstärkten Thermoplasten wie Polyamid weisen häufig infolge herausstehender Kurzfasern eine zu hohe Rauigkeit auf. Die Glättung der Oberfläche wird mit Hilfe von speziellen Grundierungen bzw. Spachteln erreicht.
1.2.3Spezielle Eigenschaften
Neben den schützenden und dekorativen Aufgaben gibt es andere, an speziellen Anforderungen ausgerichtete Funktionen, die mit der Beschichtung von Kunststoffen erreicht werden sollen. Einige klassische Beispiele seien hier aufgezählt.
•Schaffen einer Diffusionsbarriere bei Folien für die Verpackung gegenüber Inhaltsstoffen der Kunststoffe, des Verpackungsgutes und hinein dringende Gase und Flüssigkeiten
•Herbeiführen der Metallbedampfbarkeit von Kunststoffoberflächen (Scheinwerferreflektoren)
•Erzeugen von Oberflächen mit spezifischen haptischen Eigenschaften (Autoinnenraumverkleidung)
•Absorbieren oder Reflektieren bestimmter elektromagnetischer Wellen (Flugzeuge, Militärfahrzeuge)
•Reduzieren der Gleitreibung bei Scheibenwischergummis
Die Beschichtungstechnik kann auch dazu genutzt werden, ein Kunststoffteil mit Eigenschaften auszustatten, welche es aufgrund seiner chemischen Zusammensetzung nicht aufweist. Elektrisch und magnetisch leitfähige Beschichtungen schaffen diese Zusatzeigenschaften, ohne dass die gesamte Kunststoffmasse modifiziert werden muss.
Moderne funktionelle Beschichtungen, wie sie zurzeit im Trend sind, lassen sich grundsätzlich auch auf Kunststoff realisieren. So verwendet man intrinsisch leitfähige Polymere für antistatische Beschichtungen von Kunststofffolien in der Elektronikverpackung [3]. Die Flexibilität elektrisch leitfähiger Polymere ermöglicht es, Elektronik direkt in Kleidung und Verpackung zu integrieren. Hierzu werden die Polymere zur Bedruckung von Folien mit elektrischen Schaltkreisen und Strichcodes eingesetzt [4].
1.3Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft
1.3.1Erhöhen der Prozesssicherheit
Die Komplexizität der Kunststoffbeschichtung bringt es mit sich, dass die Ursachen für Qualitätsmängel bei beschichteten Bauteilen gleichermaßen in allen Einflussfeldern, d.h. Substrat, Verarbeitung, Vorbehandlung, Lackmaterial und Applikationstechnik zu finden sind. Generell werden intensive Anstrengungen unternommen, die Nachbesserungsquote zu reduzieren und zu einer höheren First-Run-i.O.-Quote zu kommen.
Bei faserverstärkten Kunststoffen sind substratbedingte Lackierfehler ein besonders häufiges Qualitätsproblem. So neigt der Werkstoff SMC (Sheet Molding Compound) zu Ausgasungen, die sich besonders an den Kanten der Bauteile durch Blasen, Kocher bzw. Nadelstiche bemerkbar machen. Bei einer Lackierung berücksichtigt man dieses Werkstoffverhalten, indem man die thermische Belastung soweit reduziert, dass Entgasungen minimiert werden. Dies erfordert entweder lange Trocknungszeiten oder alternative Trocknungskonzepte, deren Prozessfähigkeit unter seriellen Produktionsbedingungen umfassend geprüft werden muss.
Dauerbrennerthema bei der Automobillackierung ist die Farbtonübereinstimmung der Anbauteile aus Kunststoff mit der Karosserie. Durch die Einschränkung der zulässigen Farbquadranten, den Einsatz der Farbmetrik und die Angleichung der Applikationstechnik von Anbauteil und Karosse, sind hier gerade in den letzten Jahren deutliche Fortschritte erzielt worden. Eine weitere Option ist die Vereinheitlichung von Basislack-Chargen und Karosse/Anbauteil. Die Tragfähigkeit der bestehenden Konzepte zur Farbtonübereinstimmung wird jedoch mit jedem neu einzuführenden Effekt-Farbton neu auf die Probe gestellt.
Bei den technischen Beschichtungseigenschaften ist das Grundproblem der Haftung weder für alle Substrate gelöst noch wissenschaftlich verstanden. Größte Herausforderung ist die Sicherstellung der Lackhaftung auf den sich im Markt immer mehr durchsetzenden Polyolefinen. Die im Bereich der Automobilserienlackierung schon lange erhobene Forderung nach Kratzbeständigkeit hat sich inzwischen auch im Bereich der Anbauteilelackierung etabliert.
1.3.2Emissionsarme Lacke
Die Einführung der Wasserlacktechnologie mitsamt angepasster Applikations- und Anlagentechnik ist in größeren Firmen vielerorts gut umgesetzt. Die Umstellung von konventionellen, lösemittelbasierten auf emissionsreduzierte Klarlacke ist eine Aufgabe, die in vielen Anwendungen noch gelöst werden muss. Neben Hydroklarlacken sind hier UV-härtende Lacke eine Lösungsoption. Die Materialentwicklung hat für beide Technologien das Grundlagenstadium verlassen und erprobt sich seit geraumer Zeit mit je nach Einsatzgebiet unterschiedlich gutem Erfolg im Markt. Die Pulverlackierung ist derzeit nur für solche Kunststoffe ein Thema, welche die vergleichsweise hohen Lackhärtungstemperaturen schadlos überstehen. In den marktdominierenden Branchen wie der Automobilzuliefererindustrie werden Pulverlacke auf absehbare Zeit nicht die klassischen Nasslacke ersetzen.
1.3.3Wirtschaftlichkeit
Ein sehr einfacher Weg Beschichtungskosten einzusparen wird bei der Lackierung von Automobilanbauteilen dadurch beschritten, dass man die Anzahl der Lackschichten im Gesamtaufbau reduziert. Positive Erfahrungen liegen auf dem Feld der primerfreien (grundierungsfreien) Lackierung von Fahrzeuganbauteilen vor. Diese Vorgehensweise erfordert jedoch unter anderem eine hohe Oberflächenqualität des Substrates, so dass in vielen Fällen, beispielsweise beim Einsatz von mit Glasfasern hochgefüllten Kunststoffen, nicht auf den Primer (Grundierung) verzichtet werden kann. Bei manchen Lackierprozessen von Stoßfängerverkleidungen sind die substratseitigen Anforderungen erfüllt, so dass lediglich Zweischichtaufbauten aus Hydrobasislack und Klarlack zum Einsatz kommen. In anderen Fällen kommt man aus Gründen der Farbtonübereinstimmung wegen der Substratgrundfarbe und des begrenzten Deckvermögens mancher Basislacke nicht ohne farbigen Primer (Grundierung) aus.
Der Verzicht auf Lackschichten ist in extremster Ausprägung durch die Lackierung von eingefärbten Kunststoffteilen mit Klarlack praktiziert worden. Sehr elegant können auf diese Weise einfache Unifarben realisiert werden, wie dies bei den Body Panels des SMART praktiziert wird.
Die Umsetzung für Effektfarbtöne wäre Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen und auf andere Modelle erweiterten Einsatz. Doch sieht sich die Massefärbung hier mit dem Anspruch konfrontiert, eine zielgerichtete Effektgebung und einwandfreie Farbtonübereinstimmung mit dem Rest einer konventionell lackierten Karosserie zu ermöglichen. Da die Pigmentierung der Substratmasse naturgemäß nicht zu einer der Spritzlackierung äquivalenten Ausrichtung von Effektpigmenten führt, hat sich die Massefärbung mit zusätzlicher Klacklackierung bisher noch nicht als Konzept für die Beschichtung von Fahrzeuganbauteilen durchsetzen können.
Eine ganz andere Richtung auf der Suche nach Alternativen für die Lackierung verfolgt die Folientechnologie. Besonders in Verbindung mit der Möglichkeit, mehrere Fahrzeugbauteile zu Modulen zusammenzufassen und außerhalb der Fertigungsstraße der Karosserie separat fertigen zu lassen, verspricht die Folientechnologie eine deutliche Reduktion der Fertigungstiefe und damit Prozesskosten. Es existiert mittlerweile eine ganze Reihe von Folienkonzepten, die alle im Kapitel 4 behandelt werden, und teilweise über Pilotprojekte bereits Eingang in den Markt gefunden haben. Die Anwendungen beschränken sich zurzeit auf den Bereich großflächiger Anbauteile mit mäßig komplexer Geometrie. Eine typische und geeignete Lokalisation für Folienkonzepte ist das Fahrzeugdach, welches sich in starre und bewegliche, deckende und transparente Module aufteilen lässt. Man hofft und erwartet, dass die Folientechnologie ihre derzeitigen technischen Herausforderungen meistern wird und sich weiter verbreiten wird.
1.3.4Design
Ein im Markt zurzeit allgemein beobachteter starker Trend ist die Individualisierung. Als Triebkraft für das derzeitige Wachstum des Kunststofflackmarktes wird der Wunsch nach Farbe und Effekt angesehen, vor allem bei Fahrzeugen. Auch in Sektoren wie der Elektronik, besonders für Mobiltelefone, spiegelt sich der Trend zur Individualisierung durch persönliches Farbdesign wieder. Ein individuelles Farbdesign kann heute am besten durch eine anspruchsvolle Lackiertechnik realisiert werden. Besonders deutlich wird dies bei Beschichtungen mit Perleffekt, die nur im Zusammenwirken von Lackmaterial und Applikationsprozess ihre optischen Eigenschaften wie z.B. Flop-Effekte voll entfalten können.
Ein Gebiet, in welchem der Trend zu Personalisierung sich besonders stark ausprägen lässt, ist die Automobil-Innenlackierung. Die unterschiedlichsten Wünsche von einzelnen Kundengruppen lassen sich am besten mit vielen Materialien befriedigen, Kunststoffe, Leder und Textilmaterialien müssen sich farblich einander anpassen. Eine Lackierung von Innenraumteilen ist deshalb erforderlich, weil sich nur hierüber die größte Flexibilität in der Ausdifferenzierung der optischen Gestaltung vornehmen lässt. Eine große Breite an unterschiedlichen Farben im Automobil-Innenraum ist nur mit Kunststofflacken zu bewerkstelligen, allerdings haben auch innovative Folienkonzepte wie Insert Film Molding (IFM) ihren Platz gefunden. Durch das Hinterspritzen einer transparenten Folie, die mit einer Elektrolumineszenzschicht bedruckt ist, lassen sich dreidimensionale Kunststoffteile herstellen, die beim Anlegen einer Wechselspannung über die gesamte Fläche leuchten [5].
Ganz allgemein wird den schaltbaren Beschichtungssystemen eine große Zukunft prophezeit. Es ist davon auszugehen, dass die Fortschritte in der Entwicklung schaltbarer Beschichtungssysteme sich auch in anderen Fällen derart originell mit einem Kunststoffverarbeitungsverfahren verknüpfen lassen und die Möglichkeiten zur Gestaltung wie Funktionsausübung industrieller Erzeugnisse erweitern wird.
Literaturhinweise
[1]The ChemQuestGroup, Inc., www.radtech.org/ An Overview of the North American Plastic Coatings, pdf, 2003
[2]U. Hoffmann, Journal für Oberflächentechnik (JOT) 46, 11 (2006), S. 56
[3]S. Kirchmeyer, L. Brassat, Kunststoffe 95, 10 (2005), S. 202
[4]H. Rost, Kunststoffe 95, 10 (2005), S. 209
[5]E. Foltin, G. Wießmeier, Journal für Oberflächentechnik (JOT) 3 (2004), S. 34
2Kunststoff in der Beschichtungstechnik
2.1Allgemeines zu Kunststoffen
2.1.1Klassifizierung nach technischen Kriterien
Kunststoffe lassen sich nach DIN 7724 einteilen in Thermoplaste, Elastomere und Duroplaste. Die jeweiligen charakteristischen Merkmale dieser drei Gruppen werden im Folgenden erläutert und dazu einige Beispiele mit in Klammern gesetzten international üblichen Kurzzeichen nach DIN 7728 angeführt.
Thermoplaste sind unvernetzte, mehr oder weniger lösliche und thermisch reversibel erweichbare, bzw. schmelzbare Kunststoffe. Hierzu gehören die Massenkunststoffe Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polystyrol (PS) und Polyvinylchlorid (PVC). Ebenfalls zu dieser Gruppe gehören die so genannten technischen Kunststoffe wie z.B. Polyethylenterephthalat (PET) und Polybutylenterephthalat (PBT), Polyamid (PA), Polycarbonat (PC), Polystyrol-Blends (ASA, ABS, SB, SBS) und Polymethylmethacrylat (PMMA).
Elastomere sind weitmaschig kovalent vernetzte Kunststoffe, welche oberhalb von 20 °C ein gummielastisches Verhalten zeigen. Sie sind in organischen Lösemitteln nur schwer bzw. gar nicht löslich, aber quellbar und thermisch erweichbar, jedoch nicht plastisch verformbar. Beispiele hierfür sind vernetzter Natur- und Synthesekautschuk (NR, BR), Silikonkautschuk (SI), bestimmte Polyurethane (PUR) und Fluorkautschuk (FKM).
Duroplaste sind dicht vernetzte, bei Raumtemperatur harte und spröde Kunststoffe. Sie sind in organischen Lösemitteln nicht löslich bzw. quellbar und erweichen erst ab Temperaturen oberhalb 50 °C. Im erweichten Zustand sind Duroplaste im Gegensatz zu Elastomeren nur begrenzt verformbar, weitere Temperaturerhöhung führt zu Zersetzung. Beispiele für Duroplaste sind jeweils vernetzte Epoxy- (EP), ungesättigte Polyester- (UP), Phenol- (PF), Melamin- (MF) und Harnstoffharze (UF).
Tabelle 2.1: Beispiele für Kunststoffe in der Beschichtungstechnik
Branche
Beispiele der Kunststoffe
Verpackung
PE, PP, PET
Fahrzeug
PP+EPDM, SMC, PA6-GF, PC+ABS, PUR-RRIM, PC+PBT, PPO+PA, PA+ABS
Luftfahrt
CFK (EP-CF)
Elektronik
PS, Styrol-Blends, PC, PP
Medizin
PC, PP
Informationstechnologie
PC, PVC
Bauwirtschaft
PVC, PS, EPS, PUR
Sport
GFK, CFK, PC, ABS
Abbildung 2.1: Weltweite Produktion von Kunststoffen
(Quelle: Verband Kunststofferzeugende Industrie, aus [1])
Abbildung 2.1 stellt die weltweite Marktaufteilung nach Produktionsmenge im Jahr 2004 dar und Tabelle 2.1 fasst die beschichtungstechnisch bedeutendsten Kunststoffe nach Einsatzgebieten zusammen.
2.1.2Ökonomische und beschichtungstechnische Bedeutung
Die weltweite Produktion von Kunststoffen wächst seit 50 Jahren mit durchschnittlich ca. 10 %. Im Jahre 2007 lag die produzierte Menge bei 260 Millionen Tonnen [1].
Etwa die Hälfte des Verbrauchsvolumens der Kunststoffe entfällt auf Polyolefine, von denen Polyethylen (PE) den größten Anteil einnimmt und Polypropylen (PP) wegen seiner Eignung für hochwertige und kostengünstige Massenartikel mit stark wachsender Rate (weltweit 6 % p.a.), besonders in China (12 % p.a.) verbraucht wird. Polyolefine dürften in Zukunft wegen ihres noch nicht ausgeschöpften Hightech-Potenzials, des anhaltenden Preisdrucks auf Industrieerzeugnisse und dem Zwang, das Recycling durch Reduktion der Substratvielfalt zu vereinfachen, eine eher noch wichtigere Rolle als bisher spielen. Etwa 70 % aller im Automobil eingesetzten Kunststoffe basieren auf Polypropylen [2].
Die reinen Polyolefine PE und PP sind als Substrat für Beschichtungen vor allem in der Verpakkungsbranche bedeutend. Sie werden hier vor allem als Folie im Walzverfahren mit Sperrschichten versehen bzw. als Hohlkörper bedruckt. Bei Formteilen im Automobilbau hat der elastifizierte Blend PP+EPDM (engl. TPO: Thermoplastic Polyolefines, thermoplastische Polyolefine) eine starke Position. So beträgt der Anteil an TPO bei den Kunststoffen des Automobils ca. 20 %. Beispiele für Artikel sind tiefgezogene Folien für Dashboards (Armaturenbretter oder Instrumententafeln) und spritzgegossene Stoßfängerverkleidungen. Wirtschaftlichkeit, Recyclingfähigkeit und sicherheitstechnische Vorteile (passiver Fußgängerschutz) sorgen für eine steigende Tendenz, andere übliche Kunststoffe gegen Polyolefine auszutauschen.
Das ebenfalls zu den Massenkunststoffen zählende Polyvinylchlorid (PVC) wird als Material für Fußböden auch in beschichteter Form eingesetzt wird. Die Gruppe der Polystyrole (PS) und geschäumten, expandierten Polystyrole (EPS) steht seit Jahren bezüglich der Produktionsmenge an vierter Stelle und hat seine Haupteinsatzgebiete in der Verpackungs- und Baubranche. Fernsehergehäuse aus Polystyrol gehörten zu den ersten Gegenständen aus Kunststoff, die man versucht hat, zu lackieren. Weitere Einsatzgebiete für lackiertes Polystyrol sind Hifi-Anlagen und Computer. In der Beschichtungstechnik bedeutender sind schon seit langem die elastifizierten und lackiertauglicheren Styrol-Co-Polymeren mit Butadien und Acrylnitril (ABS) sowie Acrylester-Elastomer (ASA). Sie haben sich im Consumer-Elektronikbereich und als Blend mit Polycarbonat (PC+ABS, PC+ASA) bei Automobilanbauteilen einen festen Platz erobert. Beispiele für beschichtete Teile aus diesen Substraten sind Außenspiegel, Kennzeichenblenden und Konsolen. Für online-lackierfähige Kotflügel wird ein verstärkter Blend aus ABS+PA eingesetzt.
Thermoplaste wie Polycarbonat (PC), Polybutylen- und Polyethylenterephthalat (PBT bzw. PET) und Polyamid (PA) werden als technische Kunststoffe bezeichnet. Sie gehören mit einem Gesamtproduktionsvolumen von gut 9 % am Weltmarkt zu den eher kleinen Kunststoffvertretern; ihnen werden jedoch die mit 6 bis 8,5 % höchsten Produktionswachstumsraten prognostiziert. In der Beschichtungstechnik sind sie als Substrat bereits heute weit verbreitet. So wird PC als Material für Streu- und Sichtscheiben eingesetzt, wo sie noch mit einer vor UV-Licht schützenden und kratzbeständigen Beschichtung versehen werden müssen. PBT ist vor allem als Blend mit PC im Bereich der Automobilkarosserie im Einsatz, z.B. für Lufteinlassgitter. Der Werkstoff PET wird für beschichtete Folienverbünde in den Lebensmittelverpackung (Snacks) verwendet, lackiertes Polyamid (PA) beispielsweise im Haushalt bei Waschmaschinen. Glasfaserverstärkte Polyamide kommen vor allem für Werkzeuggehäuse, Autotürgriffe, Heckgriffleisten und Radblenden zum Einsatz. Eine wichtige Position hat auch der Blend von PA mit dem wärmeformstabileren Poly-phenylenoxid (PPO) für Kotflügel. Für großflächige Fahrzeug- und Luftfahrzeugbauteile aus Kunststoff sowie für Bootsrümpfe werden sonst jedoch vornehmlich duroplastische, faserverstärkte Kunststoffe eingesetzt. Solche Faserverbundwerkstoffe (FVK) können aus gehärteten ungesättigten Polyester- (UP) bzw. Epoxidharzen (EP) und Glasfasern (GF) oder Carbonfaser (CF) bestehen und tragen entsprechend die Kennzeichen GFK und CFK. Eine im Automobilbau für großflächige Anbauteile besonders wichtige Variante glasfaserverstärkter Kunststoffe ist das SMC (Sheet Molding Compound), welches aus einer zu einer Rolle aufgewickelten UP-Harzgetränkten Glasfasermatte besteht, in die neben dem Reaktionsmittel, Füllstoffe, Verdickungsmittel und weitere Additive eingearbeitet sind. Nach dem Zuschnitt erfolgt das Einlegen, die Aushärtung und Formgebung in beheizbaren Pressformen.
Polyurethane werden ebenfalls als Beschichtungssubstrat eingesetzt. Durch Reaktion in der Form kommt man zu Bauteilen aus PUR-RIM (Reaction-Injection-Moulding), bzw. in der verstärkten Version zu PUR-RRIM (zusätzliches R steht für reinforced). Aus dieser Werkstoffgruppe fertigt man z.B. Front-, Seiten- bzw. Längsträgerverkleidungen für Fahrzeuge.
Eine aktuelle Richtung der polymeren Werkstoffforschung sind Nanokomposite. Das extrem große Oberflächen-/Volumenverhältnis von Nanopartikeln verspricht gegenüber normal skalierten Partikeln sprunghaft veränderte physikalische Eigenschaften. Neben Sol-Gel-Materialien werden zur Verstärkung von Kunststoffen nanoskalierte Füllstoffe, Carbon-Nanoröhren und Nanoschichtsilikate eingesetzt [3].
2.1.3Ursachen für die wachsende Bedeutung von Kunststoff
Warum ist Kunststoff zu einem interessanten Werkstoff für Industrie- und Konsumgüter geworden? Die hierfür verantwortlichen Ursachen lassen sich wie folgt zusammenfassen:
2.1.3.1Ökonomische und ökologische Aspekte
In der Diskussion über Gewichtsreduktion und der Reduktion des Kraftstoffverbrauchs von Fahrzeugen und Flugzeugen spricht aufgrund der geringen Dichte viel für Kunststoff. Gegenüber Eisen mit einer Dichte von 7,873 g/cm3 erscheinen Polyolefine mit durchschnittlichen Dichten von kaum 1 g/cm3 als wahre Fliegengewichte und haben damit auch größeres Leichtbaupotenzial als Aluminium (2,7 g/cm3). Noch geringere Dichten weisen Schäume auf. Verstärkungsmittel wie Glasfasern bewirken hingegen eine Erhöhung der Dichte. Um die Möglichkeiten der Gewichtsreduktion weitestgehend auszunutzen, bietet sich der Einsatz leichter Carbonfasern an, was im Flugzeugbau zunehmend, im Automobilbau hingegen weniger genutzt wird. Für den Automobilbau haben Erfahrungswerte im Durchschnitt ergeben, dass eine Gewichtsreduktion von 10 % einer Reduktion des Kraftstoffverbrauchs um 7 % entspricht [4]. Der Anteil von Kunststoff am Auto liegt heute durchschnittlich bei etwa 15 %, aufgeteilt in Exterieur, Interieur, under the Hood und Chassis [5].
Für die Fertigung eines Teils aus Kunststoff wird im Durchschnitt eine deutlich geringere Masse Kunststoff benötigt als für ein Teil gleichen Volumens aus Stahl. Für die Herstellung eines Liters Polypropylen werden im Durchschnitt etwa 1,2 Liter Erdöl benötigt; für dieselbe Volumenmenge Eisen acht Liter und für einen Liter Aluminium gar 15 Liter Erdöl. Zwar ist Erdöl die zurzeit einzig genutzte Rohstoffquelle für die Herstellung von Kunststoffen, aber grundsätzlich kann jede Kohlenstoffquelle genutzt werden, auch Kalk oder Kohlendioxid [6].





























