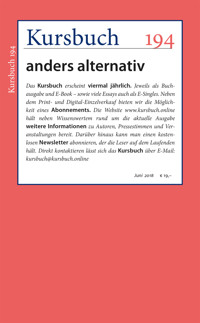
Kursbuch 194 E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kursbuch
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine Alternative dazu, diese Beschreibungsinformation zum neuen Kursbuch 194 bereitzustellen, wäre, es bleiben zu lassen. Tatsächlich? Ist die schiere Negation eine Alternative – oder einfach eben das banale Gegenteil? Das Kursbuch 194 "anders alternativ" hat keine Antworten, traut sich aber, eben jene Zwischenräume zu befragen, Mainstream-Lebensentwürfe und deren Subkulturen auszuleuchten, den Blick zu wagen auf den Sinn und den Unsinn eines Andersseins in Kultur, Politik, Gesellschaft und Ökonomie. Der umstrittene Münchner Kammerspiel-Intendant Matthias Lilienthal im Interview. Mit Beiträgen unter anderem von Jan-Werner Müller, Stephan Rammler, Jagoda Marinic, Sven Reichardt, Astrid Seville, Karl Bruckmaier, Ernst Mohr, Jeff Beer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Armin NassehiAlternatives Editorial
Tim RennerBrief eines Lesers (21)
Jan-Werner Müller… und ihr wollt den Himmel stürmen? Über Parteien, neue Bewegungen – und Parteien in Bewegung
Jagoda MarinićDas Land der Vielen Eine mehrstimmige deutsche Geschichte
Astrid SévilleThere Is No Alternative (TINA)Über den faden Sound der Alternativlosigkeit
Stephan RammlerNeonomaden, Shuttles, Cybertouristen Die Zukunft des Wohnens in der digitalen Zivilisation
Karl BruckmaierWahre Arbeit, wahrer LohnPop als Illusionsmaschine der Individualität
Alexander GutzmerDie größte Leinwand der WeltStefan Falke und die Frontera
Stefan FalkeBorder Artists
»Ich will ja gar nicht provokativ sein«Matthias Lilienthal im Gespräch mit Armin Nassehi
Ernst MohrHot ShitÜber die semiotische Konkurrenz von Marken
Daniel BellChina first!Was liberale Demokratien von der größten Einparteiendiktatur lernen könnten
Jeff BeerSingen in die eigene Faust oder: Die ALBERT-Passage
Das Albert-Glossar
Die Autoren
Impressum
Armin NassehiAlternatives Editorial
In Alternativen zu denken ist alternativlos. Das hört sich wie eine wohlfeile Parole an, ist es aber nicht. Selbst wenn wir nicht in Alternativen denken, so ist schon die Festlegung auf etwas Bestimmtes von möglichen Alternativen geprägt. Wenn wir jemandem eine Handlung zuschreiben, also meinen, dass er oder sie gehandelt hat, dann besteht der Test letztlich darin, ob es eine Alternative zum Verhalten gab. Um herauszubekommen, dass ein beobachtetes Verhalten ein zurechnungsfähiges Handeln ist, fragen wir, ob auch Alternativen denkbar sind. Bewusstseinsprüfungen bei Komapatienten etwa werden so betrieben. Ist eine Reaktion auf einen Reiz ein pures vegetatives Geschehen, oder hätte das Gegenüber auch anders handeln können? Zurechnungsfähig ist der andere nur, wenn er Alternativen hat, wenn er also auch etwas anderes hätte tun können. So unterscheiden wir willkürliches und unwillkürliches Verhalten – willkürliches Verhalten richtet sich nach einem Willen, der nur wollen kann, indem er Alternativen ausschließt. Unwillkürliches Verhalten kennt keine Willkür. Dass wir atmen oder das Herz schlägt, werden wir nicht als Handeln ansehen, denn wir haben keine Alternative dazu. Alles andere ist alternativenkontaminiert – alternativlos.
Das hört sich auf den ersten Blick an wie die alte Unterscheidung von Natur (Reich der Notwendigkeit) und Kultur (Reich der Freiheit), aber das wäre ein Fehlurteil, denn die Natur ist in ihrer evolutionären Logik der Alternativengenerator schlechthin. Selektion, Variation und Restabilisierung spielen geradezu mit alternativen Möglichkeiten, die sich dann durchsetzen können. Natur ist das Gegenteil von Notwendigkeit, sie ist eine kreative Formation zur Testung von Alternativen, von denen sich die meisten nicht durchsetzen. Insofern bestehen zwischen der natürlichen und der soziokulturellen Evolution zwar erhebliche Unterschiede, aber der Grundmechanismus ist in der Tat derselbe: Es entstehen alternative Stränge von Möglichem, die nicht alle dieselbe Chance haben, sich durchzusetzen.
Dass alles stets auch anders möglich ist, ist letztlich die Grundvoraussetzung von Ordnung. »Identity requires disorder«, sagt der Mathematiker und Netzwerkforscher Harrison White,1 und meint damit zweierlei: Zum einen weist er darauf hin, dass jegliche Identitätsbehauptung, also jegliche Festlegung auf etwas Bestimmtes immer schon im Horizont anderer Möglichkeiten, im Horizont also von Alternativen erfolgt. Die Identität von etwas zu behaupten, heißt, dass es dies und nicht jenes ist, dass es so und nicht anders ist, dass es auch anderes geben könnte. Das ist das fast Tragische daran, wenn Identitäten stark gemacht werden: Es wird damit auch immer eine Differenz behauptet. Die behauptete Identität einer Gruppe (welcher Art und Größe auch immer) verweist immer und sogar gegen die Intentionen der Sprecher auf die Differenz zu anderen Gruppen. Das ist schon aus logischen Gründen unvermeidbar, fast wäre ich geneigt zu sagen: alternativlos. Identitäten verweisen also auf Differenzen, auf alternative Möglichkeiten.
Zum anderen weist Harrison Whites Satz darauf hin, dass es Ordnung nur im Durcheinander gibt, Ordnung also stets eine Funktion von Unordnung ist.2 Die Welt selbst hat keine Ordnung, oder besser: Die Ordnung der Welt erscheint uns nur in der Ordnung, mit der wir sie sehen. Das ist das Zentrum modernen europäischen Denkens, das Welterkenntnis und Weltbezüge in den Blick nimmt, weil es gar nicht anders kann, als die Welt über den eigenen Zugang zu erschließen. Immanuel Kants geradezu epochale Wende vom Sein der Welt zum Bewusstsein, die Dinge also nur als Gegenstand der Erfahrung erkennen zu können, radikalisiert den Zweifel, dass die Welt so und nicht anders ist. Es ist eine Denkungsart über die Bedingungen, die gegeben sein müssen, dass das Bewusstsein angesichts der Mannigfaltigkeit der zunächst ungeordneten Eindrücke eine Ordnung in die Welt bringen kann. Es soll hier kein philosophisches Proseminar veranstaltet werden, aber es ist einen Gedanken wert, dass modernes Denken tatsächlich davon geprägt ist, dass die Ordnung eine Folge der Anschauung ist und nicht umgekehrt. Solches Denken rechnet immer schon damit, dass die Dinge auch anders sein könnten, als sie zunächst erscheinen.
»Identity requires disorder« – das verweist darauf, dass es gerade Unbestimmtheiten und Unterschiede, Konflikte und Uneindeutigkeiten sind, die für einen Bedarf an Identitätsbeschreibungen sorgen, nicht nur für einen Bedarf übrigens, sondern sogar dafür, dass Ordnung nur ein Ergebnis von Unordnung sein kann. Es geht also darum, wie Operationen selbst Ordnung erzeugen – und das können sie letztlich nur durch das, was in der Kybernetik das »Gesetz der erforderlichen Vielfalt« genannt wird.3 Diese »requisite variety« ist es also, die Ordnungsbildung überhaupt ermöglicht – und damit auch die Erzeugung von Bestimmtheit. Unbestimmtheit ist der Bestimmtheit vorgeordnet – deshalb meint Harrison White, dass Identität Unordnung voraussetzt und nicht Ordnung. Oder anders ausgedrückt: Alternativen lauern stets im Hintergrund, ob wir wollen oder nicht.
Um nur kleine Beispiele zu nennen: Mit der Opposition hat das politische System Herrschaftsalternativen zur Herrschaft geradezu institutionalisiert; Kunst konfrontiert uns mit alternativen Versionen der bekannten Welt; wer entscheidet, muss in alternativen Möglichkeiten und Szenarien denken; die Alternativszene der 1970er- und 1980er-Jahre hat der Öffentlichkeit einen Lebensstil vorgeführt, der durchaus evolutionäre Veränderungen in Gang gesetzt hat; der Konsumkapitalismus versorgt uns mit alternativen Konsummodellen.
Gerade das letzte Beispiel weist jedoch auf ein Problem mit den Alternativen hin. Ob die Wahl zwischen diesem oder jenem Konsumgut wirklich eine Alternative darstellt, ist die Frage. Und die Alternative zwischen politischen Parteien etwa weist oft nur auf gut eingeführte und bewährte Konfliktlinien hin, sodass dieses Entweder-oder bisweilen gar nicht als Alternative empfunden wird. Das weist auf ein logisches Problem hin, auf die Frage des tertium. Die Unterscheidung von A und B legt uns darauf fest, A als Alternative zu B und umgekehrt anzusehen. Sobald man sich an diese Unterscheidung gewöhnt hat, geraten Alternativen zu A und B aus dem Blick. Es gibt dann nichts Drittes mehr, das man sich denken kann, und zwar Drittes, das letztlich unbestimmt ist, also eine unbekannte Alternative, eine, mit der man gar nicht rechnen kann, weil sie gar nicht im Horizont auftaucht.
Wenn A geschieht, dann geschieht nicht B, wobei auch B ein möglicher Anschluss gewesen wäre. Diese einfache Negation beinhaltet freilich so etwas wie einen realistischen Fehlschluss. Woher weiß man, dass B ausgeschlossen wurde und nicht C? Und wer weiß das? Es ist deshalb notwendig, die Negation selbst noch einmal zu unterscheiden: in eine bestimmte Negation der anderen Seite einer beobachtungsleitenden Unterscheidung, zum anderen in eine unbestimmteNegation aller anderen möglichen, aber nicht mitvollzogenen Unterscheidungen.4
Von unbestimmter Negation ist dort zu reden, wo die andere, die ausgeschlossene Seite im Dunkeln bleibt, gar nicht im Horizont möglicher Anschlüsse auftaucht und die Beobachtung eines Systems mit einem unbeobachtbaren Horizont ausstattet – der paradoxerweise nur ein Horizont werden kann, wenn er nicht mehr unbeobachtet bleibt und den es ohne eine solche Beobachtung gar nicht »gibt«. Alles, was geschieht, geschieht also in einem doppelten Horizont: im Horizont des sinnhaft, das heißt konkret und benennbar Ausgeschlossenen sowie im nicht eröffneten Horizont unsichtbarer anderer Möglichkeiten.
Ich kann das hier nicht weiterverfolgen, aber zumindest dies lässt sich sagen: Wer von Alternativen redet, redet allzu oft von allzu eingeführten, stabilen Alternativen, von solchen, die gar kein Drittes mehr kennen. Dass wir freilich so selten über solche geradezu ausgeschlossenen Alternativen reden, liegt daran, dass das ausgeschlossene Dritte eben ausgeschlossenes Drittes ist und deshalb kaum wirklich sichtbar werden kann.
Die Beiträge dieses Kursbuchs führen nicht einfach Alternativen vor, sondern diskutieren ganz in dem angedeuteten Sinne die Frage, wie Alternativen entstehen, wie sich ihre Bedeutung erschließt und wie Eindeutigkeiten und Mehrdeutigkeiten sich gegenseitig beeinflussen. So weist Ernst Mohr darauf hin, dass Markenbildung zwischen Alternativen und Alternativlosigkeiten oszilliert. Jagoda Marinić führt vor, wie sich der Blick auf die Geschichte der Bundesrepublik ändert, wenn man sie aus einer anderen, einer ausgeschlossenen dritten Perspektive erzählt, nämlich der der Einwanderer. Stephan Rammler dekonstruiert die Alternative zwischen Sesshaftigkeit und Nomadentum, Astrid Séville streitet für Pluralismus als Antidot gegen den Populismus der Alternativlosigkeit. Karl Bruckmaier argumentiert so: Pop arbeite mit einem Heilsversprechen, könne aber keine Heilsgewissheit anbieten. Aber den Vorschein einer Alternative, das vermag Pop stets zu vermitteln.
Mein Gespräch mit Matthias Lilienthal, dem Intendanten der Münchner Kammerspiele, hat auch Alternativen zum Gegenstand. Lilienthals Vertrag wird wahrscheinlich nicht verlängert, weil der einen der Parteien in der Großen Koalition des Münchner Stadtparlaments seine Arbeiten als allzu alternativ zum klassischen Sprechtheater erscheinen. Grund genug, nicht darüber, aber über sein Konzept von Alternativen mit ihm zu sprechen.
Daniel A. Bell stammt aus Kanada und ist Politikwissenschaftler in Jinan und Beijing. Er hat sich einen Namen damit gemacht, die chinesische Meritokratie als legitime Alternative zur westlichen Demokratie darzustellen. Sein Beitrag diskutiert, was liberale Demokratien von der größten Einparteiendiktatur lernen könnten. Und Jan-Werner Müller diskutiert Parteipolitik nicht in dem Sinne, dass diese Alternativen im politischen Spektrum anbieten. Er weist vielmehr darauf hin, dass politische Akteure zunehmend andere, bewegungsnahe Organisationsformen annehmen, mithin also eine Alternative zur Parteipolitik etablieren.
Alternativen haben es stets mit Grenzen zu tun, mit Grenzen zwischen Wirklichem und Möglichem, zwischen dieser Beschreibung und jener, zwischen dieser Lösung und einer anderen. Mit der Grenze zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten beschäftigen sich die Fotografien von Stefan Falke, einem deutschen Fotografen, der in New York lebt. Sie zeigen die Künstlerszene an dieser Grenze, die diese Leinwand für politische und kulturelle Projektionen künstlerisch bespielt. Wie Alexander Gutzmer in seinen Erläuterungen zu den Fotografien schreibt, arbeiten die Künstler nicht nur an der Grenze, sondern mit ihr.
Jeff Beers literarischer Text zwischen Lyrik und Prosa ist ein Erinnerungsstück – lesen Sie selbst. Spannend an ihm ist, dass er geradezu ästhetisch vorführt, welche Alternativen, welche unbestimmte Negationen der übliche Text hat, der konsistent berichtet, Brüche logisch organisiert und einem erwartbaren Aufbau folgt. Das ist das Besondere an der Literatur: Wie es geschrieben ist, ist so wichtig wie das, was geschrieben wird.
Wir danken Tim Renner für den 21. Brief eines Lesers.
Anmerkungen
1 Harrison C. White: Identity and Control. A Structural Theory of Social Action. Princeton 1992, S. 9 f.
2 Vgl. Armin Nassehi: »Die Macht der Unterscheidung. Ordnung gibt es nur im Durcheinander«, in: Kursbuch 173: Rechte Linke. Hamburg 2013, S. 9–31.
3 William Ross Ashby: Einführung in die Kybernetik. Frankfurt am Main 1974, S. 298 f.
4 Vgl. ausführlich Armin Nassehi: Geschlossenheit und Offenheit. Studien zur Theorie der modernen Gesellschaft. Frankfurt am Main 2003, S. 61 ff.
Tim RennerBrief eines Lesers (21)
Älteren Kursbuch-Lesern, so wie ich es bin, fällt die Visualisierung des Wortes »alternativ« leicht: Fast zwangsläufig tauchen bei der Nennung dieses Wortes ehemalige Mitschüler aus den 1970er- oder 1980er-Jahren vor dem geistigen Auge auf. Gewandet sind diese in Latzhosen und abgetragenen Bundeswehrparkas, tragen Holzschuhe (sogenannte Clogs) an den Füßen, um den Hals ist zumeist ein Palästinensertuch gezwirbelt. Diese »Alternativen« waren verspätete Hippies. Leider fehlte ihnen der Humor der 68er, und über progressive Gesellschaftsentwürfe diskutierten sie auch nicht wirklich gerne. Dafür hörten sie hergebrachte Rockmusik wie BAP und die Bots, neue Technologien (»Atomkraft? Nej tak«) waren für sie Teufelszeug und das Strickzeug bei den Männern war ein Zeichen der Geschlechtergerechtigkeit. Kurz: Diese jungen Herrschaften waren Konservative – allerdings ohne selbst zu ahnen, dass sie das sind.
Spätestens seither ist das Wort »alternativ« nicht mehr ein Synonym für eine fortschrittliche Variante zum gesellschaftlichen Status quo. Was sich alternativ nennt, ist nun im Gegenteil in der Regel rückwärtsgewandt und lehnt die Moderne ab. Das belegt die »Alternative Music«, ein kontemporäres Rock-Genre, welches sich aus Punk und dem ihm nachfolgenden New Wave speist, also Musik von gestern mit Musikern von heute konserviert. Ebenso die »alternative Medizin«: Auch sie propagiert nicht etwa die neusten Erkenntnisse aus der Forschung, sondern basiert auf der Wiederentdeckung tradierter Heilmethoden. Ganz eindeutig wird die wundersame Wandlung des Worts »alternativ« spätestens mit der »Alternative für Deutschland« kurz AfD: Deren Parteiprogramm verspricht eine Art Restauration der deutschen Gesellschaft im Sinne der 1950er-Jahre. Reaktionärer geht alternativ kaum. Nur noch neofaschistischer: Das sind die Ideologien, die man in den USA unter den Namen »Alt-Right« zusammenfasst.
Alternativ funktioniert nur mit einem Gegenstück. Dieses Gegenstück, zu dem man eine Alternative darstellt, ist aus Sicht der Alternativen die Mehrheitsmeinung, der Mainstream. Wenn das als Monstranz vor sich her getragene »alternativ« konservativ oder reaktionär konnotiert ist, muss der Mainstream also sehr progressiv sein. Zumindest wird er so von denen empfunden, die sich »Alternative« nennen. Und in der Tat, am Ende des letzten Jahrhunderts war der Fortschrittsglaube in Gesellschaft und Politik Common Sense. Er definiert sich allerdings eher über Technologien, weniger über Inhalte. Jede linke Partei war für den Ausbau der Atomkraft – auch wenn sie ein unkalkulierbares Risiko war. Dennoch versprach sie günstigen Strom und damit ein besseres Leben für alle. Besonders nach dem Zusammenbruch des realen Sozialismus stürzte man sich in Ermangelung einer neuen, linken Utopie auf Technik: Die progressive Musik wurde immer elektronischer, kaum ein Theaterstück kam mehr ohne Video und anderen technologischen Schnickschnack aus, Computer von Apple zu nutzen wurde Ausdruck von richtiger Gesinnung.
Technik ist aber nur ein Mittel zum Zweck. Ein Algorithmus zum Beispiel ist weder gut noch böse. Technik ist immer genau das, was wir ihr vorgeben, zu sein. Eine Gesellschaft, die keine Utopien mehr kennt, und eine Linke, die diese nicht einmal mehr diskutiert, geben keine neuen Ziele vor. Hinzu kommt, dass die technische Entwicklung sich immer schneller vollzieht: Laut Moore’schem Gesetz verdoppelt sich die Leistungsfähigkeit von Rechnern alle 18 Monate – der Fortschritt ist also exponentiell. Die technologische Entwicklung wird auch für Politiker und Intellektuelle längst zu schnell und zu komplex. Spätestens beim Thema »Block Chain« sind die meisten ausgestiegen. Es bleiben diejenigen, die Technik und Programme entwickeln, sowie deren Geldgeber. Techniker und Forscher zeigen technische Möglichkeiten auf und machen damit alles möglich, der Investor wiederum sucht nach Effizienz. Die Konsequenz ist, dass Fortschritt so zur Bedrohung wird. Er verfolgt kein gesellschaftliches Ziel, sondern ist der Gewinnmaximierung untergeordnet. Maschinen und Programme ersetzen den Menschen. Das kennt man aus der industriellen Revolution.
Ohne industrielle Revolution kein Sozialismus. Der Manchester-Kapitalismus war es, der Marx und Engels an einer Alternative, einem menschenfreundlichen Zukunftsbild arbeiten ließ. Technik (damals noch Produktionsmittel genannt) sollte der Allgemeinheit dienen. Modern Times von Charlie Chaplin und Fritz Langs Metropolis zeigen auf, welche Ängste mit Technik auch Anfang des 20. Jahrhunderts verbunden waren.
Um anders alternativ zu sein, brauchen wir jetzt eine Utopie, wie es der Sozialismus war. Die progressiven Kräfte unserer Gesellschaft müssen definieren, wie wir leben wollen. Wofür soll die Technik dienen, wie wollen wir ihren Nutzen allen Menschen zuteilwerden lassen? Diese Schlüsselfrage muss beantwortet werden, um technologischer Entwicklung die richtige Richtung zu geben. Kurz: Es braucht etwas wie einen digitalen Sozialismus. Dieser muss einen Traum beschreiben, der für die Gesellschaft attraktiver ist als das rückwärtsgewandte Angebot der heutigen Alternativen. Dies wird auch der einzige Weg sein, das Wort »alternativ« für die Linke zurückzuerobern.
Jan-Werner Müller… und ihr wollt den Himmel stürmen? Über Parteien, neue Bewegungen – und Parteien in Bewegung
Bekanntlich leben wir in politisch bewegten Zeiten. Ganz konkret heißt dies unter anderem: Zeiten, in denen neuartige Bewegungen eine Revitalisierung der Demokratie versprechen. Man braucht sich nur einmal flüchtig in der europäischen politischen Landschaft umzuschauen, und der Blick trifft auf Neugründungen, die sich plakativ von traditionellen Parteien abgrenzen: Podemos in Spanien, die Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) in Italien, die Liste Sebastian Kurz in Österreich, En Marche in Frankreich – das sind nur die bisher bei Wahlen erfolgreichsten Bewegungen. Mancher sieht in ihnen Vorboten einer postrepräsentativen Demokratie, in welcher mit kontinuierlicher Bürgerbeteiligung an der Politik endlich ernst gemacht wird (oder in welcher zumindest noble Amateure aus der Zivilgesellschaft die egoistischen Berufspolitiker ersetzen). Kritiker hingegen rechnen sie ohne zu zögern einer populistischen, für die liberale Demokratie gefährlichen Welle zu. Beide Seiten liegen falsch. Es ist kein Zufall, dass die sich selbst als Bewegung vermarktenden Neugründungen de facto zu Parteien geworden sind; von einer Überwindung des Prinzips der Repräsentation oder der Vorstellung von Politik als Vollzeitberuf kann keine Rede sein. Es ist aber auch falsch, die wirklichen Newcomer wie Podemos und M5S einfach als Protestler ohne langfristige Perspektiven abzutun. Ihre, wie man sie nennen könnte, neuen Polit-Technologien sind wirklich innovativ (was nicht immer gleich heißt, demokratischer). Und nicht zuletzt haben sie die Repräsentationsverhältnisse wirklich zum Tanzen gebracht; unsere Demokratien wären ärmer ohne sie.
Parteien sind nicht erst seit wenigen Jahren ganz, ganz unpopulär. Was in den 1990er-Jahren unter dem Begriff »Politikverdrossenheit« firmierte, war vor allem Verdruss an den etablierten Parteien. Überall in Europa nahmen die Mitgliederzahlen rapide ab; zudem identifizierten sich immer weniger Bürger dauerhaft mit einer Partei, bei Wahlen wurden sie dementsprechend sprunghafter. Sozialwissenschaftler bestätigten, was der Stammtisch im Zweifelsfalle schon immer vermutet hatte: Es hatten sich »Kartellparteien« herausgebildet, die nicht nur in vieler Hinsicht miteinander, sondern vor allem auch mit dem Staat selber fusioniert hatten. Wenn doch einmal Herausforderer wie die Grünen auftraten – Störenfriede, die sich partout nicht außen vor halten ließen –, wurden sie schließlich ins Kartell aufgenommen. Kurzum, seriöse Stimmen sagten, was dann später auch Populisten immer behaupten würden: Es gibt eine politische Klasse mit ganz eigenen Interessen, die sich hinter der Kulisse divergierender Parteiprogramme formiert.
Bei solch erstarrten Verhältnissen verspricht das Wort »Bewegung«, na ja, erst einmal, Bewegung in die Sache zu bringen. Wobei so gut wie keine einzige Organisation, die sich heute als eine Art spontaner Massenbewegung verkauft, wirklich direkt aus einem Kollektiv sich zivilgesellschaftlich engagierender Bürger entstanden ist. Man denke beispielsweise an Podemos. Nach dem Platzen der Immobilienblase in Spanien waren in der Tat eine ganze Reihe von wichtigen Selbsthilfeorganisationen wie Plataforma de Afectados por la Hipoteca oder Plataforma por una Vivienda Digna entstanden. Im Mai 2011 versammelten sich Tausende auf der Puerta del Sol in Madrid, um gegen traditionelle Parteien (und Banken) zu protestieren. Ihre immer wiederholte Anklage: »Sie repräsentieren uns nicht.« Ihre Forderung: »Wirkliche Demokratie.«
Es dauerte aber noch fast drei Jahre, bevor eine Reihe junger Aktivisten – von Beruf her größtenteils Politikwissenschaftler – Podemos ins Leben riefen. Podemos war also keine direkte Folgeerscheinung des Auftretens der indignados. Podemos-Parteitheoretiker haben selber darauf hingewiesen, dass sich die Energien der Proteste von 2011 auch in ganz andere Richtungen hätten wenden können (frühere Versuche, die Demonstrationen in parteipolitische Kanäle zu führen, wie beispielsweise von Partido X, blieben erfolglos). Einer der wichtigsten Vordenker von Podemos, Íñigo Errejón, äußerte sich 2015 gar eher abschätzig über die Vorstellung einer permanenten Mobilisierung der Bürger. Irgendwann, so Errejón, müsse jeder wieder nach Hause gehen; einen »konstanten Heroismus« von Aktivisten gebe es nicht (und wenn, würde er nicht reichen, um wirklich an die Macht zu gelangen und irreversible Tatsachen zu schaffen).
Die eigentliche Lektion von »15-M« für die Podemos-Gründer war denn auch weniger, dass aufgebrachte Leute mal auf die Straße gingen – sondern, dass traditionelle linke politische Sprachen bei den Spaniern nicht mehr Anklang fänden. Sie entschieden sich bewusst für eine »transversale« Strategie, welche die traditionelle Trennung zwischen links und rechts überschreiten und einen neuen politischen Gegensatz zwischen Volk und »Kaste« (oder, noch simpler, zwischen den vielen und den wenigen, oder, am simpelsten, zwischen abajo und arriba) konstruieren sollte. Inspiriert von postmarxistischen Denkern wie Ernesto Laclau und Chantal Mouffe – sowie erfolgreichen populistischen Politikern in Lateinamerika wie Evo Morales – sollte Spanien bewusst in ein »Volk« und ein »Anti-Volk« aus korrupten Politikern und Bankern gespalten werden. Errejón erklärte, die Begriffsbildung sei hier nicht deskriptiv, sondern performativ: Die neue, von langweiliger linker Ideologie reine Sprache sollte einen vereinigten »national-populären Willen« wie in Bolivien, Ecuador und Venezuela hervorbringen. So war denn die politische Arbeit der Podemos-Gründer auch zuallererst Arbeit an der Sprache: »Wir sind Handwerker, die mit Wörtern arbeiten«, so Errejón einmal.
Das populistische Reinheitsgebot ging so weit, dass man im Zweifelsfalle immer das Gegenteil dessen machen wollte, was die Linke gerade tun würde. Und diese Regel erstreckte sich auf das, was basisdemokratisch orientierten beautiful losers auf der Linken so alles in den Sinn kommen könnte, wenn sie eine neue Partei gründeten. Zwar gibt es bei Podemos Mitgliederabstimmungen, »Zirkel«, »Bürgerversammlungen« und noch allerlei mehr, was nach kontinuierlicher Partizipation und Kontrolle von unten klingt. Aber die meisten Beobachter – und Kritiker innerhalb der Partei – sind sich einig, dass Podemos eigentlich straff von oben gelenkt wird. Pablo Iglesias Turrión, der fotogene Politikprofessor mit Pferdeschwanz und Ziegenbart, bemerkte denn auch einmal, auf Marx und Hölderlin anspielend, dass man den Himmel nicht mit Konsens stürmen könne. Prompt folgten Vorwürfe von »hiperliderazgo« und »Online-Leninismus« gegenüber Iglesias.
Das eigentlich Interessante an Podemos ist denn auch weniger die ohnehin nur lose Verbindung zu einer genuinen Massenbewegung, die ein paar Jahre vorher auf den Plätzen kampiert hatte – sondern die Ursprünge der Partei in einem traditionellen Massenmedium. Iglesias wurde einem breiteren Publikum mit seinen Polit-Talkshows im Privatfernsehen bekannt; er selbst bemerkte, das Fernsehen sei heute für die Politik so wichtig wie einst das Schießpulver für den Krieg. Zwar, so ergänzte Errejón einmal, sei das Fernsehen als grundlegendes Terrain der ideologischen Auseinandersetzung ursprünglich vom politischen Gegner konstruiert worden, man könne dieses Terrain aber zum eigenen Vorteil verändern. Iglesias wiederum garniert seine von Gramsci sowie Linkspopulisten wie Mouffe inspirierte Analyse immer wieder mit popkulturellen Referenzen wie »Game of Thrones«. Salopp, aber nicht falsch gesagt: Massenbewegung ist nicht viel, kulturelle Hegemonie im ganzen Land heißt das Ziel.
2016, nachdem es einmal mehr nicht gelungen war, die Sozialisten bei Parlamentswahlen zu überholen, erklärte ein Podemos-Gründer, Juan Carlos Monedero (ein weiterer Politikprofessor), die »populistische Hypothese« sei widerlegt worden. Aber man muss Podemos nicht an den Ansprüchen der Professoren messen. Podemos’ eigentliches Verdienst liegt weniger darin, ein ganz neues Volk konstruiert oder einzelnen Engagierten präzedenzlose Partizipationsmöglichkeiten eröffnet, als vielmehr Spanien als Ganzem ein wichtiges (und letztlich sehr erfolgreiches) Repräsentationsangebot gemacht zu haben. Der Slogan »Sie repräsentieren uns nicht« hatte ja in einer Demokratie mit einem Parteienduopol aus Sozialdemokraten und Konservativen (wobei sich beide Seiten als zunehmend korrupt erwiesen hatten) sehr wohl seine Berechtigung. Podemos ebenso wie die liberale Neugründung Ciuadadanos ermöglichten es, den de facto zentralen Konflikt in der spanischen Politik – krude gesagt: Austerität gegen Anti-Austerität – endlich plausibel im Parteiensystem abzubilden. Vor allem Podemos gelang es, junge, gut ausgebildete Bürger, welche eigentlich mit dem System schon abgeschlossen hatten, wieder an die Urnen zu bringen.
Auf lange Sicht betrachtet geschah hier etwas ganz Außergewöhnliches. Junge Menschen, deren Lebenschancen durch die Eurokrise drastisch (und wohl auch permanent) reduziert worden waren, gingen erst auf die Straßen und dann wählen – und als ihre Partei nicht gewonnen hatte, gingen sie wieder nach Hause (hoffentlich mit dem Gedanken: Wir können es – podemos, yes, we can! … – und wir werden es wieder probieren). Man braucht sich nur an die 1970er-Jahre zu erinnern, um zu sehen, dass junge, von einem System radikal enttäuschte Menschen auch schon einmal auf andere Gedanken gekommen sind, als neue Parteien zu gründen.
Zweifelsohne würden die Podemos-Denker dieses Porträt als Verharmlosung, ja gar als paternalistische Einvernahme durch liberale Demokraten zurückweisen – geht es ihnen doch um viel mehr als das Ausgleichen postdemokratischer Defizite hier und da. Das ganze »Regime von 1978« (das Jahr des Überganges von der Franco-Diktatur zu einer Demokratie, die laut Podemos zur Oligarchie degenerierte) wollen sie hinwegfegen. Es ist mehr als zweifelhaft, dass sie dies einmal schaffen werden. Was außer Zweifel steht, ist, dass sie nicht, wie Beobachter behaupten, die einen Niedergang der Volksparteien mit »Krise der Demokratie« gleichsetzen, Teil des Problems sind, sondern viel eher sagen können, Teil der Lösung einer Krise der Repräsentation zu sein – und zwar ganz unabhängig von ihrem vermeintlichen Bewegungscharakter.
Wer meint, Iglesias sei ein Online-Lenin, was mag der erst von Beppe Grillo denken? Grillo war nicht der erste Komödiant, der in der Politik reüssierte (man denke an Coluche in Frankreich). Er war aber der Erste, der Straßenprotest mit einer auf eine einzige Person zugeschnittenen Internetpräsenz verband, um daraus enormes politisches Kapital zu schlagen. Die Geschichte ist inzwischen hinlänglich bekannt: Grillo war aus dem Staatsfernsehen verbannt worden, nachdem er Witze über das gerissen hatte, was alle wussten – nämlich dass der sozialistische Premier Bettino Craxi zutiefst korrupt war. Zusammen mit Gianroberto Casaleggio, dieser seltsamen, geradezu mysteriösen Verbindung aus Internet-Hippie-Guru und hartem Geschäftsmann, baute er später seinen Blog auf als Alternative zu einer Präsenz in den traditionellen Medien. Dieser schuf die Suggestion einer direkten Verbindung zwischen Bürgern und Grillo, der sich als »Lautsprecher« der einfachen Leute präsentierte. Grillo legte stets Wert darauf, im gleichen Atemzug die Berufspolitiker wie die professionellen Journalisten zu kritisieren, denn Letztere seien nicht weniger korrupt und würden, anders als der reine »Lautsprecher« Grillo, die Dinge immer bewusst verzerren.
2007 organisierte Grillo seinen ersten großen V-Day (V stand für »Vaffanculo«, erinnerte aber auch den Film V for Vendetta); schon sechs Jahre später würde seine Partei, die laut Statut (offiziell eigentlich: »Non-Statuto«) keine Partei sein will, zur stärksten Kraft bei den italienischen Parlamentswahlen. Grillo, vermeintlich reiner Lautsprecher, machte durchweg klare Ansagen von oben an seine Anhänger, die grillini. Er behielt das Copyright des Symbols der Fünf-Sterne-Bewegung und konnte es den grillini entziehen, die in Ungnade gefallen waren, weil sie die »Regeln« der Nichtpartei mit Nichtstatut verletzt hatten (beispielsweise, indem sie an TV-Talkshows teilnahmen). Der Blog und das Online-Partizipationssystem »Rousseau« werden von Davide Casaleggio, dem Sohn des 2016 verstorbenen Gianroberto, verwaltet – und, in den Augen von Kritikern, kontrolliert, wenn nicht gar manipuliert. Die Vorstellung einer genuinen »Massenbewegung« ist also auch hier eher irreführend. Es ist die einzigartige Dynamik zwischen Straße und Internet – non c’e web senza piazza, non c’e piazza senza web laut Grillo –, welche diesen Eindruck von Basisdemokratie geschaffen hat, ebenso wie Grillos offizielle Opposition gegen jegliche Form von »leaderismo«.
Anders als in Spanien ist die Idee einer transversalen Strategie hier viel eher Realität geworden: M5S lässt sich in vieler Hinsicht in der Tat schwer in traditionelle Kategorien von rechts und links einordnen (während Podemos im Grunde immer schon als eindeutig links allzu erkennbar war). Grillo sprach einmal von M5S als einer Frage des »Lebensstils«. Die bei Politikwissenschaftlern so beliebte Vorstellung einer »Repräsentationslücke«, welche M5S nur zu füllen brauchte, trifft in Italien nicht ohne Weiteres zu. Sie beruht ganz allgemein auf einem Missverständnis demokratischer Repräsentation, das ja keine mechanische Reproduktion oder Übersetzung immer schon objektiv vorhandener Interessen und Identitäten ins politische System ist, sondern ein dynamischer Prozess, in dem sich die Selbstwahrnehmungen der Bürger, was ihre Interessen und sogar ihre Identitäten angeht, erst formieren – und zwar nicht zuletzt durch die Repräsentationsangebote, welche ihnen Politiker, Medien, Zivilgesellschaft, Freunde und Familie machen (und eben dann und wann auch mal ein Komiker …).
M5S ist nicht deswegen so bemerkenswert, weil es sich um eine Bewegung handelt – sondern weil sie ein ganz neues Gebilde darstellt, in dem jegliche vermittelnde Institution (sei es genuine parteiinterne Demokratie, seien es traditionelle Medien) eliminiert worden ist. Es gibt, anders als bei Podemos, überhaupt keine mittleren Ebenen, keine wirklich dauerhaften Strukturen (ein »Direttorio« wurde von Grillo und Casaleggio nach kurzer Zeit wieder abgeschafft). Es ist ein wenig wie bei gewissen Internetunternehmen: Die Benutzeroberfläche ist toll, es wird auch normalerweise geliefert, was man bestellt hat – aber man kann keinen anrufen, in keinen Laden gehen, keine Beschwerden jenseits der vorgefertigten Muster anmelden.
Verglichen mit Podemos und M5S ist vieles von dem, was heute als »Bewegung« verkauft wird, eigentlich Etikettenschwindel. Sebastian Kurz beispielsweise baute sich die Österreichische Volkspartei nach seinem Bilde um: Er entmachtete die einst dominanten ÖVP-Landesfürsten, brachte möglichst viele Aktive in seine Abhängigkeit und präsentierte sich – der von Kindesbeinen an nie etwas anderes gemacht hatte als Parteipolitik – als großen Außenseiter. Dabei half, dass er eine ganze Reihe von prominenten oder zumindest angesehenen Menschen aus der Zivilgesellschaft auf seine Liste setzte – und sie damit natürlich auch völlig von seinen Gunsten abhängig werden ließ.
Anders schon der Fall der Labour-Partei in Großbritannien. Man muss Jeremy Corbyn ja nicht mögen. Aber hier hat offenbar eine Bewegung von unten, nämlich die von jungen Menschen dominierte »Momentum«, wirklich einmal eine Partei weitgehend übernommen und ihren Kandidaten in Mitgliederabstimmungen gegen die Labour-Berufspolitiker im Parlament durchgesetzt. Das hatte einen ganz besonderen Effekt: Labour gewann seine Glaubwürdigkeit als genuin linke Alternative zurück. Der einst gefeierte Blair-Effekt, die Partei in die Mitte geführt zu haben (böser gesagt: sie Neoliberalismus-kompatibel gemacht zu haben), wurde weitgehend rückgängig gemacht. Überall in Europa leiden die Sozialdemokraten; in Großbritannien traten sie mit einem Programm an, das vom Inhalt her durchaus an Podemos gemahnte (die many gegen die few), und hätten wider allen Erwartens im Juni 2017 fast gewonnen.
Nicht ganz so extrem war es bei Emmanuel Macron. Allerdings schaffte auch Macron das scheinbar Unmögliche. Ein lebenslanges Mitglied der Pariser Elite, ein énarque und ehemaliger Minister, stellte sich als Außenseiter in der Fünften Republik dar. Seine Bewegung En Marche konnte zwar wirklich begeisterte junge Menschen an sich binden und machte mit dem Grande Marche den Versuch, mit möglichst vielen Bürgern ins Gespräch zu kommen (aus dem Austausch mit 25 000 Franzosen resultierte Le Diagnostic, eine lange Bestandsaufnahme der Malaise im Lande). Aber bisher ist die inzwischen zur Partei gewordene La République en Marche doch hauptsächlich ein Vehikel für die Ambitionen ihres Schöpfers. Wie bei Podemos und M5S ist es leicht, reinzukommen – man muss sich nur online registrieren, ein Mitgliedsbeitrag wird nicht erhoben –, aber schwer, hochzukommen ohne die Gunst des Gründers (man spricht auch offiziell gar nicht mehr von Mitgliedern, sondern im Zweifelsfalle von Followern – man ist versucht zu sagen: Mitläufern).
Es wäre verfehlt, Bewegungen dieser Art unverzüglich dem Populismus zuzurechnen. Populisten behaupten bekanntermaßen, sie und nur sie verträten das wahre Volk; sie erheben Anspruch auf ein moralisches Monopol der Volksrepräsentation. Ab und an hört man diesen Sound bei Figuren wie Grillo, der einmal nichts weniger als »100 Prozent« im Parlament für seine Bewegung reklamierte (mit anderen Worten: Alle anderen Mitwettbewerber um die Macht sind automatisch illegitim). Aber im Allgemeinen wäre es falsch, aus der Tatsache, dass Bewegungsparteien am Anfang oft auch Protestparteien sind, gleich auf Populismus zu schließen. Manche Berufspolitiker sind wirklich korrupt – in Spanien gibt es viele eklatante Beispiele (nur das dualistische Bild, das Populisten stets zeichnen – da oben die korrupte homogene Elite, hier unten das tugendhafte homogene Volk –, ist soziologisch immer falsch).
Und doch: Zwischen einigen der hier analysierten Phänomene und Populismus gibt es in einer Hinsicht eine Art Wahlverwandtschaft. Das liegt an der Suggestion einer »direkten Repräsentation« (um den paradoxen Begriff der italienischen Polit-Theoretikerin Nadia Urbinati aufzugreifen), wie sie sich bei Grillo, zu einem gewissen Grade aber auch bei Macron findet. Vermittelnder Institutionen bedarf es nicht, denn – so kann man weiter folgern – der wahre Volkswille ist ja immer schon offensichtlich und eindeutig. Repräsentation ist aber, wie oben angedeutet, keine Sache von mechanischer Reproduktion von etwas immer schon objektiv Gegebenem oder Offensichtlichem. An der anonymen Online-Abstimmung mögen sich ganz viele Leute beteiligen – aber eine differenzierte Diskussion unter Einbezug von kenntnisreichen (und nicht nur zeitreichen) Individuen und vermittelnder Institutionen kann trotzdem repräsentativer sein, weil mehr Angebote und Rückmeldungen in die Diskussion eingehen als ein simples Ja/ Nein.
Damit sollen die Möglichkeiten von Bewegungen, neue Repräsentationsangebote zu machen, keineswegs kleingeredet werden. Aber schon der Begriff »Bewegung« suggeriert ja, dass eigentlich immer schon alle wissen, in welche Richtung es gehen muss (das ist bei Volksparteien eher nicht der Fall). Ebenso wäre es verfehlt, jeglichen Versuch, die Rechts-links-Unterscheidung zu überschreiten, automatisch als normativ anrüchig, wenn nicht gar wieder als potenziell populistisch zu klassifizieren. Es kommt – wie immer – auf die Details an. Wird den Bürgern ein Angebot gemacht, das sie auch ablehnen können, ohne gleich als illegitim gebrandmarkt zu werden (wie dies bei Populisten der Fall ist)? Besteht die Gefahr einer Neuauflage der Rhetorik des »Dritten Weges« wie bei Macron, der meint, als Einziger eine vernünftige Mitte zu okkupieren, sodass nur irrationale Extreme rechts und links (nämlich der Front National und die linke France insoumise) verbleiben? Für diese – de facto technokratische – Haltung stand einst auch Tony Blair, der behauptete, über Globalisierung auch nur diskutieren zu wollen sei so, wie das Folgen von Herbst auf Sommer zu einem Debattengegenstand zu machen. Wer meint, die Rationalität für sich gepachtet zu haben (und sich mit seiner Bewegung als Einziger in eine rationale Richtung zu orientieren), macht es auf seine Weise den Populisten leichter. Denn diese können dann zu Recht fragen, was das denn heißen solle, eine Demokratie ohne Wahlmöglichkeiten (was nicht besagen will, dass die Populisten die wahren Verfechter der Demokratie sind).





























