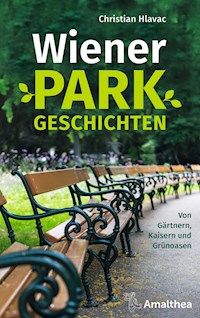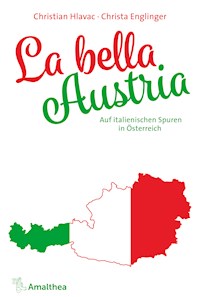
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amalthea Signum Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie viel Italien steckt in Österreich? Italien ist für viele das Land der Sehnsucht, der Inbegriff von "dolce vita" und genussvollem Essen, die Wiege europäischer Kunst und Kultur. Doch auch zwischen Vorarlberg und dem Burgenland finden sich seit Jahrhunderten Spuren von italienischem Lebensgefühl: Cafés und Eissalons, Maroni und andere kulinarische Köstlichkeiten. Venedig gab es einst auch in Wien, viele Schlösser und Kirchen haben italienische Väter, und so mancher Italiener machte Karriere in Österreich. Begeben Sie sich auf eine spannende Entdeckungsreise durch "bella Austria" – andiamo! Aus dem Inhalt: Von der Oper zum Kaffeehaus – die Tomasellis Der Schnitzelstreit zwischen Wien und Mailand Venedig in Wien Wie ein Papst zum Zirkus kam Die italienische Kulisse des "Jedermann" Christkindls italienischer Vater Eine Medici wird Landesfürstin von Tirol Eine toskanische Villa im Salzkammergut Servus, Ciao und Baba u. v. a. Mit zahlreichen Abbildungen in Farbe
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Chirstian Hlavac · Christa Englinger
La bellaAustria
Auf italienischen Spuren in Österreich
Mit 98 Abbildungen
Besuchen Sie uns im Internet unter: amalthea.at
© 2019 by Amalthea Signum Verlag, Wien
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Elisabeth Pirker/OFFBEAT
Umschlagabbildungen: iStock.com
Lektorat: Helene Sommer
Herstellung und Satz: VerlagsService Dietmar Schmitz GmbH, Heimstetten
Gesetzt aus der 11/14,5 pt Minion Pro Caption
Designed in Austria, printed in the EU
ISBN 978-3-99050-133-7
eISBN 978-3-903217-31-7
Inhalt
Italien auf einer Serviette
Schnitzel und Caffè
Ein Arme-Leute-Gericht: die Pizza
Von der Oper zum Kaffeehaus – die Tomasellis
Heiße Grüße aus dem Süden: Maroni
Gelato! Gelato!
Das schwarze Lebenselixier
Ein italienischer Cafetier im Paradies
Mandoletti! Bonbiletti!
Der Schnitzelstreit zwischen Wien und Mailand
Italienische Kaufrufe in der Stadt
Eine italienische Schnecke erobert Österreich
Der italienische Prater
Venedig in Wien
Ein Doge in Wien?
Ein italienischer »Chineser« im Prater
Von Rom nach Österreich
Wie ein Papst zum Zirkus kam
Ein Teil von Rom in Wien?
Ein italienischer Papst schreibt über Wien
Architekten und Ingenieure
Ein Venezianer als österreichischer Eisenbahnpionier
Die italienische Kulisse des »Jedermann«
Die zwei Gräber des Suezkanal-Planers
Italienische Gastarbeiter am Arlberg
Ein Genuese gestaltet das barocke Österreich
Christkindls italienischer Vater
Ein Friulaner in Diensten von Maria Theresia
Künstler und Musiker
Zwei italienische Bäckersöhne in Heiligenkreuz
Das Wiener Ende der »Vier Jahreszeiten«
Vom Ei zum Pinguin
Italienischer Klassizismus in Eisenstadt und Wien
Italienerinnen an der Macht
Eine Italienerin in der Reihe der »Schwarzen Mander«
Erinnerungen an Parma
Eine Medici wird Landesfürstin von Tirol
Italienische Mosaiksteine
Achtung: Eine italienische Wespe kommt Ihnen entgegen!
Ein Wiener Ausflugsziel aus dem Friaul
»Mehr Spleen als Sport«. Ein Italiener auf dem Großglockner
Venezianische Kostüme mitten in Österreich?
Toskanische Eremiten auf dem Kahlenberg und in Landsee
Eine Gasse für Verletzte
»Weißes Gold« wohin man schaut
Arsenal hier und dort
Eine toskanische Villa im Salzkammergut
Kunsthandlung Artaria & Comp.
Norditalienische Spuren in der Burg Kreuzenstein
Italienische Messen in Wien
Servus, Ciao und Baba
Literatur
Bildnachweis
Namensregister
Ortsregister
Oliven und Zypressen am Franziskusweg in der Toskana
Italien auf einer Serviette
Ein Novemberabend in Florenz. Seit Stunden regnet es in Strömen, und die Fassaden der Renaissancepaläste spiegeln sich in den nassen Pflastersteinen. Der Pegelstand des Arno steigt kontinuierlich auf ein besorgniserregendes Niveau, und die Einwohner bereiten sich auf ein mögliches Hochwasser vor. Die Touristen haben – müde vom ehrfürchtigen Bewundern der vielen Sehenswürdigkeiten – in Restaurants und Trattorien Zuflucht gesucht. Wir sitzen mitten unter ihnen in einer kleinen Pizzeria unweit des Bahnhofs. Als Touristen fühlen wir uns freilich nicht – Touristen sind ja bekanntlich immer nur die anderen … – sondern vielmehr als alte Bekannte und als gern gesehene Gäste, die hier fast schon zu Hause sind. Wie so oft haben wir eine Gelegenheit genutzt, um in dieser schönen Stadt einen Zwischenstopp einzulegen. Diesmal sind wir auf dem Heimweg von einer Pilgerwanderung auf dem toskanischen Teil des Franziskusweges, dessen westliche Variante von Florenz über Assisi nach Rom führt.
Wieder einmal liegen wunderbare Tage in Italien hinter uns, und wie immer fällt uns der Abschied von unserem Lieblingsland schwer. Könnten wir nicht ein Stück Italien mit nach Hause nehmen? Etwas von der großartigen Kultur, ein Stückchen Architektur, ein wenig Malerei und ein paar Takte Musik? Nicht zu vergessen einige Köstlichkeiten aus der italienischen Küche – unbedingt den unvergleichlichen Cappuccino, bitte! – und eine Prise des italienischen Lebensgefühls. Doch Halt! Das müssen wir alles gar nicht mitnehmen, denn so manches davon haben wir in »bella Austria«. Kurzerhand nehmen wir eine Serviette und notieren uns die ersten italienischen Spuren in Österreich, die uns spontan einfallen.
Doch bevor wir im Detail mit der Spurensuche beginnen, gilt es, Grundsätzliches zu klären. So ist die Frage zu beantworten, was wir im Folgenden unter »Italien« verstehen. Genau genommen, kann man erst nach der offiziellen Gründung des italienischen Einheitsstaates im Jahr 1861 von Italien, von Italienerinnen und Italienern sprechen. In das vorliegende Buch haben selbstverständlich auch ältere Spuren Eingang gefunden. In diesen Fällen verstehen wir unter dem Begriff »Italien« alles, was zum heutigen italienischen Staat zusammengefügt wurde: vor allem der ehemalige Kirchenstaat, das einstige Großherzogtum Toskana, die Herzogtümer Parma und Modena, die Königreiche beider Sizilien, Piemont-Sardinien und Lombardo-Venetien. Dass wir in Österreich so viele italienische Spuren finden, liegt auch daran, dass im 18. Jahrhundert große Teile des heutigen italienischen Staatsgebietes zum Einflussbereich der Habsburgermonarchie gehörten: die Lombardei von Anfang des 18. Jahrhunderts bis 1796, Neapel von 1707 bis 1734, Sardinien von 1714 bis 1720 und Sizilien von 1720 bis 1734. Das Großherzogtum Toskana fiel 1737 an Franz Stephan von Lothringen, den Ehemann Maria Theresias, und Venedig stand zweimal unter der Herrschaft der Habsburger: von 1798 bis 1806 und von 1815 bis 1866.
Und wer ist für uns eine Italienerin oder ein Italiener? Wir haben hierbei eine einfache Regel aufgestellt: Die Person wurde erstens in einem Ort geboren, der heute zur Republik Italien gehört, und zweitens war ihre Umgangssprache in den Jugendjahren Italienisch, soweit sich dies überhaupt nachweisen lässt.
Italienischsprachige Einwanderer bzw. Saisonarbeiter aus den südlichen habsburgischen Provinzen oder aus den italienischen Fürsten- und Herzogtümern sowie Königreichen waren zu allen Zeiten an Wanderbewegungen nach Österreich und insbesondere in die Haupt- und Residenzstadt Wien beteiligt. Die Zuwanderer stammten aus allen sozialen Schichten und gehörten verschiedenen Berufsgruppen an: Sie waren Händler, einfache Bauarbeiter, Maurer, Steinmetze, Baumeister oder auch Architekten, Offiziere, Diplomaten, Komponisten, Hofdichter, Theaterleute, Sänger, Maler, Bildhauer und andere Künstler. Gerade die Gruppe der italienischsprachigen Künstler prägte im 17. und 18. Jahrhundert große Teile der sogenannten Hochkultur: das Theater, die Oper sowie das Bauwesen. Es fällt auf, dass zahlreiche Paläste und Kirchen in Österreich das Werk von italienischen Baumeistern, Architekten, Stuckateuren und Maurern oder von Fachleuten sind, die aus den österreichischen Erblanden stammten und in Italien studierten bzw. ausgebildet wurden. Letzteres gilt zum Beispiel für Johann Bernhard Fischer von Erlach, der 16 Jahre in Rom und Neapel lebte. Trotz des großen Einflusses auf Architektur und Kultur lag der Anteil der »Italiener« an der Wohn- und Arbeitsbevölkerung in der Residenzstadt Wien meist deutlich unter einem Prozent; nur um die Mitte des 17. Jahrhunderts dürfte er höher gewesen sein – wird aber auch da kaum mehr als fünf Prozent betragen haben. Kaiser Ferdinand III. und sein Sohn, Leopold I., dichteten in italienischer Sprache; die gebildete Schicht sprach Italienisch – oder verstand es zumindest. Von 1671 bis nach 1721 erschien in Wien auch zweimal wöchentlich eine italienische Zeitung, der Corriere italiano.
»Zitronensaure« Souvenirs von der Insel Capri
Man kann davon ausgehen, dass der Zuzug von Italienern in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts während der Regierungszeit Kaiser Leopolds I. relativ hoch war. Damals wurde Italienisch zur zweiten Hofsprache und der Kaiser selbst sprach und schrieb gerne Italienisch. Noch Anfang des 18. Jahrhunderts war die italienische Sprache neben der deutschen die am häufigsten verwendete am Wiener Hof. Auch der berühmte Barockarchitekt Johann Lucas von Hildebrandt – der 28 Jahre in Italien gelebt hatte und mit großer Wahrscheinlichkeit doppelsprachig aufgewachsen war – hat in seiner fast 50 Jahre dauernden Wiener Lebensphase viele Briefe in italienischer Sprache verfasst. Unter Franz Stephan von Lothringen nahm der italienische Einfluss deutlich ab, da dieser viele Fachleute aus seinem französischsprachigen Heimatland Lothringen an den Wiener Hof holte.
Die offensichtlichsten Spuren, die Italiener in Österreich hinterlassen haben, sind im Straßenbild der Städte zu finden: nicht nur durch Bauten, die von italienischen Baumeistern, Architekten und Handwerkern geplant bzw. errichtet wurden, sondern auch durch Straßennamen. Beispielsweise finden wir in Innsbruck zwei davon: Die Montessoristraße, die auf die italienische Ärztin Maria Montessori – Begründerin der nach ihr benannten Reformpädagogik – verweist, und die Negrellistraße, die nach Luigi Negrelli, dem Planer zahlreicher (Wasser-)Straßen, Brücken und Bahnen benannt ist. In Klagenfurt wird dem Ingenieur ebenfalls mit einer Negrelligasse gedacht. Die Adriagasse, Friaulgasse und Görzer Allee verweisen in Klagenfurt hingegen auf geografische Orte. In Wiener Neustadt finden wir die Cignaroligasse, benannt nach dem italienischen Maler Gianbettino Cignaroli, der das Hochaltarbild im Dom von Wiener Neustadt gestaltete, den Francesco-Solimena-Weg, der auf einen süditalienischen Maler verweist, sowie die Locatelligasse, benannt nach dem italienischen Komponisten und Violinisten Pietro Locatelli. In Wien sind – schon aufgrund der Größe der Stadt – deutlich mehr Namensspuren zu finden.
Portofino (Ligurien), einer der bekanntesten Orte Italiens
Doch uns interessieren auch die versteckten Spuren, die nicht sofort ins Auge fallen. Begleiten Sie uns auf unserer Suche durch Österreich und schwelgen Sie mit uns in der Sehnsucht nach dem »Land, wo die Zitronen blühn«. Buon viaggio!
An dieser Stelle dürfen wir ein »Mille grazie« an jene Menschen aussprechen, die uns Anregungen, Hinweise oder Auskünfte gegeben sowie Fotos zur Verfügung gestellt haben: Christian Antz (Magdeburg), Gianni Casoni (Arezzo), Josef Hlavac (Wien), Silvia Hochedlinger-Kassar (Bregenz/Wien), Brigitte Krizsanits (Eisenstadt), Patrizia Lombardi (La Spezia), Bernadette Kalteis (Melk), Loredana Flore-Selichar (Wien). Zu guter Letzt danken wir Madeleine Pichler vom Amalthea Verlag und der Lektorin Helene Sommer für die angenehme Zusammenarbeit.
Schnitzel und Caffè
Ein Arme-Leute-Gericht: die Pizza
Sie hat einen Durchmesser von 30 bis 35 Zentimeter, einen dicken Rand ohne Blasen oder Brandflecken und ist weich und elastisch. Ihr Teig besteht ausschließlich aus Wasser, Mehl, Hefe und Salz. Nachdem er mindestens acht Stunden lang gerastet hat, wird er zu gleichmäßig runden Fladen geformt und mit den Zutaten – die möglichst aus der Region Kampanien stammen sollten – belegt. Nach nur 60 bis 90 Sekunden im mindestens 430 Grad Celsius heißen Holzofen ist sie fertig: die »echte neapolitanische Pizza«. Sie wird entweder als Pizza Marinara mit Tomaten (Paradeisern), Olivenöl, Oregano und Knoblauch oder als Pizza Margherita mit Tomaten, Olivenöl, Mozzarella oder Fior di latte, geriebenem Käse und Basilikum serviert. Natürlich gibt es noch eine Vielzahl anderer köstlicher Pizzasorten – doch die verdienen nicht das Prädikat »echt neapolitanisch«, wie man in den Bestimmungen der AVPN, der »Associazione Verace Pizza Napoletana« (Vereinigung zum Schutz der wahrhaftigen neapolitanischen Pizza), nachlesen kann. Die Vereinigung wurde im Jahr 1984 von Antonio Pace, einem pizzaiolo (Pizzakoch) aus Neapel, gegründet. Auslöser war die zunehmende Verbreitung von Fastfoodketten und anderen Anbietern, die unter der Bezeichnung »echt neapolitanische Pizza« Teigfladen herstellten, welche dieses Prädikat im qualitativen Sinne oft nicht verdienten. Um dem gegenzusteuern, setzte man sich das Ziel, den guten Ruf und die Wertschätzung der echten Pizza zu erhalten – einer Pizza, die nach neapolitanischer Tradition und aus den qualitativ besten regionalen Zutaten hergestellt wird. Hatte der Verein anfangs nur rund 20 Mitglieder in Neapel, so sind es gegenwärtig mehr als 700 Pizzerien und Restaurants auf allen Kontinenten, welche die strengen Auflagen der Associazione erfüllen. Vier davon finden wir in Österreich: eine Pizzeria in Feldkirch und drei Pizzerien in Wien.
Pizza Margherita
Sicherlich kann man auch in vielen anderen italienischen Restaurants und Pizzerien in unserem Land ausgezeichnete Pizzen essen. Die Auswahl an Lokalen ist riesig: Ein Blick in einige Branchenverzeichnisse zeigt – je nach Anbieter – zwischen 1100 und 1800 Einträge, das »Firmen A–Z« der Wirtschaftskammer bringt immerhin 178 Treffer.
Doch was ist das schon im Vergleich zur Pizza-Stadt Neapel, die an die 500 Pizzerien beherbergen soll. Neapel gilt als jener Ort, von dem aus die Pizza ihren Siegeszug rund um die Welt angetreten hat. Wann sie tatsächlich entstanden ist, lässt sich nicht leicht beantworten: Es gibt Hinweise, dass schon die Ägypter und Babylonier belegte und im Ofen gebackene Teigfladen gegessen haben. Auch in Pompeji bei Neapel sollen zu Zeiten der Römer bereits Vorläufer der heutigen Pizza verzehrt worden sein.
Wurde in Neapel bereits im 18. Jahrhundert eine Pizza, wie wir sie heute kennen, gebacken? Stammt das älteste gedruckte Pizza-Rezept tatsächlich aus dem Jahre 1858? Fragen über Fragen …
Das Wort »Pizza« soll jedenfalls aus dem neapolitanischen Dialekt stammen. Ursprünglich galt dieses einfache und billige Gericht als »Arme-Leute-Essen«, das in Neapel von fliegenden Händlern im Straßenverkauf angeboten wurde; man aß es – wie vielerorts noch heute durchaus üblich – im Stehen aus der Hand. Das Servieren in Lokalen kam erst später auf: Die erste Pizzeria im heutigen Sinne wurde wahrscheinlich 1830 eröffnet und existiert noch immer als Antica Pizzeria Port’Alba.
Unabhängig vom Ort des Verzehrs gilt die »Pizza Margherita« als bekannteste und einfachste Pizza – nicht nur in Italien. Zahlreiche Versionen der Legende ihrer Entstehung sind im Umlauf. Im Mittelpunkt steht Margherita di Savoia, die ab 1868 Gemahlin des späteren italienischen Königs Umberto I. war und für die in Neapel eine Pizza mit Basilikumblättern (grün), Tomaten (rot) und Mozzarella (weiß) belegt wurde. Diese »patriotische Pizza« in den drei Farben der italienischen Flagge (»Tricolore«) wurde – darin stimmen mehrere Autoren überein – nach der Königin benannt. Datiert wird diese »Erfindung« auf den Juni 1889, als das Königspaar in der auf einem Hügel Neapels gelegenen Sommerresidenz Capodimonte den Sommer verbrachte. Der neapolitanische Pizzabäcker Raffaelle Esposito soll dem Königspaar damals drei verschieden belegte Pizzen serviert haben: eine davon mit der Tricolore, einer Zubereitungsart, die zu dieser Zeit in Neapel schon bekannt war. Von dieser Begebenheit – die als Geburtsstunde der Pizza Margherita gilt – berichtet eine Marmortafel an einem Haus an der Via Chiaia Ecke Salita S. Anna di Palazzo, in dem schon seit 1780 Pizzen gebacken werden. Die heute dort befindliche Pizzeria Brandi – Antica Pizzeria della Regina d’Italia geht auf Enrico Brandi zurück, den Schwiegervater Raffaelle Espositos. Wie sich die Geschichte rund um die Königin wirklich zugetragen hat und ob Esposito damals tatsächlich zum ersten Mal Mozzarella als Pizza-Belag verwendet hat, ist nicht belegt. Der heutige Besitzer der Pizzeria Brandi wirbt jedenfalls nicht nur mit der Gedenktafel um Gäste; im Lokal kann man auch ein Dankschreiben des königlichen Hofes für die Lieferung der »Pizze buonissime« aus dem Jahr 1889 bewundern.
Eine Pizzeria in der Wiener Innenstadt
So schwierig die Fragen nach der »Erfindung der Pizza« und der ersten Pizzeria in Neapel zu beantworten sind, so unklar ist die Geschichte der Pizza und der Pizzerien in Österreich. Verwundert nehmen wir zur Kenntnis, dass bereits in den 1930er-Jahren Pizzen in Österreich angeboten wurden. So bewarb im Oktober 1938 die »Taverna Est« in der Salzburger Festungsgasse ihr Lokal mit der »neuen Spezialität: Pizza Napolitaner«, die schon einen Monat später korrekter als »Pizza Napolitana« bezeichnet wurde. Wann das erste Lokal in Österreich unter der Bezeichnung »Pizzeria« eröffnet wurde, ist nicht ganz eindeutig zu beantworten. Erst Mitte der 1970er-Jahre sperrten zwei Lokale unter dem Namen »Pizzeria« auf, die – soweit man das heute noch nachweisen kann – unter den ersten in Österreich gewesen sein müssen: im Jahr 1974 die »Pizzeria Grado« in der Beatrixgasse im dritten Wiener Gemeindebezirk, die von einem Österreicher betrieben wurde und bald 22 verschiedene Pizzen anbot, und 1975 die »Pizzeria Il Mare«, die vom Südtiroler Pasquale Tavella in der Zieglergasse im siebenten Bezirk gegründet wurde und noch heute von seiner Familie geführt wird.
Ganz gleich, wie alt die Pizza ist, wer sie »erfunden« hat und seit wann es sie in Österreich gibt: Der Besuch einer Pizzeria und der Genuss einer knusprigen Holzofenpizza bei italienischer Hintergrundmusik ist für viele Österreicher ein probates Mittel, sich ins Land ihrer Träume zu zaubern.
Von der Oper zum Kaffeehaus – die Tomasellis
»Herr Tomaselli, ein seit Kurzem aus Salzburg hierher berufener, bey der k. k. Hofcapelle angestellter Sänger, ist ein Tenor von vorzüglicher Schönheit, und besitzt nebst einer Stimme von großem Umfange, sehr gründliche musikalische Kenntnisse, und gehört dadurch unter die besten Professoren des Gesanges in dieser Hauptstadt [Wien].« Mit diesem kurzen Beitrag in der periodisch erscheinenden Publikation Vaterländische Blätter für den österreichischen Kaiserstaat aus dem Mai 1808 beginnt jedoch nicht die Geschichte einer Opern-, sondern die einer Kaffeehauslegende: des »Café Tomaselli«, einer Salzburger Institution mit italienischen Wurzeln. Der hier erwähnte Hofmusiker Giuseppe (Joseph) Tomaselli (1758–1836) kam 1781 nach Salzburg, in die Hauptstadt des damaligen Fürsterzbistums gleichen Namens. Geboren worden war er in Rovereto nahe dem Gardasee (Provinz Trient). Nachdem er seine berufliche Tätigkeit als Sänger in Mailand begonnen hatte, verpflichtete der Salzburger Fürsterzbischof Hieronymus Graf Colloredo den talentierten Künstler 1781 als Hoftenor der Salzburger Hofkapelle. 25 Jahre blieb Giuseppe in der Stadt an der Salzach – als Sänger und gefragter Gesangslehrer. Als das Fürsterzbistum Salzburg Anfang des 19. Jahrhunderts in das österreichische Kaiserreich eingegliedert und die fürsterzbischöfliche Hofkapelle aufgelöst wurde, wechselte Tomaselli 1807 als »k. k. Hofcapellen-Sänger« in die Residenzstadt Wien.
Das Café Tomaselli am Alten Markt in der Stadt Salzburg
Doch wie kam nun die Familie des Sängers Giuseppe Tomaselli zu einem Kaffeehaus in Salzburg? Zur Beantwortung dieser Frage gehen wir zurück in das Jahr 1800, in dem der verwitwete Sänger die 25-jährige Kaffeehausbesitzerin Antonia Honikel heiratete, die als Stieftochter eines Cafetiers ein »Kaffeesiederstöckl« (ein kleines Gebäude) in der Salzburger Getreidegasse geerbt hatte. Da sie selbst keine entsprechende Ausbildung vorweisen konnte, wurde vorerst eine eigene Geschäftsführung eingesetzt. Als einer ihrer Söhne, Carl (1809–1887), in Wien das Zuckerbäckerhandwerk erlernte, schenkte ihm seine Mutter das Kaffeehaus in Salzburg. Mit dem 1834 durch den Magistrat genehmigten Betrieb des nun selbstständig arbeitenden Zuckerbäckers Carl Tomaselli begann die Erfolgsgeschichte des legendären »Café Tomaselli« in Salzburg. Nachdem Carl das Café am Standort Getreidegasse 18 Jahre lang geführt hatte, konnte er 1852 zusätzlich das Staigerische Kaffeehaus am Alten Markt erwerben, welches von der Cafetier-Familie Staiger bereits im Jahr 1700 in der Goldgasse gegründet worden und 1764 auf den Alten Markt übersiedelt war. Dort wird es seit der Übernahme durch Carl Tomaselli bis zum heutigen Tag unter dem bekannten Namen »Café Tomaselli« betrieben. Aber nicht allein das erfolgreiche Bestehen dieses Kaffeehauses über mehr als eineinhalb Jahrhunderte ist beeindruckend. Es erstaunt auch der Umstand, dass – wenn man die vorhergehenden Eigentümer mitrechnet – das Café Tomaselli das älteste, mit einer kleinen Ausnahme durchgehend geöffnete Kaffeehaus Österreichs ist. Wie der Historiker Gerhard Ammerer Anfang des 21. Jahrhunderts nachweisen konnte, geht die Tradition des Kaffeehauses – wie erwähnt – auf das Jahr 1700 zurück, und nicht – wie an der Fassade des Hauses am Alten Markt angegeben – auf das Jahr 1703.
Wie Carl Tomaselli sein Café am Alten Markt und sein Zuckerbäckergeschäft in der Getreidegasse bewarb, zeigt eine Inseratenserie im März 1865 in der Salzburger Zeitung: »Gefertigter macht hiemit die ergebenste Anzeige, daß sein Zuckerbäcker-Verkaufs-Lokale in der Getreidgasse Nr. 249, gegenüber dem Gasparottischen Kaffeehause, neu restaurirt wurde, und daselbst alle Gattungen Bäckereien täglich frisch und in bester Qualität zu den billigsten Preisen zu bekommen sind. Bestellungen aller Gattungen Bäckereien, Torten und Gefrornen werden daselbst angenommen und pünktlich ausgeführt. Theils durch die billige Preiseintheilung, hauptsächlich aber in dem ebenfalls neu eingerichteten Arbeits-Lokale alles frisch erzeugen zu können, glaube ich meinen geehrten Abnehmern am Besten entgegen zu kommen. Indem ich zugleich für das mir bisher geschenkte Vertrauen danke, empfehle mich zu fernerem gütigen Zuspruch ergebenst Carl Tomaselli, Zuckerbäcker.« Ungeachtet der Bescheidenheitsfloskeln war Carl zu diesem Zeitpunkt bereits sehr angesehen und konnte auf viele Jahre Erfahrung zurückgreifen.
1874 übergab er im Alter von 65 Jahren den Betrieb an seinen Sohn gleichen Namens. Jahre zuvor hatte er seinen Betrieb vergrößert: durch den Bau eines Kiosks gegenüber dem Lokal, von dessen Anziehungskraft die Salzburger Zeitung im August 1860 berichtete: »Sowie die Phisiognomie unserer Stadt seit Eröffnung des Eisenbahnverkehres [die Kaiserin Elisabeth-Bahn zwischen Wien und Salzburg] durch die zahlreichen Fremden eine großstädtischere geworden ist, so suchen die hiesigen Bewohner auch fortwährend ihre Häuser, öffentlichen Lokalitäten und Kaufläden zu verschönern. Der elegante Pavillon Tomasellis auf dem Marktplatze bildet bereits ein beliebtes Rendezvous der Touristen […].« Der Kiosk, der heute an diesem Ort steht, ist allerdings ein Neubau aus dem Jahre 1910.
»Beliebtes Rendezvous«: der Kiosk Tomaselli schräg gegenüber dem Café
Mit dem in der Zeitung angesprochenen Touristenboom stieg die Nachfrage im Café am Alten Markt, und so ließ Carl Tomaselli junior im Jahr 1894 die Fassade und das Innere umbauen. Die Pläne für den Umbau stammten ebenfalls von einem gebürtigen Italiener, dem in Gemona del Friuli (Region Friaul-Julisch Venetien) geborenen Baumeister und Architekten Jakob Ceconi (1857–1922), dessen Eltern kurz nach seiner Geburt nach Salzburg übersiedelt waren. Seine Firma Valentin Ceconi & Sohn, die bereits sein Vater gegründet hatte, war damals eines der bedeutendsten Bauunternehmen in Österreich.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges machte das Café Tomaselli turbulente Zeiten durch: Die US-Amerikaner richteten in einem Teil des Erdgeschoßes eine Erste-Hilfe-Station ein. Sie führten das Café zuerst als »Forty Second Street Cafe« und später als »Flamingo Club« weiter – mit Kaffee in Plastikbechern. Im Sommer 1950 wurde das Kaffeehaus von der Familie Tomaselli als traditionelles Café wiedereröffnet und wird heute noch immer von den Tomasellis – mittlerweile in der fünften Generation – geführt. Welches Kaffeehaus auf der Welt kann das schon von sich behaupten …
Heiße Grüße aus dem Süden: Maroni
Lateinisch heißt der Baum Castanea sativa. Doch im deutschsprachigen Raum kennt man diese Baumart fast ausschließlich über ihre Früchte. Die Rede ist von den Maroni (italienisch: Marroni) und dem Esskastanienbaum, der auch als Edelkastanie – zur Unterscheidung von der mit ihm nicht verwandten Rosskastanie – bezeichnet wird.
In Italien wie auch im übrigen Südeuropa wird die Edelkastanie als Obstbaum kultiviert, in Gebieten mit mildem Klima kann sie aber auch ohne menschliches Zutun wild aufkommen. In Österreich dürfte sie ursprünglich nicht heimisch gewesen sein; in milden Lagen mit hohen Sommertemperaturen konnte sie aber angepflanzt werden. Als »Importeure« werden die Römer vermutet. Das größte nördliche Vorkommen in Österreich von – eher strauchartig wachsenden – Esskastanien findet sich im Gebiet des Eichberges (Gemeinde Gloggnitz) an der niederösterreichischen Semmeringbahn.
Vielseitige Köstlichkeit: die Nüsse der Esskastanie (Maroni) in ihrem Fruchtbecher
Südlich der Alpen können Esskastanien bei einem Stammdurchmesser bis weit über einem Meter ein Alter von über 500 Jahren erreichen, in unseren Breiten werden sie nie so alt. Das Holz wird noch heute für Rebstöcke oder Zaunpfähle und – da es gegen Feuchtigkeit widerstandsfähig ist – im Schiffsbau und bei der Herstellung von Fassdauben verwendet. In den südlichen Ländern erfährt das der Eiche ähnliche Holz eine hohe Wertschätzung: Es wird zur Herstellung von Möbeln, Furnieren, Parkettböden und Musikinstrumenten genutzt. Vor allem in der Toskana und in Umbrien dient es als Bau- und Konstruktionsholz (zum Beispiel für Dachbalken). Aufgrund des hohen Gerbstoffgehalts wurde die Edelkastanie in den Mittelmeerländern über Jahrhunderte auch als Gerbstofflieferant verwendet. In den Alpenländern setzt man das Holz hingegen bei der Lawinenverbauung und der Sicherung von Böschungen ein.
Auffällig sind neben den grob gezähnten, dunkelgrünen Blättern die Früchte: meist zwei oder drei glänzend rotbraune Nüsse in einem weichstacheligen Fruchtbecher, der sich am Boden mit vier Klappen öffnet. Die stärkereichen Früchte werden in Italien traditionell als Nahrungsmittel verwendet: Die Maroni röstet man, kocht sie in Wasser, dämpft sie im Backofen oder verarbeitet sie zu Mehl oder Mus. Kastanien galten in einigen Regionen Italiens, unter anderem im Friaul, in der Toskana und in Umbrien, über Jahrhunderte als Hauptnahrungsmittel. Die Kastanienernte – meist zwischen Ende September und Ende Oktober – war genauso wie die Olivenernte ein gesellschaftliches Ereignis und Fixpunkt im ländlichen Leben. Davon zeugen heute noch zahlreiche »Sagre di Castagne«, wie die örtlichen Kastanienfeste genannt werden, bei denen die Maroni in all ihren kulinarischen Facetten präsentiert werden.
Die Kastanien waren äußerst vielseitige Nahrungs-, Energie- und Rohstofflieferanten: Ihre Blätter wurden an Schweine und Hühner verfüttert und die Schalen zum Anzünden des Kamin- und Ofenfeuers verwendet. In harten Zeiten braute man auch ein Getränk daraus, indem man sie trocknete, rieb und wie Kaffee mit heißem Wasser aufgoss. Die Nüsse aß man entweder gekocht oder trocknete sie und ließ sie in einer Mühle zu Kastanienmehl mahlen, aus dem man gehaltvolle Speisen zubereiten konnte. Weit verbreitet war das sogenannte Baumbrot (pane d’albero), das im Winter eine wichtige Nahrungsgrundlage bildete. Es bestand aus gemahlenen Kastanien, Wasser und etwas Hefe und war so hart, dass es vor dem Verzehr in Wasser eingeweicht werden musste, was ihm auch die Bezeichnung Holzbrot (pane di legno) bescherte. Eine feinere Variante davon hat sich bis heute in der italienischen Küche erhalten: der Castagnaccio, ein köstlicher toskanischer Kuchen aus Kastanienmehl, Pinienkernen, Rosinen und Rosmarin.
Am besten Sie probieren ihn – nach einem Rezept von Daniela Braun – gleich selbst aus:
• 300 g Kastanienmehl
• 1 Prise Salz
• 3 Glas Wasser
• 7 Esslöffel kaltgepresstes Olivenöl
• 30 g Pinienkerne
• 50 g Rosinen
• 1 Zweig frischer Rosmarin
1. Das Kastanienmehl sieben und zusammen mit Salz und Wasser mit einem Schneebesen zu einem flüssigen, klumpenfreien Teig verarbeiten.
2. Danach das Olivenöl unterrühren und schließlich drei Viertel der Pinienkerne sowie der Rosinen hinzugeben.
3. Den Teig auf ein vorher mit Olivenöl eingeöltes Backblech geben und darüber die restlichen Pinienkerne und Rosinen streuen, den Rosmarin zupfen.
4. Bei dieser Menge reicht ein kleines Backblech aus. Es sollte allerdings darauf geachtet werden, dass die Teighöhe nicht mehr als zwei Zentimeter misst.
Der Castagnaccio ist dann fertig, wenn seine Oberfläche reißt. Er sollte möglichst lauwarm verzehrt werden und kann abgedeckt drei bis vier Tage aufbewahrt werden.
Maronibrater in Wien um 1910
Jetzt stellt sich die Frage, seit wann bei uns in Österreich Maroni als Nahrungsmittel verwendet werden. Eine Möglichkeit zur Beantwortung dieser Frage führt über frühe Zeitungsinserate. In der Wiener Zeitung findet sich im November 1786 eine bezahlte Mitteilung, dass der Bozener »Früchthändler« Joseph Bodner »mit den schönsten und von der besten Qualität aller Sorten Tyrollerfrüchte [Früchte aus Tirol] alhier [am Fleischmarkt in Wien] angekommen [ist], und verkauft solche um die billigsten Preise: als weisse Rosmarinäpfel, rothe deto, Muskatel oder Pantafel, Maschanzger, Kaiseräpfel, Zitronibirn, Quitten, Märgränten, Lazerolli und Maroni oder Kastanien.« Der sich als Verkäufer von »Tyrollerobst« bezeichnende Bodner lässt sich auch noch in den 1790er-Jahren in Wien nachweisen.
Heute sind die »Maronibrater« in ganz Österreich ab dem Herannahen der kühleren Jahreszeit aus dem Straßenbild nicht mehr wegzudenken. Sie dürften bereits um die Mitte des 19. Jahrhunderts in den Städten zu finden gewesen sein. Wie auch die Straßenverkäufer anderer Lebensmittel fielen sie durch einen Kaufruf auf: »Marroni arrostiti« (geröstete Maroni). Die Anzahl der Maronibrater erhöhte sich über die Jahrzehnte; Anfang der 1870er-Jahre zählte man alleine in der Residenzstadt Wien rund 500 von ihnen. Dies dürfte ein Grund gewesen sein, dass diejenigen Standler zur Kasse gebeten wurden, die auf Flächen des vom Innenministerium verwalteten Stadterweiterungsfonds ihre Glutöfen aufstellten. Der Staat mehrte damit seine Einnahmen und regulierte so indirekt auch den Markt der Anbieter. Auf öffentlichen Flächen, die hingegen dem Magistrat der Stadt Wien unterstanden, wurde den Maronibratern der sogenannte Platzzins erlassen. Doch das Beispiel des Stadterweiterungsfonds machte bald Schule. Im Jahr 1874 beantragte der Magistrat beim Wiener Gemeinderat, dass auch von Maronibratern auf öffentlichen Flächen im Eigentum der Stadt ein Platzzins – von mindestens fünf Gulden – einzuheben sei. Leiser Protest regte sich. So hieß es im September 1874 in der Morgen-Post: »Nun werden auch die Maronibrater besteuert! Das ›Maronibraten‹ wurde früher in Wien als ›freie Kunst‹ betrachtet und nicht besteuert, weil, wie es in den amtlichen Erhebungen über die Maronibraterfrage hieß, sich nur ›der ärmste Theil der Bevölkerung diesem Geschäfte widmet‹. Schlechte Beispiele aber verderben gute Sitten und weil der ›Stadterweiterungsfonds‹ anfing, auf den Plätzen, über welche er Gewalt hatte, auch die Maroniduftverbreiter zu besteuern, folgte der Magistrat und hebt nun fünf Gulden für jedes ›Kastanien-Oeferl‹ ein.« Wie wir heute wissen, hat diese Steuer der Maronibraterei nicht sehr geschadet, und so können wir noch heute auf vielen öffentlichen Plätzen der Städte und auf Weihnachtsmärkten geröstete Maroni erstehen. Bis heute kommen die meisten davon aus Italien.
Gelato! Gelato!
»Gelato! Gelato!« Dieser Ruf weckt in vielen Menschen Kindheitserinnerungen an Badeurlaube an der Adria, an Sonne, Strand, Meer – und ein köstliches Eis. Wieder daheim, freute man sich auf einen Besuch im Eissalon, der meist einen wohlklingenden italienischen Namen hatte und in dem man genüsslich den Erinnerungen an den Süden nachhängen konnte. Das Eis schmeckte tatsächlich so gut wie in Italien – und daran hat sich bis heute nicht viel geändert – kein Wunder, denn seit Jahrzehnten prägen Italiener die österreichische Speiseeiskultur.
Die ersten, die in Europa die Kunst der Speiseeiserzeugung beherrschten, waren die Sizilianer. Scherbet – Halbgefrorenes – hieß die erfrischende Köstlichkeit, die von China über Indien, Persien und den arabischen Raum den Weg nach Europa gefunden hatte. In Sizilien wurde das sorbetto im 16. Jahrhundert aus Schnee und Salz (es ist tatsächlich richtiger Schnee gemeint und nicht Schnee aus Eiklar!) im Verhältnis 1 zu 3 hergestellt, während man in Florenz das heute beliebte cremige Speiseeis – il gelato – erfand: Es sollen zwei Florentiner gewesen sein, die für einen Kochwettbewerb der Familie Medici erstmals eine gefrorene Mischung aus Eierlikör, Sahne und Obst zubereiteten. Als einer von ihnen nach Paris übersiedelte, hielt die neue Spezialität am französischen Hof Einzug und soll sich zur Zeit des Sonnenkönigs Ludwig XIV. beim Adel großer Beliebtheit erfreut haben. Damals beherrschten nur wenige Fachleute die schwierige und kostspielige Herstellung von Speiseeis, das demzufolge dem Adel und der reichen Bürgerschaft vorbehalten war.
Eine »Gelateria« in Krems an der Donau
In Wien konnte man das »Gefrorene« ab dem 18. Jahrhundert in den sogenannten Limonadenzelten und Sommerkaffeehäusern genießen. Zwei dieser beliebten Lokale wurden von den Italienern Giovanni Taroni (gestorben 1777) und Giovanni Milani (1729–1808) am Graben und am Kohlmarkt beziehungsweise auf der Burgbastei betrieben. Dort durften Erfrischungsgetränke, Früchte in Wein und »Gefrorenes« serviert werden, welches bereits in einer großen Auswahl an Sorten – von verschiedenen Früchten über Mandeln bis Vanille und Schokolade – angeboten wurde. Auch in Kaffeehäusern konnte man immer öfter Eis bestellen.
Diejenigen, die das Eis für den »kleinen Mann von der Straße« erschwinglich machten, waren allerdings die italienischen Eismänner, die gelatieri. Unter den Zuwanderern aus verschiedenen Berufsgruppen, die von Italien nach Wien kamen, findet man im Wiener Stadtarchiv in Akten aus dem 16. Jahrhundert auch einen Eisverkäufer. Der große Zustrom begann allerdings erst im 19. Jahrhundert, als gelatieri