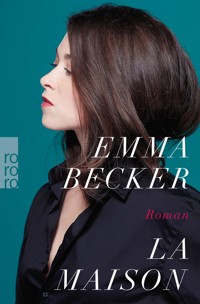
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von Zimmer zu Zimmer, von Mädchen zu Mädchen führt uns Emma Becker durch "La Maison", das Haus in Berlin, in dem sie selbst zwei Jahre lang als Prostituierte gearbeitet hat, und erzählt Geschichten. Sie nennt sich Justine. Und Justine hat Spaß am Sex. Viele Frauen hier führen ein Doppelleben, sie sind Krankenschwestern, Mütter, Ehefrauen, ihre Männer und Kinder wissen nicht, was sie tun. Diana zum Beispiel hat eine vierzehnjährige Tochter. Pünktlich, wenn die Tochter aufwacht, ist Diana zu Hause und macht Frühstück. Yvette und Selma sind Freundinnen, die alles teilen. Lotte schafft es nicht, einen Kunden zu enttäuschen, der sich in sie verliebt hat. Die Frauen sind sehr unterschiedlich, aber alle haben etwas gemeinsam: Sie fühlen sich in "La Maison" zu Hause. Dort tauschen sie Vertrautheiten aus, ihre geheimen Gedanken. Ein berührender, mutiger Roman, der in Frankreich die Kritiker begeisterte, eine Debatte entfachte und zum Bestseller wurde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 494
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Emma Becker
La Maison
Roman
Über dieses Buch
Von Zimmer zu Zimmer, von Mädchen zu Mädchen führt uns Emma Becker durch «La Maison», das Haus in Berlin, in dem sie selbst zwei Jahre lang als Prostituierte gearbeitet hat, und erzählt ihre Geschichten.
Mit großer Humanität, hintergründigem Humor und gnadenloser Ehrlichkeit beschreibt sie die Frauen und Männer, die hier ein und aus gehen, und nimmt sie ernst in dem, was sie tun und wollen. Sie selbst nennt sich Justine, und Justine hat Spaß am Sex. Diana führt ein Doppelleben, ihr Sohn weiß nicht, wo sie arbeitet; Loretta ist tagsüber Krankenschwester; Gita schafft es nicht, einen Kunden zu enttäuschen, der sich in sie verliebt hat.
Die Mädchen sind sehr unterschiedlich, aber alle haben etwas gemeinsam: Sie fühlen sich in «La Maison» zu Hause. Dort tauschen sie Vertrautheiten aus, ihre geheimen Gedanken.
Ein berührender, mutiger Roman, der in Frankreich eine Debatte anregte und die Kritiker begeisterte.
Vita
Emma Becker, geboren 1988 im Großraum Paris. Sie lebt mit ihrem kleinen Kind in Berlin. «La Maison» ist ihr dritter Roman. Sie erhielt dafür den Prix Blù Jean-Marc Roberts, den Prix du Roman News, den Prix du Roman des Étudiants France Culture/Télérama und stand auf der Shortlist für den Prix Renaudot und den Prix de Flore.
Claudia Steinitz, geboren 1961 in Berlin. Sie übersetzte u.a. Nancy Huston, Yannick Haenel und Virginie Despentes aus dem Französischen. Ausgezeichnet mit dem Johann-Friedrich-von-Cotta-Übersetzerpreis der Landeshauptstadt Stuttgart und dem Jane-Scatcherd-Preis.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel «La Maison» bei Flammarion, Paris.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2020
Copyright © 2020 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«La Maison» Copyright © 2019 by Emma Becker
Covergestaltung any.way, Hamburg, nach einem Entwurf von Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Pascal Ito / Flammarion
ISBN 978-3-644-00259-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Louis Joseph Thornton,
wunderbarer Mann und Vater.
Für Désirée.
Und für die Mädchen, für uns alle.
«Diese Spalte, die schmale Narbe, die sich nie anders öffnet als in einem endlosen Lächeln. Schwarz. Klaffend. Zahnloses Lächeln. Seltsam lasziv. Vielleicht gibt es nichts anderes am Ende unserer Unruhe, ist die einzige Antwort das unbändig stumme Lachen dieses klebrigen Lochs.»
Louis Calaferte, Septentrion
Vous qui passez sans me voir, Jean Sablon
Mein Sohn räumt begeistert den Kleiderschrank aus, während ich sein Bett mache. Ich suche eine Steppdecke, die auf seine Matratze passt – doch beim Öffnen der Flurkommode fällt mir als Erstes die drei mal drei Meter große Tagesdecke ins Auge, die ich gekauft habe, als La Maison zumachte. Hastig zusammengelegt und nie gewaschen, wartet sie dort seit fünf Monaten.
«Hilfst du mir, die Tagesdecke auszubreiten?», fragt mich Inge im roten Zimmer. Die Decke kommt gerade aus dem Trockner, sie ist warm, fast lebendig in unseren Händen. Ich musste sie waschen, weil ein Gast Öl darauf ausgekippt hatte. Jede auf einer Seite des riesigen Betts streichen Inge und ich zärtlich die Falten glatt. Wir unterhalten uns – worüber? Keine Chance, mich daran zu erinnern. Aber ich bin gut drauf, liege super im Zeitplan, und es ist fast Feierabend. Inge schiebt die Organdy-Vorhänge zur Seite, um das Zimmer zu lüften, von draußen dringt ein fast übernatürliches vorabendliches Strahlen des Spätsommers herein. «Ich geh runter, bis gleich», sage ich zu Inge und ziehe meinen schwarzen Mantel über. Sie singt fröhlich vor sich hin, und im Flur schwebt noch ein schwacher Geruch von Waschpulver und nackten Körpern.
Genau dieser Geruch hängt auch jetzt noch in der Tagesdecke, diesem Wunderwerk, das ich für lächerliche fünf Euro gekauft habe, als die Chefin alles für einen Apfel und ein Ei an uns verschleuderte, bevor die Inhaber anderer Bordelle in unseren Sachen wühlen würden.
Ich habe die Decke wie ein an der Autobahn ausgesetztes Hündchen nach Hause getragen und mir lange eingeredet, ich könne sie nicht waschen, weil meine Maschine zu klein sei. Hinter dieser Ausrede steckte einzig und allein die Angst, den Geruch für immer zu verlieren. Ohne ihn wäre es nur eine nicht besonders geschmackvolle Decke, zu groß für alles, ein störender Haufen Stoff, den ich trotzdem nie wegwerfen würde. Und da liegt sie nun mit ihrer großen Mittelfalte, die nicht gerade gezogen ist und unsere Matratze ziemlich schräg aussehen lässt. Während der Kleine neben mir weiter den Schrank ausräumt, werfe ich mich auf den duftenden Stoff, und in meinem Kopf dreht sich ein Kreisel bunter Erinnerungen. Der Waschmittelgeruch ist mir vertraut, ich könnte sogar die Sorte wiederfinden, wenn ich die nötige Zeit, Energie und Skrupellosigkeit aufbrächte, meiner Familie das Aroma des Bordells zu verpassen, in dem ich zwei Jahre gearbeitet habe. Wie aber soll ich den scharfen Geruch schwitzender Männer und stöhnender, sich windender Mädchen daruntermischen, den Geruch von Schweiß, Speichel und allen anderen menschlichen Säften, die auf den Fasern getrocknet sind, und wie die scharfe, manchmal unerträgliche Note der blauen Seife, die die Freier im Männerbad benutzten? Auch wenn ich sie nicht wasche, wird die Tagesdecke in der Luft des Zimmers irgendwann den Geruch des Kleinen annehmen; die Gespenster des Hauses (zu denen auch ich gehöre) werden sich verflüchtigen, der Duft wird Tag für Tag weniger werden, und am Ende sind die drei mal drei Meter bestickter Stoff ein jungfräuliches, nach Windeln und sauberer Babyhaut riechendes Tuch.
Ich sollte die Tagesdecke wie ein Buch aus dem Mittelalter hüten, sie nur ganz selten und unter optimalen Bedingungen ausbreiten, ohne zu viel Licht oder Bewegung. Als ich sie nach Hause trug, war ich irgendwie überzeugt, dass La Maison nicht endgültig schließen, dass uns im letzten Moment irgendwas oder irgendwer retten würde, dass ich künftig andere Accessoires hassen oder anbeten würde – und selbst wenn das Bordell hier verschwinden sollte, würde es unweigerlich anderswo neu erblühen. Ich war überzeugt, mit all dem, was ich in meine Wohnung stopfte, dem Bett aus dem weißen Zimmer, den Spiegeln, dem Nachttisch, dem Couchtisch, den Handtüchern, dem kleinen Ventilator, werde die Erinnerung überleben. Aber die Gegenstände haben eine so anmutige und diskrete Art, sich anzupassen …
Als meine Großmutter uns besuchte, fragte sie begeistert, wo wir das wunderschöne solide Bett gefunden hätten; überrascht stammelte ich etwas von einem Flohmarkt in Reinickendorf, auch wenn alles an diesem Bett das Bordell verrät. Wohin sonst passte so ein von romantischen Gipsfiguren, Tauben und blühenden Lorbeersträußen umkränzter Spiegel am Kopfende? Aber hier, in meinem Schlafzimmer, hatte das Bett seine ganze lächerliche Erotik verloren und den bescheidenen Anschein eines unverhofften Schnäppchens angenommen. Als ich verkündete, es habe gerade mal dreißig Euro gekostet, wiederholte meine Großmutter, es sei wirklich entzückend. Sie wollte wissen, wie wir es hergebracht hätten.
«Das war eine höllische Schlepperei», hörte ich mich antworten. An dem Tag regnete es, wir waren früh um sieben aufgestanden, um am anderen Ende von Berlin einen Transporter zu mieten, weil meine Augen mal wieder größer gewesen waren als der Kofferraum und wir außer dem Bett vier Spiegel, zwei Tische und einen Berg Plunder mitnehmen mussten, den ich keines Blicks gewürdigt hätte, wenn ich ihm nicht in diesem Haus begegnet wäre. Wir parkten in der Ausfahrt direkt vor der Tür, durch die meine Kolleginnen und eine Horde mit Maßbändern und Schraubenziehern bewaffneter russischer Möbelpacker kamen und gingen. Zum ersten Mal sah ich diese Haustür zwischen den zwei Buchsbaumbüschen so verzweifelt weit offen stehen. Das roch nicht nach Umzug, sondern nach Steuerschulden, Gerichtsvollzieher, Auflösung. In der ersten Etage war schon alles leer. Im Vorbeigehen warf Jutta einen langen Blick in das weiße Zimmer und seufzte: «Was für ein Elend!» Dann rannte sie weg, angeblich zu einer Verabredung, aber ich glaube, sie brachte es nicht fertig, das Bett aus dem Zimmer verschwinden zu sehen. Wir brauchten eine ganze Stunde, um es auseinanderzunehmen, es bestand aus drei unglaublich schweren Teilen, die absolut nicht für einen Transport geschaffen waren. Jemand hatte das Bett dafür entworfen, dort zu bleiben und das Zimmer nie mehr zu verlassen. Der Rost besteht aus massiven Holzbrettern, wir konnten mit aller Kraft darauf herumspringen und hörten kein Knacken, dafür war es gebaut, für Bewegung, für kräftige Stöße, für Hochzeitsnächte, wilde und flüchtige Umarmungen – nur nicht zum Schlafen. Genau deshalb schlafen wir so gut darauf. Wir versinken in der Erschöpfung all derer, die sich dort vierzig Jahre lang verausgabt haben. Aber das weiß niemand außer mir. Ich brauche immer eine Weile, ehe ich die Augen zumache, weil mich das Bedürfnis, mich im Spiegel zu betrachten, von meiner Müdigkeit ablenkt. Wenn ich den Kopf drehe, erwarte ich insgeheim immer noch, hinter meinen vorteilhaft drapierten Pobacken die weiße Kommode, in der Inge die Bettwäsche aufbewahrte, die sternförmige Lampe und das kitschige Gemälde einer Blondine am Fenster zu sehen, ich höre fast den Musikbrei, der aus den Lautsprechern quoll und dem ich meine Playlist aus der Hi-Fi-Anlage entgegensetzte. An jenem Tag dachte ich irgendwann, wir würden das Bett nie aus dem Zimmer kriegen und müssten es zerstückeln. Wir hatten bestimmt fünfzig Schrauben entfernt, und als wir versuchten, den Rahmen hochzuheben, drohte er zu zerbrechen. Am Ende mussten wir die fünf Russen zu Hilfe rufen, die in einem anderen Zimmer ein anderes Bett zerlegten. Wir fühlten uns wie die Gehilfen eines Bestattungsunternehmers. Da, wo das Bett gestanden hatte, war das Parkett heller, und ich überlegte mir, dass die Chefin ein ganz junges Mädchen gewesen sein musste, als diese Bretter das letzte Mal Licht gesehen hatten. Drei Viertel der Mädchen, die später auf diesem Bett lagen, waren damals noch nicht einmal geboren. Der Staub war ebenso alt. Wir beluden den Transporter und fuhren erschöpft und schmutzig los; es war das letzte Mal, dass ich das Haus, die Zimmer, die Buchsbaumbüsche, diese Straße in Wilmersdorf gesehen, das letzte Mal, dass ich diesen Geruch aufgesogen habe.
Stattdessen spinne ich nun an meiner Geschichte vom segensreichen Flohmarkt, wo wir ein Paar Spiegel, die ursprünglich vierhundert D-Mark gekostet hatten (wie dem Etikett auf der Rückseite zu entnehmen ist) für zwanzig Prozent des Preises bekommen haben. Und diese Lampe, die Handtücher, die Ablage … Das Einzige, was wirklich nach Bordell riecht, ist die Tagesdecke, die ich verstecke wie ein Brautkleid, nachdem die Ehe tragisch geendet hat. Erklären kann ich diesen Kauf nicht, die Decke ist tausend Meilen von meinem normalen Geschmack entfernt. Ihr Wert ist einzig und allein emotional, aber diese Emotionen lassen sich nicht ohne weiteres rechtfertigen – deshalb schreibe ich dieses Buch.
Am Ende habe ich keine Wahl, weil sich der Kleine nach seinem Bad splitterfasernackt in meine Arme kuschelt und ausgiebig auf die Tagesdecke pinkelt – jetzt muss ich sie waschen. Auf die Kinder können wir uns immer verlassen, wenn es darum geht, eine Seite umzublättern, die wir gern noch länger gelesen hätten. Hier beginnt die Trennung.
Und hier beginnt mein Buch.
«Man durfte nicht dahin gehen, wo die Dame mit den prachtvollen Kleidern wohnte. Niemand sprach mit ihr, niemand sagte ihr auch nur Guten Tag. Sie entführte kleine Jungs. Ihr Haus war voll davon. Voll kleiner Jungs, die man nie wiedergesehen hatte, die man nie wiedersehen würde, weil sie sie nacheinander auffraß. Die Dame mit den prachtvollen Kleidern war ein Freudenmädchen.»
Louis Calaferte, La Mécanique des femmes
«Doch die Leute im besetzten Haus
riefen: ‹Ihr kriegt uns hier nicht raus!
Das ist unser Haus, schmeißt doch endlich
Schmidt und Press
und Mosch aus Kreuzberg raus!›»
Ton Steine Scherben, Rauch-Haus-Song
Season of the Witch, Donovan
Wann habe ich angefangen, darüber nachzudenken? Ich hatte eine ganze Menge bescheuerter Ideen im Leben, aber ich glaube, diese eine war – mehr oder weniger bewusst – immer da.
Vielleicht war es vor fünfundzwanzig Jahren, an einem ganz normalen 14. Dezember in Nogent. Oder zehn Jahre später, als mir langsam der Unterschied zwischen kleinen Mädchen und Frauen auffiel. Vielleicht, als ich zu lesen begann. Vielleicht, als ich begriff, dass ich Joseph nicht halten kann, und allein und traurig durch die breiten, eisigen Straßen von Berlin lief. Vielleicht beginnt dieser Roman auch genau in dieser Nacht: Stéphane, der zu Besuch gekommen ist und sich darüber schwarz ärgert, liegt neben mir im Tiefschlaf; er zieht mir nicht nur die ganze Decke weg, sondern schnarcht auch noch dumpf und bedeutungsschwer. Wenn ich neben einem Mann, der schnarcht, der auch deshalb schnarcht, weil er keine Zwanzig mehr ist, nicht einschlafen kann, dann bedeutet das, dass ich mich wieder mal habe reinlegen lassen, dass ich entgegen meiner Erwartung und trotz meiner Liebe zu Stéphane eigentlich einen Jungen mit brandneuen, völlig freien Nebenhöhlen brauche – anders gesagt einen Jungen meines Alters. Unvorstellbar, oder?
Natürlich ist da noch Joseph. Joseph – den Namen in der Dunkelheit zu denken, ihn mit der Liebkosung der zart aufeinanderliegenden Lippen geräuschlos auszusprechen ist ein Schmerz, für den ich keinen Namen habe. Vielleicht ist es besser so. Vielleicht sollte ich Joseph nicht in diesen Roman mischen. Wenn jemand geht, ist es wie ein Tod, nur dass du nicht darüber hinwegkommst, weil der Gedanke, dass diese Person quicklebendig und gar nicht weit weg ist, dass sie nur für dich nicht mehr existieren will, immer wieder neues Salz in die Wunden spuckt. Es ist ein Tod. Und ich habe dazu beigetragen, Joseph zu töten, wie ich überhaupt damit beschäftigt war, alle Menschen, die ich liebe, langsam umzubringen.
Ich verstehe seinen Hass auf mich, im Vergleich zu meinem Selbsthass gleicht er allerdings eher einer schwachen Antipathie. Ich bin aus Feigheit nach Berlin gegangen und weil ich keinen anderen Weg sah, ihm begreiflich zu machen, dass ich ohne Hoffnung war. Dass wir ohne Hoffnung waren. Ich war überzeugt, dass ich dort, in dieser Stadt, Menschen finden würde, die mir ähnlich wären. Ich weiß noch nicht, ob es irgendwo auf der Welt Menschen wie mich gibt, aber die Straße ruft mich, immer wieder, lauthals, unter dem geringsten Vorwand. Seit Joseph weg ist, habe ich das Gefühl, den Atem anzuhalten, wenn ich nicht draußen bin, nicht laufe. Jetzt, während Stéphane schläft, so tief es nur geht, weiß ich nicht, was mich daran hindern sollte, wieder zu atmen. Also ziehe ich mich an, um zu fliehen. Als Stéphane noch nicht da war, starb ich vor Einsamkeit, aber kaum ist er angekommen, sehne ich mich nach mir selbst, wie immer, wenn jemand, egal wer, auf meine Gesellschaft hofft. Deshalb die überraschenden Fluchten. Alles, sogar das Reiben der Schnürsenkel, die ich mit angehaltenem Atem zubinde, sogar das Knacken meiner Knie, wenn ich mich bücke, um nach meiner Tasche zu greifen, spielt gegen mich und für den Schlafenden. Gott sei Dank könnte man im Schlafzimmer eine Kanone abfeuern, ohne dass Stéphane ein Auge aufmachen würde. Als ich die Tür schließe, fühle ich mich, als hätte ich mir die Freiheit gestohlen, wie ein Kerl, der zusieht, dass er wegkommt, nachdem er ein Mädchen in einer Bar angemacht und in ihrer Wohnung gevögelt hat.
So, mal wie eine Frau, mal wie ein Mann, fühle ich schon seit einigen Jahren. Eigentlich schon immer. Aber es ist mir noch nie so aufgefallen wie in Berlin, bei meinen einsamen nächtlichen Spaziergängen auf den großen, von Prostituierten gesäumten Straßen. Wie durch Zauberhand kreuzen sie meinen Weg, egal, wo ich entlanglaufe. Nachmittags um vier ist die Straße leer, aber kaum geht die Sonne unter (rasend schnell wie immer in Berlin im Februar), hast du einmal geblinzelt, da stürmen schon Legionen von Mädchen mit Kniestiefeln und Gürteltaschen den Bürgersteig. Seit ich hier wohne, habe ich das Gefühl, immer dieselben zu treffen, und wäre ich nicht so entsetzlich schüchtern, sobald es sich um Frauen handelt, würde ich sie so selbstverständlich grüßen wie die Händler in meinem Viertel. Vielleicht halten sie mich für eine Zivilpolizistin oder eine potenzielle Kollegin, die sich über ihre Arbeitsbedingungen informiert. Mein Refugium ist eine Bank ganz in der Nähe, idealerweise unter einer Laterne; ich setze mich hin und tue so, als würde ich lesen, oder ich lese tatsächlich, aber nie, ohne nach ihren Schatten zu schielen, die sich neben meinem bewegen.
Jedes Mal denke ich, das sind Frauen, die wirklich Frauen sind, die nur das sind. Eindeutig geschlechtliche Wesen, mühelos zu erkennen. Gäbe es bei ihnen auch nur die geringste Zweideutigkeit, würde sie im Überschwang der Accessoires und der Pheromone, mit denen sie ihr Stückchen Bürgersteig sättigen, ertrinken. Von Joseph habe ich die widersinnige Überzeugung übernommen, dass eine Frau, die ebenso viel und ebenso unbekümmert Sex hat wie ein Mann, eine Nutte sein muss, egal, in welcher Aufmachung und mit welchen Blicken sie sich anbietet. Das zeigt, wie schwer es Joseph in unseren drei gemeinsamen Jahren zwischen wilder Liebe und unsäglichem Hass gefallen sein muss, mich klar zu definieren. Vielleicht gab es am Anfang ein Missverständnis, doch irgendwann hat Joseph verstanden (nicht akzeptiert), dass die Hingabe und die Neugier, die mich im Bett auszeichneten, bei weitem nicht ihm allein vorbehalten waren – schlimmer noch, dass sie nicht auf ihn gewartet hatten, um zu erblühen. Wahrscheinlich hat er auch verstanden, dass sich meine Lust nicht auf einen Mann im Besonderen richtet, sondern auf die Gesamtheit der männlichen Art, gespickt mit unverständlichen Trieben, die sich nicht auf das Frohlocken des Fleisches beschränkten. Ich habe so viele Jahre damit verbracht, die Lust, den Körper überhaupt zu intellektualisieren, dass ich ihn fast befriedigen könnte, ohne auch nur ein Kleidungsstück abzulegen. Wie? Keine Ahnung. Wahrscheinlich schlafe ich genau deshalb weiter mit Männern, ich bilde mir ein, dass sich die Lösung des ewigen Rätsels gegen jede Erwartung genau da finden lässt.
Die Wahrheit ist, dass seit Josephs Fortgehen jeder Gedanke an körperliche Erleichterung verflogen ist. Ich denke nicht mal mehr daran, es ist so unwahrscheinlich wie irgendwas, mit einem anderen als ihm zum Orgasmus zu kommen. Meine Befriedigung läuft über die des Mannes, ich sehe ihn unter mir ausgestreckt, halte das Geheimnis zwischen den Schenkeln und begreife es nicht, bin überzeugt, mich ihm durch diesen wilden Ritt anzunähern, bei dem nur mein Gehirn aktiv ist. Mein Körper gibt sich dieser Farce gerne hin, aber ich kann mir noch so große Mühe geben, es mit der raffiniertesten Akrobatik treiben, immer ertönt in mir die ruhige, kalte Stimme eines lauernden Raubtiers: Kann sein, dass er gleich kommt. Wenn du ihn so streichelst, passiert’s. Wenn du etwas langsamer wirst, zögerst du es noch ein bisschen hinaus, aber guck mal, wie ihm die Haare auf der Brust zu Berge stehen, sieh dir die Gänsehaut auf seinem Bauch an – da, er kommt. Er starrt auf deine hüpfenden Brüste, und bei dem Anblick ist er nicht mehr zu bremsen.
Hinter dieser Stimme höre ich eine andere, unanständig kindliche, es ist die der immer noch Fünfzehnjährigen, die kaum fassen kann, was sie sieht. Die Bewegung meiner Brüste bringt ihn zum Höhepunkt, meine Brüste, diese winzigen Brüste, von denen ich nie geglaubt hätte, dass sie mehr als bloße Deko sind! Mein Körper, mein Geruch, die Art, wie ich mich bewege, die Geräusche, die ich mache – mein Körper saugt ihm langsam die Beherrschung und seine Säfte aus dem Leib, ist das nicht allein schon ein Wunder? Ich, ein Körper? Ein Körper, der geil macht? Krass!
Nach all den Jahren, in denen ich mich dieser Beschäftigung hingebe, sollte man annehmen, die anfängliche Begeisterung habe nachgelassen – aber nein. Jeder Mann, der mich anspricht und mehr oder weniger subtil seinen Wunsch äußert, das Bett mit mir zu teilen, wirkt auf mich wie eine Chance, die ich ganz fix ergreifen muss, bevor sie verschwindet. Als könnte ich womöglich wieder in der Haut des kleinen Mädchens aufwachen, das schon die Hoffnung aufgegeben hatte, für die Jungs etwas anderes zu sein als die Freundin mit Brille. Ich frage mich, was wohl im Kopf einer Hure vorgeht, wie ihr Ego, ihr Selbstwertgefühl aufgebaut ist. Von meiner kleinen Bank aus beobachte ich eine ganz junge Blondine, die eine Vogue pafft, während sie auf und ab geht. Sie trägt, wie ihre Kolleginnen überall in Berlin, Kniestiefel aus Kunstleder, die das Laternenlicht spiegeln und das Auge magisch anziehen. So tadellos weiß und mit den hohen Plateausohlen rufen sie noch lauter als die lasziven Blicke Zu mieten. In die Stiefel gesteckte helle Jeans, hauteng um rührend jugendliche Schenkel, neonfarbene Gürteltasche, die irgendwie pikant ihre kurze Kunstpelzjacke bauscht. Im eisigen Wind präsentiert sie ihr rosiges, etwas feuchtes Gesicht und lange blonde, fast weiße, hinter ihr wogende Locken, die durch den grauen Zigarettenqualm glänzen.
Als sie den Rauch ausbläst, verrät mir ihr Gesicht, dass sie mindestens fünf Jahre jünger ist als ich. Fünf Jahre, kaum zwanzig, aber welche Kunst der Bewegung, was für ein Selbstbewusstsein! Das geht schon bei den Absätzen los. Niemand könnte damit laufen, ich jedenfalls nicht, aber bei ihr sind sie eine ebenso natürliche Verlängerung des Beins wie ein nackter Fuß. Und das Geräusch, das schmachtende Knallen bei den zehn Schritten hin und her, die ihr Territorium begrenzen … Wer es hört, weiß, dass dieser gekonnte Rhythmus nicht von einem wackligen Mädchen stammt, das sich gleich die Knöchel verrenkt – hinter diesem Klappern steckt auf jeden Fall eine aggressiv verführerische Frau, die sich absolut im Griff hat. Und dann die Kleidung, das Haar, das Make-up; ehrlich, superheiß, aber wie eine Karikatur! Wie kann sie in ihrem Alter all diese Tricks und Deppenköder kennen, ohne wie ein kleines Mädchen auszusehen, das gerade den Kleiderschrank seiner Mutter geplündert hat? Wie fühlt sich das an, zu wissen, dass sie bei jedem Mann, den sie trifft, gewollt oder nicht, sexuelle Gedanken weckt? Was macht es mit ihr, da zu stehen, auf der Straße, zwischen Autos und Passanten, eine dröhnende, unerbittliche Erinnerung an die Vorherrschaft der Lust über alles andere?
Und was würde Stéphane dazu sagen, dem ich mich nicht mehr in solcher Aufmachung zu zeigen wage, seit ich mich in einer Pariser Fußgängerpassage in sündhaft teuren Stiefeletten der Länge nach hingepackt habe? Damals vergingen endlose Sekunden, bis mir Stéphane und ein paar Schaulustige, die ihr Lachen kaum unterdrücken konnten, zu Hilfe kamen – und kein Slip ersparte den braven Leuten den Anblick meines aufgewühlten Schamhaars. Obwohl das lange her ist, haben Stéphane und ich nie zusammen darüber gelacht, es bleibt ein Nicht-Ereignis, das weiterhin zwischen uns steht, so ernst und belastend wie ein Problem, das einen Streit auslösen könnte, sobald es jemand antippt. Ich habe es aus verständlicher Eitelkeit und aus Stolz nicht versucht, aber ich habe nie begriffen, was Stéphane davon abhält; vielleicht einfach die Angst, mich zu ärgern, indem er mich an den Abend erinnert (dessen Fortsetzung mich keineswegs für den Sturz entschädigte, sondern eine Reihe von Abfuhren in diversen Swingerclubs bereithielt – kurz und gut auch für unser Ego ein langsamer, schmerzhafter Sturz in High Heels). Oder er fand es gar nicht lustig. Das ist eine Möglichkeit, die mich ins Grübeln bringt. Vielleicht haben Stéphane und ich nicht den gleichen Sinn für Humor? Das würde das Schweigen erklären, das über dieser und anderen, harmloseren Szenen liegt, die sich alle um meine Person drehen und mit allem möglichen Schnickschnack zu tun haben, den die weibliche Spezies eigentlich ebenso gut beherrscht wie den eigenen Atem, während ich davon völlig überfordert bin. Wenn ich es mir recht überlege, würde er ebenso wenig über eine Fettleibige lachen, die im Schwimmbad einen Bauchklatscher macht – man amüsiert sich nicht über die Behinderungen der anderen. Vielleicht ist das der Eindruck, den ich auf ihn mache, wenn ich auf meinen Stilettos den Schmerz kaum verbergen kann. Wenn er die Anmut dieser Post-Teenagerin auf ihren zehn Metern Straßenpflaster sehen würde, die hier auf und ab läuft, ohne das geringste Unbehagen zu verraten, müsste er einsehen, dass mein fehlendes Talent für solche Sachen angeboren ist.
Ist das die Antwort auf die Fragen, die ich mir stelle, sobald Stéphane in meiner Nähe ist? Auf das ständige Gefühl, zwei Parallelwelten versöhnen zu wollen, die nicht durch den Raum, sondern durch die Zeit getrennt sind, weshalb ich eine Science-Fiction-Maschine bräuchte, um mich Stéphane wirklich nahe zu fühlen? Ob ich Absätze trage oder nicht, hat nicht den geringsten Einfluss auf unsere Nähe – das ist nur ein Symptom: Für ihn bin ich keine Frau. Sagen wir, noch keine. Falls ich doch eine bin, und wenn ich nackt bin, springt es ins Auge, fehlen mir trotzdem Jahrzehnte an Raffinement, das Frauen unter dem Joch des männlichen Begehrens erlernen. Was mir fehlt, um Stéphane zu faszinieren, ist guter Wille genauso wie eine gewisse Gleichgültigkeit, während ich versuche, mich in Stöckelschuhen auf den teuflischen kleinen Pflastersteinen von Paris oder auf den Treppen ohne Geländer zu bewegen, die in völlig überschätzte Clubs führen, wo wir erbarmungslos durchfallen, wahrscheinlich auch, weil sich Schmerz und Unreife auf meinem Gesicht ablesen lassen. Was mir fehlt, ist der Hochmut der anderen Frauen, wenn sie aufgepeppt sind, um zu killen, diese acht bis zehn Zentimeter Provokation, die Illusion, die Männer zu beherrschen. Was mir tatsächlich fehlt, ist die Fähigkeit, ihm ebenso arrogant zu begegnen wie jedem anderen Mann, der mir total egal ist.
Ich spüre es ganz deutlich, wenn wir spazieren gehen oder zusammen essen; ich spüre, dass wir abgesehen von manchen Ansichten, die wir teilen, und einer gleichen Sensibilität das am wenigsten zusammenpassende Paar sind, das man sich vorstellen kann. Es macht ihn fertig, dass alle glauben, er sei ein Vater, der seine in Berlin lebende Tochter zum Essen ausführt. Aber was sollen die Leute sonst denken, wenn ich mich wie eine brave Tochter anziehe, um nicht mit etwas Eleganz den Eindruck zu erwecken, ich wäre ein Escort-Girl, das seinen Kunden ausführt? Ihm wäre das natürlich lieber. Stéphane würde sich nie hinreißen lassen, mich in der Öffentlichkeit zu küssen, er behält seinen rauen Ton und seine schroffe Art, verloren zwischen Freund und Liebhaber. Wenn er lacht und ein Teil von mir bei seinem so erwachsenen sexy Lachen schmilzt, umklammert meine Hand unter dem Tisch meinen Schenkel vor Angst, nach seiner zu greifen. Mir ist auch schon der Gedanke gekommen, dass er mich nicht wegen der anderen in der Öffentlichkeit weder küsst noch umarmt, sondern weil er einfach keine Lust hat, weil ihn unsere Spaziergänge durch Berlin, die ihm zu lang sind, ebenso ermüden wie meine ständigen Fragen, mein Drang, ihn immer besser kennenzulernen; weil ihn mein ununterbrochener Redestrom – Zeichen meiner Schüchternheit und meiner Angst, er könnte sich langweilen – keineswegs unterhält, sondern erstickt, weil Stéphane sich mit mir irgendwann genauso nach seiner Einsamkeit sehnt wie ich mich nach meiner. Wenn wir zusammen unterwegs sind, gehen wir einander spürbar auf den Wecker, nur im Bett, fern der Blicke der Welt, erreichen Stéphane und ich – zumindest unsere Körper – eine Form der Gelassenheit. Jedenfalls bevor er anfängt zu schnarchen, ein ganz neuer Parameter, den ich in meinen Romanzenphantasien bislang nicht berücksichtigt hatte und der mich begreifen lässt, dass ich zu jung für ihn bin oder er vielleicht zu alt für mich ist. Das würde erklären, warum ich ständig das Gefühl habe, zwei Teile aus unterschiedlichen Puzzles ineinanderpressen zu müssen, wenn ich mich ihm nähern will. Und warum es mir, wenn er wegfährt und sich die Erleichterung in mir ausbreitet, nichts mehr vorspielen zu müssen, so leidtut, dass ich nicht zärtlicher, verständnisvoller sein, ihn nicht in mich verliebt machen konnte.
Ich stelle ihn mir schon in seinem Flugzeug vor, den rauen Bären, der mein Zimmer mit seinem Gebrumm erfüllt und die ganze Decke an sich zieht, den Grobian, der sich weigert weiterzulaufen, sobald ich zugebe, dass ich kein klares Ziel für unsere Wanderung festgelegt habe, der ungeduldig wird, wenn ich mich in der Hausnummer irre, diesen Mann, der älter ist als mein Vater und den die Vorstellung, auch nur im Entferntesten Lehrer oder Mentor zu sein, mit Grauen erfüllt, den meine Neugier nervt – und der doch auf so einzigartige Weise meinen Namen ausspricht, wenn er kommt. Es gibt einen heiligen Moment, wenn ich über ihm bin, höher, als ich es je sein werde, wenn Stéphane einem fast schon Ertrunkenen gleicht, wenn ich im Weiß seiner verdrehten Augen ein herrschaftliches, geradezu mythologisches Bild von mir sehe – und er «Emma, Liebste, Liebste, o Emma» sagt, wie ein in einer Frau verlorener Mann, ohne Altersunterschied, ohne Rücksicht auf die Herkunft, nicht wie ein Mann beim Orgasmus – jedenfalls nicht nur –, sondern wie ein Mann, der wahrhaft liebt. Danach wird seine Haut in dem prasselnden, nur langsam verlöschenden Feuer brennend heiß; den Kopf zwischen meinen Brüsten, blind und taub, seufzt er vor Wohlbehagen. Wenn er die Augen wieder öffnet, schließe ich meine, weil die Macht, die mir mein Talent im Bett zu verleihen scheint, der Tatsache keinen Abbruch tut, dass dieser Mann mich beeindruckt. Das ist der Fluch dessen, was ich trotz allem unsere Liebe nenne. Der einzige Augenblick der Nähe ist der, den er in mir verbringt. Das ist der Zauber unserer Geschichte, dieser Moment nach der Liebe, wenn ich ihn betrachte, wie er mich auf den Ellbogen gestützt betrachtet und mein Haar mit der Sanftheit streichelt, die Männer für eine Frau zeigen, mit der sie gerade geschlafen haben; man könnte darin eine normale Szene zwischen zwei Liebenden sehen, wäre da nicht die Fassungslosigkeit in seinen Augen bei dem Gedanken, dass diese Lust von mir kommen konnte, von dieser Göre, die er niemals lieben wird. Wir sind ganz und gar zusammen und so allein wie nie. Dann scheint es plötzlich, als wäre es doch möglich, sich zu lieben. In dieser Stille und dieser Betrachtung wird mir bewusst, dass jedes Wort diesen zerbrechlichen Zustand der Gnade, unser vergängliches Verständnis füreinander zerstören würde; dabei hätte ich so viel zu sagen, vielleicht ist das mein Problem, mein Drang zu reden, wenn die Stille völlig ausreicht. Ich würde gern behaupten, dass es tatsächlich einen Moment und einen Ort gibt, an dem Stéphane und ich uns lieben, auch wenn es nur ein winziger Punkt ist – und tatsächlich genügt dieses Eckchen, um uns beide bis an den Rand des Schlafes zu beherbergen, ehe es sich während der Nacht verflüchtigt. Am Morgen ist jeder an seinen Platz zurückgekehrt, Stéphane mit seinen Fehlern, ich mit meinen, aber ich kann nicht hören, wie er über die Kälte oder die Entfernung jammert, ohne mich an die Nacht zu erinnern, in der wir so verliebt waren. Ich warte geduldig auf den Abend, um die Erfahrung auf diesem griesgrämigen Schriftsteller zu wiederholen, ihm die Hingabe und die seltsame Klarheit zu entlocken, mit der er mir vom anderen Ende der Welt schreibt: «Vielleicht bist du im Grunde doch die Einzige.» Das ist ziemlich viel Unsicherheit für einen Satz. Um so eine Erklärung zu erhalten, müssen schon einige Parameter zusammenkommen: Stéphane muss traurig oder durch den Orgasmus seines Zynismus beraubt und von einer seiner Frauen oder Geliebten verlassen worden sein. Was mich von du bist die Einzige trennt, ist das vielleicht am Satzanfang und das im Grunde, das sich als gegen jede Logik und nach gründlicher Prüfung meiner Situation übersetzen lässt. Raymond Radiguet hat geschrieben, wenn man ich liebe dich zu einer Frau sage, könnte man denken, man habe es aus diversen Gründen getan, die nichts mit der Liebe zu tun haben, man könnte denken, man lüge; dennoch hat uns in diesem Augenblick irgendetwas getrieben, ich liebe dich zu sagen, also ist es wahr. Es gibt Momente, in denen Stéphane und ich uns lieben, meistens klingt es absurd, aber manchmal rührt mich die Wahrheit dieser Lüge, dann kommt mir die Welt wie ein feindliches Terrain vor, in dem er und ich Seite an Seite kämpfen – und das ist doch besser als ein feindliches Terrain, in dem ich ganz allein gegen alle stünde, oder?
Als ein Polizeiauto an der Stelle vorbeifährt, wo das Mädchen herumsteht, stelle ich mir für einen erstarrten Moment vor, dass die Bullen, wenn sie ihre Papiere verlangen, genauso gut auch nach denen eines seltsamen Mädchens fragen könnten, das um vier Uhr früh auf einer Bank in der Kälte sitzt und liest. Da ich außer meinem Buch nichts mitgenommen habe und es mir gerade noch fehlen würde, die Nacht wegen eines Missverständnisses auf der Wache zu verbringen (obwohl ich dort vielleicht besser schlafen könnte als neben Stéphane), verdrücke ich mich in den Schatten einer Kastanie, bis das Auto weg ist. Auch das Mädchen hat sich verflüchtigt, und ohne sie bleibt nur ein von Spucke feuchter Fleck Asphalt übrig, der unter ihren Füßen zu blühen schien.
Von der Wohnungstür aus betrachte ich Stéphanes Körper, der sich diagonal über die ganze Matratze ausbreitet. Er schnarcht nicht mehr; entweder hat ihn das Schlüsselgeräusch kurz gestört, oder meine Anwesenheit und meine Wärme haben vorhin eine günstige Schnarchatmosphäre geschaffen. Ich ziehe mich langsam aus und setze mich auf den Bettrand in die Bucht zwischen seinen angezogenen Knien und seinem Gesicht. Ich habe nicht oft Gelegenheit, ihn so zu betrachten, ehrlich gesagt ist das eine Premiere – Stéphane hat noch nie bei mir übernachtet. Als ich ihn so sehe, so ganz ausgeliefert, trifft mich natürlich die Erkenntnis, dass wir nichts miteinander zu tun haben. Das springt ins Auge. Fünfundfünfzig, stell dir das vor, auch wenn er jünger wirkt, für zwanzig würde ihn niemand halten. Alles an ihm kündet von Reife, sogar im Schlaf, selbst da behält er seine ernste, besorgte Miene. Wenn ich die Brille abnehme, sind die Konturen in der künstlerischen Verschwommenheit meines kurzsichtigen Blicks weniger markant, weniger scharf, und ich kann ihn so sehen, wie er mit dreißig war – nicht in meinem Alter, nein, Stéphane mit fünfundzwanzig ist ein Eldorado, von dem höchstens die Archive erzählen –, wie das Foto, das beim Erscheinen seines dritten Buches aufgenommen wurde. Man könnte dieses schlafende Gesicht mühelos über das runde, fröhliche des jungen Schriftstellers legen, der in Paris keinen Schritt machen konnte, ohne sich zehnmal zu verlieben. Das erfinde ich nicht, ich habe es gelesen, und wenn ich Mühe habe, es zu glauben, lese ich es noch mal. Um nicht zu vergessen, dass er mit dreißig schon so brummig war und lange brauchte, um aufzutauen, dass er hinter dieser Rüstung die Hysterie verbarg, in die ihn die Frauen versetzten – Stéphane ist ein sehr kontrolliertes Feuer, dessen Wärme nur manchmal kurz aufblitzt. Ich frage mich, ob er sich in mich verliebt hätte; Stéphanes dreißig Jahre, die aufregenden Achtziger, als ich noch im Nebenhoden meines Vaters plätscherte, sind für mich eine paradiesische Dimension, in der nichts unmöglich gewesen wäre. Ich sehe mich, weit oben, wie auf einem Turm, dieses junge, energiegeladene Tier faszinieren und in ganz Paris ausführen, sehe mich das Geheimnis jener Frau ergründen, der einzigen, die er genug geliebt hat, um ihr ein Kind zu machen. Vielleicht hätte auch ich ihn damals auf die Idee gebracht, sich fortzupflanzen, um mich in seiner Nähe zu halten – er hätte mich geliebt, dann wäre er meiner überdrüssig geworden und hätte mich am Ende für die Opfer gehasst, die niemand von ihm verlangte. Ich wäre die Gewohnheit geworden, die im Nebenzimmer mit dem Kleinen schläft, erschöpft und voller Milch, müde, weil sie ihn so gut kennt, müde seiner Schwächen, seiner Feigheit, seiner Versprechen, gedemütigt und entehrt von den nächtelangen Männertouren – ich hätte Stéphanes Wutanfälle, seine Vorwürfe, seine Ungereimtheiten, seine Betrügereien, vielleicht sogar seine Tränen kennengelernt. Und ich hätte nach Jahren des Zusammenlebens sagen können, dass es echt keinen Grund gibt, sich groß Gedanken zu machen, dass er nur ein Mann wie alle anderen ist. Wir hätten uns aus ernsthaften Gründen gefetzt, gebrüllt, Geschirr zerschlagen, und nachts hätte ich mich schuldbewusst auf den Rand seines Bettes gesetzt, wie jetzt, wie jetzt hätte ich die Hand auf seine Haare gelegt, Stéphane hätte ein Auge aufgemacht, hätte mich stumm angesehen, gezögert, was er empfinden soll, und hätte geseufzt Ach, Liebling …!
«Ach, du bist es.»
Stéphane schüttelt sich, dreht sich auf die andere Seite und murmelt, während er schon wieder einschläft:
«Was hast du getrieben? Du bist eiskalt.»
«Nichts. Ich war ein bisschen spazieren.»
«Du bist verrückt. Komm ins Bett.»
Was wohlgemerkt genau das wäre, was er auch damals zu mir gesagt haben könnte. Ich suche mir einen Platz in seiner Wärme, halte meine kalten Arme und Beine weit von seinen weg. Meine ganze naive Zärtlichkeit hat sich tief in meinen Kopf verkrochen, ich finde das vertraute Gefühl wieder, neben einem Freund der Familie zu schlafen, der sich zu spät darum gekümmert hat, noch ein Zimmer zu reservieren, und mehr oder weniger gern einwilligt, meins zu teilen.
Stéphane und ich laufen unter einer schüchternen Sonne die Danziger Straße entlang. Ein mühsamer Spaziergang, weil Schnee liegt und weil wir kein Ziel haben (nach fünfhundert Metern weiß ich sowieso nicht mehr, wo ich bin), aber Stéphane scheint sich nicht zu ärgern, der Schnee, den er schon lange nicht mehr gesehen hat, macht ihn ganz fröhlich. Als wir eben die Kastanienallee heraufkamen, habe ich ihn ohne Grund lächeln sehen, der Kuchen zum Frühstück hat ihm geschmeckt, und die Geschäfte gefallen ihm. Er hat mir eine Riesenfreude gemacht, als er aus einem gar nicht unangenehmen Schweigen heraus, und obwohl ich nichts verlangt hatte, verkündete: «Ehrlich, hier könnte ich leben.»
Was ihn, abgesehen von seiner Arbeit, daran hindern würde, sei vielleicht das Wetter in Berlin. Zu kalt.
«Ja, aber sieh mal, wie hübsch das ist, eine Stadt ganz in Weiß.»
«Das stimmt», gibt er ruhig, fast verträumt zu, während er die Häuser betrachtet, die Sonne und Schnee wie Edelsteine funkeln lassen. «Aber in London …»
Da schiebt sich ein hübsches Mädchen zwischen uns, ihr Pelzmantel mischt einen Hauch von feuchtem Fell in ihr Parfüm – und sie schenkt Stéphane, dem braven, von seinem Töchterchen begleiteten Familienvater, einen Blick wie ein Blitz, der ihn herumfahren lässt. Ich würde mich darüber ärgern, trüge sie nicht diese glänzenden Kniestiefel, weißer als der Schnee, wie gemacht für die Anmache im Winter.
«Ha! Das ist etwas, das du in London nicht hast.»
«Hübsche Mädchen?»
«Quatsch! Huren.»
«Das war eine Hure?»
Stéphane dreht sich noch einmal um, trotz der Stiefel kann er nicht glauben, dass dieses Mädchen im Studentinnenlook eine Hure sein soll, und noch weniger, dass sie sich keine Gedanken wegen der Gesetzeshüter macht.
«Aber … ist das legal?»
«Alles ist legal. Prostitution, Bordelle, Escort-Girls.»
«Das ist ja das Paradies!»
Stéphanes Augen, in denen Faszination oder plötzlicher Appetit blitzt, folgen ihr bis zur Ecke Schönhauser Allee – in diesen Blick habe ich mich damals verliebt. Diesen Blick hat er am ersten Tag auf mich gerichtet, nachdem wir uns die Hand gedrückt hatten. Beim Weggehen hatte ich mich umgedreht, weil ich sehen wollte, welchen Eindruck mein Rock auf den viel zu erwachsenen Mann gemacht hatte – und da war dieser Blick gewesen. Weil ich glauben möchte, dass diese Aufmerksamkeit nicht den Professionellen vorbehalten ist, vermute ich, dass er alle Frauen so ansieht, die mit einer Mischung aus Gleichgültigkeit und Provokation wandelnde Symbole des Begehrens sind, friedlich in ihrer Allmacht und voller Verachtung für ihre Anbeter. Das war ich also auch für ihn, bevor mein Überschwang mir Wort und Initiative gab und ich an Strahlkraft verlor, was ich an Intimität gewann.
Ich war zu beeindruckt von diesem kaum verhohlenen, aber für jede andere unlesbaren Blick, um ihn zu deuten; ich bewahre nur eine sehr lebhafte Erinnerung an Wärme und die Dringlichkeit, schnell zu verschwinden, bevor meine Erscheinung ihre Herrlichkeit verlor. Als ich nun dieselben Augen an den Pelz und die schamlosen Stiefel geheftet sehe, frage ich mich mit der Kälte eines Gerichtsmediziners: Was denkt er, genau jetzt? Wenn ich ihn danach fragen würde, würde er Nichts sagen, aber ich könnte sehen, wie sich sein Gesichtsausdruck plötzlich ändert, als hätte ich ihn aus einem Traum gerissen – woraus besteht dieser Traum? Sicher ziehen Bilder an seinen Augen vorbei, Bilder von ihr nackt, in unmöglichen Stellungen, schwirrt in seinem Kopf alles, was er von ihr verlangen könnte, wenn er sich die kurzzeitige Herrschaft über sie gönnen würde. Denkt er, auch nur flüchtig, daran, sie mit zu uns zu nehmen?
«Glaubst du, sie ist epiliert?», frage ich mit einer Spur Hinterhältigkeit, sein Instinkt erfasst sie sofort, denn er trompetet:
«Bist du eifersüchtig?»
«Eifersüchtig? Eher hypnotisiert.»
Wir sind jetzt mitten im rechtsfreien Raum, dem kaum beleuchteten Teil von Prenzlauer Berg; etwas abseits der Fahrbahn haben die Huren ihren Dienst angetreten.
«Vor zwanzig Jahren war es in bestimmten Straßen in Paris genauso», stellt Stéphane fest.
«Was meinst du, wohin sie mit ihren Kunden gehen?»
«Keine Ahnung. Ins Auto? Vielleicht haben sie kleine Absteigen.»
Da ist eine große Brünette, hässlich, zu dick, in ein Korsett gezwängt – der Anblick ihrer Fleischmassen über und unter der enggeschnürten Taille erfüllt mich mit Grauen und Fröhlichkeit. Während sie Stéphane streift, schenkt sie ihm einen verächtlich-einladenden Blick, kaum eine Sekunde, bevor sie sich wieder auf ihr Ziel konzentriert, wahrscheinlich das Ende der Straße, der Anfang einer anderen, und unter Tausenden Männern der eine, der sich zu einem Halt im Warmen überreden lässt. Ich weiß nicht, ob sie Stéphane überhaupt gesehen hat, ob nicht Leute wie er, die nur im Vorbeigehen schauen (egal, wie eindringlich), zu einer feindlichen, lächerlichen Menge verschmelzen, die gern würde, aber nicht kann, die gern würde, aber sich nicht traut, die nicht mal gern würde, aber sich aufgeilt, bevor sie nach Hause zurückkehrt – eine Menge, die keinen Cent dafür rausrückt, sie mit den Augen zu verschlingen, sie, die das Wunder vollbringt, gleichzeitig bekleideter als ich und nackter als eine Statue zu sein, wie sie sich so in einem über ihre Daunenjacke geschnürten Korsett anbietet.
«Warum warst du nie im Bordell?»
«Ich hatte es nie nötig, ins Bordell zu gehen.»
«Das ist keine Frage von Not, oder?»
«Sagen wir, ich hatte nie das Bedürfnis, eine Frau zu bezahlen. Du kennst ja meine Knausrigkeit.»
«Es ist also eine Frage des Geldes? Erzähl mir nicht, dass es eine Frage des Geldes ist.»
«Warum sollte ich bezahlen, wenn ich ganz umsonst ein Mädchen haben kann, das Lust auf mich hat?»
«Ach, Stéphane …! Ich weiß nicht, wegen der Poesie?»
«Es macht mich nicht besonders scharf, ein Mädchen zu ficken, von dem ich weiß, dass sie es macht, weil ich sie bezahle. Wenn du ein Mann wärst, würdest du verstehen, was ich meine.»
Ich lache, und in meiner aktuellen Obsession habe ich das Gefühl, dass die kleine blonde Hure, die uns ansieht, auch mir zulächelt.
«Wenn ich ein Mann wäre? Mein Lieber, wenn ich ein Mann wäre, wäre ich ständig bei ihnen.»
«Das glaubst du doch selber nicht!»
«Na gut, vielleicht nicht bei denen auf der Straße. Aber ich würde ins Bordell gehen. Findest du das nicht wunderbar? Nicht das Hingehen, allein schon, dass es möglich ist. Stell dir vor, du gehst zur Arbeit, und dich packt die Lust auf Sex, und auf deinem Weg liegt ein kleines Bordell mit einem Dutzend hübscher Mädchen, die …»
«… die darauf pfeifen, ob ich oder ein anderer sie nimmt.»
«Nehmen wir an, es ist früh am Tag, ja? Das Bordell hat gerade aufgemacht. Sie sind doch auch nur Menschen, vielleicht hatte eine von ihnen beim Aufstehen auch Lust, wie du.»
«Ich weiß nicht, wie lange du Lust haben kannst, wenn du so einen Job machst.»
«Hör mal, Stéphane! Das sind doch keine Roboter.»
«Nein, aber du hast keine Ahnung, wie es sich anfühlt, von zehn Männern am Tag gefickt zu werden. Wahrscheinlich finden sich Geist und Körper nach einer Weile damit ab. Echte Erregung wäre da das Sahnehäubchen, und das ist extrem selten. Stell dir vor … Oh, pardon, Madame!»
Die Hure, die Stéphane fast umgerannt hätte, ist eine Blondine mit so roten Lippen, dass der Rest ihres weißen Gesichts verschwindet und nur noch dieser blutrote Fleck zu sehen ist. «Pardon!», wiederholt Stéphane verwirrt, und das Lächeln, mit dem sie ihm antwortet, verwandelt ihren Mund in einen Strauß aus Rot, Weiß und Rosa. Sie tritt auf ihren endlosen Absätzen einen Schritt zurück, um uns vorbeizulassen, und da der Mann, der nicht für Frauen bezahlt, sie immer noch anstarrt, verzieht sie einladend das Gesicht und zeigt mit dem Kopf auf den Eingang eines grauen Hauses, während sie mit den behandschuhten Händen die Masse ihrer entblößten Brüste so verheißungsvoll, so wirkungsvoll hochschiebt, dass ich Stéphanes ablehnende Geste ein bisschen bedauere.
«Sie war süß», gibt er zu.
«Ich kapiere nicht, wie eine Frau die Lust so gut imitieren und so leicht bei den anderen wecken kann, wenn sie total vergessen hat, was das ist.»
«Moment, sie hat schon Lust, Lust aufs Geld.»
«Ja, aber damit du so eine gelungene Imitation bringst, ohne ein Wort zu sagen, und die Lust im Bruchteil einer Sekunde weckst, sodass jeder Mann genauso schnell vergisst, dass es ein Spiel ist …»
«Das ist Theater.»
«Ja, aber gutes Theater. Das ist große Kunst. Oder die Lust des Mannes ist total gaga, und ein Mädchen muss nur die Titten hochschieben, damit er an Gegenseitigkeit glaubt.»
«Du weißt doch, wie bescheuert die Männer sind.»
«Okay, nehmen wir an, die Männer sind bescheuert. Aber auch nicht so bescheuert, dass …»
«Doch.»
«Mach mich nicht fertig, ich habe doch gesehen, wie du sie angestarrt hast.»
«Weil sie hübsch war!»
«Ich bin froh, dass du das sagst. Und du gibst mir recht; vielleicht besteht ihr Job erstmal nur darin, hübsch und begehrenswert zu sein, aber der Unterschied zwischen denen, die du ansiehst, und denen, die du ignorierst, ist die Seele, die sie dazugeben, um dich anzulocken.»
«Also sind sie Schauspielerinnen.»
«Möglicherweise die größten der Welt. Eine Hure, die dir das Gefühl gibt, dass du sie wirklich besitzt, eine Hure, die dich vergessen lässt, was sie gekostet hat, ist die Quintessenz der Schauspielerin, mehr ist nicht nötig.»
Stéphane lächelt mich an.
«Das ist ein einfaches Prinzip, solange du den Job nicht selbst machst. Ich bin sicher, dass deine Freier in Paris voll und ganz befriedigt waren. Aber nur, weil du es aus Spaß gemacht hast. Weil es dich keine große Anstrengung gekostet hat, so zu tun, als ob – wenn du überhaupt so getan hast, als ob –, weil du das Geld nicht brauchtest, um deine Miete und deinen Einkauf zu bezahlen, sondern dir davon geleistet hast, was für dich Luxus war. Wenn du dagegen von den Mädchen hier sprichst …»
«Ich sage nur, dass so tun, als ob, und zwar so gut, dass niemand es merkt, vielleicht zur Frau dazugehört.»
«Ach ja? Und zu was für einer Frau?»
«Zu jeder Frau.»
«Zu jeder Frau oder nur zu dir? Dein Problem ist die Neigung zu verallgemeinern, um dich zu beruhigen.»
«Es würde mich sehr wundern, wenn ich die Einzige wäre. Euch stört bei einer Hure zwar, dass sie simuliert, aber sie bringt euch trotzdem zum Orgasmus.»
«Du weißt doch, wie einfach es ist, einen Mann zum Orgasmus zu bringen.»
«Ja, das könnte auch eine Maschine. Aber das hindert euch nicht daran weiterzumachen, oder? Vielleicht ist das alles von Anfang an unecht, sogar mit deiner Geliebten oder deiner Frau – trotzdem hast du Lust auf Sex. Wenn du eine Erektion kriegst, denkst du nur noch an die Wärme eines Körpers an deinem und an die Geräusche, die das Mädchen machen wird, wie es gleich unter dir zappelt – solange es nur irgendwie den Eindruck macht, Lust zu haben, denkst du keine Sekunde daran, dass es nur Theater sein könnte.»
«Du meinst also, dass jede Frau simuliert?»
«Eine Hure bleibt eine Frau. Sie hat einen speziellen Beruf, aber das macht keine spezielle Frau aus ihr, du hast das gleiche Risiko zu scheitern und die gleiche Chance für einen Triumph wie bei jeder anderen.»
«Bei einer Frau, die nicht jeden Tag mit Sex verbringt, hast du eine größere Chance, sie emotional zu berühren und zu erregen. Weil sie nicht mit professioneller Gleichgültigkeit gepanzert ist.»
«Es kommt auch sonst vor, dass eine Frau mit Männern schläft, die sie eigentlich kaltlassen. Es gibt eine Menge Gründe, Sex zu haben, ohne dabei an den Körper zu denken.»
«Welche denn so?»
Welche? Ich sehe Stéphane an und fühle mich ihm plötzlich ferner denn je. Wenn er ein Mädchen wäre, könnten wir ganz sicher die besten Freundinnen sein – das Einzige, was ihn daran hindert, mich zu verstehen, ist dieses überzählige Organ zwischen seinen Beinen, für das Sex zwangsläufig Orgasmus heißt. Sex und Orgasmus sind untrennbar verbunden, Schwanz und Gehirn führen beim Sex kein Paralleldasein – sie gehen Hand in Hand und verschmelzen im Orgasmus. Wenn ich Stéphane so auf seinen Penis reduzieren würde, würde er lauthals protestieren und mir grobe Vereinfachung vorwerfen – mit dem entsprechenden schlechten Gewissen.
Zwei Stunden später, im Hamburger Bahnhof, sagt mir Stéphane, der nicht mehr scherzt, sobald es um Kunst geht, als wollte er mir einen Gedanken zu dem Kunstwerk mitteilen, vor dem wir stehen (eine merkwürdige Installation von Joseph Beuys), leise ins Ohr:
«Ich habe einen Steifen.»
«Warum?»
«Keine Ahnung, einfach so.»
Wir bewegen uns im Krebsgang zur Mauer gegenüber, wo Skizzen hängen, die mit Blut oder Erdbeersaft gezeichnet zu sein scheinen. Das interessiert Stéphane nicht mehr, er überfliegt die Erklärungen nur noch und sucht mit den Augen eine dunkle Ecke. Er findet sie in einem kleinen Raum, in dem experimentelle Kurzfilme gezeigt werden, und als wir uns zwischen die wenigen Besucher schieben, die im Stehen zuschauen, flüstert er:
«Gib mir deine Hand.»
«Du hast mich doch in diese Ausstellung geschleppt!»
«Ich weiß nicht, was los ist, ich habe eine Testosteronattacke!»
«Das geht vorbei.»
«Du willst nicht wissen, was ich mit dir anstellen würde, wenn es ginge. Mitten in diesem Saal.»
Was heißt, ich will es nicht wissen? Obwohl ich gerade anfing, mich für die Ausstellung zu interessieren, strecke ich Stéphane die Hand hin, er schiebt sie in seine Hosentasche, und ich lege sie um seinen Schwanz. Es ist faszinierend, dass dieser Mann kein Gramm Verstand mehr hat, wenn er so gepackt wird – wir sind drei Kilometer durch den Schnee gestapft, um zu diesem Museum zu kommen, das er unbedingt sehen wollte, haben uns dreimal gestritten, weil ich meinen Orientierungssinn überschätzt hatte, Stéphane hat die Besichtigung begonnen, als verdiente niemand außer Beuys den Namen Künstler, und jetzt raubt ihm eine Hand, eine kleine, warme Hand um seinen Penis jedes Denkvermögen.
Und er würde nie auf die Idee kommen, dass die Erregung, die ich empfinde und von der ich ihm erzähle, völlig von meinem Körper losgelöst ist. Er würde nie auf die Idee kommen, dass mein Körper völlig kalt bleibt, mein Kopf aber heiß ist – dass seine Erregung und die ihn heimsuchenden Bilder mich so fröhlich machen. Ist nicht genau das die Lüge zwischen ihm und mir? Er behauptet, ich sei der Ursprung dieser Erektion, und ich behaupte, diese Lust zu teilen, die nicht mir gehört und die wahrscheinlich dem plötzlichen Temperaturwechsel zwischen Straße und Museum geschuldet ist.
Für Frauen gibt es eine Menge hervorragender Gründe für Sex, die nichts mit der körperlichen Lust zu tun haben. Wie soll ein Mann das wissen? Wie könnte Stéphane auch nur ahnen, dass meine Freude darin besteht, dass sich unsere beiden Kontinente berühren, die sich ohne die Wetterbedingungen, ohne diesen Schneesturm einander kaum genähert hätten? Es ist dieser Zauber – zu erleben, wie er sich hingibt, wieder so jung, so weich wird wie ich, zu hören, wie seine tiefe Stimme in die schrillen Höhen des kleinen Jungen steigt, wenn ich mich auf ihn setze, zu sehen, wie er die Augen aufreißt, fassungslos ob der Macht, die ich erlange, wenn ich über ihm bin.
Breezeblocks, Alt-J
Oktober 2010, Joseph wird einundzwanzig; wir sind so verliebt, dass jedes Geschenk lächerlich wäre, unser Glück würde sich durchaus mit einer Kleinigkeit, einem Pullover oder einer Konzertkarte, zufriedengeben, aber in meinem Größenwahn habe ich einen teuflischen Plan ausgeheckt, von dem ich so begeistert bin, dass ich ihn unmöglich für mich behalten kann. Ich werde ihm ein Escort-Girl für einen Dreier schenken. Ich habe das Hotel reserviert und die Uhrzeit festgelegt, ich habe ein ganzes Programm im Kopf, jetzt fehlt nur noch das Mädchen.
Ich habe eine aufgetrieben, die perfekt wäre, weil sie auf Paare spezialisiert ist. Ihr Körper, soweit mich das interessiert, sieht hübsch aus, und die Beschreibung auf der Website lässt hoffen, dass sie nicht übertrieben professionell auftreten wird. Es gibt nur ein Problem: Ihr Gesicht ist verpixelt. Trotz meiner höflichen Anfrage weigert sie sich, mir ein Foto zu schicken; egal, wie perfekt der Körper ist, ich werde nicht das Risiko eingehen, ein Mädchen zu engagieren, dessen Gesicht womöglich alles kaputt macht.
Nach langem Hin und Her entscheide ich mich für Larissa, die ich auf einer englischen Escort-Website entdeckt habe, eine entzückende zwanzigjährige Russin, blond, mit zarten Zügen und großen mandelförmigen eisig blauen Augen, deren Foto ich ganz stolz Joseph zeige. In den zwei Wochen bis zu dem großen Abend sind wir nur damit beschäftigt, uns gegenseitig heißzumachen und uns exotische Kombinationen zwischen Larissa und mir vorzustellen, während er, die Hand am geschwollenen Penis, sich an unvergesslichen Bildern ergötzen wird; die Verwirklichung all der Schweinereien, die wir uns im Internet angesehen haben, scheint wunderbarerweise unmittelbar bevorzustehen. Bei unserem endlosen Vorspiel ist der schmachtende Name Larissa immer dabei.
Wir trafen uns im Café de la Paix.
Es war kalt und schön an jenem Tag, ich fröstelte, als ich auf der Terrasse nach ihr Ausschau hielt, während sie drinnen auf mich wartete. Nach dem ersten Blick hätte ich auf dem Absatz kehrtmachen müssen, aber ich war zu beeindruckt – wie reagierst du, wenn dich der Oberkellner an den Tisch einer riesigen, in einen Pelz gehüllten Russin führt, die gerade die Zangen eines Hummers knackt und Champagner trinkt? Alles an ihr stank nach Geld, sogar das Lächeln, zu dem sich ihr Gesicht verzog, ohne die Augen zu erreichen. Der Samt ihrer geschminkten Haut fing das Licht ein und strahlte in den Saal, misstrauisch beobachteten die Männer das seltsame Paar, das wir bildeten. Sie roch nach etwas Starkem, Raffiniertem, Guerlain Violette, und ihre kleinen Zähne funkelten wie Perlen, wenn sie so tat, als lachte sie.
Wenn Joseph bei mir gewesen wäre, wäre ihm sicher all das aufgefallen, wofür ich zu aufgeregt war; dass sie zu stark geschminkt war, dass es ihr scheißegal war, mit einem Mädchen oder einem Jungen zu schlafen, solange sie bezahlt wurde – wenn du Ansprüche stellst, bringst du es nicht so weit, im Café de la Paix Hummer zu speisen. Dass sie überhaupt nicht dem Foto glich – keine Spur von dem Nymphengesicht, nur die hohen Wangenknochen hatten der Bildbearbeitung des Fotografen widerstanden. Ich hätte ihr danken und mich auf die Suche nach einer neuen Hetäre machen müssen, aber die Zeit war zu knapp, um mir diese Laune zu erlauben, und wir hatten schon zu viel von Larissa geträumt.
Nachdem ich den größten Teil meines Vermögens losgeworden war, zwang ich mich, Larissa so, wie sie war, in unsere Phantasien aufzunehmen und die unergründliche Gleichgültigkeit zu ignorieren, die sie in mir weckte. Als Joseph mich fragte, wie es gelaufen sei, raste mein Herz, und ich log: «Oh, sie wird dir sehr gefallen.»
Ab achtzehn Uhr sind wir im Hotelzimmer. Ich habe den Champagner und das Koks rausgeholt, das sich als besonders schlecht erweisen wird – aber es kommt nicht infrage, dass ich mein eigenes Geschenk schlechtmache. Um Haltung zu bewahren, drehe ich uns hektisch einen Joint, der mich genauso wenig auf Touren bringt wie das Koks. Die Mischung von beidem, getränkt mit lauwarmem Champagner, rettet mich nicht vor meinen Ängsten.
Es ist zwanzig Uhr, Larissa ist nicht gekommen, ich fange halb an zu hoffen, dass sie sich mit meinem Geld davongemacht hat – die Aussicht, uns zu zweit zu lieben, ist plötzlich viel erregender als die Möglichkeit, den Job zu dritt zu versauen. Joseph hat genauso viel Angst wie ich. Wenn ich ihn umarme, wie in jener Zeit alle zwei Minuten, spüre ich hinter seiner schönen Brust sein Herz verloren rasen.
Als wir schon nicht mehr damit rechnen, klopft die ehrliche Larissa schließlich doch zart an unsere Tür, und mir wird ganz schwummrig. Gott sei Dank ist das Zimmer zu klein, als dass ich die Chance hätte, Joseph diskret zu fragen, was er von ihr hält – sowieso sind wir zu verstört und zu besorgt, um uns abzusprechen. Larissa ist mit Schuhen fast einen Meter achtzig groß und überragt uns um anderthalb Köpfe. Wir sehen ihr an, dass sie nicht mit einem so winzigen Zimmer gerechnet hat, natürlich ist sie an die riesigen Räume der Pariser Nobelherbergen gewöhnt, die hätte ich reservieren sollen, eine Suite im Ritz, die uns mit ihrem großkotzigen Luxus erschlagen hätte. Wenn mich nicht schon Larissa ruinieren würde, hätte ich das gemacht; die eben noch kuschlige Enge des Zimmers wird erstickend, ich bin verlegen, weil es nur einen Stuhl gibt, und biete ihn ihr an, während wir uns wie zwei dumme Gänschen auf den Bettrand hocken. Larissa ist erhaben, erwachsen, uns quillt die Unerfahrenheit aus allen Poren. Sie sieht nur, wie jung und verschreckt wir sind. Das Beste wäre, so zu tun, als fiele ihr das nicht auf, aber nach einem langen Blick auf Joseph sagt sie kichernd auf Englisch: «Bist du überhaupt schon achtzehn?»
Während wir nicken, Joseph knallrot und ich entsetzt, sehe ich meine Hoffnungen dahinschmelzen. Ich hatte gedacht, ein junges, verliebtes Paar würde für sie mehr ein Trinkgeld sein als ein echter Job, aber in ihren großen Augen funkeln unverkennbar Herablassung und Hohn – und plötzlich habe ich ein bisschen Mitleid mit uns: Ich hätte eine Junge nehmen sollen, eine Anfängerin, die keinen Unterschied zwischen Arbeit und Vergnügen oder Arbeit und Erfahrung gemacht hätte und die überwältigt gewesen wäre von Josephs Schönheit, Josephs atemberaubender Raubtierschönheit auf dem Höhepunkt seines Ruhms.
Aber ich habe bezahlt und finde mich in der unangenehmen Position der Kundin wieder, die alles versuchen muss, um der Hure ein paar Fetzen von echtem Interesse zu entreißen. Da sich die Umgebung nicht für eine spontane Orgie anbietet und weder Joseph noch ich auf die Idee kommen würden, uns auf sie zu stürzen, beginne ich ein lahmes Gespräch auf Englisch, eine Sprache, die wir alle drei mit unerträglichem Akzent massakrieren.
Ich habe noch nie eine so eisige Frau getroffen; auch wenn sie lächelt oder bei meinen erbärmlichen Geistesblitzen grinst, auch wenn sie nur ein ganz kurzes Kleid trägt, habe ich mich keinem Menschen je so fern gefühlt. Das Koks, das ich ihr höflich anbiete und das sie höflich annimmt, lässt sie keineswegs auftauen, sondern verstärkt noch ihre Vorbehalte gegen uns, gegen die Ignoranz von Ahnungslosen, die das erstbeste weiße Pulver kaufen, wenn es nur fein genug gemahlen ist. Das in lächerlichen Lines ausgebreitete Gramm Nichts wird uns ebenso wenig helfen wie die meinem Vater geklaute Champagnerflasche: Entspann dich, Baby, sniff ein bisschen Canderel, schlürf ein Glas Sekt! Wie armselig!
Die Zeit verstreicht unerbittlich, ohne dass jemand etwas unternimmt: Ich weiß nicht, wer mehr Ohrfeigen verdient, ich, die labert und labert, Joseph, der mit seinem iPod den DJ spielt, oder Larissa (schließlich ist es ihr Job, verdammt!), die es sich mit ihrem Glas in der Hand gemütlich macht, die langen Beine über dem Schatz gekreuzt, für den ich mühsam mehr als einen halben Mindestlohn zusammengekratzt habe. Die sich wahrscheinlich sagt, dass sie schon eine Dreiviertelstunde rumgebracht hat – ich würde es ja begreifen, wenn wir zwei alte Lüstlinge wären, aber kannst du dir leichter zu befriedigende Kunden vorstellen? Nur ein Kuss, ein winziger Kuss mit einer feuchten Zungenspitze würde uns beide in ekstatische Höhen katapultieren, das muss sie doch merken, sie hat doch sicher begriffen, dass keiner von uns beiden unmögliche Verrenkungen oder alberne Rollenspiele verlangen wird. Da sie da ist, sind wir bereit, so zu tun, als würden wir uns mit nichts zufriedengeben.
Sie verfügt zwar nicht über die geringste Spur von





























