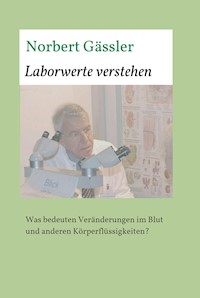
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Laboruntersuchungen sind in der Medizin der Schlüssel zur Diagnose. Aber was bedeuten die Laborwerte, was sagen sie aus? In diesem Buch sind die wichtigsten Laboranalyte zusammengefasst und es wird dargestellt, weshalb und wofür diese Laboranalysen durchgeführt werden. Sowohl der Nachweis als auch Abweichungen von den "normalen" Konzentrationen oder Aktivitäten erlauben Einblicke in das Innere des menschlichen Körpers und unterstützen die ärztliche Diagnose bzw. Therapie. Für den Patienten und Interessierten sind dies häufig komplizierte Fachbegriffe und Zuordnungen. Der Autor hat hier recht überschaulich die wichtigsten Laboruntersuchungen und Laborwerte zusammengestellt und verständlich beschrieben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 87
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Laborwerte verstehen
Was bedeuten Veränderungen im Blut und anderen Körperflüssigkeiten?
Norbert Gässler Hildesheim
Meiner lieben Familie gewidmet
Prof. Dr. Dr. N. Gässler Hildesheim
Impressum
ISBN 978-3-8495-8855-7 (Paperback) ISBN 978-3-8495-8856-4 (Hardcover)
Inhaltsverzeichnis
1
Wasser und Elektrolyte
2
Vitamine und Spurenelemente
3
Calcium und Knochenstoffwechsel
4
Proteine und Aminosäuren
5
Immunsystem
6
Fette, Lipoprotein-Stoffwechsel
7
Kohlenhydrate und Glukosestoffwechsel
8
Leberfunktion
9
Nierenfunktion
10
Herzdiagnostik
11
Enzyme
12
Blutbild und Hämatologie
13
Porphyrinstoffwechsel
14
Hormone, Schilddrüsenhormone
15
Tumormarker
16
Therapeutisches Drugmonitoring
17
Säure-Basen-Haushalt
18
Blutgerinnung
19
Blutgruppenserologie
20
Virale Infektionen
21
Bakterielle Infektionen
22
Mykosen
23
Parasitosen
24
Molekularbiologische Analytik
25
Referenzwerte
1 Wasser und Elektrolyte
Elektrolyte sind Stoffe, die in wässrigen Lösungen elektrische Ladungen weitergeben; d.h. sie können den elektrischen Strom leiten. Hierzu zählen Säuren und Basen und insbesondere deren Salze. Die positiv geladenen elektrischen Teilchen heißen Kationen. Zu den wichtigsten kationischen Elektrolyten zählen Kalium, Natrium, Calcium und Magnesium.
Anionen heißen die elektrisch negativ geladenen Teilchen; Chlorid, Phosphat und Sulfat sind hierfür Beispiele.
Die Verteilung von Kationen und Anionen im Körper bildet ein empfindliches Gleichgewicht, es wird Elektrolythaushalt genannt. Normalerweise herrscht im Körper elektrische Neutralität; d.h. Kationen und Anionen sind im Gleichgewicht. Unterschiedliche Vorgänge und Krankheiten können jedoch Einfluss auf die ausbalancierte Ionenkonzentration nehmen, wie z. B. Schwitzen, Erbrechen, Durchfall und Nierenerkrankungen. Die so bedingte Verschiebung der Elektrolyt-Zusammensetzung wird kompensatorisch durch andere, meist gegenpolige Elektrolytveränderungen ausgeglichen.
Die Konzentration eines bestimmten Elektrolyten ist häufig innerhalb der Zellen different von der Konzentration außerhalb der Zellen, dem so genannten extrazellulären Raum.
Der Transport der Ionen erfolgt aktiv und passiv durch die Grenze der Zellen hinweg, d.h. innerhalb der Zellmembran. Dieser Ionenaustausch und die damit verbundenen Elektrolytkonzentrationen innerhalb und außerhalb der Zellen bedingt u. a. die Informationsübertragung in unserem Nervensystem.
Verschiedene körpereigene Stoffe, wie z. B. Hormone nehmen Einfluss auf dieses empfindliche Regelsystem und verändern die intra-und extrazellulären Ionen-Konzentrationen.
Eng mit den Elektrolytkonzentrationen verknüpft ist die Regulation des Wasserhaushaltes im Körper. Die Körperflüssigkeit ist Ausgangs- und Endprodukt zahlreicher biochemischer Reaktionen und für das Funktionieren der Lebensprozesse unentbehrlich. Im menschlichen Körper, der beim Baby zu ca. 80 %, beim Erwachsenen zu 70 % und im Alter zu 60 % aus Wasser besteht, ist ein fein strukturiertes Regulationssystem entwickelt, das den Elektrolyt-Wasserhaushalt unabhängig von der täglich aufgenommenen Menge über weite Bereiche konstant hält. Vom gesamten Körperwasser verteilen sich ca. 7 % auf die Blutflüssigkeit, ca. 23 % auf die Gewebeflüssigkeit und ca. 70 % auf die Zellflüssigkeit, d.h. auf den intrazellulären Raum.
Abb. 1: Verteilung des Körperwassers
Zur Aufrechterhaltung des Blutkreislaufes ist ein definiertes Volumen der extrazellulären Blutflüssigkeit notwendig. Abweichungen hiervon können mit der Natriumkonzentration oder der Osmolarität erkannt werden.
Die Osmolarität ist die Summe aller osmotisch wirksamen Substanzen im Plasma, z. B. Elektrolyte, Glukose (erhöht bei Diabetes mellitus), Harnstoff (erhöht bei Nierenschäden) u. a. mehr.
Die Wasserzufuhr, d.h. das Trinken, ist lebensnotwendig. Der Mensch kommt nur wenige Tage (max. zehn) ohne Flüssigkeitszufuhr aus. Der Wasserhaushalt wird durch Wasserzufuhr und -verlust bestimmt. Die durchschnittliche Wasserzufuhr beträgt täglich ca. 2,5 Liter. Die gleiche Menge wird täglich wieder abgegeben; 0,5 l mit der Atemluft, 0,4 l mit dem Schweiß, 0,1 l mit dem Stuhl und 1,5 l als Urin ausgeschieden.
Abb. 2: Wasserhaushalt
Zusätzlich zum Wasser werden auch Mineralstoffe, d.h. Elektrolyte, ausgeschieden. Die Niere als zentrales Organ besitzt die Fähigkeit steuernd in den Elektrolyt- und Wasserhaushalt einzugreifen. Aber auch Hormone und das Nervensystem können auf diese Homöostase regulierend einwirken.
Diagnostik
Natrium, Kalium und Chlorid die wichtigsten intra- und extrazellulären Kationen werden im Labor sehr häufig mit ionensensitiven Elektroden gemessen. Zu den wichtigsten Elektrolyten im Körper zählen:
Positiv geladene Kationen
• Na+ (Natrium)
• K+ (Kalium)
• Ca2 (Calcium)
• Mg2+ (Magnesium)
Negativ geladene Anionen
• Cl− (Chlorid)
• HCO3− (Bikarbonat)
• PO43− (Phosphat)
• Weitere negativ geladene Teilchen, z. B. auch größere Proteine
Tab. 1: Elektrolyte
Erhöhte oder erniedrigte Natriumwerte lassen Rückschlüsse auf den Wasserhaushalt zu, während Konzentrationsänderungen des Kaliums vor allem Verteilungsstörungen kennzeichnen.
Täglich wird ca. 1 bis 2,5 g Natrium benötigt; das entspricht einer täglichen Aufnahme von ca. 2 - 6 g Kochsalz (NaCl). Ungefähr 100 g Natrium werden im menschlichen Körper gespeichert. Der Verlust an Natrium über den Schweiß und Urin entspricht der täglichen Zufuhr. Jedoch kann die Natriumzufuhr bei Erbrechen und Durchfall, größeren Schweißverlusten oder erhöhten Harnmengen ungenügend sein. Aber auch das Gegenteil, die erhöhte Zufuhr von Natrium kann gesundheitsschädlich sein und sich in Form von Wasseransammlungen, Kopfschmerzen, Bluthochdruck u. a. zeigen.
Besonders in Fleisch, Fisch, Käse, Saucen, Kartoffelchips u. v. mehr sind größere Mengen Natrium in Form von Kochsalz enthalten.
Kalium ist das wichtigste Kation innerhalb der Zellen. Der Kaliumhaushalt wird durch verschiedene Hormone aber auch durch Glukose und Insulin in sehr engen Grenzen reguliert.
Der tägliche Kaliumbedarf liegt bei ca. 2 g und wird mit besonders kaliumreichen Lebensmitteln wie Bananen, Aprikosen, Fruchtsäften, verschiedensten Gemüsesorten u. v. mehr gedeckt. Die Kaliumkonzentration im Blut ist eng gekoppelt mit der Kaliumkonzentration innerhalb der Zellen. Zu hohe Kaliumkonzentrationen können zu Herzrhythmusstörungen bzw. zu Herzstillstand führen. Der pH-Wert des Blutes hat erheblichen Einfluss auf die Kaliumkonzentration im Plasma bzw. Serum.
Selten indiziert ist die zusätzliche Konzentrationsbestimmung von Chlorid um Störungen der Flüssigkeits- und Elektrolytbilanz oder Störungen des Säure-Basen-Haushalts zu kennzeichnen.
Wasser greift als Energie- und Informationsträger direkt in die energetisch-informationellen Regulationsvorgänge des Körpers ein. Die Erkenntnis, dass elektromagnetische Schwingungen auf das Wasser in unseren Körper gelangen, macht sich die Homöopathie im positiven Sinne zu Nutzen.
2 Vitamine und Spurenelemente
Vitamine, Mineralien und Spurenelemente sind lebensnotwendige Stoffe. Ihre Aufgaben sind sehr vielfältig, sie regulieren und aktivieren den biologischen Stoffwechsel, die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit und sie sind an Schutz- und Immunprozessen beteiligt, z. B. bei der Blutbildung, beim Knochenaufbau und bei der Zellatmung.
Der menschliche Organismus ist nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen in der Lage, Vitamine selbst herzustellen. In den meisten Fällen ist der Körper auf die Nahrungsaufnahme von Vitaminen und Spurenelementen angewiesen. Obwohl der tägliche Bedarf hierfür im Nano- und Mikrogramm-Bereich liegt, sind nach Berichten z. B. der Deutschen Gesellschaft für Ernährung bis zu 20 % der deutschen Bevölkerung mit Vitaminen und Spurenelementen unterversorgt. Zu Mangelerscheinungen kommt es meist bei Unterernährung oder einseitiger Ernährung, gestörter Aufnahme aus dem Darm und erhöhtem Vitaminbedarf, z. B. während der Schwangerschaft und Stillzeit.
Mögliche Anzeichen dieser Mangelzustände können Müdigkeit, Erschöpfung, Schlafstörungen, Depressionen, Nervosität, Reizbarkeit, Konzentrationsstörungen und sexuelle Inaktivität sein.
Vitamin C (Ascorbinsäure) als wichtigster Vertreter der wasserlöslichen Vitamine ist für die Stimulation der Abwehrkräfte, des Infektionsschutzes und seiner Funktion als Radikal-Fänger bekannt; ebenso wie Vitamin D (Calciferol) für seine Funktion im Calciumstoffwechsel für die Knochenbildung und den Knochenaufbau bekannt ist.
Folsäure (Vitamin B 9), Vitamin B 12 (Cyanocobalamin) und Pyridoxin (Vitamin B 6) haben wesentlichen Anteil an der Blutbildung und dem Homocystein-Abbau.
Das fettlösliche Vitamin K ist essentiell für die Blutgerinnung. Vitamin A wird innerhalb der retinalen Stäbchenzellen im Auge zum Dämmerungs- und Nachtsehen benötigt; ferner wirkt dieses Vitamin als Schutzstoff für die Haut.
Vitamin
empfohlene tägliche Menge
Vitamin A (Retinol)
0,8 – 1,1 mg
Vitamin B1 (Thiamin)
1,1 – 1,6 mg
Vitamin B2 (Riboflavin)
1,5 – 1,8 mg
Vitamin B6 (Pyridoxin)
1,6 – 2,1 mg
Vitamin B12 (Cobalamin)
ca. 0,003 mg
Vitamin C (Ascorbinsäure)
75 mg
Vitamin D
0,005 mg
Vitamin E (Tocopherol)
12 mg
Folsäure
0,36 mg
Vitamin K
0,065 – 0,08 mg
Tab. 2: Vitamine
Wesentliche Spurenelemente und ihre Hauptfunktionen sind im Folgenden aufgeführt:
Magnesium verändert an der Zellmembran die Durchlässigkeit von Natrium-, Kalium- und Calcium-Ionen. Das führt z. B. zur Auslösung der Herzkontraktion und beeinflusst den Herzrhythmus oder bestimmt die neuromuskuläre Erregbarkeit durch Auslösung von Nervenaktionspotentialen.
Kupfer wird in vielen Enzymen als Kofaktor benötigt und beeinflusst die Blutbildung, Pigmentbildung und die Synthese des Bindegewebes (Kollagenaufbau).
Eisen ist Bestandteil des sog. körpereigenen Kraftwerks (Mitochondrien) und wird für den Sauerstofftransport und der Sauerstoffspeicherung in den roten Blutkörperchen benötigt
Fluor fördert die Tätigkeit von knochenaufbauenden Enzymen (Osteosynthese). Außerdem härtet Fluor den Zahnschmelz und verhindert somit die Schädigung des Zahnes durch im Mund entstehende Säuren aus bakterieller Zersetzung.
Jod ist Bestandteil der Schilddrüsenhormone. Bei Jodmangel kommt es zur Schilddrüsenunterfunktion mit klinischen Zeichen, wie niedrige Pulsfrequenz, Verlangsamung des gesamten Stoffwechsels, Antriebslosigkeit und Müdigkeit. Äußeres Kennzeichen des Jodmangels ist häufig ein Kropf (Halsverdickung durch wucherndes Schilddrüsengewebe).
Zink ist Bestandteil des Immunsystems und schützt vor Virusinfektionen. Es ist in über 60 Enzymen beinhaltet und notwendig für gesunde und vitale Haut und gesundes Haar.
Chrom reguliert u. a. die Blutfette und den Blutzuckerspiegel. Außerdem erhöht Chrom die Aufnahme von Aminosäuren und verbessert die Eiweißneubildung und ist somit essentiell bei der Abwehrfunktion des menschlichen Organismus.
Selen wirkt als Antioxidans und Radikal-Fänger und schützt somit gemeinsam mit dem Vitamin C die Zelle vor schädlichen Substanzen.
Mangan ist Kofaktor bei einer Reihe von manganabhängigen Enzymen. Es fördert die geistige Belastbarkeit und wird bei der Übertragung der Muskelreflexe benötigt. Da Mangan in allen Zellen der Leber vorkommt, besitzt es eine leberschützende Wirkung.
Diagnostik
Häufigste Ursache von Vitamin-Mangelzuständen (Hypovitaminosen) sind Störungen bei der Vitaminaufnahme, schwere Lebererkrankungen und einseitige Ernährung.
Hypervitaminosen (Vitaminüberschuss) können lediglich bei Vitamin A und D beobachtet werden. Die quantitative Vitamin-Bestimmung wird aufgrund der aufwendigen Diagnostik, häufig mittels chromatographischer Methoden (HPLC), nur in speziellen Fällen durchgeführt.
Ähnliches gilt auch für die isolierte Bestimmung von Spurenelementen. Diese werden ebenfalls aufwendig mittels Atomabsorptions-Spektrometrie bestimmt. Die Indikation zur quantitativen Bestimmung erfolgt entweder isoliert oder in Kombination mit anderen Parametern anhand der Ausprägung klinischer Symptome.
Der tägliche Bedarf von Vitaminen ist sehr unterschiedlich; während 5 bis 50 µg Vitamin D ausreichen, sollten jedoch mindestens 75 mg besser 1 g und mehr Vitamin C mit der Nahrung aufgenommen werden.
Auch bei den Spurenelementen variiert der essentielle (lebensnotwendige) Bedarf sehr stark. In Anhängigkeit von Lebensalter und Geschlecht reichen z. B. 12-15 mg Zink, ca. 190 µg Jod, ca. 100 µg Chrom oder Selen, 1,5-3 mg Kupfer und 10-15 mg Eisen täglich aus.
Element
Menge
Chrom
30 - 100 µg
Selen
86 - 155 µg
Jod
186 - 200 µg
Fluor
1 - 1,5 mg
Kupfer
1,5 - 3,0 mg
Mangan
2 - 5 mg
Eisen
10 - 15 mg
Zink
12 - 15 mg
Magnesium
300 - 400 mg
Tab. 3: Spurenelemente und Mineralstoffe
Eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung führt im Regelfall zur Aufnahme ausreichender Mengen von Spurenelementen und Vitaminen. Im Folgenden sind einige Nahrungsmittel mit hohen Vorkommen an Spurenelementen aufgeführt:
Chrom:
Linsen, Vollkornbrot, Hühnerfleisch, Hefe
Eisen:
Leber vom Schwein und Rind, Hühnerfleisch, Obst, Linsen, Hirse, Austern
Fluor:
Mineralwasser, See- und Meeresfrüchte, Käse, Fleisch und Tee
Jod:
Seefische, Krustentiere, jodiertes Speisesalz
Kupfer:
Innereien von Tieren, Schalentiere, Schokolade, Nüsse
Selen:
Vollkornprodukte, Naturreis, Getreidekeimlinge, Pilze, Spargel, Eier, Hefe, Fisch und Schalentiere
Magnesium:





























