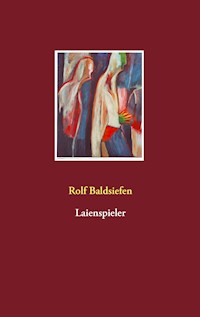
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Nachkriegszeit bis Mitte der sechziger Jahre ist der zeitliche Rahmen der Geschichte. Sie handelt von der Familie des Fabrikarbeiters Alois Brettschneider. Diese wohnt in Fronheim, im Bergischen Land. Ein unbedeutender Ort. Vater, Mutter, Tochter und Sohn zieht es zu den örtlichen Laienbühnen von Karnevalsverein, Schützenverein und katholischer Jugend. Die Rollen auf der Bühne wie auch die Rollen im Alltag spielen sie mehr schlecht als recht. Die vielen geplatzten Träume und die innere Gefangenschaft der Personen sind der Nährboden ständiger Konflikte. Sie überdecken oft die Vielfalt erbaulicher Erlebnisse der einzelnen Familienmitglieder. In diese Atmosphäre emotionaler Unsicherheit wächst der zunächst noch pflegeleichte Rudi hinein. Doch von der Pubertät an kommt es in zunehmendem Maße zu Rivalitäten zwischen Vater und Sohn. Flucht erscheint ihm als Ausweg...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 637
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Irgendwo im Bergischen Land liegt Fronheim. Ein unbedeutender Ort. Kaum jemand außerhalb der Ortsgrenze nimmt Notiz. Kleine Bauern, Handwerker und Fabrikarbeiter dominieren die Schicht der Erwerbstätigen. Die körperlichen und seelischen Einschläge der Kriegsjahre, wie auch eine eklatante Vernachlässigung geistiger Bildung werden in manchen Familien zum Auslöser von Konflikten zwischen den Eltern und den heranwachsenden Kindern. Die Brettschneiders haben Träume von besseren Zeiten, die oft in herben Enttäuschungen verpuffen. Alle Familienangehörigen zieht es zur Bühne. Karnevalsverein, Schützenverein und katholische Jugend bieten dazu Möglichkeiten. In diese Traumwelt wächst der zunächst noch pflegeleichte Rudi hinein. Aber mit Beginn der Pubertät ist mit dem Liebsein Schluss. Von da an gibt es in der Familie Brettschneider nur noch wenige spannungsfreie Tage. Die Rivalität zwischen Vater und Sohn gipfelt schließlich in einer unheilvollen körperlichen Auseinandersetzung. Die Familie bricht auseinander….
Rolf Baldsiefen, geboren 1943 in Lindlar, arbeitete zunächst als Schriftsetzer, später als Lehrer an Haupt- und Gesamtschule, als Liedermacher und als Maler. Mit Laienspieler (2007) gibt er sein Debüt als Schriftsteller.
Inhaltsverzeichnis
1. Teil: Heimatbühne
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
2. Teil: Sturm und Drang
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
3. Teil: Amerikanisches Finale
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Glossar
1. Teil: Heimatbühne
1.
Als die ersten fünfzig Jahre des vergangenen Jahrhunderts über die kaum nennenswerten kleinen und mittelgroßen Dörfer im Tal der Sülz dahingekrochen waren und den nächsten fünf Dekaden Einlass gewährten, da gewannen die kleinen Dinge, die dem Alltag Farbe verleihen, an Gewicht. In Fronheim, dem Handlungsort unserer Geschichte, gab es weder Polizei noch Arzt und die wenigen Telefonanschlüsse ließen sich noch an zehn Fingern abzählen. In den Nächten bekam manch einer der Zecher einen Schrecken, wenn er in Ermangelung einer Straßenbeleuchtung mit einem anderen Spätheimkehrer, der von der zweiten Theke des Ortes heim wankte, auf der in tiefste Finsternis getauchten Straße zusammenstieß.
Die Fernsehhändler klopften schon an die Türen des rund achthundert Seelen zählenden Gemeinwesens. Sie mussten sich aber noch etwas gedulden.
Auch für die rund zweihundert Familien von Fronheim, deren Lohntüten zu keinen größeren Sprüngen Anlass gaben, war nach wie vor Geduld die Nummer Eins in der Rangliste der Überlebensstrategien und sollte es wohl noch längere Zeit bleiben.
An den Sonntagen wurden die vielen Wald- und Feldwege zu Laufstegen familiärer Eitelkeit. Kein Fremder hätte erkennen können, welcher soziale Rang und welche Rolle im häuslichen Drama sich hinter der Maske des Sonntagsstaats verbarg.
2.
Es war ein wunderschöner Sommertag. Das bunte Völkchen heimischer Singvögel konzertierte schon seit vier Uhr in der Früh. Udo, dem Hund des alten Gluck, musste eine Laus über die Leber gelaufen sein, denn eine Stunde nach Eröffnung des Morgenkonzerts zerschnitt sein dümmliches Bellen das Wohlgefühl der Schläfer, die, eingelullt in die Klänge dieser ungeschriebenen Partitur, sich noch einmal herumgedreht hatten. Wieder eine Stunde später war es mit der Nachtruhe dann endgültig vorbei, als die Kirchenglocken von St. Agatha zur Frühmesse gemahnten.
An diesem herrlichen Sonntagmorgen stand für Familie Brettschneider ein längerer Spaziergang auf dem Programm. Man wollte mal wieder nach Weiler. In Weiler gab es den „Krug“. Die Frikadellen und der Kartoffelsalat der Gast- und Raststätte erfreuten sich seit jeher einer Beliebtheit weit über die Grenzen des Ortes Weiler hinaus.
Gegen sieben war schon reger Betrieb in der eher für Zwerge vermessenen Küche des kleinen Fachwerkhauses, das die Brettschneiders nun schon seit acht Jahren bewohnten. Das Häuschen lag an einem schmalen Weg, der in einem rechten Winkel von der Durchgangsstraße abbog. Die Durchgangsstraße trug zu Recht diesen Namen.
Die noch kleine Zahl der Fahrzeugbesitzer von außerhalb durchfuhr den Ort nur, um zu einem der größeren Orte und Kleinstädte zu gelangen. Der eine oder andere legte hin und wieder einen kurzen Stopp ein, um sich vom Wirt der „Dorfschenke“, dem Glucks Erich, die mehr oder weniger wahren lokalen Aktualitäten berichten zu lassen. Die Fronheimer selber verließen nur dann ihren Heimatort, wenn die wenigen Geschäfte vor Ort den momentanen Bedürfnissen nicht gerecht werden konnten.
Wenige arbeiteten außerhalb der Ortsgrenze und nahmen den Bus, der sie nach Arbeitsschluss wieder zurückbrachte.
Der Blick von der Durchgangsstraße traf gleich auf das kleine Fachwerkhaus. Rechts davor, im rechten Winkel zur Straße, stand seit ewigen Zeiten die „Dorfschenke“, die mit einer Kombination aus Lebensmittel- und Schreibwarenladen baulich verbunden war. Fachwerkhaus, Gastwirtschaft und Laden gehörten der alten Frau Gluck und ihrem Mann, von allen liebevoll Opa Anton genannt. Die alten Glucks und die Familie ihres Sohnes bewohnten das obere Stockwerk. Den Brettschneiders gegenüber hatte der Falters Jupp seinen ambulanten Tabakwarenhandel. Die Bäckerei Weiske schloss sich mit dem Laden links vom Weg und dem Backes auf der anderen Seite des Weges an. Einige Meter weiter führte der Weg vorbei an drei weiteren kleinen Fachwerkhäusern. Dieses noch nicht asphaltierte Stückchen Erde, das nach jeder Witterung ein anderes Gesicht zeigte, war zugleich das Kommunikationszentrum dieser Familien. Hier traf man sich zum munteren Schwätzchen und zum Austausch des „Allerneuesten“. Jede Familie hatte vor ihrem Haus eine Bank, die von allen genutzt wurde.
Der Weg ging nach zweihundert Metern über in das „Sträßchen“. Dank seiner starken Neigung avancierte der sechzig Meter lange Abschnitt im Winter zum Rodelparadies für die Fronheimer Kinder. Am Kopfende schloss sich das „Sträßchen“ an den drei Meter breiten nur noch leicht ansteigenden dreihundert Meter langen Kirchweg an.
Anna Brettschneider hatte heute als erste ihr Bett verlassen, war leise die steile Holztreppe heruntergehuscht und hatte den Herd angemacht, um Kaffee zu kochen. Hier am Herd war ihr Platz. Hier war sie die absolute Herrscherin. Nicht einmal Gertrud, ihrer heranwachsenden Tochter, gewährte sie Einlass in ihr Reich. Die Ursachen für die späteren misslungenen Kochversuche Gertruds werden daher nicht schwer auszumachen sein. Links vom Herd, zwischen Waschbecken und Treppe, stand der Kohlenkasten. Es war Rudis Aufgabe, ihn immer wieder mit Briketts und Eierköhlchen zu füllen. Unter der Treppe, die zum kleinen Speicher und zum nicht viel größeren Schlafzimmer der Eltern führte, befand sich das Heiligtum von Rudis Vater, Alois Brettschneider. Als schlecht verdienender Fabrikarbeiter in dem sieben Kilometer entfernten Edelstahlwerk Hager & Krott hatte sich sein Traum von einer eigenen Werkstatt nicht erfüllen können. Der Keller stand die meiste Zeit im Jahr unter Wasser, so dass er für diesen Zweck ungeeignet war. Außerdem war dieser Ort mit seinem Rundgewölbe reserviert für Brennmaterial, Kartoffeln und Eingemachtes. Die dafür notwendigen auf Pfählen stehenden Kästen und Regale hatte Brettschneider selbst geschreinert. Die Winterzeit über hingen nach innen gedrehte ausgestopfte Kaninchenfelle von der Decke herunter, die im Frühjahr von einem Kürschner aus Renneberg abgeholt wurden. So hatte Brettschneider sich notgedrungen auf den kleinen Raum unter der Treppe beschränken müssen. Hier lag das bisschen Werkzeug, das immerhin ausreichte, um so manche Reparatur am Haus und an den wenigen Gartengeräten durchzuführen. Kein anderer als der Patron selber durfte sich der nützlichen Raritäten bedienen, es sei denn, er gestattete eine Ausnahme. Dann allerdings sprang er ständig um den Benutzer herum und achtete darauf, dass die großzügige Leihgabe nicht durch unsachgerechte Handhabung beschädigt wurde. Rudi hatte des Öfteren, trotz der Angst vor Strafe, dieses oder jenes Werkzeug benutzt. Er hätte ohnehin, um sich nicht zu verraten, jedes heimlich fabrizierte Stück verstecken müssen. Man kann sich vorstellen, wie verkrampft der Junge die wenigen Male ans Werk gegangen ist. Ich muss mir genau merken, wo ich welches Werkzeug weggenommen habe. Lag der Hammerkopf nach hinten oder nach vorne im Schränkchen? Waren die Zangenbacken geöffnet oder hatten sie geschlossen zwischen … ja, zwischen welchen anderen Werkzeugen … gelegen? Und wenn er beim Zurücklegen nicht exakt der von Brettschneider vorgesehenen Lage von Zange, Hammer und Meißel entsprochen hatte, gab es abends Theater. Dem Vater längere Zeit die Wahrheit nicht zu sagen, hielt Rudi nicht aus. Nicht aus moralischen Gründen sondern aus tödlicher Angst hätte er die Schuld mit sich herumgeschleppt wie einen stinkenden Jauchekübel. Ein paar hinter die Ohren brachte denn, so paradox es klingen mag, die Erlösung. Um aber nicht ständig in dieser Gewissensnot leben zu müssen, ließ er es irgendwann ganz.
Der einzige Schmuck des Eingangsbereichs, dieses Mehrzweckraumes für Kochen, Kohlen, Körperpflege, bestand aus zwei kleinen vierzehn mal vierzehn Zentimeter großen gerahmten Farbdrucken. Es waren Kopien von Bildern des holländischen Malers Jan Vermeer van Delft. Auf dem einen Bild sitzt eine Lautenspielerin, die ein ähnliches Instrument in ihrem Schoß hält, wie es Anna Brettschneider mit in die Ehe gebracht hatte. Vielleicht war dies einer der Hauptgründe, warum sie so sehr an diesem Bild hing. Auf dem zweiten Bild sieht man eine Spitzenklöpplerin, die weltabgewandt sich voller Hingabe ihrer Arbeit widmet.
„Dat is wat Echtes“1, hatte sie dem sechsjährigen neugierigen Rudi erklärt. Der war noch zu klein, um Mutters Behauptung auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Erst Jahre später war ihm Mutters Erklärung als kritiklose irrige Schwärmerei aufgefallen. Wer weeß, wer dr Mama sonen Quatsch beijebraat hätt 2, dachte er und sah keinen Grund, die Mama nachträglich in eine unangenehme Situation zu bringen.
Heute war das innerfamiliäre Klima gut. Auch der Himmel spielte mit. Die Sonne hatte sich schon vor Tagen durchgesetzt und schien sich den Logenplatz auch für die nächsten Sommertage nicht nehmen zu lassen. Das wolkenfreie Blau entsprach den von Nörgeleien und Streitlust gesäuberten Gedanken der vier Wanderwilligen. Heute ging man ausnahmsweise mal nicht zur Kommunion. Mit nüchternem Magen wollte man die Wanderung nicht beginnen. So gab es schon vor dem Kirchgang Frühstück: zur Feier des Tages Edelstolzkaffee und mit Butter bestrichene Weckchen vom Vortag. Der Sonntag war den Bäckern damals noch heilig.
Das Haus wurde abgeschlossen, obwohl das Inventar keinem Dieb Freude bereitet hätte. Der vorsintflutliche gusseiserne Hausschlüssel wanderte in Mutter Brettschneiders Tasche. Vater und Sohn schlugen noch einmal nacheinander am Grauwackesockel der hinteren Hauswand ihr Wasser ab. Es war die Westseite, die Seite, an der der Regen sich in erheblichem Maße an der Gebäudereinigung beteiligte. Man scheute das Plumpsklo, das sich nur drei Meter entfernt im hinteren Teil des Geräteschuppens befand. Gertrud, Rudis sieben Jahre ältere Schwester, hatte sich des lieben Friedens Willen entschlossen mitzugehen, obwohl sie nicht mehr allzu viel von solchen Familienaktivitäten hielt. Den Weg zur Kirche schafften die Vier in rund fünfzehn Minuten. Der Gottesdienst dauerte eine Dreiviertelstunde. Dann nahm das Unternehmen Familienausflug seinen Lauf.
Nach wenigen Kilometern erreichten sie den Nadelwald, den sie auf dem Weg nach Weiler zu durchqueren hatten. Rudi freute sich auf die Sinalco, die er schon seit Jahren für Liebsein während der Wanderung bekam. Da bekanntlich eine gute Laune den Menschen gestimmt macht, Normen für eine Weile zu ignorieren, setzten die vier Glücklichen heute das Ruhegebot des deutschen Waldes außer Kraft. Es wurde gesungen. Gertrud und Mutter Anna stimmten eines ihrer liebsten Bügelbegleitlieder an. Vaters Bariton und Rudis Knabenstimme machten das Quartett komplett und vierstimmig erklang das Lied von Farina, dem braunen Naturkind. Das war deutsche Schlagerkunst vom Feinsten. Da wogten Maisfelder im Lenzwind. Das Mädchen Farina flocht ihrem Poncho, so hieß der nächtliche Liebhaber, einen Blütenkranz. Da passte der Mond auf, dass beiden nichts geschah. Zu guter Letzt bat Poncho die Farina, doch mit ihm zu gehen. Und da Poncho sie so nett gebeten hatte, willigte Farina ein. Und so zogen sie beide von dannen, vermutlich ins Glück, wie sich das in den damaligen Schlagern so gehörte. Und die eher spärliche Kommunikation zwischen Farina und Poncho soll in Moll und in Dur stattgefunden haben. Letzterem Tongeschlecht widmete sich das Brettschneider-Quartett. Die stimmliche Sicherheit aller Familienmitglieder und die Freude an der Terzenseeligkeit sorgten dafür, dass die positive Stimmung bis zum Abend anhielt.
Mit den Jahren kam es immer seltener zu solchen in Eintracht ablaufenden Ereignissen. Die stupide und körperlich schwere Fabrikarbeit hatte den Vater schon früh verschleißen lassen. Viele Enttäuschungen hatten seine Vita geprägt und ihn zu einem weltfremden immer reizbareren Egoisten gemacht. Sein Bildungsnotstand und seine unreflektierten und daher selten zu begreifenden Erziehungsmaßnahmen gaben immer häufiger Anlass zu innerfamiliären Konflikten. Die Blicke zwischen dem heranwachsenden Sohn und seinem Vater verdunkelten sich in zunehmender Weise. „Do wiers (wächst) mo nit över dn Kopp.“3 Das „Du“ versah der kopflose Vater mit starkem Nachdruck. Sein Zorn zielte auf den jetzigen Rudi, den hilflosen Rudi. Sicher hatte er längst erkannt, dass der andere Rudi, der Rudi der nächsten Jahre sich seinem Machtanspruch entziehen wird. So war denn seine Verzweiflung nicht zu überhören, wenn er Rudi sein Gesetz an den Kopf knallte: „Sulang du ding Föß unger mingen Dösch setz`, häs de zo doon, wat de Mamma un ech dir säjen.“4 Die Mama hatte er einfach ungefragt mit einbezogen in seine Drohung. Dies sollte es ihm leichter machen, seine Ohnmacht zu ertragen. Es gab Tage, da schien allein Rudis Anwesenheit für den Vater Grund genug zu sein, seine Geschütze aufzufahren. Ein Satz, manchmal nur ein Wort, waren dann Auslöser einer väterlichen Attacke. Schon Rudis Atmung zur Stützung des ersten Wortes, ja schon das Denken einer Erwiderung registrierte der Seismograph des Vaters und machte einen Präventivangriff erforderlich. Mimik und Gestik allein waren keine Garantie für einen Triumph. Erst seine Stimme gab ihm kurzzeitig das Gefühl des Sieges. Er dröhnte mit seinem sich überschlagenden Bariton alle Versuche einer Gegenwehr nieder. Die dünnen Wände des Fachwerkhauses erlaubten den vorbeiziehenden Passanten eine unbeabsichtigte Teilnahme am Drama der Protagonisten.
Draußen stand die alte Frau Donrath. Mit ihren achtzig Jahren war sie die Älteste unter den Nachbarn. Hören konnte sie aber noch wie eine junge Frau. Und da ihr tägliches Unterhaltungsprogramm vorwiegend aus Spinxen, Kiebitzen und dem Hören von Flöhehusten bestand, war für sie das Geschrei aus dem dünnwandigen Fachwerkhaus eine willkommene Abwechslung. Ihre Stimme, die nur wenig an jugendlicher Kraft eingebüßt hatte, glich sie durch hexenhafte schneidende Übertöne aus. Jetzt mischte sie sich lauthals in das Theater der Brettschneiders ein.
„Haaloo“.
Anna Brettschneider hatte den Ruf der Alten gehört und öffnete das Fenster.
„Wat es dann bei üch loss?“ 5
„Hück es Waschdaach“ 6, versuchte Frau Brettschneider die für sie peinliche Situation zu entschärfen.
„Waschdaach? Un do maat ihr esune Kraach?“ 7 Frau Donrath liebte es, so laut zu sprechen oder gar zu rufen, damit nur ja das ganze Dorf etwas davon mitbekam.
„Jo, jo, Waschdaach. Dä Jung kritt ens widder de Kopp jewäsche“. 8
„Ja, ja, die Jurend.“ 9 Dann hob sie noch einmal ihre Stimme.
„Evver - mir woren fröher och nit besser!“ 10 Der kleine Seitenhieb ließ sich unschwer überhören.
Inzwischen hatte sich der Sturm zwischen den Lehm- und Holzwänden gelegt. Anna Brettschneider sah zwischen sich und der alten „Vürwitzschnute“ 11 keinen weiteren Gesprächsbedarf und schloss wieder das Fenster.
3.
Rudi hatte nach acht Jahren die Katholische Volksschule in Fronheim mit einem glänzenden Abschlusszeugnis verlassen und war nun schon seit einem Jahr in der Lehre. Jeden Morgen fuhr er mit dem Bus der Wupper-Sieg AG nach Dinkelbach. Hier hatte er in der Druckerei Schmelling die Lehre als Schriftsetzer begonnen. Sein eher mickrig zu nennender Körperwuchs und sein ahnungsloses, hin und wieder zu heftiger Röte tendierendes Gesicht, das in unterschiedlich langen Intervallen herab von einem proportional viel zu langen Hals leuchtete, kamen den älteren Kollegen zu pass. Sie brauchten einen Schwachen, mit dem sie ihren einseitigen Spaß haben konnten. Rudis Lebensfremdheit, die er aus seiner geistig wenig anregenden häuslichen und dörflichen Umgebung mitbrachte, verleitete manchen Kollegen zu bösartigen Späßen und Hänseleien. „Hier, halt mal die Zeilen und kuck mal, ob du einen Fehler findest“, sagte der Altkollege an der Linotype und ließ ihn Zeilen, die gerade den Gießmund verlassen hatten, ungeschützt aus dem Zeilenhaken nehmen. Der Erfolg des Altkollegen wurde mit mehr oder weniger lautem Applaus belohnt. „Hol mir in der Apotheke eine Milchpumpe für meine Frau.“ Im letzten Moment hatte man ihn zurückgerufen. Vor Wut hatte er das für Auslieferungen von Drucksachen bestimmte Fahrrad in die Ecke gefeuert. Dafür gab es dann von höchster Stelle eine Rüge, die er einstecken musste, ohne über die Gründe seines Verhaltens befragt zu werden. Ein pfiffiger jüngerer Kollege heftete ihm unbemerkt einen diskriminierenden Spruch an den Kittel. Bevor er selber diese feige Tat bemerkte, hatten sich Kollegen der Druckerei Schmelling, Männer und Frauen, auf seine Kosten amüsiert. Solche und viele andere Aufträge dachte man sich für ihn aus. Walter, sein zwei Jahre älterer Lehrlingskollege, kannte keine Hemmungen bei der Wahl seiner Schandtaten. In dem kleinen engen Kellerraum stand die hölzerne Papierpresse. Nicht mehr verwendbares Papier- und Verpackungsmaterial wurde vom Parterre durch einen eigens dafür eingebauten Schacht direkt in die nach oben geöffnete Presse befördert. Um dem entstehenden Papierballen die nötige Festigkeit zu geben, musste immer einer der Lehrlinge in den Kasten steigen und mit seinen Füßen das Papier stampfen. Rudi war gerade dabei, als sich oben über dem Einfüllschacht die Klappe öffnete und er nur kurz Walters hämisches Grinsen wahrnahm. Und schon ergoss sich die Füllung eines Wassereimers über ihn. Bis seine Sachen getrocknet waren, behalf er sich mit Walters Kittel, den der ihm gönnerhaft zur Verfügung stellte.
Selbst die Geschäftsleitung hielt sich nicht an die Spielregeln. Die alte Chefin zwang ihn in unfreundlichem Befehlston, ihre Teppiche auszuklopfen. Wieder fiel kostbare Ausbildungszeit aus. Freitags war Putztag. Dagegen hatte Rudi grundsätzlich nichts einzuwenden, gab es doch, vor allem im Kellerbereich, wo der alte Kriegsversehrte, Paul Hammel, seinen kleinen Getränkestand betrieb, immer viel zu lachen. Dass er allerdings auch beide Klos, das Männer- und das Frauenklo zu reinigen hatte, stand nicht in seinem Lehrvertrag. Als er dann wahrheitsgetreu alle diese außerberuflichen Tätigkeiten in seinem Berichtsheft, mit der jeweiligen Zeitangabe, eingetragen hatte, zwang ihn der Betriebsleiter, dem Rudi die Peinlichkeit an den Augen ablesen konnte, dies zu ändern. Er solle halt Arbeiten eintragen, die dem Ausbildungsstand entsprachen. Die Berufschule rege sich sonst unnötigerweise auf. Auch er, der Betriebsleiter sei einmal Lehrling gewesen, und auch er habe, nicht anders als Rudi, Dinge tun müssen, die eben getan werden mussten. Und geschadet habe es ihm auch nicht. Schließlich seien Lehrjahre keine Herrenjahre.
Wenn Rudi dann am Abend weinend seinem Vater von den Schikanen berichtete, versuchte der ihn zu trösten mit der Bemerkung: „Mach en Fuß (Faust) en de Täsch“. 12 Was hätte der Vater auch ändern können? Sein Leben als Fabrikarbeiter hatte seine Sprache so dermaßen reduziert und ruiniert, und auch an Geduld mangelte es ihm, so dass er befürchtete, nicht überzeugend vor der Geschäftsleitung der Druckerei Schmelling auftreten zu können. Und – wer hätte ihm den Verdienstausfall und das Fahrgeld für den Bus nach Dinkelbach ersetzen sollen? Auch den Eltern fiel nichts Besseres ein, als auf den Spruch hinzuweisen, den er schon von seinem Betriebsleiter hatte anhören müssen. So war denn Rudis dreijähriger Lehr und Leidensweg, ohne Hoffnung auf bessere Zeiten, vorprogrammiert.
Doch eines Tages gab es eine wohltuende Unterbrechung. Walter nahm Rudi in der Pause mit zu sich nach Hause, um ihm seine neue Single vorzuführen. Es blieb für Rudi unverständlich, wieso gerade der, der genauso wie die anderen ihn als Zielobjekt ihrer Gemeinheiten benutzte, ihm diese Freude machen wollte.
Es gab immer häufiger Anlässe, die ihm zeigten, welch Konglomerat von Eigenschaften Menschen in sich vereinen können. Da paarten sich die Bosheit mit der Güte, die Hinterhältigkeit mit der Offenheit und der Hass mit der Liebe. Die Seele, so schien ihm, war wohl ein grenzenloser Tummelplatz all dieser Gegensätze.
Trotz allem: Heute weiß er, dass damals mit ihm etwas Wunderbares geschehen ist, das ihm Hoffnung gab und ihm Mut machte durchzuhalten.
RCA hatte die neueste Scheibe von Elvis Presley auf den deutschen Markt geworfen und Rudis Kollege hatte sie sich gekauft. Sein Taschengeld-Etat erlaubte ihm hin und wieder solche spontanen Lustkäufe und so konnte Rudi, bei dem die finanziellen Mittel dem Einkommen des Vaters entsprechend gering waren, von Walters Anschaffung profitieren.
Der Weg bis zu Walters Elternhaus war zwei Kilometer lang und so blieb denn zum Abspielen der Single nicht viel Zeit übrig. Walter hatte die Platte auf dem kleinen Perpetuum Ebner aufgelegt und nun machte sich der mit einem Transmissionsriemen aus Gummi angetriebene Apparat an die Arbeit. Für Rudi war dies alles viel zu phantastisch, als dass er sich um die profanen Dinge gekümmert hätte. Hier sang, oder besser gesagt, hier schrie einer eine Botschaft über den Atlantik, die schon nach wenigen Takten Rudis Panzer aufbrach und ihn für zweimal drei Minuten aus der feindlichen Welt der Philister in seinem Lehrbetrieb heraushob. Da wurde Walters Zimmer zu Memphis, zu Amerika. Und Rudi, der während seiner Schulzeit keine Gelegenheit hatte, englisch zu lernen, verstand diesen Elvis besser als jeder andere. Hier schrie jemand Rudis gesamtes Frustdepot leer: Hört her ihr in Gemeinheiten Eingerosteten! Ihr Seelenritzer! Ihr, die ihr euch schamlos an den Schwächen anderer ergötzt und Freundlichkeiten nur in eigennützigen kleinen Dosen verschenkt. So und nicht anders muss es Elvis gemeint haben, wenn Rudi mit Hingabe, gar mit Anbetung seinem „Jailhouse Rock“ oder seinem „Heartbreak Hotel“ lauschte. Aber auch seine Einsamkeit, seine Ohnmacht, sein Verlangen nach Zuneigung fand er von Elvis in seinem „Lonely Man“ oder „Love Me Tender“ verstanden. Elvis war der einzige, von dem er sich ernst genommen fühlte. Wenn auch zu diesem Zeitpunkt das Beherrschen der englischen Sprache für Rudi noch Nebensache war, so wurde, da sein Verlangen nach Identifikation mit seinem amerikanischen Freund sich mit jeder neuen Single verstärkte, das Erlernen der englischen Sprache zur Bedingung. Anders als sein Kollege, der in der Dinkelbacher Realschule englisch lernen durfte, war Rudi dies in der Fronheimer Volksschule verwehrt geblieben. Die elf Kilometer entfernte Abendschule war damals für einen Lehrling, der acht und mehr Stunden seinem Betrieb gehörte, zudem auch noch ohne eigenes Fahrzeug an seinen Ort gebunden war, keine realistische Lösung des Problems. Erst in späteren Jahren, als Rudi längst sein Elternhaus verlassen hatte, sollte sich ihm in den mittlerweile flächendeckend eingerichteten Volkshochschulen die Gelegenheit des Nachholens bieten.
Zu Hause hatte man noch kurze Zeit nach Kriegsende einen Volksempfänger, mit einer Skala, die beim Drehen gefährliche Knack- und Kratzgeräusche von sich gab. Ein runder Stofflappen schützte die Membrane. Der gestiegene Anspruch, auch der ärmeren Leute, verlangte nach einem Möbelstück, das etwas hermachte. Der alte schwarze Plastikkasten von Hitlers Gnaden flog im hohen Bogen auf den Müll. In den anderen Familien verfuhr man ähnlich. Wer aber glaubte, mit der Beseitigung der Volksempfänger sei auch das über die Ätherwellen in die Wohnungen gegossene Gedankengut der Nazis beseitigt worden, der hatte sich geirrt. In den folgenden zehn, zwanzig Jahren waren immer wieder böse klingende Töne der Unverbesserlichen und der am neuen Staat Leidenden zu hören, dass der Adolf es garantiert besser gemacht hätte. Mit der Neuanschaffung wollte man nun endlich ungestört Musik, Nachrichten und Hörspiele konsumieren dürfen. Vater Brettschneider besorgte einen gebrauchten und preisgünstigen Heinzelmann. Den pflanzte er mitten auf den Wohnzimmerschrank. In seinem hellen Holzgehäuse zeigte das Gerät dem Besucher, dass auch für die Brettschneiders „dr Wohlstand usjebrochen es“. 13 Man konnte mit ihm jedoch nur mehr schlecht als recht Mittelwelle und Langewelle empfangen. Was fehlte, war die Ultra-Kurzwelle. UKW aber brachte Studio B, montagsabends, moderiert von Chris Howland. Zum Repertoire der Sendung zählten Schlager von Paul Anka, Pat Boone, Conny Francis und Johnny Cash, und es fehlten nie Titel von Elvis Presley. Es gab Schlager und Schlagerparaden; der Name Hit war noch nicht geboren. Rudi musste sich jeden Dienstag von seinen Freunden und Lehrlingskollegen anhören, dass Elvis wieder einmal der absolute Knaller gewesen war. An ein neues Radio war aber bei der akuten Finanzmisere der Familie nicht zu denken.
Aus den Kolonialwarenhandlungen waren inzwischen Lebensmittelläden geworden. In Fronheim gab es davon zwei. In beiden hatten die „ärm Lück“ 14 „Anschreibebücher“ hinterlegt. Wenn die Schuldeintragung bei den Brettschneiders in dem einen Buch zu Image schädigender Höhe anwuchs, schickte die Mutter ihren Rudi in das andere Geschäft. Die letzten Bohnen pulend, die allzeit bereite orangefarbene Plastikschüssel vom Schoß nehmend, rief sie ihm hinterher, er solle den Schlusssatz beim Hinausgehen nicht vergessen. Er verließ die Läden dann immer mit der stereotypen Formel: „De Mama bezahlt.“ Auch beim Metzger lag ein Anschreibebuch. Hier gab es für den kleinen Brettschneider vorm Verlassen des Geschäftes die obligatorische Scheibe Fleischwurst. In den Lebensmittelläden bekam der Blondschopf ein Tütchen voll mit harten Himbeerbonbons, die ihm immer den Gaumen zerfledderten.
Die Arme-Leute-Ehre ließ es nicht zu, länger mit der Zahlung auf sich warten zu lassen. Da diese Beträge nie eine beängstigende Höhe erreichten, waren die jeweiligen Ladeninhaber immer wieder zu Stornierungen bereit. Was sollten sie auch anderes machen. Meistens konnte schon mit der nächsten Lohntüte die angehäufte Schuld beglichen werden.
Die meisten Familien von Fronheim zählten zur untersten Einkommensklasse. Ein UKW-Empfänger mit Studio B war nun mal nicht drin. Man war auch nicht bereit, nötigere Anschaffungen dafür auf die lange Bank zu schieben.
Es war an einem Samstagmorgen. Rudi machte sich wieder einmal zu einem Botengang für die Metzgerei Rödder fertig. Der Vierzehnjährige hatte sich um diese bezahlte Freizeitbeschäftigung bemüht, denn irgendwie musste er das Geld für einen eigenen UKW-Empfänger zusammen bekommen. Nach dem gemeinsamen Mittagessen zu Hause fuhr er mit seinem Fahrrad, das ihm der Freund seiner Schwester Gertrud, der Hoffmanns Paul, für fünf Mark verkauft hatte, die zweihundert Meter bis zu seinem Auftraggeber. Er fuhr vorbei an Glucks „Dorfschenke“ und Lebensmittelladen und vorbei an der Schusterwerkstatt des Feierabendschusters Emil Böll. Böll hatte als Ausgebombter kaum Kunden gewinnen können, da man im Dorf dem alteingesessenen Schuster Schatz die Treue hielt. Tagsüber verdiente Böll auf dem Bau als Handlanger seinen Lohn und den wenigen Neuen im Dorf, die sich noch nicht festgelegt hatten und denen er eben wegen der wenigen Aufträge auch schneller helfen konnte, machte er abends die Schuhe. Von der „Avus“-Kurve, wie die jungen Auto- und Motorradliebhaber die Kurve zwischen dem Kriegerdenkmal und dem Hotel-Restaurant Heinen nannten, bog jetzt Rudi nach links ab und war nach wenigen Metern bei der Metzgerei. Dort wartete auf ihn ein Korb mit bestellten Wurst- und Fleischwaren, die er zu den Kunden in den umliegenden Ortschaften zu bringen hatte. Nach Beendigung dieses Botendienstes erhielt Rudi seine vier Mark. Aber genau so wichtig wie das Geld war das nun folgende Nachspiel. Frau Rödder mochte den Jungen. Sie hatte der Mutter oft von Rudi und seinem klaren Blick geschwärmt. Das hatte die Mutter sehr stolz gemacht. Auch das Anschreiben war für die Metzgersleute nie ein Problem gewesen. Frau Rödder hatte die Satten und die Hungrigen vor ihrer Theke studiert. Rudi zählte zu den letzteren. Jeden Samstag gegen fünf Uhr kehrte er von seinem Botengang zurück. Zu diesem Zeitpunkt konnte die Metzgersfrau überblicken, was über das Wochenende an Wurst- und Fleischwaren liegen blieb. So bat sie den hungrigen Jungen ins Wohnzimmer, wo sie bereits groß aufgetischt hatte. Nach anfänglichem Zögern und der Bitte der Frau Rödder folgend, „haute“ er denn auch rein, bis ihm der Bauch zu platzen schien. Danach schwang er sich auf sein Fahrrad und trampelte den Weg zurück nach Hause. Frau Rödder blieb noch eine Weile in der Tür stehen und schaute wehmütig dem hübschen Jungen hinterher.
Zu Hause gab es, wie jeden Samstag, die leckeren Samstagnachmittagsteilchen vom Bäcker Weiske. Schon beim Öffnen der Haustür roch Rudi das Aroma des frisch gemahlenen Kaffees. Schnell hängte er seinen Anorak an einen der Garderobehaken über dem Kohlenkasten und betrat erwartungsvoll das Wohnzimmer. Hier warteten schon Schwester Gertrud und der Vater. Die Mutter kam mit den Teilchen aus dem Frischhaltekeller und das Wochenendvergnügen nahm seinen Lauf. Was der Vater an diversen sonntäglichen Mittagessen sein „Leibgericht“ nannte, das waren für Rudi die unvergleichlichen Teilchen vom Bäcker Weiske. Nach den süßen Extras zündete sich der Vater zur Feier des Tages einen Burger Stumpen an. Die Mutter schenkte noch eine zweite Tasse aus dem„ Bunnepöttche“ 15 nach, so dass das Familienprogramm für diesen Zeitraum, einem Ritual gleich, seinen stimmigen, ja geradezu würdigen Abschluss erfuhr. Zu Beginn des Winters, wo Rudis Wurst- und Fleischtransporte witterungsbedingt ein Ende fanden, halbierte sich sein samstägliches Essvergnügen. Der Kaffee- und Kuchenschmaus blieb jedoch noch längere Zeit ein Ritual des gemütlichen Beisammenseins.
An einem dieser Samstage hatte die Mutter für ihren Sohn eine Überraschung. Sie erzählte von einer Rentnerfamilie im benachbarten Holltal, die sich eine Musiktruhe mit Radio und Schallplattenapparat gekauft hatte. Sie habe gehört, dass sie ihr altes UKW-Gerät für fünf DM abgeben würde. Schnell eilte Rudi zum Schuppen und holte sein Fahrrad, das er eben erst abgestellt hatte. Die Mutter griff nach dem Portemonnaie und steckte ihm das Geld in die Rocktasche. Schon im Wegfahren rief er: „Danke Mama, danke!“ In Rekordzeit überwand er die fünf Kilometer und im gleichen Tempo kehrte er, das Radio festgeschnürt auf dem Gepäckträger, nach Hause zurück. Poh, für fünf Mark, das werden mir meine Kameraden nicht glauben. Und so war denn die Familie Brettschneider im Besitz eines Blaupunkt-UKW-Empfängers.
Dann kamen sie, die Montagabende. Seine Montagabende! Mit seinem Studio B! Das war Gottesdienst, das war die Droge für sieben Tage, die sich Rudi „reinzog“. Und da er nicht jeden Abend Zeit und Raum für „seine“ Musik beanspruchte, zudem seine ebenso vom neuen Rhythmus enthusiasmierte sieben Jahre ältere Schwester mit durch die enge Passage des mit billigen Möbeln zugestellten drei mal vier Meter großen Wohnzimmers rockte, waren auch die Eltern zu Zugeständnissen bereit.
Das war jetzt die Zeit der Epigonen. Schlagerstars und Filmhelden wurden zu Idolen, deren Fremdheit in Stimme, Sprache und äußerem Erscheinungsbild zum Nachmachen reizte. Der Generation der Eltern war dies erspart geblieben. Wen hätte man kopieren sollen. Man blieb bis dato in den Grenzen des Bekannten, des Normalen und lediglich die Mannequins in den Katalogen von Schöpflin und Quelle boten mit Frisur, Kleidung und kessem Blick möglicher Weise eine Vorlage. Bewegung und Stimme fielen als Muster allerdings aus. Da es nie zu Kaufempfehlungen allzu auffallender Kleidung kam, konnte man sich problemlos in der undifferenzierten Masse bewegen. Die bis dahin geschonten Blicke der Passanten wurden auch weiterhin nicht beunruhigt. Manche der Katalogkundinnen, gehen wir einmal davon aus, dass Männer kaum zum Kreis der Besteller gehörten, erlebten beim sonntäglichen Kirchgang oder beim Spaziergang am Nachmittag ihr blaues Wunder. Sie mussten mit ansehen, wie zwei oder drei weitere Kundinnen mit der gleichen neuen Errungenschaft von Schöpflin oder Quelle auf der Bildfläche erschienen.
Die jüngere Generation strebte jetzt nach Anderssein. Das ewig Gleiche im Alltag des Dorfes war ihr suspekt geworden. So mancher kleinere Ort hatte oberflächlich betrachtet den Charme eines Friedhofs. Das Festhalten am Gewohnten, das die Eltern mit den anderen Erwachsenen des Dorfes verband, fand bei der Jugend nur noch wenig Verständnis. Das Herumnörgeln der Eltern ging an dem einen Ohr hinein und an dem anderen Ohr wieder hinaus. Eine schwere Zeit für Mütter und Väter.
Rudi und viele andere seiner Generation gaben sich große Mühe, dem Gang und der Stimme des Idols möglichst nahe zu kommen. Aber schon bald hatte man die Grenzen erkannt. Deckungsgleiche war nicht zu erreichen, daher vermengte mancher Nachmacher all die Attribute, die bei ihm selber einen gewissen Grad an Ähnlichkeit mit diesem oder jenem Idol erkennen ließen, zu einem mehr oder weniger überzeugenden Konglomerat. Der Dunkelhaarige konnte unmöglich James Dean kopieren. Er wählte daher die gegelte Tolle und die Koteletten seines Elvis und blieb doch in Gang und Ruhepose seinem James aus „Denn sie wissen nicht, was sie tun“ treu. Überzeugen wollte man die große Schar derer, die den gleichen Informationsstand von Schallplatten, Radio, Zeitungen, Illustrierten und Kino-Filmen erworben hatten. Die beste Kopie oder das beste Ensemble an äußeren Erkennungszeichen konnte mit großem Zuspruch rechnen. Das Wagnis, sich nun plötzlich extrem anders als bisher in seinem Dorf zu zeigen, war nicht ungefährlich. Neider machten sich oft einen Spaß daraus, im Vorbeigehen die mit Mühe befestigte Haartolle durch einen schnellen gezielten Hieb zu zerstören. Weniger grob, jedoch für manchen genau so schmerzlich, waren das Verlachen und die Hänseleien, die nicht lange ausblieben. Also den Mittelweg finden und sich der Zustimmung gewiss sein, war in dem, in Normen verstrickten Fronheim, ratsam.
Als auf der Elviswelle nun auch ständig neue Fotos, sogar Filme herüberschwappten, bot sich Rudi der Vergleich mit seiner eigenen Erscheinung. Und da war weiß Gott keine Ähnlichkeit erkennbar. Schnell fand er einen Weg: Sein, wenn auch nur blondes Haar, erhielt ab der richtigen Länge eine Tolle und am Hinterkopf einen akkurat senkrecht gezogenen Scheitel, die sich beide, dank dem nötigen Quantum an Taft, den ihm seine Schwester zu ihrer eigenen Erheiterung gerne auslieh, für kurze Zeit haltbar machen ließen. Die Koteletten allerdings reichten Mangels Bartwuchs gerade mal bis zur Ohrmitte. Elvis war auf den vielen Fotos nie ohne Gitarre abgebildet. So wanderte ab sofort jede verzichtbare Mark in das Schubfach mit den Elvisfotos. Doch das gesparte Taschengeld, sowie Nebeneinkünfte aus der samstäglichen Lieferung von Fleischwaren für Metzger Rödder und aus dem Job als Kegeljunge, den er neuerdings auf der Kegelbahn des Hotel-Restaurants Heinen angenommen hatte, reichten nicht aus und hätten den Kauf viel zu lange hinausgezögert. Und da Verwandtschaft oder mögliche Sympathisanten der Brettschneiders für ein Vorstrecken des Fehlbetrags nicht in Frage kamen, „pumpte“ Anna Brettschneider, wie so oft schon, den Kölner Waren-Kredit-Verein, WKV, an. Aufgrund ihr unbekannter Alternativen wählte sie immer wieder nur diesen einen Weg und nahm jedes Mal die hohen Zinsen in Kauf. So war Rudi denn schneller, als er gedacht hatte, im Besitz einer Gitarre. Die ganze Familie freute sich über dieses Prachtstück. Es war eine mittelgroße rotbraun lackierte Framus mit Resonanzkörper und einem Plastikaufsatz, der zum einen beim Spielen mit dem Plektron den Lack vor unschönen Kratzern schützen sollte und zum anderen einen Elektroanschluss für einen möglichen Verstärker enthielt. Der Erwerb von Letzterem war verständlicherweise ausgeschlossen. Rudis zunehmender Drang jedoch, seine Verwandlung zu Ende zu bringen, duldete keinen Aufschub mehr. Er setzte seine schauspielerischen Qualitäten ein und nutzte jede kurze Pause im jeweiligen Lied, um mal eben an den beiden Knöpfen zu drehen, „um den Klang neu einzustellen“. Das jedenfalls glaubten ihm seine ersten jugendlichen Anbeterinnen aus der Nachbarschaft.
Rudi war es bis dahin noch nicht möglich gewesen, „Elvis the Pelvis“ in Kino oder Fernsehen in Aktion zu sehen. Lediglich ein Foto war ihm in die Hände gekommen, auf dem Elvis in herausfordernder Weise mit gespreizten Beinen seinen Unterkörper nach vorne bog. Das wollte nun Rudi unbedingt mit in seine Show aufnehmen. Doch immer, wenn er sich auf seinen nach außen gestellten Füßen haltend, langsam die Knie zum Boden und gleichzeitig die Rückenpartie in einen stetig spitzer werdenden Winkel bog, stürzte er nach wenigen Sekunden ab. Jedes Mal war dabei seine Gitarre, die er nicht aus den Händen ließ, in Gefahr, frühzeitig ihren Geist aufzugeben. Irgendwann stellte er seine Bemühungen ganz ein. Getreu dem ersten Gebot „Du sollst keine fremden Götter neben mir haben“ beschränkte sich Rudi auf seine Anbeterrolle und war damit zufrieden. Die Blamage des schlechten Imitators blieb ihm somit erspart.
Als Pubertierender in der immer unberechenbareren Welt der Erwachsenen hatte Rudi dank seiner Intelligenz schon früh begriffen, wann Anpassung, wann Widerstand ratsam war.
Um nicht jedes Mal aus allen Wolken zu fallen, wenn Mutter oder Vater ihn mit unverständlichen Erwartungen und Reaktionen traktierten, spielte er eine Zeitlang den angepassten Sohn, der seinen Eltern stets Freude bereitet. Wirkte zunächst noch die Vernunft mit bei seinen Entscheidungen und war das hartnäckige Pochen auf Recht ökonomisch wenig gewinnversprechend, so war ein Sichstämmen gegen den wachsenden inneren Widerstand auf die Dauer unmöglich durchzuhalten. Er erkannte in zunehmendem Maße, dass ihm eine Glocke von Entwicklungsblockern übergestülpt worden war. Und so schlug sein Verhalten schon bald in Unnahbarkeit und Aggression um. Zu Hause hielt er sich jetzt nur noch dann auf, wenn er in seinem Zimmer unterm Dach sein „Tutti frutti“ röhren konnte. Seine Eltern hatten nach langem Hin und Her Einsicht gezeigt und ihr Schlafzimmer nach unten verlegt. Das hatte den Nebeneffekt, dass sie ihren jugendlichen Rebellen zumindest aus den Augen hatten. Ihre Ohren allerdings wurden nicht geschont.
4.
Alois Brettschneider hatte schon bald, nachdem er die Ehe mit Anna Meller geschlossen hatte, deren Wanderlaute übernommen. Ihr selber taten die Finger, auf deren Kuppen vom vielen Wäschewaschen sich kein Horn mehr bilden wollte, zu weh und so war sie froh, dass das gute Stück nicht auf dem Speicher sein Dasein zu fristen brauchte. Alois spielte auf dem Instrument, sobald er Lust und Zeit dazu hatte. Mit wenigen Akkorden und einem immer gleichen Wechselspiel von Daumen und dem Rest der Finger der rechten Hand begleitete er ein Repertoire, das aus dem „Kuckuckswalzer“, den Liedern von Willy Schneider und später auch dem Lied des kleinen Schlagersternchens Conny Froboes „Pack die Badehose ein“ bestand. Brettschneider hatte wenig Gespür für den richtigen Moment. So wurden seine Solokonzerte in zunehmender Weise zum Reizobjekt für die übrigen Familienmitglieder. Auch den seltenen Gästen zwang er seinen Vortrag auf. Ihre Besuche gingen denn auch mit der Zeit merklich zurück. Alois Brettschneider war ein Unikum, eine Rarität. Er hatte sich an seinem Arbeitsplatz in der Pause eine eiserne Halterung geformt. In diese klemmte er jeweils vor Beginn des Konzerts mit konzentrierter Miene seine in C gestimmte Mundharmonika von Hohner mundgerecht ein. Dann ging es los. Während er mit den beiden Händen seine Laute bearbeitete, blies und sog er mit seinem Mund die Luft durch den „Maulhobel“, wie er treffend die Mundharmonika nannte. Er wechselte zwischen Instrumentalstücken und Gesang und vor den bekannten Refrains rief er die Zuhörer in zwingend barschem Ton zum Mitsingen auf. Und wäre er nicht immer wieder, meist unaufgefordert, mit seinen Lieblingsliedern „Ach, ich hab` sie ja nur auf die Schulter geküsst“ und „Im tiefen Keller sitz ich hier“ in rücksichtsloser Weise in laufende Gespräche eingebrochen, so hätte er sich in den anschließenden Auseinandersetzungen mit den Familienangehörigen nicht jedes Mal mit den immer gleichen Worten „dat is mingen Hobby“ 16 verteidigen brauchen. So klangen denn die Lieder von Willy Schneider „Schütt die Sorgen in ein Gläschen Wein“ und „Man müsste noch mal zwanzig sein“, nicht wie eine vom Schöpfer dieser Lieder beabsichtigte freundliche Einladung zu einem Gläschen Wein. Für den Alleinunterhalter Alois Brettschneider waren sie viel mehr weitere Attacken gegen die Mauer der Ablehnung. Der Frust aller Beteiligten drang daraufhin, wie man das in der Familie Brettschneider mittlerweile gewohnt war, wie dichter Nebel in alle Räume. Anna Brettschneider hatte sich selber zu wenig in der Gewalt, um Frieden stiftend auf ihren Mann einzuwirken. Oft war das Gegenteil der Fall. Ihrer jeweiligen Laune entsprechend, an ihrem eigenen Zukurzgekommensein ständig leidend, schüttete sie einen Bottich unflätiger Beleidigungen über ihm aus, von denen „Do Kommodenhillije“, 17 „Do Stroßenengel“ 18 noch zu den harmloseren zählten. Menschenverachtend waren die Verbalattacken, die sich beide einfallen ließen. Diese ergossen sich dann wie eiskalte Sturzbäche in die porösen Seelen der Beteiligten. Wenn die Krise in der BrettschneiderFamilie die kalte vegetationsfreie Zone erklommen hatte, bekam als erster Rudi sein Fett ab. Beide Eltern brauchten dann einen Kälteableiter. Rudi beteiligte sich verständlicherweise erst, als er schon siebzehn war, an diesen kopflosen Schlachten. Es blieb für ihn in Zukunft dann nur noch die Flucht, weg von diesen unerträglichen Einbrüchen in sein nach Stabilität suchendes Seelenleben.
Die Wanderlaute war wieder in ihrem Baumwollsack und die genervten Familienmitglieder gaben sich den Ritualen am Ende des Tages hin. Der kleine Wohnzimmerofen erhielt noch einmal Nahrung für die Nacht, der Toiletteneimer stand wieder bereit für verdaute karge Proletariernahrung, die man nicht bereit war, im dunklen und kalten Plumpsklo abzuladen, das Korsett der Mutter erwärmte sich in Ofennähe für den nächsten Tag und in den unbequemen Betten lagen vier schmollende Lebewesen, von denen sich jedes ein friedvolleres Leben herbeiphantasierte.
5.
Regentage waren besondere Tage im Hause Brettschneider, vor allem dann, wenn Anna Brettschneider sie zu Bügeltagen machte. Der anderthalb mal ein Meter große Wohnzimmertisch mit seinen hundert Funktionen erfüllte an solchen Tagen zwei bis drei davon. Schon das Heranschleppen der Bettdecke aus Armeebeständen und des kleineren weißen Leinenlappens legte das Programm des Zimmertheaters für die nächsten zwei Stunden fest. Die Requisiten waren an der Schmalseite des Tisches aufgebaut. Da war der kleine blaue Plastikbehälter mit den hundert winzigen Löchern in der Verschlusskappe. Gefüllt mit Wasser stand er bereit für seine Einsätze als Wasserspender. Das Bügeleisen hatte Anna Brettschneider auf einem umgedrehten Porzellanteller postiert und per Kabel, dessen Stoffmantel schon altersbedingte Fransen zeigte, mit einer der beiden Steckdosen verbunden. Annas Lauf-, Stepp- und Drehkreis hatte einen Durchmesser von vierzig Zentimetern und wurde vor ihrem Bauch vom Tisch begrenzt und im Rücken vom Wohnzimmerschrank, der ähnlich wie sein hölzerner Möbelbruder hundert unterschiedlichen Zwecken der Familie diente. Alois Brettschneider hatte, endlich sicher gehend, dass er Anna ehelichen würde, in der Werkstatt seines Bruders Hermann den Schrank selber gebaut. Sehr vielgestaltig war das Inventar. Wenn man überhaupt von Werten im Hause Brettschneider sprechen wollte, so wären allein die vier Sammeltassen zu nennen, die mit Golddruck an große Ereignisse erinnerten. „Zur ersten heiligen Kommunion“, „Zur Vermählung“, „Zur Goldenen Hochzeit“, Aufdrucke, von denen letzterer auf einen Irrweg hinwies, an dessen Anfang unbekannte Jubilare gestanden haben mussten, die auf die Reise zu ihrer himmlischen Wohnstatt, außer ihrer eigenen Nacktheit nichts mehr mitzunehmen brauchten. Auf der vierten Tasse stand leicht angekratzt in schöner Frakturschrift „In Liebe“. Nur Anna Brettschneider wäre in der Lage gewesen, diesen kryptischen Schwur zu entschlüsseln. Aber Alois Brettschneider wie auch Gertrud und Rudi wussten, dass jedes Nachfragen zwecklos war.
„Jeder Mensch braucht seine Jeheimnisse, nit zu viel, aber…“, war einer dieser Sätze von Gewicht, den sie, in geheimnisvolles Lächeln eingewickelt und weitgehend vom Alltagsplatt gereinigt, immer parat hatte. Und damit war der Fall erledigt.
Was noch an Behältnissen zu Speis und Trank benötigt wurde, hatte neben den Sammeltassen seinen schnell erreichbaren Platz im obersten Teil des zweistöckigen Schranks. Ein vom Graveur bearbeitetes Fenster in der Mitte gewährte einen eingeschränkten Einblick.
Das besondere an diesem Schrank war die „Taille“ zwischen dem oberen und unteren Teil. Hier waren drei Schubladen, „Schösser“, untergebracht. In der mittleren Schublade lag das Portemonnaie mit dem Kleingeld für alltägliche Blitzeinkäufe, „öm de Eck eröm“, 19 im Lebensmittelladen der Glucks. In den beiden anderen Schubladen waren Bestecke und Nähzeug untergebracht.
Im unteren Teil befanden sich Tischdecken, Putztücher und die wenigen elektrischen Geräte eines Arbeiterhaushalts. Der linke Flügel war für Rudi reserviert.
Rudi ging noch zur katholischen Volksschule in Fronheim. Nach Schulschluss führte ihn oft sein erster Weg zu seinem kleinen Reich. Eines Tages, Anna Brettschneider musste wohl wieder einmal vom hartnäckigen stupiden Ordnungswahn ihres Mannes auf die Palme getrieben worden sein, hörte er über sich die Mutter, wie sie sich in kopflosem Hass zu der Äußerung hinreißen ließ: „Eher schlach ech dech kapott, als dat do mir so wees, wie dinge Vatter.“ 20 Rudi wurde von dieser unerklärlichen Entgleisung tief getroffen. Eine Lappalie war, wie so oft, der Anlass gewesen. Rudi hatte Minuten lang vor seinem Heiligtum, dem an ihn abgetretenen Fach des ohnehin viel zu kleinen Wohnzimmerschrankes gehockt und „pingelich jenau“ 21 seine wenigen Sachen, ein paar Bücher, eine Mundharmonika, eine Blockflöte, Schulsachen und ein handgetriebenes Fernlenkauto hin und her gerückt, bis die Platzierungen letztendlich seinem strengen Ordnungssinn entsprachen. Mit dem gleichen „Tick am Kopp“ → hatte Alois Brettschneider Ehejahre lang seine Frau gereizt.
Das Kabel war angeschlossen, die Hitze des Bügeleisens mit ein bisschen Spucke geprüft, nun konnten sich nacheinander Hemden, Socken, Höschen und die anderen Textilien auf den Weg machen. Die nichts sagenden Wäscheknäuel huschten über Anna Brettschneiders Bühne ihrer Verwandlung entgegen. Rudi sah, wie jedes einzelne Stück die Zauberhände seiner Mutter verließ und sich mit den anderen zu duftenden, schrankfertigen Gebilden formierten. Diese Wärme, dieser Geruch von Angesengtem – noch viele Jahre später fühlte und roch er sich bei wiederkehrenden ähnlichen Erlebnissen zurück in das Zwei-Personen-Stück mit der Mutter, in dem anderthalb bis zwei Stunden lang die heile Welt so greifbar nahe war. Der Norddeutsche Rundfunk wurde heute im kleinen Heinzelmann mit seinen ständigen Störungen nicht eingeschaltet. Anna Brettschneider durchwanderte mit ihrer schönen Altstimme, die sie hin und wieder verließ, um sich im Hoheitsgebiet des Soprans zu bewegen, alle Marienlieder, von denen „Meerstern ich dich grüße, ooh Maariiaa hilf“ unangefochten den ersten Platz ihrer Hitliste besetzte.
Zwischen der kurzen Seite des Tisches, auf der Anna Brettschneider Bügeleisen und Wasserspender abstellte und der zur Mitte des Raumes hin eingedellten Zwei-Personen-Chaiselonge hockte Rudi. Konzentriert und äußerst gespannt hielt er die manuelle Fernsteuerung seines namenlosen Fernlenkautos in den Händen. Die Linke umfasste, wie der Arzt die Spritze, das zehn Zentimeter große Plastikteil, in das er durch Drücken eines Kolbens einen Schwenk des Autos von links nach rechts dirigieren konnte. Wollte er wieder nach links zurück, so konnte er dies durch allmähliches Loslassen ermöglichen. An der rechten Seite befand sich der „Schwengel“. Diesen benutzte Rudi zur Regulierung des Tempos. Auch konnte er durch entgegengesetztes Kurbeln sein Auto rückwärts fahren lassen. Leider war schon seit einiger Zeit die Feder, die den Kolben in seine Ausgangslage bringen sollte, ausgeleiert, so dass ein Fahren nach links nur noch schwer möglich war. Arbeiterkinder wussten aber, dass Reparaturen und Einbauen von Ersatzteilen im Budget der Familie nicht vorgesehen waren. So gab es außer vereinzelten Flüchen kein Bitten und Betteln. Rudi nahm die Minderung seiner Fahrkunst denn auch ohne zu murren hin. Er wurde erfinderisch und gestaltete den Rennkurs so, dass sein Auto mit Bravour die Zielgerade überfahren würde. Unterm Dach hatten die Eltern eine Kiste mit Bauklötzen abgestellt, die schon früheren Generationen Freude bereitet hatten. Rudis Bauklotzära war eigentlich vorbei. Hier jedoch, beim Markieren seiner Avus, waren sie von großem Nutzen. Der hundert Jahre abgelaufene Holzfußboden, dessen härtere Astanschlüsse allein dem ständigen Radieren der unterschiedlichsten Schuhbeschläge hatten trotzen können, war von Alois Brettschneider durch einen Balatum-Belag wieder einigermaßen begehbar gemacht worden.
Einmal die Woche trug die Mutter eine dünne Schicht Bohnerwachs auf. Immer dann, wenn es ihr nötig erschien, vor allem, wenn ihre missgünstige Schwester, deren Augen stets auf der Suche nach kleinsten Makeln waren, ihren Besuch angekündigt hatte, verzauberte sie mit dem Bohnerbesen den unebenen Arme-Leute-Teppich in einen festlich strahlenden Parkettboden. „Jetz kann dat messjünstije Luder ruich kumme“. Überm Waschbecken, vorm Ausgang rechts, hing der Spiegel. Zwischen Waschbecken und Haustür befand sich ein kleines Fenster. Beide, Spiegel und Fenster ermöglichten unbeobachtet einen Blick nach draußen, bestens geeignet zur Überwachung anrückender willkommener und unwillkommener Besucher. Wenn die Schwester nur noch wenige Meter vor der fünfstufigen Außentreppe in Annas Radarschirm sichtbar wurde, eilte sie schnell zum Gerätewinkel an der Treppe zum Keller und holte den Mopp. Das letzte Krümelchen Dreck verschwand und die Schwester musste sich eine andere Begrüßung ausdenken.
Der unebene, bei jedem Tritt leicht schwingende Zimmerboden machte es dem Mobiliar schwer, lebenslange Standfestigkeit zu zeigen. Mit Bierdeckeln aus der „Dorfschenke“ hatte Brettschneider die Frage der Justierung gelöst.
Rudis Lieblingsstrecke verlief in Schlangenlinien durch die hügelige Balatum-Landschaft. Die Tischbeine dienten als Schikane und kaum vermeidbar: auch die Beine der Mutter. Kräftige Waden prangten in Nylonstrümpfen der stärkeren Sorte. Die Füße steckten in halb geschlossenen Pantoffeln, auf denen über dem Rist kleine rosa Pelzchen klebten. Der, wie die Beine, kräftig zu nennende Oberkörper atmete und schwitzte bei den täglichen Arbeiten in Bluse und Rock, die Anna Brettschneider zum Teil selber genäht hatte. Zur Arbeitserleichterung ließ sie an solchen Tagen ihr Korsett im Schlafzimmerschrank. Die Nahtstellen des voluminösen Büstenhalters drückten sichtbar durch den Stoff der Bluse.
Hunderte Grau- und Feinbrote hatten in der fleischigen Bucht zwischen ihren Brüsten ihre Weihe erfahren. Vor jedem ersten Anschnitt wurde mit dem Brotmesser ein Kreuz in den Boden des Brotes gekratzt. Dann schnitt sie so viele Schnitten ab, wie es der akute Hunger verlangte. Das Reststück verschwand im emallierten Brotkasten, den sie von ihrer Mutter vermacht bekommen hatte.
Die Aufgabe ihres Mannes war es, das Messer immer wieder auf Vordermann zu bringen. Zu seinem Werkzeug gehörte ein alter Schleifstein, der ihm nach dem Tod seines Vaters, dem Klempnermeister Josef Brettschneider, zugefallen war. Er erreichte jedes Mal einen Schärfegrad, der die Führung des Messers lebensgefährlich machte. Immer, wenn die Mutter ein neues Graubrot anlegte, schaute ihr Rudi dabei mit ängstlichem Blick zu, befürchtete er doch, dass sie sich irgendwann einmal in ihre schönen satten Brüste schneiden würde.
Bluse und Rock verschwanden hinter der Schürze, „dem Schützel“. Keine Frau in Fronheim erledigte ihre Hausarbeit ohne Schürze. Der Rock wurde an Wintertagen durch eine warme langbeinige Trainingshose ergänzt. Viele ließen sich allerdings aus Eitelkeit lieber „de Blos voköhle“ 23 und mussten dann wieder einmal mit dem Bus nach Friedrichstal zu Dr. Wetterhahn oder nach Holltal zu Dr. Schellenberg.
Anna Brettschneider schwang nun schon eine Stunde lang ihr Bügeleisen. Der erste Teil ihres Repertoires an Marienliedern war abgesungen und nun war endlich, wie das eine gute Dramaturgie verlangt, ihr Hit „Meerstern ich dich grüße“ an der Reihe. Die Intervallsprünge des „Ooh, Maariiaa hilf“ gelangen ihr mehr oder weniger publikumsverträglich. Sie hätten auch sicher ihr selber Freude bereitet, wenn nicht im gleichen Moment des zweiten lang gezogenen A´s Rudis Fernlenkauto ihr mit Karacho gegen das rechte Schienbein gedonnert wäre. Ein lauter Aufschrei! Sie knallte das Bügeleisen auf den Teller und fasste sich mit der rechten Hand an den Knöchel. Dies dauerte nur wenige Sekunden, dann aber erhob sie sich raketenartig und langte nach dem Übeltäter. Sie wollte ihm, dem Verursacher ihres Schmerzes, einen Watschen verpassen, doch Rudi waren Mutters Reaktionen nicht unbekannt und so entwisch er der strafenden Hand noch rechtzeitig. Nun, der Schmerz war dann doch nicht so groß, so dass Anna Brettschneider fort fuhr in ihrem Liedvortrag und auch das Bügeleisen glitt in seinem ziellosen sternförmigen Hin und Her weiter über Arbeits- und Alltagskleidung und über die „Sachen für juut“ 24, als wäre nichts gewesen.
Sie wollte gleich mit der zweiten Zeile des Marienliedes weitermachen und als sie gerade die „Gottesmutter“ hatte „süß“ werden lassen wollen, Krach! war das linke Bein an der Reihe. „Tschuldigung, Tschuldigung“ klang es, Böses ahnend, von der Rennbahn herauf. „Wart, mein Freundchen, jetz kummen ech dir dohin“ 25, rief die Mutter aufgebracht, langte nach hinten ins mittlere Schoss und holte den hölzernen Kochlöffel hervor. Jetzt schlug es für Rudi dreizehn. Die Mutter fest im Blick, platzierte er sich so, dass zwischen ihm und ihr immer der Tisch stand. Mal ging es nach links, mal nach rechts und Anna Brettschneider Löffel schwingend hinterher. Einmal war es ihr denn doch zu bunt. „Bleibs de jetz stehn, du Lümmel“. Aber Rudi dachte nicht daran. Mutters Wahl des Fast-Hochdeutschen hätte Rudi signalisieren müssen, dass die Lage ernst war. Es war aber nicht Angst, die ihn vor der Mutter fliehen ließ. Irgendetwas an der Art, wie die Mutter drohte, ließ Rudi an ihrer Konsequenz zweifeln. Er empfand daher die Flucht vor der Henkerin zunehmend als sportliche Veranstaltung. Seltsamer Weise lief im Kopf der Mutter ein ähnlicher Prozess ab. Die Wut war aus ihrem Gesichtsausdruck schon bald gewichen, und sie unterdrückte, für Rudi nach der Minute des Ungewissen, jetzt unverkennbar ein Frieden verheißendes Lachen. Dennoch: Der Junge musste bestraft werden. Und dann dieser Reflex. Als habe ihr Arm ganz alleine die Entscheidung getroffen, holte sie aus und zielte auf seinen blond gelockten Schädel. Der Mutter blieb der Atem im Halse stecken. Rudi sah in einem Sekundenbruchteil das auf ihn zufliegende Wurfgeschoss und duckte sich genau so schnell nach unten weg. Über ihm sauste der Kochlöffel vorbei. Mit einem stumpfen Flopp landete er in einem der tönernen Blumentöpfe. Da Anna Brettschneiders Fensterschmuck ohnehin nur eine Standfläche von zehn Zentimetern zur Verfügung hatte, führte schon die leiseste Berührung zu Absturz und Vernichtung. Anna, sichtlich erleichtert, ihren Sohn nicht getroffen zu haben, fand schnell wieder zur Rolle der ordnungsliebenden Hausfrau zurück. „Nu luur dir ens die Sauerei an“. Annas Blick verweilte einen kurzen Moment auf dem Trümmerfeld, sah die tausend Scherben, den fünfzehn Zentimeter großen Kaktus und den Dreck, oh, dieser Dreck. Rudi hatte sich vorsichtshalber anderthalb Meter von ihr entfernt aufgehalten, immer die Tür im Visier, um vielleicht doch noch rechtzeitig der Guillotine zu entkommen. Anna Brettschneider bückte sich und nahm den Kaktus in die Hand. Dann hob sie ihn zum Fenster ins Licht. Sie beschaute ihn von allen Seiten.
„Wer hätt uns dä dann jeschenk?“
Rudi wunderte sich über die plötzlich zurückgekehrte Normalität.
„Dat? Dat wor de Tante Lotte“ 26.
„Et Lotte? Vun der kunnt jo och nix Vonönftijes kumme. Holl de Emmer un nix wie fott met däm Dreck.“ 27
Anna Brettschneiders Abneigung gegenüber ihrer Schwägerin ließ sie in Wort und Tonfall deutlich spüren. Der eigentliche Schauplatz der noch vor wenigen Minuten stattgefundenen Auseinandersetzung zwischen Mutter und Sohn war längst verlassen. Die Erinnerung, durchdrungen von der Ablehnung und Verachtung der Schwägerin, hatte Annas aktuellen Ärger gelöscht.
6.
Es war an Rudis Erstkommuniontag. Anna Brettschneider und auch die anderen Mütter der Erstkommunionkinder hatten Friseur Bellinghoff eine Menge Arbeit verschafft. Dauerwellen, wohin man sah. Die allgemein positive Stimmung schloss eine sonst übliche Nörgelei über die Preise heute aus. Zu gewöhnlichen Anlässen hatten sich die Frauen jedoch ihre Frisuren stets selber gemacht. Dem aufmerksamen Beobachter und freundlich gesinnten Sammler außergewöhnlicher Eindrücke entging an solchen Tagen nicht die Vielzahl der durch Lockenwickler entstellten Köpfe. Die ohnehin unerotischen außerirdischen Gebilde wurden von den Frauen durch ein Überziehen von Netzen oder dünnen Plastikhauben in ihrer abschreckenden Wirkung noch verstärkt. Die mühsam fabrizierten Wellen, vor allem aber die echte teure Dauerwelle durfte bis zum Tage ihrer Vorführung nicht Schaden leiden. Die Tage bis zum Weißen Sonntag, dem ersten Sonntag nach Ostern, waren heimtückisch oder besser gesagt, das Wetter machte zu dieser Jahreszeit den neu frisierten Köpfen oft zu schaffen. Regen und nicht selten Schnee und Hagel lauerten den Frauen auf, wenn sie sich stolz mit ihrer neuen Haarpracht nach draußen wagten. So verkaufte ihnen Bellinghoff zur Dauerwelle auch immer gleich den neuesten Haarfestiger und denen, die sie noch nicht hatten, die gegen jedes Unwetter schützende Plastikhaube noch dazu.
Gertrud, auf ihre erste Dauerwelle angesprochen, erzählte immer wieder gerne von der merkwürdigen Reaktion an ihrem Arbeitsplatz.
Man schrieb das Jahr 1951. Es war das Jahr von Gertruds Schulentlassung. Jetzt hieß es, sich zu entscheiden. Das Angebot an Lehrstellen für Mädchen war gering. Kostenträchtige Busfahrten zu entfernt gelegenen Firmen sollten vermieden werden. Da der Vater schon seit Jahren sich seine Anzüge „für juut“ beim Schneidermeister Fischer, beim Fischers Willi, bauen ließ, erwarteten die Brettschneiders auch mal eine Gegenleistung. Ihre Treue zum Schneidermeister war jedoch nicht der ausschlaggebende Faktor, der zur Einstellung der fünfzehnjährigen Gertrud führte. Es war allein das sympathische Auftreten des Lehrlings in Spe, das den Chef, wie auch den Altgesellen Anton Schmitz eine angenehme Zusammenarbeit erwarten ließ. Vielleicht spielten die dicken satten Zöpfe, mit denen Gertrud zur Vorstellung erschienen war, eine nicht unbedeutende Rolle. Es war noch gar nicht so lange her, als das vorbildliche gesittete deutsche Mädel mit Zöpfen und geflochtener Haarkrone dem Idealbild der heranwachsenden deutschen Frau entsprach. Aber schon am Ende des ersten Lehrjahres überfiel über Nacht den Teenager der Wahn, schnellstmöglich erwachsen wirken zu wollen. Und dies würde am ehesten leicht gemacht durch eine Dauerwelle. Als die neue „Erwachsene“ nach fünfstündiger Tortur beim „Treppen Bennad“, wie der Vater stichelnd den Friseur Bellinghoff betitelte, den Weg in die Öffentlichkeit wagte, hatte sie mit deren Reaktion nicht gerechnet. In Verbindung mit der Dauerwelle hatte Bellinghoff seinem Opfer zusätzlich einen Pony verpasst. Der wiederum erinnerte die Mutter, die alles um sie herum ohnehin mit der moralischen Messlatte beurteilte, an die „Golden Twenties“, an Charleston und damit nicht zuletzt an den großstädtischen Sündenpfuhl.
„Do stecks dir sofort mit enem Spängche die Hoare zoröck. Do sühs jo us wie, wie … ech woare mech nit, et uszespreche. Jott bewahre!“ 28
Und auf der Arbeitsstelle? Geknickt von Mutters Hartherzigkeit wagte sie es schon gar nicht mehr, frisch und frei, wie das Chef und Altkollege von ihr gewohnt waren, die Werkstatt zu betreten. Wie befürchtet, umgab sie in den ersten Minuten sprachlose Fassungslosigkeit. Dann meinte der alte Schmitz, dem Lehrling in seiner bekannten verständnisvollen Art den Grund für sein Überraschtsein sagen zu müssen.
„Jertrud … Jetz sühs de us wie die anderen“ 29.
Erst als Brigitte Bardot, Bibi Johns, Catarina Valente und andere Vorbilder den neuen Trend bestimmten, entschied sich auch Gertrud für eine Änderung ihres Outfits. Mit einem Pferdeschwanz erschien sie in der kleinen Schneiderwerkstatt. Die Dauerwelle ließ allerdings vorerst nicht mehr als ein Pferdeschwänzchen zu. Inzwischen hatte auch die ältere Generation sich damit abgefunden, dass „die Jurend von heute“ sich nicht mehr den Erwartungen der Eltern und älteren Kollegen widerstandslos ergaben.
„Jetz siehsde winnistens nit mehr wie en alte Frau aus“ 30, meinten diesmal einhellig Meister Fischer und Altkollege Schmitz. Die Bemühung beider Herren, mit Gertrud hochdeutsch zu sprechen, zeigte ihren Respekt vor der jungen Dame und wahrte gleichzeitig eine gesunde Distanz zwischen Lehrling und Vorgesetzten.
Schon Tage vor Rudis „Hinführung zum Tische des Herrn“ schien die Arbeit Anna über den Kopf zu wachsen. Hausputz, als käme der Kardinal Frings zu Besuch: waschen, „wat ze wäsche es“.31 Wen einladen? Wieviel Fleisch wird gebraucht? Wie viele Kuchen müssen gebacken werden? Welche in Annas Backofen und welche in den Backöfen der Nachbarinnen, Falter und Runkel? Dann einkaufen, möglichst zu gleichen Anteilen in allen Geschäften Fronheims. Herrjehminne! Das Herz pochte gewaltig.
Dann am vorletzten Abend vor dem Fest:
„Meddachs kummen nur de Paten un die Vowandte, die mo immo süht. Die andere, die sech jo doch nie blecke looße, wäde nit enjelade. O Jott, jetz han ech vill ze vill Fleesch enjekouf“ 32.
„Dann esse mo evven jet mi“ 33, meinte Alois Brettschneider, der sich bis dahin kluger Weise aus allem heraus gehalten hatte und dies auch weiterhin zu tun beabsichtigte.
„Mösse mo dann dat Lotte, ding Schwester enlade“? 34
„Ech weeß et net“, antwortete Brettschneider und zeigte damit, was ihm an seiner Schwester lag.
„Dat hät jo doch nur an allem jät uszesetze“ 35.
Doch Tante Lotte kam, auch ohne ausdrücklich eingeladen worden zu sein. Schon allein das Geschenk, das sie mitbrachte, der zum Sterben verurteilte Kaktus, wies darauf hin, wie wenig ihr der Akt des Schenkens bedeutete und wie wenig sie die Meinung der anderen interessierte. So wie sie im Kaufhaus Peters in Köln das Restaurant aufsuchte, um sich mit Kuchen den Bauch voll zu stopfen, so nutzte sie auch Veranstaltungen im privaten Bereich, um dem niederen Trieb für kurze Zeit Beruhigung zu verschaffen.
Der festtägliche Kaffeeklatsch am Nachmittag, einer der ganz seltenen Treffen im Hause Brettschneider, vereinte für einige Stunden eine Gruppe Menschen, die in den letzten Wochen in Anna Brettschneiders instabiler Rangliste ganz oben rangierten. Rot im Gesicht, wie eine Tausendmeterläuferin, empfing sie die geladenen Gäste an der Haustür und führte sie ins Wohnzimmer zu ihren Plätzen. Rudi hatte Tischkärtchen gebastelt. So war gleich zu Beginn der Veranstaltung ein Plätzesuchen ausgeschlossen. Wer jetzt mit seinem Nachbarn nicht klar kam und dabei die Freude am munteren Kuchenessen verlor, konnte getrost in seinen Gedanken Anna die Schuld zuschieben. Sie hatte schließlich diese Konstellation so gewollt.
Rudi hatte sich, nachdem die letzten Geschenke eingegangen waren, in sein Zimmer zurückgezogen. Den Kaktus





























