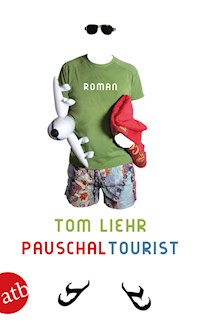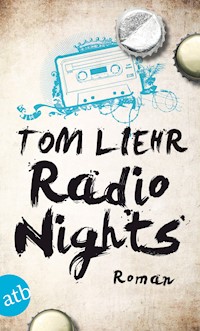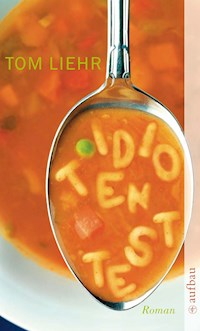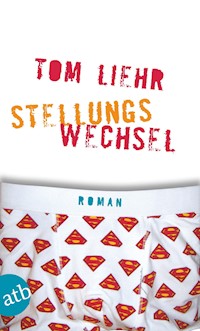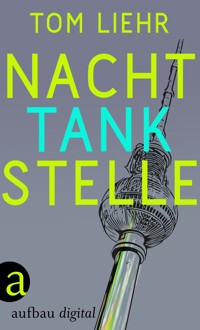9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sebastian Kunze ist als Großstadtjournalist gescheitert. Er landet mit Frau und Tochter in der brandenburgischen Provinz, denn Melanie ist Psychotherapeutin, und auf dem Land gibt es, was sie braucht: Einen Kassensitz und therapiebedürftige Menschen. Doch die ländliche Realität zwischen Gurkenständen und Landgaststätten hält für das Paar einige Überraschungen bereit. Melanie traut sich bald kaum mehr auf die Straße - wegen all der «Bescheuerten». Sebastian hingegen lernt die Überschaubarkeit des neuen Lebens zu schätzen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 372
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
Sebastian Kunze ist als Großstadtjournalist gescheitert. Er landet mit Frau und Tochter in der brandenburgischen Provinz, denn Melanie ist Psychotherapeutin, und auf dem Land gibt es, was sie braucht: Einen Kassensitz und therapiebedürftige Menschen. Doch die ländliche Realität zwischen Gurkenständen und Landgaststätten hält für das Paar einige Überraschungen bereit. Melanie traut sich bald kaum mehr auf die Straße – wegen all der »Bescheuerten«. Sebastian hingegen lernt die Überschaubarkeit des neuen Lebens zu schätzen …
Über Tom Liehr
Tom Liehrwar Redakteur, Rundfunkproduzent und DJ. Seit 1998 Besitzer eines Software-Unternehmens. Er lebt in Berlin.
Im Aufbau Taschenbuch sind seine Romane »Radio Nights«, »Idiotentest«, »Stellungswechsel«, »Geisterfahrer«, »Pauschaltourist«, »Sommerhit«, »Leichtmatrosen« und »Freitags bei Paolo« lieferbar.
Mehr Informationen zum Autor unter www.tomliehr.de.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
https://www.aufbau-verlage.de/newsletter-uebersicht
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Tom Liehr
Landeier
Roman
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog: Es tut mir leid, Pocahontas
Teil Eins: Diagnose
1. Tagebuch von Melanie Kunze, Donnerstag, 16. Juni, 15 . 30 Uhr
2. Clubbing
3. Tagebuch von Melanie Kunze, Donnerstag, 16. Juni, 20 . 00 Uhr
4. Unordnung
5. Tagebuch von Melanie Kunze, Freitag, 17. Juni, 15 . 00 Uhr
6. LDS
7. Tagebuch von Melanie Kunze, Freitag, 17. Juni, 19 . 00 Uhr
8. Silikon
9. Tagebuch von Melanie Kunze, Samstag, 18. Juni, 10 . 30 Uhr
10. Erkundungen
11. Tagebuch von Melanie Kunze, Samstag, 18. Juni, 16 . 30 Uhr
12. Freunde
13. Tagebuch von Melanie Kunze, Sonntag, 19. Juni, 01 . 30 Uhr
14. Kleinanzeigen
15. Tagebuch von Melanie Kunze, Sonntag, 19. Juni, 19 . 30 Uhr
16. Nscho-tschi
Teil Zwei: Therapie
1. Arbeitslos
2. Tagebuch von Melanie Kunze, Montag, 20. Juni, 20 . 00 Uhr
3. Autorengruppe
4. Tagebuch von Melanie Kunze, Montag, 20. Juni, 23 . 30 Uhr
5. Warndreieck
6. Schatzsuche
7. Tagebuch von Melanie Kunze, Dienstag, 21. Juni, 17 . 00 Uhr
8. Baumarkt
9. Tagebuch von Melanie Kunze, Mittwoch, 22. Juni, 18 . 30 Uhr
10. Playmobil
11. Tagebuch von Melanie Kunze, Donnerstag, 23. Juni, 13 . 30 Uhr
12. Ausritt
13. Tagebuch von Melanie Kunze, Samstag, 25. Juni, 2 . 30 Uhr
Teil Drei: Konvaleszenz
1. Selfie
2. Missionar
3. Tagebuch von Melanie Kunze, Samstag, 25. Juni, 14 . 00 Uhr
4. Gin Tonic
5. Tagebuch von Melanie Kunze, Samstag, 25. Juni, 22 . 00 Uhr
6. Aufräumarbeiten
7. Tagebuch von Melanie Kunze, Sonntag, 26. Juni, 13 . 30 Uhr
Teil Vier: Rehabilitation
Brunner Gurkenfest (Drei Monate später)
Impressum
But it’s not the fall that hurts, it’s when you hit the ground.
(Caesars, »It’s Not The Fall That Hurts«, auf Paper Tigers, 2005)
In Erinnerung an Michl »3LG« Rudrich
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog: Es tut mir leid, Pocahontas
Teil Eins: Diagnose
1. Tagebuch von Melanie Kunze, Donnerstag, 16. Juni, 15 . 30 Uhr
2. Clubbing
3. Tagebuch von Melanie Kunze, Donnerstag, 16. Juni, 20 . 00 Uhr
4. Unordnung
5. Tagebuch von Melanie Kunze, Freitag, 17. Juni, 15 . 00 Uhr
6. LDS
7. Tagebuch von Melanie Kunze, Freitag, 17. Juni, 19 . 00 Uhr
8. Silikon
9. Tagebuch von Melanie Kunze, Samstag, 18. Juni, 10 . 30 Uhr
10. Erkundungen
11. Tagebuch von Melanie Kunze, Samstag, 18. Juni, 16 . 30 Uhr
12. Freunde
13. Tagebuch von Melanie Kunze, Sonntag, 19. Juni, 01 . 30 Uhr
14. Kleinanzeigen
15. Tagebuch von Melanie Kunze, Sonntag, 19. Juni, 19 . 30 Uhr
16. Nscho-tschi
Teil Zwei: Therapie
1. Arbeitslos
2. Tagebuch von Melanie Kunze, Montag, 20. Juni, 20 . 00 Uhr
3. Autorengruppe
4. Tagebuch von Melanie Kunze, Montag, 20. Juni, 23 . 30 Uhr
5. Warndreieck
6. Schatzsuche
7. Tagebuch von Melanie Kunze, Dienstag, 21. Juni, 17 . 00 Uhr
8. Baumarkt
9. Tagebuch von Melanie Kunze, Mittwoch, 22. Juni, 18 . 30 Uhr
10. Playmobil
11. Tagebuch von Melanie Kunze, Donnerstag, 23. Juni, 13 . 30 Uhr
12. Ausritt
13. Tagebuch von Melanie Kunze, Samstag, 25. Juni, 2 . 30 Uhr
Teil Drei: Konvaleszenz
1. Selfie
2. Missionar
3. Tagebuch von Melanie Kunze, Samstag, 25. Juni, 14 . 00 Uhr
4. Gin Tonic
5. Tagebuch von Melanie Kunze, Samstag, 25. Juni, 22 . 00 Uhr
6. Aufräumarbeiten
7. Tagebuch von Melanie Kunze, Sonntag, 26. Juni, 13 . 30 Uhr
Teil Vier: Rehabilitation
Brunner Gurkenfest (Drei Monate später)
Impressum
Prolog: Es tut mir leid, Pocahontas
(Drei Monate vorher)
Das Kruzifix schien mich zu beobachten. Es hing zwar in einer oberen Ecke des Wartezimmers und war nicht einmal besonders groß, aber der gekreuzigte Messias, der an den Händen und Füßen karmesinrot blutete, starrte mich an, als wäre er nur für mich dort angenagelt worden. Ich verspürte ein irritierendes Zwicken im Genitalbereich – das allerdings ständig, seitdem ich mich zu diesem Schritt entschlossen hatte – und versuchte, Blicke in Richtung Kreuz zu vermeiden. Religiöse Symbole interessierten mich durchaus, wenn auch nur, weil ich permanent von ihnen umgeben war. Doch dieses Ding verströmte eine unangenehme Präsenz, formulierte eine Botschaft. Ich nahm die Sonnenbrille ab – hier, in Prag, würde mich ohnehin niemand erkennen – , zog zur Ablenkung mein Smartphone aus der Tasche und checkte den aktuellen Stand meiner Facebook-Fans (sechstausendzweihundertzehn, fünfundzwanzig mehr als vor einer Woche, aber immer noch fast fünfhundert weniger als am Jahresanfang), dann die Reaktionen auf meine letzte Kolumne (Hass, Beleidigungen und Morddrohungen, Beifall von offenbar Hirntoten), konnte mich aber kaum konzentrieren und sah schließlich doch wieder in diese Ecke, die anders als die drei anderen frei von Staubfäden und abblätternder Raufasertapete war.
Dieser Jesus grinste fies.
Er grinste mich fies an.
Die Arzthelferin, eine Sechzigjährige in Birkenstocks und fleckigem Kittel, kam herein und nickte mir zu, unfreundlich und herablassend, wie der Beamte im Amtsgericht Schöneberg vor fünfundzwanzig Jahren, als ich dort gewartet hatte, um meinen Austritt aus der evangelischen Kirche zu erklären. Ich schaltete das Telefon mit zitternden Fingern auf Stand-by und folgte ihr. Es ging durch einen muffigen Flur in ein Behandlungszimmer, das, vorsichtig ausgedrückt, etwas mittelalterlich wirkte und von einem ebenfalls Sechzigjährigen beherrscht wurde, der weißhaarig und -bärtig neben einem mit braunem Kunstleder bezogenen Behandlungstisch stand, die Hände hinter dem Rücken gefaltet hatte und mich mit einer machohaften Mischung aus Desinteresse, Amüsement und Ablehnung zu betrachten schien: ein Mario-Adorf-Double für Fußgänger.
»Herr Kunze, nehmen Sie Platz«, sagte er in akzentfreiem Englisch, ohne aber meinen Namen entsprechend zu schleifen.
Ich setzte mich auf das Kunstleder und hatte plötzlich Angst, die sich zu meinem überraschend schlechten Gewissen gesellte. Schließlich war ich im Begriff, meine Frau auf eine deutlich handfestere Weise zu hintergehen, als ich das bislang je gewagt hatte.
»Wir nehmen eine örtliche Betäubung vor, der Eingriff dauert nur ein paar Minuten. Sie werden nichts davon spüren. Ich schneide in den« – für den folgenden Begriff fehlten mir die Englischkenntnisse – »und durchtrenne anschließende die« – ich vermutete, das Wort bezeichnete die Samenleiter – , »dann vernähe ich. Die Wunde wird schnell verheilen, die Fäden fallen von selbst ab. In einer Woche können Sie wieder kopulieren.« Obwohl er in einer Fremdsprache redete, in der Betonungen selten so ausfallen, wie sie in der Muttersprache ausgefallen wären, erkannte ich Geringschätzung und wiederum Ablehnung. Okay, was sollte man auch von Leuten halten, die nach Tschechien reisten, um sich für ein paar lumpige Euro sterilisieren zu lassen, während die Angetraute daheim dachte, man sei auf einer Konferenz (wie in meinem Fall), einer Kumpelstour oder Ähnlichem?
»In einer Woche«, wiederholte ich ungläubig, denn ich hatte mich über die Operation informiert und auch in einigen Internet-Foren gestöbert, was mir normalerweise fernlag, denn in Internet-Foren traf man mehr Dumme als vor Fernsehern, auf denen RTL lief. Patienten erzählten davon, noch über Monate Schmerzen verspürt zu haben, und die Lektüre von Bruno Preisendörfers Roman »Manneswehen«, der ebendiesen Eingriff thematisierte, hatte mich auf wochenlange Abstinenz und unangenehme Folgen eingestimmt. »Meine Methode ist einzigartig«, sagte der alte Arzt. Ich hatte ihn im Netz gefunden.
»Aha.« Alles hier und heute war einzigartig. Immerhin erfolgte der Eingriff nach dieser »einzigartigen« Methode ohne jede Voruntersuchung. Der Gedanke daran, irgendwo in dieser kuriosen Wohnung eine Spermaprobe abzugeben, kam mir äußerst absurd vor.
»Und billig.«
»Prima«, erklärte ich, obwohl dieser Aspekt für mich kaum von Belang war, und lauschte in den etwas zittrigen Nachhall meiner eigenen Stimme. In diesem Augenblick sah ich das Gesicht meiner Frau vor mir: das von schwarzen Haaren umrahmte, von dunkelbraunen Augen beherrschte, immer leicht – aber nie künstlich – gebräunte Gesicht von Melanie, die ich, was sie nicht mochte, gerne und durchaus liebevoll »Pocahontas« nannte. Normalerweise gelang es mir nicht, sie zu visualisieren. Jetzt schon.
»Also dann«, sagte der Mann und nickte seiner Helferin auf die gleiche Weise zu, wie die das vorher bei mir getan hatte. Vielleicht eine tschechische Eigenart. Ich sah zum Fenster, durch dessen staubgraue Gardinen ein Blick auf die Prager Burg zu erhaschen war. Die Frau zog eine Spritze auf und sah mich dann herausfordernd an, aber auch nicht eben sonderlich interessiert. Ich zog die Hosen herab, dann die Unterhosen, hob das T-Shirt über den Bauchnabel und manövrierte mich in die Rückenlage. Das Kunstleder verklebte mit meiner Gesäßhaut – legte man nicht normalerweise Abdeckungen auf die Behandlungstische?
»Rasieren Sie mich nicht?«, fragte ich. Diese Frage hatte mich im Vorfeld tatsächlich beunruhigt, weil es nur wenige plausible Erklärungen für plötzliche Schamhaarglatzen gab. Pocahontas war vielleicht manchmal ein bisschen naiv, aber sie war keineswegs dumm.
»Nicht nötig«, sagte der Arzt, während er seine Fingernägel musterte. Ich tat das auch und konnte erhebliche Verschmutzungen erkennen. Als er meinen Blick sah, lächelte er seltsam.
»Machen Sie sich keine Sorgen«, murmelte er.
Darauf fiel mir keine Antwort ein. Denken Sie nicht an rosa Elefanten – das gehörte in die gleiche Kategorie. Es blieb einem nichts übrig, als intensiv an rosa Elefanten zu denken. Ich machte mir Sorgen, dachte an horrormäßige Komplikationen, abfallende Körperteile etwa oder den Verlust aller Gefühle und Funktionen im unteren Körperbereich. Plötzlich schwitzte ich, obwohl es in dieser Altbauwohnung angenehm kühl war, was nicht mit den absonderlichen Gerüchen korrelierte.
Die Helferin stach zu, in der Leistengegend, quasi direkt neben den Kronjuwelen. Ich kiekste, niemand reagierte. Kurz darauf spürte ich, wie ich nichts mehr spürte. In meinem Schrittbereich breitete sich eine Lähmung aus, von der ich wieder kurz befürchtete, sie würde meinen gesamten Körper ergreifen, aber das geschah nicht. Die Frau zog eine Art Tuch aus Krepppapier aus einer Schublade. Es dauerte ein paar Sekunden, bis sie das Loch im Papier so angeordnet hatte, dass sich mein Gehänge in dessen Mitte befand. Sicher gab es Leute, die bei solchen Gelegenheiten ihr Handy zückten und die Fotos in den vermeintlich sozialen Netzwerken präsentierten. Es gab in dieser Hinsicht längst nichts mehr, das es nicht gab.
»Entspannen Sie sich«, sagte der Arzt und griff nach einem Skalpell.
Ich sah zur Decke. Styroporplatten, wie man sie in den Siebzigern in Deutschland an viele Wohnzimmerdecken geklebt hatte, hier allerdings wenig fachmännisch und seit Jahren ungereinigt. Ich versuchte, versteckte Muster zu erkennen, während der alte weißbärtige Mann an mir herumschnippelte. Noch bevor ich eines fand, sagte er: »Fertig. Das war’s.« Done. That was it.
»Wie?«, fragte ich auf Deutsch, was mir im unnarkotisierten Zustand im Leben nicht eingefallen wäre. Ich verachtete Leute, die solche grammatikalisch und semantisch unkorrekten Ein-Wort-Fragesätze verwendeten. Und dann auch noch in der falschen Sprache.
»Noch zwei Stiche, und es ist erledigt.«
»Nicht zu fassen«, erklärte ich ehrlich, aber das blieb unkommentiert. Der Arzt fuhrwerkte noch einen Moment lang herum, ohne dass ich erkennen konnte oder wollte, was er genau tat, und sagte dann: »Sie können aufstehen.«
Die Helferin zog das Krepppapier weg. Ich richtete mich auf und sah mir selbst in den Schritt. Da war etwas Blut, umgeben von der rotbräunlichen Farbe, die offenbar von Jodtinktur oder Ähnlichem stammte, und ich erkannte mit etwas Mühe einen sehr kurzen Einschnitt, aus dem zwei Fädchen hervorlugten, die weißbraun und irgendwie unschuldig aussahen. Alles gut versteckt inmitten meines Schamhaars, das ich selbstverständlich nicht kappte. Wer nicht wusste, wonach er zu suchen hätte, würde das im Leben nicht entdecken.
»Das war wirklich alles?«
Er nickte völlig emotionslos. »Meine spezielle Methode. Keine Folgen, keine Komplikationen. Wie versprochen.«
»Unfassbar«, sagte ich.
»Wie so vieles«, erklärte er kryptisch und entließ mich mit einer merkwürdig endgültigen Geste. Im Wartezimmer saßen inzwischen vier Männer, die mich nur kurz zur Kenntnis nahmen, um gleich wieder das Kruzifix anzuglotzen. Ich schnappte mir meine Jacke, warf sie mir über die Schulter, setzte die Sonnenbrille wieder auf, passierte die quietschende Praxistür, sprang erstaunlich unbehindert die zwei Treppen herab und trat in die Prager Frühlingsluft. Es roch nach asiatischem Fastfood, hastig gerauchten Zigaretten und billigem Bier. Heerscharen von Touristen sahen sich suchend nach dem Weg zur Karlsbrücke um. Ich trottete zum Hotel, setzte mich an die Bar, bestellte ein Bier und wartete auf den Schmerz.
Aber er kam nicht. Jedenfalls nicht der, den ich erwartet hatte. Stattdessen musste ich an den gekreuzigten Gottessohn denken – und an die Söhne und Töchter, die ich nun nicht mehr bekommen könnte und würde. Nicht dass mich das beunruhigte: Genau deswegen war ich ja hier. Um nicht noch mal das Geschrei aus dem Babybettchen ertragen zu müssen, wie vor knapp vier Jahren, als Lara zur Welt gekommen war, trotz Melanies regelmäßiger Pilleneinnahme. Ich wollte kein weiteres Kind, ich hatte schon das erste nicht gewollt. Deshalb dieser Schritt, dieser Schnitt. Aber da war etwas, das über schlechtes Gewissen und Sorgen über mögliche Komplikationen weit hinausging. Sogar über die Gewissheit, einen Vertrauensbruch begangen zu haben, der alle vorherigen in den Schatten stellte. Ich fühlte mich beschissen, woran auch das zweite und das dritte Bier nichts änderten. Irgendwann, es dunkelte bereits und die Lichtreflexe der Leuchtreklamen tanzten auf dem Tresen, setzte ein leichtes Ziehen ein, aber dabei blieb es auch. Mein Telefon summte, eine SMS von Melanie, die mich in einem Workshop wähnte: »Alles gut? Hab Dich lieb.«
»Alles super, ich Dich auch«, heuchelte ich zurück, bestellte einen vierfachen Jack Daniel’s und sank etwas später in einen tendenzkomatösen Schlaf. Als ich erwachte, tat nichts mehr weh, und vier Tage nach meiner Heimkehr war die Wunde völlig verschwunden.
Teil Eins Diagnose
1. Tagebuch von Melanie Kunze, Donnerstag, 16. Juni, 15 . 30 Uhr
Es war ein sehr schönes Gefühl, als ich vorhin in den Ort gefahren bin. Alles sehr provinziell und ländlich, aber hübsch und überschaubar, fast schon idyllisch. Man kennt sich, man weiß voneinander. Die Gemeinde hat knapp viertausend Einwohner, das habe ich gestern ergoogelt. Ungefähr ein Tausendstel der Einwohnerzahl von Berlin. Also gibt es auch nur ein Tausendstel der unschönen Aspekte: Kriminalität, Ignoranz, Intoleranz, Gewalt, Anonymität, Ellbogenmentalität. Ich finde die Vorstellung wirklich äußerst behaglich, an einem solchen Ort, in einem solchen Ort zu leben.
Außerdem ist die Stadt nicht sehr weit weg – ich bin ganze anderthalb Stunden gefahren, den Umweg zu Petra nicht mitgerechnet. Unsere Freunde – gut, meine Freunde – könnten uns hier besuchen, ohne Weltreisen unternehmen zu müssen. Aber die Distanz empfinde ich trotzdem als wohltuend. Schade, dass ich Lara nicht mitnehmen konnte, aber es wäre zu anstrengend, wenn sie bei alldem dabei wäre, was in den nächsten Tagen ansteht.
Ich sitze an einem niedlichen Schreibtisch in einem ungeheuer schönen Hotelzimmer und blicke auf einen kleinen See. In der Ferne kann ich die stärker bewaldeten Gebiete erkennen, also den Bereich, wo der eigentliche Spreewald beginnt. Wo die Touristen unterwegs sind, in kleinen Kähnen. Das will ich demnächst unbedingt ausprobieren, aber ich glaube kaum, dass Basti mitmacht.
Er hat heute Abend schon wieder einen Termin – eine Cluberöffnung oder so was. Großer Gott, er ist zweiundvierzig Jahre alt, aber er glaubt immer noch, dass die »Szene« zusammenbricht, wenn er keine Präsenz zeigt. Dabei sind diese Leute zwanzig Jahre jünger als er. Sie werden ihm bald nicht mehr zuhören. Nichts mehr auf sein Urteil geben. Und auch die Weiber werden irgendwann nicht mehr auf ihn reinfallen.
Ich gehe jetzt duschen und dann noch einmal zum Haus. Ich kann mich daran einfach nicht sattsehen. Und danach gönne ich mir ein feines Essen im Hotelrestaurant.
Die Verpackung lasse ich lieber nicht im Mülleimer hier im Zimmer. Ja, es ist ein Nobelhotel, und hier wird vermutlich dreimal am Tag sauber gemacht. Aber sicher ist sicher. Ich will nicht, dass es Basti auf diese Art erfährt.
2. Clubbing
Der Eingang zur Bar war kaum zu finden. Die Gegend wurde von Gewerberuinen beherrscht, für die möglicherweise Bebauungspläne vorlagen, aber noch keine Bebauungsaufträge. Schlammige Zugangswege, ein paar Funzeln, die kaum ausgereicht hätten, um Besenschränke zu beleuchten, hin und wieder ein rostiges Geländer, das wie vergessen mitten im Weg stand. Aber ein paar Gestalten huschten an mir vorbei, die Gesichter beleuchtet vom Glühen ihrer Smartphones, weshalb ich annahm, auf der richtigen Fährte zu sein. Kurz darauf sah ich die Warteschlange, etwa zwanzig, dreißig Menschen, und dann entdeckte ich die Tür, ein braunrotes Metallding mitten in einer braunroten Wand, hinter der vermutlich Gewölbe lagen, denn über mir rauschte soeben ein Regionalexpress von links nach Süden. Auch hier gab es kein erkennbares Zeichen für Gastronomie – kein Schild, kein Licht, keine Bierwerbung, nichts. Diese Zustände markierten einen Trend, dem die Großstadtritter zwei Punkt null (vier? sieben?) zu folgen versuchten, um sich in den Zeiten der sofortigen, viralen Verbreitung neuer Geheimtipps noch den Anschein von Exklusivität zu geben. Gegen Facebook, Twitter, Instagram und den ganzen Scheiß kam man nicht an. Es gab nichts Geheimes, Brandheißes, verrucht Neues mehr – und erst recht keine Szene. Es gab einen, der etwas postete, und dann Follower, denen die Geschwindigkeit des Folgens wichtiger war als der Gegenstand der Verfolgung. Neuigkeiten existierten für die Dauer von Mikrosekunden. Selbst in Nigeria, Uruguay und Aserbaidschan konnten sich Leute jetzt schon Fotos dieser Bar anschauen, die ich in ein paar Augenblicken zur Eröffnungsfeier betreten würde.
Vorausgesetzt, jemand öffnete diese Tür. Denn es gab nicht nur kein Schild oder sonstige Hinweise auf das Dahinter – es gab auch keine Möglichkeit, sich als potenzieller Besucher bemerkbar zu machen. Zwei Frauen, die vorne in der Schlange standen, klopften energisch an, vermutlich nicht zum ersten Mal, aber ohne Ergebnis.
Ich zog etwas widerwillig mein Smartphone hervor und öffnete die MMS mit der Pressemitteilung und der Einladung. Am Ende der Nachricht fand ich einen Link, den man zu aktivieren hatte, wenn man eingetroffen war. Also tat ich das, ebenfalls widerwillig, und kam mir dabei wie ein dämlicher Bittsteller vor – wie einer von denen vor, neben und hinter mir. Mein Smartphone verschickte eine Nachricht, ich passierte die unisono – aber zaghaft – protestierende Warteschlange; Leute, die wussten, dass sie hier auf Gefälligkeiten und eher zufällig erfüllte Anforderungen angewiesen waren, aber dennoch die Idee nicht ganz aufgegeben hatten, eigentlich dazuzugehören, etwas wert zu sein. Und ich dachte dabei an die Eröffnungsfeiern in den Neunzigern, rote Teppiche und blitzlichtstreuende Fotografen, wenigstens Fackeln oder so, dazu Hostessen in knappen Outfits mit Prosecco für die Gäste. Nein, seinerzeit sogar noch richtiger Schampus.
Die Tür öffnete sich. Jemand schob sich an mir vorbei, ich schob auch und war wieder vor ihm. Der breitschultrige Glatzkopf in den späten Dreißigern, der aufgemacht hatte, musterte mich.
»Name?«, fragte er herablassend und ignorierte die Leute hinter mir, die auf sich aufmerksam zu machen versuchten. Schöne junge Frauen und bärtige Männer in teuren Anzügen, mit schnittigen Frisuren und Gesichtern wie aus der »Cool Water«-Werbung. Gab es das Zeug eigentlich noch?
Ich war verblüfft, denn der Typ kannte mich – es war nicht sein erster Job als Türsteher und meine ungefähr millionste Veranstaltung dieser Art. Noch mehr verblüffte mich, dass er sich, ohne meine Antwort abzuwarten, dem Mann zuwandte, der mich eben noch zu überholen versucht, den ich im dämmrigen Licht aber nicht erkannt hatte.
»Hey, Josh, wir haben dich schon vermisst«, sagte der Türsteher und winkte Josh Clab hinein. Josh Clab war, wie er sich selbst titulierte, »Szene-Blogger«, hieß eigentlich Kevin-Louis Krüger und zwinkerte mir jetzt zu, etwas herablassend, aber nicht unfreundlich. Der Türmann machte Anstalten, das Portal wieder zu verschließen. Ich sprach die Worte aus, die auszusprechen einer Demütigung gleichkam. Nein, eine war. Denn ich war Sebastian Kunze, und mein Name stand auf der Gästeliste. Er stand auf jeder verdammten Gästeliste.
»Sebastian Kunze. Gästeliste.«
»Sebastian?«, wiederholte er fragend, immer noch in der Türschließbewegung.
»Kunze. Von der ›Bernd & Susi‹.«
»Und Susi.« Er grinste hämisch – und verschloss die Tür.
Die sich erst drei oder vier Minuten später wieder öffnete, während deren ich darüber nachdachte, diese unglaublich hippe und vermutlich total nihilistische Eröffnungsfeier einfach auszulassen, mich in einen wirklich coolen Laden zu setzen und dort einen hämischen Verriss rauszurotzen, auf Basis der Fotos, die in Aserbaidschan herumgereicht wurden, wo man bereits EasyJet-Flüge für das kommende Wochenende hierher buchte. Eine junge Frau – vor ein paar Jahren hätte man sie als »Hardbody« bezeichnet – lächelte mich an, griff nach meinem Jackettärmel, was ich zuließ, um die Situation nicht noch demütigender werden zu lassen, und zog mich hinein.
»Schön, dass doch noch jemand von euch kommt«, sagte sie, strahlte mich an, stolzierte aber sofort davon, um Wichtigeres zu tun, zum Beispiel winzige Staubmäuse vom hochglanzpolierten Tresen der Garderobe schnipsen.
Doch noch jemand von euch?, hallte in meinem Kurzzeitgedächtnis nach. Aber ich war nicht hier, um mir sinnlose Gedanken zu machen. Ich war Sebastian Kunze, der in der nächsten – leider erst in zwei Wochen erscheinenden – Ausgabe von Bernd & Susi, dem legendären Stadtmagazin, mitteilen würde, ob es sich lohnte, diesen Laden aufzusuchen, und dessen Empfehlung oder Warnung dann ziemlich viele Leute folgen würden.
Die Musik, die ich im Gang hörte, irritierte mich kurz – es handelte sich um jenen Titel, mit dem Lena Meyer-Landhut oder so vor ein paar Jahren den Eurovision Song Contest gewonnen hatte. Der Hardbody tänzelte lächelnd im Takt an mir vorbei, um hinter mir die Tür für wichtige Menschen zu öffnen. Einen Mainstream-Discjockey, der diese Mucke bei einer Ü40-Party aufgelegt hätte, hätte man ausgebuht, aber hier war es in Ordnung. Okay, das war Spekulation – selbstverständlich ging ich nicht auf Ü40-Partys, weil man das einfach nicht tat, ganz egal, wie sich die Welt veränderte.
Ich durchschritt den Gang und gelangte in die eigentliche Bar. Dafür, dass draußen ziemlich viele Leute warteten, war es relativ leer – zwei Drittel, vielleicht vier Fünftel der Sitzgelegenheiten wurde okkupiert – , aber auch die Maxime, dass die Größe des Publikums etwas über die Qualität aussagte, galt schon lange nicht mehr. Der schwule Kabarettist Sascha Zwengel belegte mit seinem Tross aus alternden Dragqueens, jungen Spielgefährten und Nachwuchskomikern, die darauf hofften, in seinem Fahrwasser minimale Bekanntheit zu erlangen, zwei Tische direkt am Eingang. Man schnatterte, aber selbst im Vorbeigehen klang das Geschnatter müde, aufgesetzt und erbärmlich. Zwengel war eine Ikone, aber allmählich zerfielen seine stark geschminkten Züge, den großen Erfolg hatte er nie erreicht, und das Ende war absehbar. Er nickte mir kurz zu, kaum bemerkbar. Ich zog nur eine Augenbraue hoch. Mit zwei oder drei Kolumnen hatte ich ihm ziemlich eingeschenkt, dann aber schnell die Lust verloren, weil Zwengel nicht zu den Leuten gehörte, mit denen Dispute Spaß machten. Dafür war er auf tragische Weise einfach zu freundlich. Vermutlich nahm er jedes verdammte Wort ernst, das ich geschrieben hatte.
Ich betrat das Gewölbe, lang gestreckt und an der Stirnseite von einer Bar beherrscht, die über die gesamte Länge reichte. Das Licht war dezent und pastellig, reflektiert von einer Myriade Spiegelscherben, mit denen man die Gewölbedecke beklebt hatte. Nett, dachte ich. Am linken Ende der Bar befand sich eine Kabine, in der DJane Austen stand, wie immer in der Rüschenbluse – auch so ein Opfer des vorschnell gewählten Images, das sich nie ausgezahlt hatte. Lesbisch, in den späten Dreißigern. Vor ihrer Kabine, auf einer dezent angedeuteten Tanzfläche, standen ein Keyboard und ein Mikrophonständer. Hinter dem Tresen fehlten die meist üblichen Flaschenbatterien. Stattdessen hingen dort Bilder, vor denen referenzschöne Studentenkellner hin und her huschten, einem vollbärtigen Mann in den Zwanzigern ausweichend, der konzentriert einen Shaker schüttelte und dabei dreinschaute, als würde er mindestens eine Zeitmaschine konfigurieren. Josh Clab saß in der Mitte, die Bilder betrachtend. Ich setzte mich neben ihn. In seinem Gesicht, das ich bei den bisherigen Begegnungen, ungefähr zwei- bis dreihundert insgesamt, ausschließlich lächelnd erlebt hatte, befand sich das erwartete Lächeln, mit einer dezent ironischen Note. Vermutlich hielt er die Bilder, die das beim ersten Hinschauen durchaus zuließen, für die üblichen Kunstdrucke, die man in Hotelfluren und Praxiswartezimmern vorfand. Ich wusste es besser. Es waren Originale von einer Berliner Künstlerin namens Alex Nimtz, bei der ich vor ein paar Monaten eine Nacht verbracht hatte. Vor dem Sex – der unspektakulär ausgefallen war und den Aufwand nicht gelohnt hatte – hatte sie mir erklärt, wie ihre Bilder entstanden. Extreme, sehr ausgefuchst beleuchtete Nahaufnahmen der Oberflächen von Flüssigkeiten, hier vermutlich Cocktails, die sie anschließend in Öl auf nicht grundierter Leinwand nachmalte. Wahrscheinlich waren es Leihgaben; Alex Nimtz rief aktuell fünfstellige Summen für ihre Gemälde auf, konnte die Nachfrage aber kaum befriedigen.
Ich hob die Hand, mein Nachbar ebenfalls. Eine Neun, die in der Nähe stand – zwanzig, höchstens zweiundzwanzig, brünettes Kurzhaar, Stretchtop und verdammte Neoprenshorts, die alle Details der Einflugschneise erkennen ließen – , setzte ein perfektes Kunstlächeln auf – und fragte Josh Clab, was er trinken wolle.
»Das Übliche«, sagte er lächelnd, die Neun nickte – und ging davon.
Josh Clab drehte sich zu mir und lächelte weiter.
Er war, wenn meine Informationen stimmten, achtundzwanzig. Josh Clab alias Kevin-Louis Krüger repräsentierte diese unsägliche Demokratisierung von Prominenz, zugleich stand er für alles, was meinem Metier zusetzte. Clab schwatzte dem Szenevolk nach dem Maul, interessierte sich kaum für Fakten oder gar Hintergründe, stellte Behauptungen und Gerüchte direkt neben Beweisbares oder die spärlichen Kenntnisse, über die er verfügte. Aber er schrieb eloquent und flüssig, war charmant und sehr umgänglich und deshalb beliebt. Viel beliebter als ich. Er kannte jeden, jeder kannte ihn, weshalb er meistens gut informiert war. Sein Markenzeichen waren extrem teure, extrem elegante Anzüge, maßgeschneidert und figurbetont, dazu anthrazitfarbene Designershirts. Er war muskulös, aber schlank. Sein Outfit hätte – vom Fehlen von Krawatte und Hemd abgesehen – Barney Stinson die Neidesröte ins Gesicht getrieben, aber leider waren da außerdem sein flusiger Vollbart, die kindische Unfrisur seiner kompakten Kurzhaare und das unselige Piercing seitlich am linken Nasenflügel: das Unendlichkeitszeichen in billigem Sterlingsilber. Nach unserem ersten Zusammentreffen vor drei oder vier Jahren hatte ich ihm – natürlich – eine Kolumne gewidmet und sein Aussehen darin als dasjenige eines »von homophoben Holzfällern aufgezogenen Bastards, der anschließend von einem homophilen Couturier gefoltert worden war«, bezeichnet. Bei unserer nächsten Begegnung hatte er mich nur angelächelt und »Sie müssen es ja wissen« gesagt. Man siezte sich nicht, wenn man zu unsereins gehörte, wenn man sich dreimal pro Woche traf, inmitten von Leuten, die einander und uns natürlich auch duzten. Er hatte es fertiggebracht, dieses »Sie« wie eine sehr lange, sehr schmerzhafte Beleidigung klingen zu lassen – und damit tatsächlich Wirkung erzielt. Das trug ich ihm nach, viel mehr und intensiver als die Tatsache, dass sein »Clabbing«-Blog mit teuerster Edelwerbung gepflastert war und Tausende pro Monat abwarf, während das steinzeitliche Web-Portal der Bernd & Susi händeringend um jeden Klick warb und froh sein konnte, wenn der Reifenhändler aus Moabit oder diese dusselige, schwer gehypte Gemüsedönerbude vom Mehringdamm für zwei fünfzig pro Woche ein unselig gestaltetes Minibanner schaltete. Die Geschäftsleitung des Verlags, dem die B&S aktuell gehörte, vertrat die Meinung, Investitionen in diesem Bereich seien kontraproduktiv, weil man dem eigenen Magazin online Konkurrenz machen würde. Im Ergebnis war beides defizitär, und gemäß einer aktuellen Umfrage kauften die meisten das Blatt sowieso nur noch, weil Kurt Jungadler, der Messias der Kinokritik, darin nach wie vor seine prägnanten Filmbesprechungen zuerst veröffentlichte. Leider hatte Jungadler kürzlich angedeutet, demnächst in Rente gehen zu wollen. Er war zweiundachtzig. Die gleichen Ziffern wie bei Kevin-Louis Krüger.
»Und?«, fragte mein Sitznachbar. »Erster Eindruck?«
Die Neun stellte einen Cocktail vor ihm ab – einen White Russian. Relativ vollendet, im Tumbler, Sahneanteil noch nicht mit dem Rest vermischt, dezente Dekoration. Clab nickte anerkennend, zauberte mit dem ersten Schluck einen Sahnestrich auf den eigenen Bart, den er mit einer routinierten Handbewegung sofort wegwischte. Die Kellnerin musterte mich.
»Und du?«
»Etwas Fruchtiges mit einer dezenten Note von Wein. Nicht zu trocken, aber auch nicht süß, mit aromatischem Abgang. Bitte keinen verdammten Hugo. Der Chef de Bar soll mich überraschen.«
Sie war für einen Moment irritiert, nickte dann und ging zum Zeitmaschinen-Konfigurator. Der nickte kurz darauf ebenfalls und sagte etwas. Die Neun kam zurück.
»Okay, dauert aber einen Moment.«
»Also«, sagte Josh Clab, wobei er sein riesiges Smartphone aus der Jackett-Innentasche zog. Ohne hinzusehen, schaltete er es frei und öffnete ein paar Social-Media-Portale. Niemand – von neureichen Russen abgesehen – hatte die Sonderausgabe dieses ohnehin deutlich zu teuren Telefons in Gold gekauft – nur Josh Clab. Und nur bei ihm sah es nicht unpassend aus. Die inzwischen wieder abgeebbte Invasion der neureichen Russen hatte ich selbstverständlich in meinen Kolumnen thematisiert.
»Was willst du von mir, Kumpel? Dass ich dir den Text für deinen Blog diktiere?«
»Ich will freundlich sein, Kunze. Immerhin weiß ich ja, was so abgeht.«
»Wissen und glauben, zu wissen, ist nicht dasselbe.«
»Fakten sind unumstößlich.« Ich hatte keine Ahnung, wovon der Mann redete, aber es war mir auch egal. Außerdem konnte er Fakten nicht von Ostfriesenwitzen unterscheiden.
»Alles ist umstößlich, Kollege.«
»Kollege also. Nett, danke.«
»Erfährt ja keiner.«
Er sagte noch etwas, doch ich wurde abgelenkt, weil sich links von mir eine Frau niederließ. Eine atemberaubende Frau. Die Tresen-Neoprentante mit ihrem Landemuster im Schritt in allen Ehren – wobei Sex mit solchen Weibern in aller Regel eher anstrengend ausfiel, wie ein Workout, ständig die eigenen Leistungskennziffern im Blick. Man kam da selten über eine Vier, höchstens mal knapp an die Sechs.
Aber diese Frau. Auch Josh Clab schwieg und glotzte, natürlich grinsend.
Sie mochte in den Dreißigern sein, wobei schwer auszumachen war, ob am Anfang, in der Mitte oder am Ende dieser Lebensdekade, trug die dunkelblonden, glänzenden Haare nackenkurz, hatte knallblaue Augen, eine sehr schmale, perfekt geformte Nase und offensichtlich längere Beine als mein (einziger) Spezi Thorben, der zwei Meter zwölf groß war. Sie war in ein schwarzes, oberschenkellanges, sehr elegantes Kleid mit kurzen Ärmeln gekleidet, trug dazu eine dezente Goldkette und dazu passende Ohrringe. Ihre Füße steckten in den lässigsten Pumps, die ich seit langem gesehen hatte, auch schwarz.
Ich starrte sie nicht an, ich musterte sie tatsächlich nur kurz und sah dann woanders hin. Meine schnelle Auffassungsgabe und mein gutes Gedächtnis für Details gehörten neben meinem – okay, von unterschiedlichen Personen sehr unterschiedlich eingeschätzten (scheiß der Hund drauf!) – Schreibtalent zu den Eigenschaften, die es mir ermöglicht hatten, gegen zeitweise energischen Widerstand in der Redaktion der Bernd & Susi zu verbleiben. Na ja, da war außerdem noch dieser Vertrag, den ich in einem von dessen schwachen Momenten dem vorvorigen Geschäftsführer abgeschwatzt hatte und der mir, insofern ich keinen gravierenden Schaden anrichtete und tausend Zeilen pro Monat ablieferte, für die Dauer der Existenz des Magazins meine Position sicherte, aber davon abgesehen war ich wirklich gut. Was nicht heißt, dass ich mir immer Mühe gab. Genau genommen eher selten. Aber selbst das reichte meistens.
Ich betrachtete den Rest des Volks, was nicht sehr ergiebig war, sah die Frau wieder kurz an, wie zufällig, und sie tat dasselbe umgekehrt. Dann wandte ich mich abermals Kevin-Louis Krüger zu, der soeben seinen zweiten White Russian bekam, das aber nicht bemerkte, weil er nicht dazu in der Lage war, die Faszination für das Wesen in Schwarz zu verbergen.
Eine weitere Horde Gäste wurde eingelassen, der Laden füllte sich. DJane Austen machte eine Ansage, kündigte eine Musikerin aus Manchester, New Hampshire, an, die nun auftreten würde. Die schöne Frau stand auf, ging an mir vorbei, schenkte mir ein Lächeln, das aber nicht ganz gelang – sie war lampenfiebrig. Die Musikerin also. Ich wusste natürlich, dass es in New Hampshire ein Manchester gab, aber Josh Clab fragte mich tatsächlich, ob er die Ansage richtig verstanden habe.
»War wohl ein Witz«, gab ich zurück.
Er zog kurz die Stirn kraus und konsultierte dann sein Smartphone. Ich beobachtete währenddessen, wie sich die Dame hinter dem Keyboard positionierte, vermutlich eher aus Nervosität ein wenig am Mikrophonständer herumfriemelte und dann mit einer sogar gesprochen beeindruckenden Stimme »Hello, Berlin« sagte.
»Scheiße, natürlich gibt es ein Manchester in New Hampshire«, sagte Krüger.
»Es gibt mehr als zwei Dutzend Manchesters in den Staaten, darunter mindestens vier größere, Herr Kollege. So etwas kann man wissen.«
»Man muss nicht jeden Scheiß wissen«, antwortete er lächelnd.
»Stimmt schon. Aber man sollte wenigstens wissen, was Scheiß ist und was nicht.« Ich ließ den Satz enden, obwohl ich ihn auch noch hätte fragen können, ob er wohl wisse, von wem die Bilder hinter dem Tresen waren. Ich fragte nicht, weil ich ihm eine Information vermittelt hätte, die ich selbst in der Kritik verwenden wollte. So oder so war es eine nette – und nicht erstmals erlebte – Erfahrung, dass der großartige Szene-Blogger ohne Google und Wikipedia aufgeschmissen war.
Das Set der Dame begann, ohne dass sie ihren Namen erwähnt hätte. Auch DJane Austen hatte das nicht getan. Das erste Stück war eine A-capella-Ballade, irgendeine ältere Dylan-Nummer, die auch mit dieser beeindruckenden, fraulich-tiefen, dezent rauchigen Stimme nicht besser wurde, weil das einfach unmöglich war, wenn irgendwas von Dylan stammte. Es gab höflichen, vereinzelten Applaus, die meisten Gäste ignorierten die Darbietung einfach. Aber mit dem zweiten Song verursachte sie mir eine redliche Gänsehaut. Gitarrenakkorde via Keyboard, auch wieder ein langsames Stück, das sich jedoch gemächlich steigerte, bis die Frau aus Neuengland plötzlich explodierte, ohne zu überdrehen. Während sie lauter wurde, schien alles in der Bar leiser und langsamer zu werden. Anschließend gab es ordentlich Beifall, und daran änderte sich während der kommenden zwanzig Minuten nichts. Als sie sich wieder neben mich setzte, deutete ich eine Verneigung an. Die Anstrengung, und es musste eine Anstrengung gewesen sein, war ihr nicht anzusehen. In diesem Augenblick bekam ich endlich meinen Drink, etwas Hellgelbes in einem länglichen Cocktailglas, ohne jede Dekoration. Ich mochte dekorierte Drinks ohnehin nicht, sondern solche, die gut gemacht waren und mundeten. Wenn das der Fall war, nahm ich auch eine Zubereitungszeit von einer halben Stunde hin.
»Tut mir leid«, nuschelte die Neopren-Neun, ohne mich anzusehen.
»Ich bin Journalist«, sagte ich zu der Musikerin.
»Hi«, sagte sie und nippte an Mineralwasser.
»Das war beeindruckend.«
»Danke. Ich bin Melanie.«
Sie hielt mir die rechte Hand entgegen, die ich auch nahm und kurz schüttelte – ich war eigentlich kein Freund von solchen Gesten, bevorzugte die Distanz, auch während der Anbahnung, danach natürlich nicht mehr. Aber die Hand fühlte sich gut an, während der Name in meinem Hirn rotierte. Melanie, wie meine Frau. Die Amerikanerin hatte zwar das A fast wie ein E klingen lassen, sodass sich ihr Name wie Meleny anhörte, aber es blieb der gleiche. Meine Kopfhaut spannte. Der Gedanke, meine Frau mit einer anderen zu betrügen, die genauso hieß, war erregend und irritierend zugleich. Was Pocahontas wohl gerade machte? Sie war in einem Ort namens »Brunn im Spreewald«, wo ich sie morgen treffen würde. Vermutlich saß sie an einer Hotelbar und ließ sich anbaggern. Nein, das tat sie nicht. Melanie mochte es nicht, angebaggert zu werden. Sie mochte es, wohlwollend zur Kenntnis genommen zu werden, auch von attraktiven Männern, aber nach allem, was ich über sie wusste, wehrte sie jeden Annäherungsversuch bestimmt und höflich schon in der Frühphase ab.
»Sebastian«, antwortete ich.
»Journalist?«, fragte sie, stärker lächelnd.
Ich nahm einen Schluck von meinem Drink, der exzellent schmeckte, weshalb ich Augenkontakt mit dem Barmann herzustellen versuchte, was auch sofort gelang, denn er schien nur darauf gewartet zu haben, obwohl er wieder mit einem Shaker hantierte. Ich nickte kurz, wartete seine Reaktion jedoch nicht ab, weil ich das nie tat. Darum ging es bei diesem Spiel. Ich beurteilte ihn, nicht er mich. Es war mir egal, was er von mir dachte. Das galt längst nicht nur für ihn, sondern für fast alle hier. Auf die Anerkennung dieser Leute war ich nicht angewiesen, sondern sie auf meine.
Ich erklärte der Dame – Melanie, verdammt – , dass ich für ein großes Stadtmagazin arbeitete. Sie wechselte auf den Barhocker direkt neben meinem, Josh Clab versuchte, sich in das Gespräch einzumischen, indem er »Great show« sagte und der Frau eine Hand entgegenstreckte.
»Thanks«, sagte sie, schüttelte kurz die Hand und sah dabei mich an.
Verdammt, dachte ich. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich sah den Rest der Nacht vor meinem geistigen Auge ablaufen, die Gespräche zwischen den kommenden zwei, drei Sets, die Taxifahrt in ihr Hotel oder irgendein anderes, den Höflichkeitsdrink an der Hotelbar, die Knutscherei im Aufzug, das peinliche Spielchen mit der Minibar im Zimmer, die geöffnete, aber ungetrunkene Piccoloflasche Champagner (achtzig Tacken auf der Rechnung), den Sex, bei dem in diesem Fall Chancen auf eine Acht oder Neun bestanden, aber auch solche auf eine Katastrophe. Ich sah mich, wie ich um fünf oder sechs aus dem Zimmer schlich, im Fahrstuhl meine Kurznachrichten checkte, mir ein Taxi winkte und mich zu Hause, in Friedrichshain, unter die Dusche stellte. So würde es ablaufen, mit neunundneunzigprozentiger Sicherheit sogar exakt so. Aber, Scheiße, sie hieß Melanie.
Und dann kam alles ganz anders.
Clemens – ich kannte seinen Nachnamen nicht – setzte sich neben mich, weil Josh Clab irgendwo war, bei einem Promi aus der Regionalliga oder auf Klo für eine Prise Nasenpuder, und legte einen Stapel Zeitungen und Zeitschriften auf den Tresen. Früher hatte dieser sympathische, große, schnurrbärtige und grauhaarige Mann selbst als Journalist gearbeitet, in den Neunzigern und bis in die Mitte der sogenannten Nullerjahre, und dann hatte es Gerüchte gegeben, böse Gerüchte über sexuelle Präferenzen, seine Kinder und ein paar andere Sachen, vermutlich gestreut von der Exfrau. Obwohl es nie Anklagen oder ähnliche Konsequenzen gegeben hatte, endete seine Karriere damals über Nacht, mündete in eine mehrjährige Existenz am äußersten Rand der Gesellschaft, bis sich Clemens aufrappelte, eine neue Partnerin fand und diesen Job als mobiler Zeitungsverkäufer, nachts unterwegs in Kneipen, Clubs und Bars, wo er die Publikationen fünf, sechs Stunden feilbot, bevor man sie an den Kiosken und in Zeitungsläden kaufen konnte oder im Briefkasten vorfand. Er hatte seinen Optimismus zurückgewonnen, möglicherweise sogar ein bisschen mehr als nur das, und wie Josh Clab lächelte er meistens, aber auf ganz andere Art. Ich empfand eine gewisse Zuneigung für ihn, weil er Integrität und Tapferkeit verkörperte. Außerdem war dieser Typ ziemlich klug, und für Schlauheit hatte ich ein Faible.
»Herr Kunze«, sagte er und zog eine buschige Augenbraue hoch. »Etwas unerwartet, um ehrlich zu sein.«
»Clemens. Guten Abend.«
»Platz 17. Ich hätte dich, wenn überhaupt, entweder ganz vorne oder ganz hinten erwartet. Platz 17, das ist mehr Demütigung, als nötig gewesen wäre.«
Ich verstand nicht, was er meinte.
»Andererseits«, begann er lächelnd und nahm Mineralwasser entgegen, »ist Platz 17 aus knapp vier Millionen ja irgendwie auch eine Ehre.« Dann trank er.
»Ich habe keine Ahnung, wovon du redest«, gab ich zu.
Er sah mich an, musterte mich. »Du hast wirklich keine Ahnung, oder?«
Ich hob die Hände.
Clemens nickte auf merkwürdige Weise. »Töte nicht den Botschafter. Aber ich muss ehrlich sein. Das ist schon ein besonderer Moment.« Er zog die neue Bernd & Susi aus dem Stapel hervor. »Tut mir leid«, sagte er dann noch.
Die Titelseite war schwarz, und in großen Lettern stand da nur das Wort »ADELE«. Es war sofort klar, dass nicht die Sängerin aus Tottenham gemeint war, sondern die schwäbische Verabschiedung, denn der Magazingründer, Tim Nolte, schon seit Jahren im Ruhestand, stammte aus dem Ländle. Sonst war nur das Logo des Magazins auf dem Cover.
Auf der dritten Seite befand sich der Hinweis, dass diese Ausgabe die normalerweise erst im Herbst veröffentlichte Liste der 50 überflüssigsten Berliner enthalte, mit der wir die Stadt seit zwölf Jahren für zwei bis fünf Tage in Atem hielten, ergänzt um die Ankündigung, dass diese Ausgabe die letzte sei, weil ein Verlag die Namensrechte – und nur diese – gekauft habe und sie für eine kostenlose Beilage in ein paar Tageszeitungen verwenden werde, ansonsten wäre es das mit der B&S gewesen, nach über vierzig Jahren. Die Liste wurde von einem dreiköpfigen Team produziert und geheim gehalten, bis das Magazin in Druck ging. Ich blätterte zur Seite 42, wo sie traditionell begann, und navigierte dann zu Platz 17. Sebastian Kunze. Dort stand:
Es war uns schon immer ein Rätsel, warum die Göttin so viel Schreibtalent an einen solchen Soziopathen verschwendet hat. Kunze ist ein Sexist, ein Faulenzer und ein selbstgerechtes Arschloch. Wir durften ihn leider nicht feuern, aber ihm keine Träne nachweinen, das dürfen wir jetzt – endlich.
Der kurze Text wurde von einem Foto illustriert, das mich dabei zeigte, wie ich einer mäßig talentierten Schauspielerin in den Ausschnitt linste, während ich diesen mit dem rechten Zeigefinger etwas erweiterte. Ich erinnerte mich nicht an diese spezielle Situation, aber das Bild war sicher kein Fake, obwohl ich meistens gut darauf achtete, ob jemand in der Nähe eine Kamera oder ein Handy hochhielt, wenn ich mich ungebührlich benahm und noch halbwegs über Selbstkontrolle verfügte. In letzter Zeit war das immer schwieriger geworden, weil sich die verdammten Smartphones zu verdammten Körperteilen gemausert hatten. Und, zugegeben, unter stärkerem Alkoholeinfluss wurde die Kontrolle problematisch. Ich trank selten zu viel, aber manchmal passierte es einfach.
Es dauerte zwei, drei Minuten, bis ich all das begriff. Zwei, drei sehr lange Minuten, während deren mein Gedächtnis einen Film abspulte, der aus vielen Momentaufnahmen zusammengesetzt war, die mich in wenig gutem Licht zeigten – oder mich hätten ahnen lassen können, was im Busch war.
Die Bernd & Susi wurde aufgelöst.
Platz 17.
Schön, dass doch noch jemand von euch kommt.
Alle hatten es gewusst, nur ich nicht. Okay, ich suchte die Redaktion selten auf. Ich las das Magazin auch nicht – die einzig interessanten Beiträge stammten schließlich von mir, und ich ging auch nie ins Kino; Kurt Jungadler war mir egal, von einer gewissen und vermutlich eher einseitigen Sympathie abgesehen.
Und dann.
Platz 17.
Ich war arbeitslos.
Fuckfuckfuckfuck.
Ich weiß nicht genau, wie der restliche Abend verlief. Ich verließ die Bar, ging in eine Kneipe, bestellte einen Drink und ließ meine privaten Kontakte über das Smartphone-Display flutschen. Ich erwog, Pocahontas anzurufen, möglicherweise auch Thorben, aber ich wusste, was sie mir erzählen würden, also konnte ich auch ohne Telefonate über diese Anmerkungen nachdenken, was wenig brachte. Der Rest der Kontakte war wertlos; lauter Menschen, die mich nicht mochten und die ich nicht mochte, da ich sie entweder in Kolumnen verarbeitet hatte oder sie zu jenen Leuten gehörten, mit denen ich nur den Umgang pflegte, weil sie mit Melanie befreundet waren. Jeder von ihnen – durch die Bank – würde es genießen, mich in dieser schwachen Situation zu erleben, und diesen Genuss gönnte ich ihnen nicht.
Ich nahm den Drink und einen weiteren und bestellte etwas Härteres. Das war nicht meine übliche Konfliktbewältigungsstrategie, die normalerweise aus direkter Konfrontation bestand – ich liebte es, in die Offensive zu gehen, mich der Herausforderung zu stellen. Aber es gab keinen Gegner. Die Fakten waren geschaffen. Die Bernd & Susi war Geschichte und Sebastian Kunze damit auch. Während ich einen schrecklichen dreifachen Bourbon kippte, sah ich meine direkte Zukunft vor mir – keine besonders prickelnde. Sie hatten recht. Aber ihm keine Träne nachweinen. Niemand würde das tun. Selbst der kleine Belletristik-Verlag, der vor ein paar Wochen höflich angefragt hatte, ob er aus meinen Kolumnen ein Buch machen könne, was ich bislang unbeantwortet gelassen hatte, würde keinen fünfstelligen Vorschuss mehr anbieten. Nicht einmal mehr einen nullstelligen. Sie würden mich auslachen.
Ich bestellte weitere harte Drinks. Ich ging wohl noch in andere Kneipen und bestellte noch mehr harte Drinks. Ich schrieb schließlich Kurznachrichten an alle möglichen Leute und bekam parallel sehr viele, die ich nicht las oder nicht mehr entziffern konnte. Ich schaltete das beschissene Telefon aus. Ich trank, rauchte sogar, obwohl ich das verabscheute, noch mehr als das Sichbetrinken. Ich erteilte einer knapp vierzig Jahre alten Frau, die möglicherweise nur freundlich sein wollte, eine grausame, äußerst beleidigende Abfuhr. Bei der zweiten oder dritten oder achten Kneipe setzte die Erinnerungsfähigkeit aus. Ich fuhr wahrscheinlich im Taxi nach Hause, schaffte es in die Wohnung und ins Bett. Sebastian Kunze, Platz 17, von einer Sekunde zur anderen vom Mittelpunkt an den Rand gedrängt.
Schluss mit lustig.
3. Tagebuch von Melanie Kunze, Donnerstag, 16. Juni, 20 . 00 Uhr
Das Hotel ist nett. Das Restaurant ist nett. Ja, das ist Bastis Sprache. Nett, das ist das höchste Prädikat, das man aus seinem Mund zu hören bekommt, und wenn er mal etwas noch besser findet, dann lächelt er, während er nett sagt. Ich muss das auf die Agenda für mein Projekt SK nehmen, ihm beizubringen, sich anders zu äußern. Wahrscheinlich aber steht es da schon längst: Punkt 733 auf der Liste.
Dieses nette