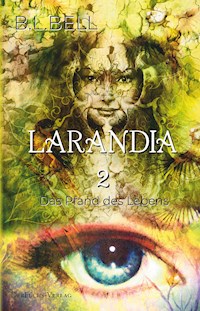3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DerFuchs-Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Zwei Welten, zehn Widerstandskämpfer, ein Ziel! Larandia, eine Parallelwelt zur unseren, in der das wieder erstarkende Böse versucht, sich erneut zu erheben. Diesem stellt sich allerdings eine Gruppe von Widerstandskämpfern entgegen, allen voran der weise Magier Gollnow. Die Suche nach dem zweiten Thronfolger führt die Gemeinschaft quer durch Larandia und immer wieder stellen sich ihnen Feinde in den Weg ... Zur selben Zeit zieht die siebzehnjährige Kimberly Berry aus dem sonnigen Kalifornien in die schottische Kleinstadt Wick. Dort lernt sie die quirlige Emma, den hitzigen Oliver und den mysteriösen Adam kennen. Alle drei wirken recht geheimnisvoll, was Kimberlys Neugier weckt. Wäre doch gelacht, wenn sie ihnen nicht auf die Schliche kommen könnte. Ungewollt vermischen sich das mittelalterliche Larandia und die hochmoderne Menschenwelt – mit ungeahnten Folgen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
LARANDIA
Das Bündnis der Zehn
Ein Roman von
B.L.BELL
Larandia widme ich allen Fantasybegeisterten, die gerne in neue Welten eintauchen und eine Vielzahl von Charakteren schätzen. Allen, die auch nicht davon abgeneigt sind, dass ihre Charaktere eine Achterbahn der Gefühle erleben und sich erstmal selbst finden müssen. Larandia war mein erstes selbst geschriebenes Buch und ich hoffe, ihr Leser könnt mithilfe dieser Geschichte für einige Stunden dem Alltag entfliehen. Besonders möchte ich dem DerFuchs-Verlag danken, dass er sich meinem Werk angenommen hat und es zu dem Buch hat werden lassen, was es nun ist. Mein lieber Papa, danke das du immer an mich und mein Schreiben geglaubt hast. Du hast mich ermutigt, immer das zu tun, was mich glücklich macht. Bitte pass weiterhin oben vom Himmel auf uns alle auf.
Vorwort
»Mein Sohn, am Tage deiner Geburt zitterten sogar unsere Feinde vor deinem Namen. Mit Stolz und voller Freude sah ich dich, mein Sohn, heranwachsen zu einer Waffe des Krieges. Vergiss niemals, dass unser Geschlecht schon immer über Larandia geherrscht hat und wir unser Land stets mit Würde und Weisheit regiert haben. Wenn meine Zeit gekommen ist, mein Sohn, sollst du König werden!«
(König Amandaiil Savage)
Larandia
Kapitel 1 Aufbruch der Widerstandskämpfer
Es war schon früher Abend, als sich eine kleine Gruppe von fünf Personen der Südstraße, etwas abseits vom Silberwald, näherte. Im blassen, klaren Licht der Septembersonne lagen graugrüne Wälder, Böschungen und ein schmaler Pfad vor ihnen, der sich hoch hinauf auf einen Berg schlängelte. Die Gruppe beschloss, gleich den Aufstieg anzugehen, solange noch kein Feind oder Verfolger in Sicht war. Oben schien sich nichts zu bewegen. Kurz darauf ließen sie sich auf der Ostflanke des Berges nieder – in einer Senke mit grasbewachsenen Seiten. Sie waren völlig außer Atem und ihnen taten die Füße weh. Obwohl alle lange Märsche gewohnt waren, fehlten ihnen doch die Pferde. Die hatten sie in Bruch, einem kleinen Dorf in der Nähe des Nebelgebirges im Süden, erstmal zurücklassen müssen. Eine Gruppe aus Reitern wäre doch zu auffällig gewesen.
Auf dem kleinen Gipfel fanden sie ein kreisrundes Mauerwerk, welches mit Moos und Efeu überwuchert war. Hier und da befanden sich kleine Feuerstellen. Anscheinend war hier ein beliebter Rastplatz. Sie hatten Hunger, doch die Gruppe wagte es nicht, ein Feuer zu entfachen – aus Angst, sie könnten gesehen werden. Daher mussten sie sich mit einer Hand voll Beeren und einem Laib Brot begnügen.
Einer von ihnen stellte sich auf die zertrümmerte Mauer ringsum und spähte in das Landesinnere. Weit und breit war nichts zu sehen. Unter ihnen schlängelte sich, neben der Südstraße, ein breiter, klarer und tiefer Fluss. Es war der Fluss Elmo, der Larandia in zwei Teile spaltete. Er entsprang einer Quelle im äußersten Norden, zwischen Tar‘Nerith und Tel’Eiylan, und floss nach einer langen Reise quer durch das ganze Land in das Meer im äußersten Süden des Bezirkes Tel’Navar.
Er suchte mit seinem Blick die weiten Ausläufer des Gebirges ab: Die Näheren waren eintönig braun und grau, dahinter die höher gelegenen Berge mit weißen Spitzen. Das Nebelgebirge, ein riesiger Gebirgspass, teilte Larandia und zog sich vom Süden bis in den hohen Norden. Vor seinem Auge taten sich die endlosen Weiten von Sommerland auf. Dieses mussten sie noch durchqueren, um ins Königreich Elenduiel vorzudringen. Denn dort lag ihr eigentliches Ziel: Der zerstörte Königspalast der Hauptstadt Kaladar.
»Sanduiil, was sieht dein elbisches Auge?«, fragte eine männliche Stimme und ihr Besitzer blickte zu dem Elben empor.
Der stand in seiner glänzenden Robe von ihm abgewandt. Seine langen weißen Haare hatte er zu einem Zopf geflochten. Die spitzen Ohren standen weit ab. Er trug einen moosgrünen Overall, braune Schnallenstiefel und auf dem Rücken einen Bogen. In seinem Ledergürtel steckten zwei kleine Dolche.
»Ich sehe keine Regung oder Bewegung des Feindes. Niemand ist uns gefolgt. Wir dürften sicher sein. Aber wir sollten nicht lange verweilen. Verfolger und Späher könnten sich jederzeit nähern«, sprach dieser mit einer Stimme wie Samt.
»Wir sind seit drei Tagen und Nächten unterwegs. Wir müssen so schnell es geht über den Gebirgspass kommen und nach Elenduiel vordringen. Dort ist die Pforte in die Menschenwelt. Wir brauchen jegliche Hilfe, auch wenn unsere Chancen schlecht stehen«, sagte der Mann hinter dem Elben und trat neben ihn.
Er trug eine dunkelblaue Kutte mit goldenen Rändern. Seine aschblonden Haare standen wild ab, er hatte einen Dreitagebart, kräftige Hände und an seiner rechten Hüfte steckte ein langes Schwert in der Scheide. Wenn man genau hinsah, konnte man an seinen Fingerspitzen kleine Funken erkennen, welche aus diesen hervor waberten.
Der Name des Mannes war Gollnow. Er war ein Magier und hatte über viele Jahrhunderte die Kunst der Magie erlernen müssen. Feuer und Wassermagie einzusetzen war nicht schwer, doch die Macht der Ogham-Magie zu erlernen, eine Kunst. Diese Art der Zauberei musste man immer mit Bedacht einsetzen, denn jede Art von Magie raubte dem Körper Energie. Daher hatte sich Gollnow auch im Schwertkampf ausbilden lassen, um nicht allzu verwundbar zu sein. Seine Macht war geschwächt, je mehr er sich von seinem Reich Tel’Eiylan im Westen entfernte. Daher führte Gollnow immer ein Schwert mit sich. Reine Vorsichtsmaßnahme.
»Verliere nicht gleich den Mut, mein treuer Freund. Allein unsere Vereinigung zeigt, dass wir anders denken und handeln als unsere Vorfahren. Wir haben uns miteinander verbündet und erbitten Hilfe«, antwortete Sanduiil und wandte sich vom Späherposten ab.
Sein Blick fiel auf zwei schlummernde Personen. Die eine wirkte ziemlich klein, etwas stämmig und war von vielen Furchen und Narben im Gesicht gekennzeichnet. Sie trug eine braune Hose, ein ockerfarbenes Shirt, hatte wettergegerbte und ledrige Haut, eine kräftige Nase, dicke Füße und Hände. Auf dem Schoß lag eine doppelschneidige Axt und auf seinem Kopf thronte ein silberfarbener Helm. Der Name des Gnoms war Tulip, ein Vetter zweiten Grades des Gnomenkönigs Golatas. Der Elb lächelte, wenn er auf den kleinen Gnom herabsah, doch keineswegs belustigt. Er war immer wieder verwundert, wie viel Mut, Ausdauer und Kraft diese kleinen Geschöpfe hatten. Er begegnete ihm im Blauwald, als er sich zu weit in das Gebiet der Gnome mit ihrer Hauptstadt Gondrax vorgewagt hatte. Dort hatte Sanduiil versucht, Verbündete zu finden.
Sein Vater, der große Elbenkönig Fanras, hatte die Gabe der Voraussicht. Nicht immer ganz zutreffend und zu hundert Prozent genau, jedoch war stets etwas Wahres dran gewesen. Fanras hatte einen dunklen Schatten am Horizont des schwarzen Landes und der verfluchten Toten-Stadt War gesehen. Das Böse, das dort lauerte und von der damaligen Hohepriesterin Zerodyme gebannt worden war, durfte unter keinen Umständen wieder auferstehen, sonst würden alle in größter Gefahr sein. Der Schwarze Fürst, ein mächtiger Schwarzmagier, konnte nach einem erbitterten Kampf vor vielen Jahrhunderten endlich besiegt werden und in Larandia kehrte Frieden ein. Es hatte zu viele Opfer gegeben und das ganze Land war auseinandergerissen worden. Dies durfte unter keinen Umständen erneut passieren.
Sollte sich nun das verbannte Böse wieder erheben? Sanduiil fühlte sich eh und je Larandia und seinen Bewohnern zutiefst verpflichtet und wollte dieser Prophezeiung nachgehen, kostete es, was es wollte ...
Der Gnom Tulip hatte seinen Kopf gegen die zarte Schulter einer weiteren Person gelehnt. Sanduiil bemerkte, wie Gollnows Augen auf ihr Antlitz geheftet waren, und schmunzelte leicht. Ihr langes, schwarzes und seidiges Haar war an einigen Stellen am Kopf geflochten. Ihre Haut wirkte ebenmäßig und sehr blass. Sie trug ein rubinrotes knielanges Kleid, schwarze Leggins und braune Lederstiefel. Serenity war die Tochter der Paladinkönigin Narissa und hatte in einer Nacht- und Nebelaktion das Königreich Tar’Nerith hoch oben im Norden verlassen. Sie hatte ihr behagliches Leben im Palast von Azul aufgegeben, um sich der kleinen Gruppe anzuschließen.
Es war wahrlich keine Reise für schwache Nerven oder verwöhnte Prinzessinnen. Doch dies störte Serenity keinesfalls. Sie hatte von frühester Kindheit an die Heilung von Verwundeten und Kranken erlernt – genauso wie den Nahkampf mit Stangenwaffen und einige tödliche Zaubersprüche im Namen der Gerechtigkeit. Diese durfte sie aber nur einsetzen, wenn es keinen anderen Ausweg mehr gab, denn die Macht der Magie schwächte die Körper der Paladine besonders, da sie eigentlich nicht dafür gemacht waren.
Gollnow konnte seinen Blick nur schwer von der schlafenden Schönheit abwenden. Doch in seinem Leben hatte er keinen Platz für solche Schwärmereien oder tiefere Gefühle, denn er hatte sich mit Leib und Seele ganz seinem Volk und seinem Oberhaupt Xaramas verschrieben. Manchmal war es jedoch schwierig, Herz und Verstand in Einklang zu bringen.
Der Elb hatte sich in der Zwischenzeit der fünften Person zugewandt. Die saß auf einem Felsen, schärfte ihr Schwert und blickte düster in die Runde. Seine Statur glich der eines Kämpfers, eines Gladiators. Die Arme waren muskelbepackt und seine Haut tief gebräunt von der Sonne. Die Haare kohlrabenschwarz und er hatte sie zu einem Zopf gebunden. Die Rüstung war dunkelgrau und schon ein klein wenig in Mitleidenschaft gezogen worden. Um seine Taille trug der Krieger einen Gürtel, an welchem kleinere und auch größere Dolche baumelten.
Andariel, so der Name des Mannes, war ein ehemaliger Soldat der königlichen Leibgarde des Geschlechtes Savages. Er hatte nach dem Sieg über die Beasts und den Schwarzen Fürsten neue Herausforderungen gesucht – in den Weiten des Sommerlandes wie viele andere auch. Im Königreich Elenduiel wollte niemand mehr leben. Es war zu trostlos, einsam und alles erinnerte an den Krieg. Der Königspalast in der Hauptstadt Kaladar hatte man fast komplett zerstört.
Es schmerzte Andariel zu sehr, dorthin zurückzukehren, doch er wusste ebenso wie seine Begleiter, dass sich dort ein magisches Portal zu einer ihnen fremden Welt befand. Zu einer Parallelwelt, die sich Erde nannte. Von dort waren damals in der ersten Zeitrechnung die Speziellen Menschen nach Larandia gekommen. Es hieß, man hatte sie wegen ihrer Andersartigkeit aus ihrer eigenen Heimat vertrieben und sie ließen sich in Elenduiel nieder, erkannten das Geschlecht Savage als ihre Herrscher an und kämpften von diesem Tage an für ihre neue Heimat.
Doch niemand hatte wirklich etwas für diese anderen Menschen übrig gehabt. Allein schon ihre Fähigkeiten: Gedankenlesen, Feuer mit bloßer Gedankenkontrolle entfachen und leiten, das Verwandeln in Tiere und das Bewegen oder Leiten von Gegenständen – auch mit bloßer Gedankenkontrolle. Für fast alle Bewohner Elenduiels waren sie Hexen oder böse Schwarzmagier gewesen. Böses Blut.
Die Herrscher der Savages begegneten diesen Speziellen Menschen allerdings mit Würde und Respekt, boten ihnen ein neues Leben in ihrem Königreich und, solange niemand aus ihren Reihen zu Schaden kam und sie ihre Kräfte für das Gute einsetzten oder im Kampf gegen Feinde, sollte niemand ihnen ein Haar krümmen. So war das Gesetz – bis zum heutigen Tage.
»Andariel, über was zerbrichst du dir den Kopf?«, fragte Sanduiil und setzte sich zu ihm.
»Über alles. Was gedenkt Ihr in der Neuen Welt zu finden?«
»Hilfe. Neue Verbündete. Wir müssen versuchen, unsere Völker wieder zu vereinen. Wir müssen besonders das Spezielle Volk einen und erneut einen König auf den Thron von Elenduiel setzen«, sprach der Elb und begutachtete seine Dolche.
»Wenn dies geschieht, wird der Zauberbann der großen Zerodyme gebrochen und der Schwarze Fürst aus dem Schwarzen Land entkommen! Ihr seid wahnsinnig!« Andariel schüttelte entschieden den Kopf und rammte sein Schwert in den Boden.
»Nicht, wenn wir vorher an die Klinge der Hoffnung herankommen. Sie wurde mit dem Kronprinzen Van Savage in den Eishöhlen der Skriills eingefroren. Ob sein Körper diesen Jahrhunderte langen Schlaf überlebt hat, wage ich zu bezweifeln, doch wir müssen es versuchen. Ich glaube daran. Zudem leben Nachkommen des Speziellen Volkes ebenfalls auf der Erde. Beides müssen wir hierherbringen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich das Böse in War wieder erhebt. Mit jedem Jahr wird der Zauberbann von Zerodyme schwächer«, vernahmen beide eine Stimme, welche zu Serenity gehörte.
Sie hatte sich erhoben und sah mit fester Miene die beiden Männer an.
»Serenity hat Recht. Die Hohepriesterin ist mit einem langen Leben gesegnet, doch auch sie ist nicht unsterblich. Und wie ich gehört habe, neigt sich bald auch ihre Zeit dem Ende zu. Sie ist die letzte Hohepriesterin ihrer Art. Wenn Zerodyme stirbt, ist der Zauber gebrochen. Seit über fünfhundert Jahren ist der hart erkämpfte Frieden nun schon in unserem Land, aber ich sehe dies nur als eine kurze Ruhe, ehe uns der große Sturm heimsucht.« Der Gnom Tulip hatte sich mittlerweile erhoben und stützte sich auf seine doppelschneidige Axt.
»Genauso hatte es mir mein Vater vorausgesagt. Daher bin ich von Pelarion aufgebrochen und traf auf Tulip im Blauwald. Dich, mein guter Freund Andariel, haben wir vor einer Schlägerei in einem Wirtshaus am Fuße des Elmos in Bruch gerettet«, lachte Sanduiil und warf sein langes weißes Haar in den Nacken.
»Von wegen gerettet – ich kam sehr gut alleine klar. Ich mag es nur nicht, wenn man mir das verweigert, wofür ich bezahlt habe. Und der Wirt war sehr knauserig«, meinte Andariel und verschränkte die Arme vor der Brust.
»Das sehe ich zwar anders, aber lassen wir dich mal in dem Glauben.« Tulip tätschelte ihm den Oberschenkel, da er nicht höher kam.
»Wie gut, dass ich auf meiner Flussreise in Richtung Osten auf Gollnow traf. Du kamst gerade mit einem Boot vorbei und nahmst mich mit«, sprach Serenity dankbar in Richtung des Magiers und lächelte ihn an.
Gollnow wurde sofort wieder warm ums Herz, als er in ihre eisblauen Augen blickte.
»Ohne dich wäre ich verloren gewesen. Ich war noch nie auf der anderen Seite des Nebelgebirges im Osten. Auch das Königreich Elenduiel kannte ich bis jetzt nur von Erzählungen meiner Mutter und der Lehrer«, schwärmte Serenity und strahlte über beide Ohren.
»Ja, nun, wir müssen uns beratschlagen. Ewig können wir hier nicht verweilen. Die Feinde könnten uns schon dicht auf den Fersen sein. Der Mond geht bereits auf. Wir sollten versuchen, uns schlafen zu legen und beim ersten Sonnenstrahl die Reise fortzusetzen«, sagte Gollnow.
Er räusperte sich etwas verlegen und blickte zur wachsbleichen Scheibe des Vollmondes empor. Serenity und Tulip entfernten sich einige Schritte von ihnen und schauten über den Rand ins Tal hinab. Sanduiil, Gollnow und Andariel setzten sich beieinander und Gollnow beschwor mit wenigen Worten für jeden eine kleine bläuliche Flamme. Sie war winzig klein, gerade einmal so groß wie ein Hühnerei, doch sie strahlte eine behagliche Wärme aus und man verbrannte sich nicht an ihr. Sie sollten einen in der Nacht nur etwas wärmen.
»Ihr Magier seid schon wirklich nützlich, das muss man euch lassen«, meinte Andariel und beobachtete die blaue Flamme in seiner Hand.
»Danke für das Kompliment. Wie du jedoch weißt, beherrschen wir noch viel mehr als nur dieses bisschen Hokuspokus«, meinte Gollnow und zwinkerte ihm zu.
»Ja, ja – ihr seid alle ganz tolle Helden«, sagte Sanduiil und schüttelte den Kopf.
»Was willst du damit sagen? Hältst du dich etwa für etwas Besseres, Elb?«, meinte Gollnow und blickte ihn herausfordernd an.
»Mein lieber Freund, mein Volk ist das älteste Volk der Geschichte. Wir haben in unserem Jahrtausende langen Bestehen schon alles gesehen: Große Könige fallen und auferstehen, Magier sich duellieren bis aufs Blut, tausende Kriege gefochten in großen Schlachten – ich sollte vielleicht anfangen, wenn dies alles vorbei ist, ein Buch zu schreiben«, überlegte Sanduiil und musste leise lachen.
In diesem Augenblick kamen Tulip und Serenity vom oberen Rande der Senke herbeigeeilt und in ihren Gesichtern spiegelte sich Furcht wider.
»Was ist los?«, fragte Sanduiil und sprang sofort auf.
»Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich einige Schatten gesehen habe, die den Hang hinaufkommen«, stammelte Serenity und umklammerte ihren Stab.
»Hast du sicher etwas gesehen?«, fragte Andariel und schaute prüfend in alle Richtungen.
»Ja, ich habe es auch gesehen. Dunkle Gestalten. Sie bewegen sich rasch auf uns zu«, erwiderte Tulip und zückte seine Axt.
»Zieht all eure Waffen und bleibt dicht zusammen«, befahl Andariel und zog sein Schwert aus der Scheide, das im Mondlicht blitzte.
Sanduiil zog seinen Bogen und spannte den ersten Pfeil. Gollnow konzentrierte sich und bunte Funken sprühten aus seinen Fingerspitzen. Serenity erhob ihren Stab und aus dem unteren Ende klickte plötzlich eine scharfe Spitze hervor. Sie lauschten alle in die Nacht hinein.
Die Nerven war zum Zerbersten gespannt. Eine Zeit lang wagten sie alle kaum zu atmen. Stumm und wachsam starrten sie in die Dunkelheit. Nichts geschah. Weder Bewegungen noch Laute drangen durch die Nacht.
Doch, da war etwas!
»Leise«, murmelte Andariel und seine Augen verengten sich zu Schlitzen.
»Was ist das dort drüben?«, keuchte Serenity auf und deutete in Richtung Westen.
Über den Rand der Senke erhoben sich Schatten. Wie viele es waren oder ob es gar nur einer war, konnten sie nicht erspähen. Alle strengten ihre Augen an. Die seltsamen Schatten begannen zu wachsen, wurden immer größer und größer. Es gab keinen Zweifel mehr: Drei große Gestalten in roten Kutten standen am Rand der Senke und starrten kurzzeitig auf die Gruppe herab. Alle spürten eine undurchdringliche Kälte und ihr Atem formte sich zu Rauchschwaden. Dann kamen sie langsam näher.
»Rotkutten! Zieht Eure Waffen und bleibt zusammen!«, rief Andariel und stellte sich schützend vor Tulip und Serenity.
»Du musst mich nicht verteidigen, ich bin eine ausgezeichnete Kämpferin«, meinte Serenity und trat einige Schritte nach vorn.
»Wenn sich eine Frau schon dem Feind entgegenstellt, muss ich das ja auch tun, sonst hält man mir meine Feigheit noch ewig vor«, jammerte Tulip, schwang seine Axt und stürmte ebenfalls los.
»Ich sagte doch, nicht nach vorne! Zusammenbleiben!«, brüllte Andariel, schüttelte wütend den Kopf und hastete ebenfalls den Gestalten entgegen.
»Immer muss es nach deren Kopf gehen«, meinte Sanduiil und eilte seinen Freunden zu Hilfe.
Alle schwangen ihre Waffen und mit einem lauten Donnergrollen begann die Schlacht in der Senke. Serenity und Tulip stürzten sich laut schreiend auf eine Gestalt und man hörte das Aneinanderschlagen der Schwerter. Andariel lieferte sich unterdessen einen wilden Schlagabtausch, knallte mehrmals zu Boden, rappelte sich jedoch entschlossen immer wieder auf. Sanduiil feuerte zwei Pfeile ab, welche die dritte Gestalt direkt in Herz und Kopf trafen. Elbenpfeile waren mit einer magischen Substanz überzogen, die sich gegen nicht-menschliche Wesen richtete und ihnen Schaden zufügte. Gollnow raunte einige Zauberformeln und errichtete Schutzbarrieren, um weitere Feinde abzuhalten. Serenity hob ihren Stab und rammte die dolchartige Spitze in den Kopf des Rotkuttenträgers. Von hinten näherte sich Tulip und hieb mit seiner Axt mitten in den Rumpf der Kreatur. Die zischte laut und fiel dann auf den matschigen Boden. Andariel focht mit seinem Angreifer einen heftigen Kampf aus, wurde dabei unter lautem Aufschrei an der Schulter verletzt. Er blutete, blickte wütend auf seinen Gegner und hieb diesem daraufhin mit einem Schlag den Kopf ab.
»Flieht mit mir! Flieht mit mir hinab Richtung Sommerland. Vielleicht können wir irgendwo Schutz finden. Der Weg führt uns zum nächsten Dorf. Beeilt euch und bleibt um Himmels willen zusammen«, rief Gollnow und ein heller Strahl aus seiner Hand, leuchtete ihnen den steinigen, holprigen Weg ins Tal hinab.
Die Truppe lief hinter dem Magier her, blickte sich ständig prüfend um, ehe sie in der Dunkelheit verschwanden.
Kapitel 2 Eine Welt zerbricht
Acht Wochen zuvor ...
Ich lag noch vollkommen müde und abgespannt in meinem riesigen Himmelbett. Die weißen Vorhänge tanzten im morgendlichen Sonnenlicht, welches mich an meiner Nase kitzelte. Ich hörte ein mir bekanntes Geräusch und sofort musste ich lächeln. Ich liebte es. Das Rauschen des Meeres.
Ich lebte zusammen mit meinen Eltern und meiner Nanny Francesca in einem großen Strandhaus ganz in der Nähe des Santa Monica Pier im Stadtteil Santa Monica in Los Angeles. Ich hatte alles, was ich mir nur wünschen konnte. Eine Nanny, die sich Tag und Nacht um mich kümmerte, wenn meine Eltern – wie momentan – auf einer Forschungsreise in ihrer zweiten Heimat Kairo in Ägypten unterwegs waren. Wir skypten natürlich täglich miteinander, jedoch besaß ich den unglaublichen Luxus von enormer Freiheit. Jeden Tag verbrachte ich mit meinem Freund und meinen Freunden nach der Schule Zeit am Meer, beim Shoppen oder im Kino.
Die Highschool war endlich vorbei und voller Vorfreude sah ich schon der Zeit am College entgegen: Die Verbindungspartys, die rauschenden Feste, die hoffentlich interessanten Vorlesungen, da ich Literatur und Englisch im Hauptfach gewählt hatte, und einfach ein neuer Lebensabschnitt mit all meinen Freunden. Dieses Jahr war ich, wie zu erwarten, zur Abschlussballkönigin gewählt worden, zusammen mit Justin Preston, meinem festen Freund. Ich war das glücklichste Mädchen der Welt. Justin war Kapitän der Footballmannschaft und die anderen Mädchen lagen ihm zu Füßen. Doch wir hatten nur Augen füreinander. Heute Abend sollte am Strand von Santa Monica unser Schulabschluss gefeiert werden und mein Tag war vollgestopft mit für mich wichtigen Terminen. Ich wusste gar nicht, wie ich das eigentlich alles schaffen sollte.
Ich lebte ein Leben, in dem im Grunde die ganze Zeit die Sonne schien. Man könnte meinen: wie langweilig, wie klischeehaft! Aber soll ich euch etwas sagen? Mir war das egal. Ich wollte nicht in irgendeine verrückte oder außergewöhnliche Sache verstrickt werden. Es gab auf der Welt so viele Kriege, Ungerechtigkeiten, Verzweiflung, Trauer, Gewalt und Tod – da war ich über mein spießerhaftes Dasein einfach nur froh.
Ich setzte mich schlaftrunken auf und meine nackten Füße berührten den kühlen Marmorboden des Zimmers. Meine Nanny musste dringend aufräumen. Sie vernachlässigte definitiv ihre Pflichten. Ich würde Francesca demnächst darauf ansprechen, dachte ich mir und beobachtete dann kritisch die junge Frau im hohen Wandspiegel.
Einen Meter siebzig, rotbraune lange Haare, die mir bis auf den Rücken reichten, tiefblaue Augen, hohe schmale Wangenknochen und eine schlanke Figur. Ich war nie besonders sportlich gewesen, hatte jedoch das Glück mit einer schlanken Figur gesegnet zu sein.
Alles in allem war ich wohl geraten, doch was niemand wusste, war, dass ich eine kleine Behinderung hatte, von der niemand wusste. Jedenfalls nannte ich das selbst immer so. Ich konnte nämlich in die Köpfe anderer sehen. Ich konnte hören, was sie dachten. Ich konnte Gedankenlesen. Man könnte mich auch in der Fachsprache als Telepathin bezeichnen. Ich hatte diese Behinderung, oder auch Gabe, schon mein Leben lang.
Es war einerseits sehr praktisch, zu wissen, was mein Gegenüber dachte, denn so konnte mich niemand anlügen, da ich dies natürlich sofort bemerkte. Auch war ich für viele Jungs die perfekte Freundin gewesen, weil ich immer wusste, was sie mochten und was nicht. Ich konnte sie also stets zufriedenstellen. Natürlich hatte diese Gabe der Telepathie auch ihre Tücken. Ich las auch zwangsläufig Gedanken von Menschen, von denen ich es gar nicht wollte. Doch es fiel mir schwer, mich gegen hunderte oder tausende Gedanken abzuschotten. Manchmal klappt es, dass ich diesen unsichtbaren Schleier hochfahren konnte und mal die Ruhe und Stille genießen konnte. Wenn ich es jedoch nicht mehr schaffte, denn das erforderte sehr viel Kraft und Konzentration, fiel dieser Schleier oder die Barriere und auf mich strömte alles nur so ein. Des Öfteren bekam ich dadurch Kopfschmerzen oder, wenn es ganz schlimm wurde, sogar Migräneanfälle. Da halfen oft nur Kopfschmerztabletten und viele Stunden im Bett, abgeschottet von der Außenwelt. Allerdings gehörte dies einfach zu meinem Leben dazu und ich hatte mich daran gewöhnt. Jeder musste mit seinem Handicap leben, egal wie.
In Gedanken versunken sprang ich unter die große Regendusche im weißen Marmorbadezimmer und ölte danach meine Haut mit dem neuesten Körperöl ein: Kokos aus der Karibik. Danach kramte ich eine Weile in der Kommode herum mit meinen neuesten Kleidungsstücken, welche erst gestern vom letzten Reisetrip nach Paris geliefert wurden. Mode war mir sehr wichtig. Ich definierte mich sozusagen über meine Klamotten. Und schließlich war ich das It-Girl der Schule, die Trendsetterin. Jedes Mädchen wollte mit mir befreundet sein und jeder Junge wünschte sich, mit mir auszugehen. Da hatte man schon einen gewissen Ruf zu wahren.
Ich entschied mich für einen weißen kurzen Rock, ein dunkelblaues Top und weiße hohe Riemchensandalen. Meine Haare föhnte ich trocken und glatt. Perfekt. Ich zwinkerte mir selbst im Spiegel zu, schnappte mir daraufhin meine Tasche und lief die breite Marmortreppe hinunter in unsere Eingangshalle. Dort wartete schon meine Nanny:
»Guten Morgen, Miss Kimberly. Ihr Kaffee steht in der Küche und ein Pancake liegt auch dabei«, begrüßte sie mich freundlich.
»Guten Morgen. Kaffee ja, Pancake nein. Lieber ein Müsli oder nur einen Obstsalat«, rief ich ihr zu, rauschte an ihr vorbei in die Küche und griff nach der Kaffeetasse.
»Miss Kimberly, Sie müssen essen. Sie sind noch im Wachstum und ohnehin schon sehr dünn«, belehrte sie mich jeden Tag aufs Neue.
»Ja, ja, ich weiß. Sie werden auch nicht von jedem hier in der Gegend beobachtet und akribisch beäugt, was Sie tragen, wie dick oder dünn Sie sind oder auch was Sie sich beim nächsten Bäcker um die Ecke zu essen kaufen. Mein Leben ist nicht so einfach wie Ihres, Francesca«, meinte ich gelangweilt und rollte mit den Augen.
»Oh ja, Miss Kimberly, Ihr Leben ist so anstrengend. Ich fange schon bald an sie zu bemitleiden«, meinte meine Nanny süffisant und schüttelte den Kopf.
»Ich muss los, wir sehen uns heute Abend. Wird wahrscheinlich spät werden, da die Schulabschlussparty am Strand stattfindet«, rief ich und wollte gerade gehen, als mich Francesca zurückhielt.
»Stopp! Was haben wir immer gesagt? Woran sollen Sie sich halten?«
»Keine Drogen, kein Alkohol, keine komischen Rituale mitmachen und kein Sex on the Beach«, lachte ich, nachdem ich dies aufgezählt hatte, und winkte ihr über die Schulter zu.
Sekunden später befand ich mich schon vor der Haustür und lief auf mein Auto zu. Mein Auto: ein schneeweißes Mercedes Benz Cabrio. Zu meinem sechzehnten Geburtstag hatte ich es von meinen Eltern bekommen und seitdem hütete ich den Wagen wie meinen Augapfel. Ich ließ den Motor an und rollte von unserer Auffahrt herunter, ehe ich nach rechts auf die Hauptstraße abbog. In der Nähe des Joslyn Parks war unser Treffpunkt und als ich ankam, waren alle schon da. Die ganze Clique. Kaum stieg ich aus meinem Auto, war ich auch schon der Mittelpunkt.
»Hey, Kimberly, da bist du ja!«, meinte meine Freundin Candice mit ihren langen und lockigen roten Haaren laut.
»Hey, Cool-Girl, alles klar?«, fragte eine andere Stimme und ich wurde von jedem geherzt und gedrückt.
Sekunden später saßen wir in einem feinen Restaurant und aßen Lachs, Kaviar, Baguette und tranken dazu alkoholfreien Champagner. Wir unterhielten uns über die Party heute Abend: Wer mit wem kam, wer was anzog ... Und immer wieder tauschte ich verliebte Blicke und Küsse mit Justin aus. Ich war im siebten Himmel. Manchmal fühlte es sich so an, als würde ich unter einer wohl behüteten Käseglocke leben, von welcher alles Böse dieser Welt abgeschottet wurde.
Als es kurz vor zwölf Uhr war, ging ich in Begleitung meines Freundes zum Auto. Er küsste mich zärtlich auf die Lippen und ich blickte in seine stahlblauen Augen. Eine leichte Brise wehte durch sein strohblondes Haar.
»Sehen wir uns heute Abend, mein Engel?«, fragte er mich sanft.
»Ja. Ich lass mich jetzt nur für dich schön machen«, sagte ich freudig wie ein Kind im Süßigkeitenladen.
»Du bist immer schön. Egal, was du mit dir machen lässt. Ciao, Baby«, antwortete Justin und half mir dann galant in den Wagen.
Sekunden später fuhr ich zum Beautysalon Richtung Downtown. Dort blätterte ich in der neusten Klatschzeitschrift herum, während eine Dame unter mir an meinen Füßen arbeitete. Eine Stunde später bekam ich frisch manikürte Fingernägel, weitere zwei Stunden später ließ ich mir die Haare zu einer schicken Frisur hochstecken. Es war später Nachmittag, als ich mit meinem Wagen wieder nachhause fuhr.
Meine Nanny war nicht zuhause, doch sie hatte mir einen gemischten Salat hingestellt. Zumindest dachte sie nun an meine Figur. Ich ging in mein Zimmer und sah mir im Schrank eine Auswahl der Garderobe an. Nach langem Überlegen, mein Fußboden war mittlerweile übersät mit Kleidungsstücken, welche ich aus dem Schrank gepfeffert hatte, entschied ich mich für ein knielanges Cocktailkleid mit Spaghettiträgern, bestickt mit blau-weißen Blumen.
Gerade als ich mein neustes Parfüm auftrug, klingelte es an der Haustür. Ich lief eilig hinunter und öffnete sie ein wenig außer Atem. Es war Justin, der in einer schönen, eleganten Jeans, mit Hemd und seiner goldenen Rolex am Handgelenk vor mir stand. In der Auffahrt parkte sein roter Lamborghini. Meine Güte, ich hatte solches Glück mit diesem Mann. Meine innere Göttin zwinkerte mir vielsagend zu.
»Wow, Kimberly«, staunte Justin und zog mich sofort in seine Arme.
»Vorsicht, ruinier nicht meine Frisur und das Make-up«, wehrte ich ihn liebevoll ab: »Danke, dass du mich abholst.«
»Frauen ... Hast du alles, Darling?«, fragte er, bevor ich die Tür hinter mir schloss.
»Jup, alles dabei. Kann losgehen«, antwortete ich und stieg dann neben ihm in den Wagen.
Als wir losfuhren, spürte ich auf einmal etwas Seltsames in der Magengegend. Ein Schauer lief mir über den Rücken, was keineswegs angenehm war. Ein Gefühl von Angst, als ob bald etwas passieren würde. Etwas, das mein Leben bald mit einem Schlag ändern würde und nichts würde mehr so sein, wie es mal war. Ich versuchte, mich von diesem Gedanken zu befreien, und atmete tief ein und aus. Ich lenkte meinen Blick auf den Santa Monica Beach und meine Augen wanderten über den weiten, unendlich riesigen Ozean.
Ich hatte in der letzten Zeit öfter Albträume bekommen, die ich jedoch niemandem erzählte. Sonst würde man mich noch für verrückt halten. Ständig lief ich durch dunkle, mir unbekannte Wälder und seltsame Gegenden. Ich wurde verfolgt. Beobachtet von giftgrünen Augen. Dann rannte ich urplötzlich in eine Person, welche in Flammen stand. Eine andere wiederum erstrahlte in hellem Licht und auf einmal hörte ich Schreie. Unendliche Schreie von überall her.
Schweißgebadet wachte ich jedes Mal in meinem Bett auf und diese Visionen wiederholten sich, wurden von Mal zu Mal intensiver.
Die Abendsonne tauchte den Himmel in ein rötliches Tuch, jedoch war es noch angenehm warm: achtundzwanzig Grad. Wir fuhren auf einen breiten Parkplatz und konnten bereits die dröhnende Musik und viele bunte Luftballons und helle Lichter erkennen. Massen von Jugendlichen strömten in Richtung The Bungalow. Dies war ein erstklassiges Restaurant mit direktem Sitz am Pier und man konnte von dort aus zu den Strandbars gehen. Eine Band spielte auf einer großen Bühne, wo schon kräftig gefeiert wurde.
»Ich dachte, wir wären die Ersten«, meinte ich und ließ mich von Justin an der Hand durch die Mengen schleifen.
»Was? Quatsch! Die Ersten sind schon seit heute Nachmittag hier. Komm, ich habe uns eine Lounge gemietet, gleich in der Nähe der Caribbean Bar«, sagte Justin.
»Gott sei Dank – eine Lounge. Ich möchte nicht inmitten von allen stehen oder sitzen«, bedankte ich mich und schlenderte um einen am Boden liegenden betrunkenen Typen herum.
Kurz darauf saßen wir in gemütlichen grauen Loungesesseln und hielten Cocktails mit Schirmchen in den Händen. Dazu gab es kleine Snacks und wir lauschten der Musik. Meine Freundin Candice tanzte ganz in der Nähe mit irgendeinem Typen aus unserer ehemaligen Parallelklasse. Meine Banknachbarin Amanda hatte sich an Jason Long herangeschmissen und knutschte wild mit ihm herum. Gerade als ich einen weiteren Schluck meines Cocktails nehmen und danach mit Justin auf die Tanzfläche wollte, erblickte ich aus dem Augenwinkel vier Gestalten, welche sich einen Weg durch die Menge bahnten und direkt auf mich zukamen. Als sie näher kamen, erkannte ich zwei uniformierte Polizisten vom L.A.P.D., daneben eine schmale Frau mit durchdringendem, ernstem Gesicht und meine Nanny. Francesca sah allerdings nicht aus wie sonst. Ihr Gesicht wirkte blass und ihre Augen waren rot. Sie sah verweint aus, hatte die Lippen fest aufeinandergepresst. Immer wieder griff sie nach dem Arm der anderen Frau, um sich zu stützen. Verwirrt stand ich auf und auch Justin erhob sich sofort.
»Was macht deine Nanny hier? Und warum ist die Polizei dabei?«, fragte er etwas lauter durch das Dröhnen der Musik und ergriff sofort meine Hand.
»Ich weiß es nicht. Ich habe aber so das Gefühl, dass das nichts Gutes bedeutet«, flüsterte ich und erneut überkam mich so ein eigenartiges Gefühl von aufsteigender Panik.
»Miss Berry? Kimberly Berry?«, erkundigte sich einer der Polizisten und nickte in meine Richtung.
»Ja, das bin ich«, meinte ich und sah zu meiner Nanny, die kurz davor war, in Tränen aufzubrechen.
»Wir müssen mit Ihnen reden. Können wir das bitte an einem geeigneteren Ort machen?«, wollte der andere Polizist wissen und schaute sich suchend um.
»Ja, am Lagerfeuer. Da dürfte jetzt noch nichts los sein«, meinte ich und nickte ihnen zu.
»Soll ich mitkommen?«, fragte Justin.
»Nein, Sie bleiben hier. Miss Berry, kommen Sie bitte«, sagte die dünne Frau neben meiner Nanny und wies in Richtung Strand.
Ich antwortete nicht. Ich wollte eigentlich widersprechen, doch mir fiel nichts ein. Irgendwie war alles, was hier lief, falsch, vollkommen falsch.
Wir gingen schweigend nebeneinander her und meine Nanny schluchzte immer wieder. Ich blickte sie an, aber sie wandte den Blick immer wieder ab. Ich versuchte, in ihren Kopf zu kommen, doch ich bekam nur bruchstückhaft mit, was sie dachte. Da ich selbst so verwirrt und innerlich aufgewühlt war, konnte ich in jenem Moment meine und ihre Gedanken nicht mehr richtig ordnen und hoffte nur, dass ich bald erfuhr, was hier eigentlich los war. Wenn ich stark verwirrt war oder zu viele Gefühle oder Gedanken auf mich einströmten, fiel es mir grundsätzlich schwer, meine Gabe anzuwenden.
Kurz darauf standen wir vor dem großen Lagerfeuer und ich hörte das Knacken der Holzscheite und das Rauschen des Meeres. Mein Herz klopfte mir dabei bis zum Hals und ich schluckte schwer. Meine Hände hatte ich zu Fäusten geballt, so angespannt war ich und sah mich verwirrt um.
»Was gibt es denn so Wichtiges und wer sind Sie?«, fragte ich die dünne Frau.
»Ich bin Miss Marshall vom Jugendamt«, sagte sie.
»Jugendamt? Ich hab doch eine Nanny und meine Eltern«, fiel ich ihr sofort ins Wort.
»Genau um Ihre Eltern geht es, Miss Berry«, brummte der Polizist und ich bemerkte, wie angespannt er war.
»Wir müssen Ihnen leider eine traurige Mitteilung machen, Miss Berry«, fing der andere Polizist an und Francesca brach in Tränen aus und hielt sich ein Taschentuch vor die Lippen.
Trotz der aufsteigenden Panik in mir, bemühte ich mich noch irgendwie klar zu denken. Mir schnürte es jedoch regelrecht die Kehle zu.
»Was ist denn passiert?«, stammelte ich und mir wurde heiß und kalt zugleich.
»Ihre Eltern waren auf dem Rückweg mit ihrer Privatmaschine von Kairo nach Los Angeles. Leider ist ein tragischer Unfall passiert«, begann die Frau vom Jugendamt und bei den letzten Worten sank ich zu Boden. Ich zitterte wie Espenlaub und mir wurde schlecht.
»Die Maschine Ihrer Eltern ist über dem Meer abgestürzt. Es tut mir leid, Miss Berry, aber Ihre Eltern sind ums Leben gekommen«, sagte der Polizist langsam und er betonte jedes einzelne Wort.
Eine Weile vernahm ich nichts mehr um mich herum. Ich hörte nichts mehr. Ich sah nichts mehr. Ich wiederholte die Worte in Gedanken, um sie zu begreifen.
»Meine Eltern ... tot ... ein Absturz ... im Meer.« Ich versuchte zu sprechen, doch die Worte verwirrten mich.
Ich schloss die Augen, spürte warme Tränen an meinen heißen Wangen herunterlaufen. Sie liefen und liefen, ohne dass ich etwas dagegen tun konnte. Eine Hand legte sich auf meine Schulter, welche sich dann um meinen ganzen Körper schloss, und versuchte, mich auf die Beine zu stellen. Es war Francesca, aber ich nahm sie gar nicht mehr wahr. Ich nahm überhaupt nichts mehr wahr um mich herum. Ich versuchte, mich mit zitternden Beinen zu erheben, klappte jedoch immer wieder ein, wie ein Klappmesser. Ich spürte Stiche. Tiefe, schneidende Stiche in meinem Herzen. Ich richtete mich erneut auf und bemühte mich, vorwärtszugehen. Immer wieder strauchelte ich und je mehr ich verstand, was da gerade geschehen war, desto häufiger fiel ich hin.
Als ich einen weiteren Fuß nach vorn setzte, stolperte ich, stürzte in den Sand und blieb dort liegen. Ich drehte mich auf die Seite, zog die Beine an und um mich herum wurde es plötzlich schwarz.
»Tod ..., der Tod ..., er hat sie eingeholt ... Mama ... Papa«, flüsterte ich mit einer mir völlig fremden Stimme.
Ich hielt mich mit aller Kraft an dem tauben Gefühl fest, das mich davor bewahren sollte, zu begreifen, was ich einfach nicht begreifen wollte. Die Dunkelheit umfing mich, hielt mich und zog mich in einen tiefen Strudel.
Das Leben, die Liebe – alles war vorbei.
Kapitel 3 Alles auf Anfang
I