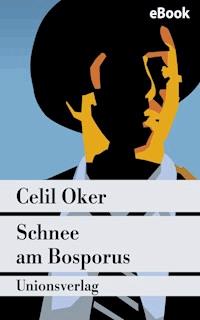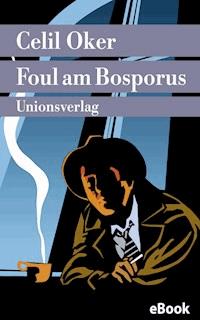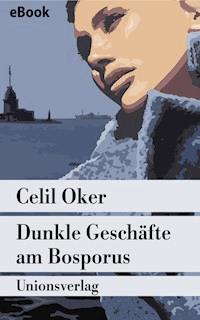9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Remzi Ünal, Istanbuls einsamer Privatdetektiv, nikotinsüchtig und Kaffeeliebhaber, hat schon bessere Zeiten gesehen. Da taucht im Café Kaktüs Dr. Kemal Arsan, der smarte Internist einer Privatklinik, auf. Er vermisst seit vier Tagen seine Freundin, eine Krankenschwester derselben Klinik. Remzi übernimmt und scheint in ein Wespennest zu stechen: Ein junger Arzt liegt tot in der Wohnung einer Pflegerin, ein Kleinkrimineller geht mit dem Skalpell auf Remzi los, eine ominöse Klinik behandelt mit zweifelhaften Methoden rätselhafte Fälle. Die Ermittlung läuft aus dem Ruder. Schöne, kluge Krankenschwestern, lügende Ärzte und eine verwirrte alte Frau halten Remzi im verkehrsverstopften Istanbul auf Trab. Wer gehört hier zu wem, und wer hat was zu verbergen? Remzi Ünal hat als Erster eine Ahnung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 490
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Remzi Ünal, Istanbuls einsamer Privatdetektiv, nikotinsüchtig und Kaffeeliebhaber, hat schon bessere Zeiten gesehen. Da übernimmt er einen neuen Fall und scheint prompt in ein Wespennest zu stechen. Plötzlich halten ihn schöne, kluge Krankenschwestern, lügende Ärzte und eine verwirrte alte Frau im verkehrsverstopften Istanbul ganz schön auf Trab.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Celil Oker (1952-2019) arbeitete als Journalist, Übersetzer und Leiter einer Werbeagentur. Als er in der Zeitung die Ausschreibung las für den ersten türkischen Wettbewerb für Kriminalliteratur, schrieb er Schnee am Bosporus und gewann den ersten Preis.
Zur Webseite von Celil Oker.
Gerhard Meier (*1957) studierte Romanistik und Germanistik. Seit 1986 lebt er bei Lyon, wo er literarische Werke aus dem Französischen und aus dem Türkischen (Hasan Ali Toptas, Orhan Pamuk, Murat Uyurkulak) überträgt. 2014 wurde er mit dem Paul-Celan-Preis ausgezeichnet.
Zur Webseite von Gerhard Meier.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Celil Oker
Lass mich leben, Istanbul
Kriminalroman
Aus dem Türkischen von Gerhard Meier
Ein Fall für Remzi Ünal (5)
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 3 Dokumente
Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel Ateş Etme Istanbul im Verlag Altin Kitaplar, Istanbul.
Die Veröffentlichung wurde gefördert von TEDA, einem Projekt des Ministeriums für Kultur und Tourismus der Republik Türkei.
Originaltitel: Ateş Etme Istanbul
© by Celil Oker 2013
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: hikrcn
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30904-3
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 24.06.2024, 09:22h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
LASS MICH LEBEN, ISTANBUL
1 – Ich wachte auf. Mit Ach und Krach …2 – Mit der U-Bahn war ich schon ewig nicht …3 – Sie wohnte in einem schmalen, mit billigen rosa …4 – Ich zog die letzte Zigarette aus dem Päckchen …5 – Ein Geschrei weckte mich. Draußen stritten sich zwei …6 – Die Sicherheitsleute brauchten wir gar nicht zu fragen …7 – Während ich bewusstlos war, sah ich Bilder aus …8 – Einen Augenblick lang war es ganz still im …9 – Am Taksim-Platz stieg ich in einem dunkelblauen T-Shirt …10 – Während ich die anderthalb Portionen Adana-Kebab vertilgte …11 – Nein, es explodierte nicht etwa am Sockel des …12 – Eine halbe Stunde später ging ich auf der …13 – Eine halbe Stunde später saßen wir auf der …14 – Nein, diesmal nicht. In dem Schlafzimmer, in das …15 – Aus einem Dampfer kamen Scharen von Leuten heraus …16 – Ich schlief wie ein totes Pferd. Eine traumlose …17 – Nach dem Abschiedsfrühstück im Kaktüs, das neben so …18 – Ich stieg gegenüber dem Müllcontainer aus, in den …19 – Ich stieg in dem Haus, in dem jemand …20 – Ich stieg vor dem Kiosk aus, an dem …21 – Als Ismet Günaldi mich erblickte, wandelte sich die …22 – Weder Sinem Akalin noch der Mann mit der …23 – Ganz gegen meine Erwartung schien sich bei den …24 – Je mehr man von jemandem verlangt, umso geringer …25 – »Hast wieder eine ziemliche Show abgezogen, Remzi Ünal« …Mehr über dieses Buch
Über Celil Oker
Celil Oker: »Dies ist ein Wink des Schicksals«
Celil Oker: »Der Detektivroman ist eine Tragödie mit Happy End«
Thomas Wörtche: Universal Ünal
Über Gerhard Meier
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Celil Oker
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema Spannung
Zum Thema Türkei
1
Ich wachte auf. Mit Ach und Krach. Nicht dass ich tief geschlafen hätte, aber in der Nacht, na ja, der Restnacht, war ich mindestens zehn Mal wach geworden. Keine Ahnung, wann ich ins Bett bin und wie viel ich getrunken habe.
Wer alte Freunde verliert, hält sich an noch ältere.
Das Bett war hart, das Kopfkissen ungewohnt, der verrutschte Bettbezug roch. Aber egal, ich war so was von müde. Mir drehte sich ein wenig der Kopf. Ich musste auf der Stelle weg gewesen sein. Keine Spur von dem üblichen Einschlafritual: Was war heute, was wird morgen sein?
An die Motorengeräusche draußen gewöhnt man sich, an das verdammte Hupen nicht. Warnhupen, Protesthupen, Fluchhupen. Von jedem Fluchhupen wurde ich wach. Dann fluchte ich selbst, wühlte den Kopf ins Kissen und schlief bis zum nächsten Hupen.
Eine Plage für sich war das Getrappel hoher Absätze über mir. Wie kriegen die Frauen bloß die Füße in so spitze Schuhe, frage ich mich. Sie lachten, manchmal antwortete ein Mann, dann hörte das Getrappel auf, aber nur kurz. Kinder waren keine zu hören.
Natürlich wurden Türen zugeschlagen und Türen aufgerissen. Ich fluchte und schlief wieder ein. Ich schlief, um den schalen Geschmack des letzten Abends loszuwerden. Um zu vergessen. Um vielleicht etwas Schönes zu träumen. Ich habe aber nichts geträumt oder es schlicht vergessen. An manche Träume erinnert man sich nicht.
Die Frau, die mir erklärt hatte, warum man sich an manche Träume nicht erinnert, verfluchte ich nicht, ganz im Gegenteil.
Schließlich wurde ich ganz wach. Ich stierte die Wände an und die Wände mich. Ich richtete mich ein wenig auf, schob mir das Kopfkissen in den Rücken und lehnte mich an die Wand. Dann streckte ich mich zum Nachtkästchen aus, erwischte die Zigarettenschachtel, fischte die letzte Zigarette heraus. Da hatte einer vor dem Einschlafen doch noch ein wenig mitgedacht, bravo. Ich zündete die Zigarette an und fummelte mir die Schachtel als Aschenbecher zurecht. Die Wirklichkeit war weit weg. Zufrieden tat ich den ersten Zug.
Als zehn Milligramm Teer, null Komma acht Milligramm Nikotin und zehn Milligramm Kohlenmonoxid durch die Lunge in meinen Körper zogen, gestaltete sich die Welt erträglicher. Ein bisschen Schlechtes tut gut, sagte ich mir.
Vier Züge später tauchte aus dem Nichts der Remzi Ünal von gestern Morgen wieder auf. Und der von vorgestern Morgen und von vorvorgestern Morgen. Also der Remzi Ünal, der keinen blassen Schimmer hat, was er mit dem Tag anfangen soll. Mit anderen Worten: Ich.
Ich stand auf.
Die Zigarette drückte ich aus und versenkte sie in dem Grab, das sie sich redlich verdient hatte. Dann zerknüllte ich das Päckchen und warf es in den Papierkorb. Um noch mehr Mensch zu werden, brauchte ich jetzt einen Kaffee.
Draußen wieder Fluchhupen, danach Geschrei. Diesmal fluchte ich nicht, und auch im Obergeschoss war Ruhe.
Ich ging ins Bad und wusch mir ausgiebig das Gesicht. Das Wasser ließ ich laufen, damit es immer kälter wurde. Auch Haare, Nacken und Ellbogen benetzte ich reichlich. Tropfend ging ich zurück ins Zimmer. Ich holte meine Hose aus der Ecke, in die ich sie in der Nacht gefeuert hatte, und zog sie an. Weitere Finessen überlegte ich nicht, sondern ließ mein schwarzes T-Shirt über die Hose hängen.
Die Uhr hatte ich noch an, die Brieftasche lag auf der Kommode. Socken suchte ich mir nicht, sondern schlüpfte direkt in die Espadrilles, die es vor zwei Tagen im Laden an der Ecke im Ausverkauf gegeben hatte.
Im Zimmer war kein großer Spiegel, der mir offen und ehrlich hätte sagen können, wie ich aussah. Ich zuckte mit den Schultern. Du bist eben Remzi Ünal, oder was von Remzi Ünal noch übrig ist.
Ohne mich umzublicken, verließ ich mein Schlupfloch.
Die zwei müden Männer, die im Gang an mir vorüberkamen, grüßte ich nicht. Sie sahen aus, als hätten sie aus der Osttürkei Opferschafe gebracht. Beim Gehen berührten sich ihre Schultern.
Der Läufer auf den Stufen war abgewetzt und verstaubt. Dass er keine Schritte schluckte, wusste ich schon von dem nächtlichen Getrappel. An den Wänden kein einziges Bild.
Der Pförtner, Nachtwächter, Concierge, Kuppler, Drogenbeschaffer und gelegentliche Polizeispitzel Emre Yeğenoğlu guckte auf dem kleinen Fernseher an der Rezeption Discovery Channel. Als er mich kommen hörte, drehte er sich um und sah mich mit geröteten Augen an. »Morgen, Remzi. Früh dran heute.«
Ich sah auf meine Uhr. Menschen, die einer geregelten Tätigkeit nachgingen, waren um diese Zeit längst beim Mittagessen. Ich erwiderte nichts und lächelte nur gequält. Scherzkeks. Ich ließ ihn allein mit der Gazelle und dem hinterherjagenden Jaguar. Kein Frage, für wen Emre war.
Das Hotel lag zwei Straßen unterhalb der Istiklal-Straße; seinen Namen möchte ich schamhaft verschweigen. Ich ging auf die Tür zu, bei der die untere Glasscheibe schon kaputt gewesen war, als ich das Hotel zum ersten Mal betreten hatte. Bei spätabendlicher Heimkehr hatte mich durchaus schon die Lust gepackt, die Scheibe mit einem kräftigen Tritt vollends zu zerdeppern, aber getan hatte ich es noch nicht.
Draußen war der schönste Istanbuler Herbst zugange, den man sich nur vorstellen konnte. Zwischen zwei Häusern sah ich ein paar Wölkchen dahinziehen, ansonsten strahlend blauer Himmel.
Als Erstes kaufte ich mir am nächsten Kiosk Zigaretten. Geld hatte ich ja. Von den rot-weißen Päckchen, die vorne und hinten mit Warnungen zugepflastert waren, konnte ich mir eine ganze Menge kaufen. Und wenn die zu Ende waren, wieder welche. Und wieder und wieder. Anstatt an Einsamkeit zu krepieren, krepierte ich doch lieber mit gnädiger Erlaubnis der türkischen Tabakaufsichtsbehörde.
Gemächlich ging ich die İmam-Adnan-Straße hoch, auf das Café Kaktüs zu. Im unteren Teil der Straße herrschte elende Langeweile, und weiter oben war es keinen Deut besser, denn wo noch vor einem Monat die Leute draußen an Tischen gesessen und geraucht hatten, war es nun gähnend leer.
Ich betrat das ebenfalls gähnend leere Kaktüs und bestellte bei dem langen Kellner einen Kaffee. Bis der kam, schon mal eine Zigarette? Aber nein, ging ja nicht mehr.
Ich schaute zu den Passanten hinaus. Zum Lesen holte ich mir nichts. Was auf der Welt so passierte, das passierte eben, ob ich nun davon wusste oder nicht. Wenn ich davon was erfuhr, pfiff ich ja doch bloß durch die Zähne, und davon hatte die Welt auch nichts.
Mein Kaffee kam. Wie ein lange erwarteter Freund. Mit einem kräftigen Schluck begann ich unser Zwiegespräch. Er war in Form. Heiß, aufweckend, ehrlich. Ohne ein einziges Wort vermittelte er mir, dass er immer an meiner Seite sein würde, sobald ich ihn nur vermisste. Innigst erwiderte ich seine Hingabe. Unser Gespräch vertiefte sich. Alles in mir öffnete sich. Die draußen vorbeigehenden Frauen kamen mir immer schöner vor, die Männer immer intelligenter.
Noch bevor ich die Hälfte ausgetrunken hatte, kam ein junger Mann durch die Tür und sah sich um. Er war blond und trug eine Brille und ein petrolblaues Hemd. Bestimmt hat seine Freundin sich verspätet, dachte ich mir und wandte mich wieder meinem warmherzigen Freund zu.
Der junge Mann ließ seinen Blick schweifen, als wollte er sich einen Platz aussuchen, dann blieb der Blick an mir hängen. Sogleich setzte der Mann den leicht übertriebenen Ausdruck von jemandem auf, der seinen Augen nicht traut.
Ich kümmerte mich nicht weiter um ihn.
Aus dem Augenwinkel merkte ich aber doch, dass er mich noch immer ansah. Er wischte sich die Hand an seiner weiten Jeans ab. Er muss mich verwechselt haben, dachte ich. Es gibt reichlich Männer auf der Welt, die mit großem Ernst vor ihrem Kaffee sitzen und sich nach einer Zigarette sehnen. Und diese Menschen ähneln einander. Nicht ganz, aber doch irgendwie. Ich hoffte, er werde seinen Irrtum einsehen, sich hinsetzen und auf seine Freundin warten.
Aber nichts dergleichen. Er setzte sich überhaupt nicht hin. Er fuhr sich mit der Hand durch die Haare und wischte sich die Hand wieder an der Hose ab. Dann sah er durch die offene Tür hinaus, als könnte ihm da jemand bei seiner Entscheidung behilflich sein. Schließlich beschloss er, die Sache selbst in die Hand zu nehmen, und ging zwei Schritte auf mich zu.
Ich blickte auf und merkte sofort, dass er mich nicht nur um Feuer bitten würde.
Er beugte sich zu mir vor. »Sind Sie Remzi Ünal?«
Ich hatte einen Mafiaspruch parat, den ich schon lange mal loswerden wollte. »Wer will das wissen?« Keine Ahnung, ob er meine Anspielung kapierte.
»Jemand, der Ihre Hilfe braucht«, sagte er.
Ich sah ihm ins Gesicht. Von seinen zusammengepressten Lippen ließ ich mich nicht beeindrucken. »Ich bin nicht in der Lage, jemandem zu helfen«, sagte ich und versuchte, mich wieder auf meinen Kaffee zu konzentrieren. Das ließ er aber nicht zu. Er zog einen Stuhl heran und setzte sich mir gegenüber. Ein bisschen schief saß er da. Seine blonden Haare hatte er etwas lang werden lassen. Aber nicht allzu lang. Die blauen Augen wirkten hinter der Hornbrille klein.
»Es heißt, Sie seien der tüchtigste Privatdetektiv von ganz Istanbul.«
In der Hoffnung, der lange Kellner mochte das nicht gehört haben, blickte ich zur Bar hinüber. »Ach, woher«, erwiderte ich leise. »Ich hatte da ein, zwei Fälle. Und das ist auch schon eine Weile her.« Von wem er über meine berufliche Vergangenheit wusste, interessierte mich nicht. Ich sah auf meinen Kaffee, der mittlerweile kalt sein musste. Und wieder zu dem Mann. Er sollte mich in Ruhe lassen. Doch er lächelte, als würde er gleich zum nächsten Angriff ansetzen.
Erst zögerte er noch, dann redete er ganz schnell, wie um sich zu überwinden. »Wenn Sie mir zuhören, kann ich auch Ihnen helfen. Und zwar sofort.«
Sofort konnte er mir nur dadurch helfen, dass er abzischte. Irgendwie merkte ich aber, dass ich ihm das nicht sagen würde. Und das wiederum merkte er.
»Na, was sagen Sie?«
Ich fühlte mich wie bei einer gewieften Wahrsagerin. Beziehungsweise so, wie meine Kunden sich wohl manchmal bei mir fühlten. Früher mal. »Dann helfen Sie mir doch«, sagte ich. Und gestand mir damit selbst ein, dass ich seit einer Weile hilfsbedürftig war. Da, wo ich es nötig hatte, würde er mir zwar nicht helfen können, doch das war wieder ein anderes Thema.
Lächelnd setzte er sich auf seinem Stuhl zurecht. »Sie sollten mal Ihr Cholesterin messen lassen«, sagte er. »Könnte ziemlich hoch sein.«
Ich merkte zwar, dass ich ihm in die Falle ging, fragte aber trotzdem: »Woher wollen Sie das wissen?«
»Sie haben um die Iris herum so einen weißen Ring, ziemlich deutlich. Das lässt auf einen hohen Cholesterinspiegel schließen.«
Ich fühlte mich nicht bemüßigt, ihm zu erläutern, dass ich mich in letzter Zeit vor allem von Adana- und Urfa-Kebab ernährte, und, wenn ich schlecht drauf war, von Hamburgern und Fritten. Und dass ich mein Aikido-Training sträflich vernachlässigte.
»Und was soll ich tun?«
»Erst das Cholesterin messen lassen. Und dann tun, was der Arzt sagt.«
»Das meine ich nicht. Was ich für einen Arzt wie Sie tun soll?«
Breit lächelnd lehnte er sich zurück. Dann sah er sich um, ob uns jemand beobachtete. Es waren aber nur wir beide in dem kleinen Café. »Werden Sie mir zuhören?«, fragte er dann.
Das war genau die Nummer, die ich oft bei meinen Kunden abzog, und sie funktionierte immer. Ich verschwieg ihm das. Die Genugtuung gönnte ich ihm nicht. Ich nickte.
»Sie sollen meine Freundin finden«, sagte er.
Fast hätte ich geantwortet, super Idee, ich will die meine auch finden. Finden können hätte ich sie durchaus, nur wusste ich nicht, ob sie das auch wollte. Ich hatte mich zwar geändert, aber nicht so, wie es ihr gepasst hätte.
Ich musste mich sammeln, und dazu brauchte ich noch einen Kaffee. Ich sah zur Bar, wo der Kellner sich gerade zu mir umdrehte, als hätte er auf mich gewartet, und deutete auf meine Tasse. Dann sah ich mein Gegenüber an, ob der auch einen wollte.
»Ich hatte ein Bier bestellt«, sagte er.
Genug der Geselligkeit. Ich sah dem jungen Mann ins Gesicht.
»Sie sollen meine Freundin finden«, wiederholte er.
»Das habe ich kapiert. Und woher wollen Sie wissen, dass ich Sie nicht zum Teufel jage?«
»Ich weiß es eben.«
Ich beschloss einfach, ihm zu glauben. »Seit wann ist sie verschwunden?«
»Seit vier Tagen. Sie ist nicht zur Arbeit gekommen, und sie geht nicht ans Telefon. Ich bin zu ihrer Wohnung, da war sie auch nicht.«
»Freunde, Kollegen?«
»Die kann ich nicht fragen. Also nicht richtig.«
»Warum?«
»An meinem ersten Arbeitstag im Krankenhaus hat mein Chef mir gleich klargemacht, dass sich Ärzte nicht mit Krankenschwestern einlassen sollen, aus Prinzip nicht. Ich habe ein paar Mal rein als Kollege gefragt, aber niemand wusste Bescheid. Und weiter kann ich nicht gehen.«
»Also was jetzt, kümmern Sie sich um Prinzipien oder nicht?«
»Na ja …« Er wusste nicht recht, was an Berufsgeheimnissen er mir offenbaren sollte. »In Privatkliniken nimmt man es heutzutage mit den Prinzipien nicht mehr so genau.«
»Aha.«
Der Kellner brachte lächelnd das Bier und den Kaffee. Ich lächelte nicht zurück und nahm sofort einen großen Schluck, solange der Kaffee noch heiß war.
»Sonst haben Sie keine Fragen?«, wunderte sich der Arzt.
Ein weiterer Schluck Kaffee rann den Kehlkopf hinunter. Das tat gut. Eigentlich brauchte ich bis zum Abend nichts mehr zu essen. Und dann ein Adana-Kebab. Oder Leber. Und Raki. »Ich habe unseren Vertrag erfüllt«, sagte ich. »Als Gegenleistung für den tückischen weißen Ring um meine Iris, der da nicht sein sollte, habe ich Ihnen zugehört. Ob ich den Auftrag annehme, weiß ich noch nicht. Nehmen Sie das bitte nicht persönlich, ich weiß überhaupt nicht, ob ich noch Aufträge annehmen soll.«
Der Arzt leerte zügig das halbe Bierglas und wischte sich mit einer Serviette die Mundwinkel ab. Dann hob er das Glas, als ob er den Rest auch gleich hinunterschütten wollte. Er hielt aber inne, sah kurz auf die Wand hinter mir und verzog den Mund.
»Sind Sie verheiratet?«, fragte er. Seine Stimme war nicht mehr so selbstsicher wie zuvor. Mir war, als schuldete ich ihm eine Antwort.
»Nein.«
»Sind Sie mit einer Frau zusammen?«, setzte er ermutigt fort.
»Ich war es.«
»Was ist geschehen?«
Nun reichte es aber. »Was geht Sie das an? Falls Sie als vierte Überzeugungsmethode auf die Tränendrüse drücken wollen, das zieht bei mir nicht. Als ich das letzte Mal darauf reingefallen bin, ist es für mich gar nicht gut ausgegangen.«
»Sie sind aber meine letzte Rettung«, sagte der Arzt mit zitternder Lippe.
»Wenn Sie zu weinen anfangen, gehe ich.«
»Ich werde nicht weinen. Ich gehe lieber selbst. Verzeihen Sie, dass ich Sie belästigt habe. Mein Bier ist schon bezahlt.«
Er stand auf, wischte sich wieder die Hand an der Hose ab und zuckte mit den Schultern. Nach einer knappen Abschiedsgeste ging er schnell hinaus und verschwand die Straße hinunter. Ich starrte auf die leere Tür. Er hat hängende Schultern, dachte ich. Bei großen Menschen sieht das noch trauriger aus.
Herrgott noch mal. In meinem gar nicht so kurzen Berufsleben hatte ich junge Mädchen gesehen, die mich tränenden Auges auf die Wange geküsst hatten. Ihre Gesichter glänzten, weil ich sie aus irgendeiner misslichen Lage gerettet hatte, und ihre Blicke verrieten mir, dass sie mich niemals vergessen würden.
Mir fiel die Aikido-Anfängerin ein, die ein paar Stunden, nachdem ich ihre Bitte um Hilfe abgelehnt hatte, ermordet worden war. Ihr letzter Blick, als sie aus meinem Auto stieg … Und ob ich wollte oder nicht, musste ich auch an Yildiz Turanli denken.
Du wirst alt, Remzi Ünal, sagte ich zu mir. Ich stand auf, verließ das Lokal und ging die Straße hinunter. Der Kellner würde schon wissen, dass ich nicht die Zeche prellen wollte. Der Arzt war auf der Höhe einer Bar, in der wir mal den Geburtstag eines ermordeten Mädchens gefeiert hatten. Die Bar selbst gab es längst nicht mehr. Ein Tattoo-Studio war da jetzt. Ich legte einen Zahn zu, bis ich in Rufweite war.
»Herr Doktor, warten Sie!« Bei dem Wort Doktor drehten sich ein paar Leute zu mir um. Nur der Doktor selbst nicht. »Herr Doktor, so warten Sie doch, reden wir noch mal.« War das möglich, dass er mich nicht hörte? Ich ging noch schneller. »Wenn Sie schon fündig geworden sind, kehre ich wieder um«, rief ich.
Das musste er nun doch gehört haben. Er blieb stehen und drehte sich um. Als er mich erblickte, ging ein Lächeln über sein Gesicht. Fragend hob er die Arme.
Ich kam keuchend bei ihm an. Ja, du wirst wirklich alt.
»Wo wollen Sie denn so schnell hin?«, fragte ich.
Er sah mich wortlos an.
»Kommen Sie, reden wir noch mal«, fuhr ich fort. »Vielleicht lässt sich ja was machen.«
Er nickte und ging mit gesenktem Kopf neben mir her. Bis wir beim Kaktüs ankamen, redeten wir kein Wort. Meine halb leere Tasse und das Bierglas standen noch auf dem Tisch, und wir setzten uns wieder. Der Kellner sah uns an.
»Was möchten Sie?«, fragte ich den Doktor.
»Dass Sie meine Freundin finden«, erwiderte er verschmitzt. Ich bestellte noch einen Kaffee. »Jetzt erzählen Sie mal«, sagte ich.
»Was?«
»Alles, von Anfang an.«
»Dann nehmen Sie den Auftrag also an?«
»Weiß ich noch nicht. Erzählen Sie erst mal. Wer Sie sind, wer Ihre Freundin ist, und so weiter. So wie Sie es der Polizei erzählen würden.«
»Erst will ich wissen, ob Sie den Auftrag annehmen. Ich will nicht noch mal enttäuscht werden. Danach erzähle ich Ihnen, was Sie wollen.«
Ich schüttelte den Kopf. Nein, das mit dem Altwerden war tatsächlich keine gute Idee. Aber jetzt gab es kein Zurück mehr. »Na gut, ich nehme ihn an. Aber nicht dass Sie meinen, ich unterschreibe was. Ich tue meine Arbeit, wie es mir passt. Wenn was schiefgeht, versuche ich zuerst, meinen eigenen Arsch zu retten. Aber der, laut dem ich der beste Privatdetektiv von Istanbul bin, hat Ihnen das wohl schon gesagt.«
Er nickte.
»Was Sie mir sagen, erzähle ich nach Möglichkeit nicht weiter. Und was andere mir sagen, erfahren Sie nicht. Fotografieren, Telefonabhören und solche Scherze gibts bei mir nicht. Auch keine Quittungen, höchstens Ergebnisse.«
Wieder nickte er.
»Und ich muss sicher sein, dass es für meine Arbeit auch eine Gegenleistung gibt.«
Er sah mich fragend an und erwartete, dass ich ihm einen Preis nannte. Das konnte er haben. »Wie viel können Sie zahlen?«, fragte ich.
»Bitte?«
»Wie – viel – können – Sie – zahlen?«
Er sah so verdutzt drein wie ein Patient, der das Diplom bei seinem Arzt an der Wand als Fälschung erkennt. »Wie meinen Sie das?«, fragte er.
»Ich habe Ihnen ja gesagt, dass ich schon lange keine Aufträge mehr annehme. Ich bin über die Tarife für meine Art von Dienstleistungen nicht mehr ganz auf dem Laufenden. Also, wie viel können Sie zahlen?«
Er fuhr sich durch die gut geschnittenen Haare, die wie in einer Shampoo-Werbung quasi in Zeitlupe wieder zurückfielen. Ich wartete.
»Äh, ich weiß nicht so recht. Kann ich Ihnen das später sagen?«
»Nein. Jetzt.«
Er wiegte den Kopf hin und her und verzog das Gesicht, als gefiele ihm selber nicht, was er gleich sagen würde. »Rechnen Sie einfach zu dem, was Sie zuletzt gekriegt haben, zehn Prozent Inflation dazu.«
Ich musste innerlich schmunzeln. Naiv war der Kerl nicht. Ich stellte eine kleine Rechnung auf und nannte dann eine Zahl. Mit der gleichgültigen Miene eines Gebrauchtwagenverkäufers.
»Einverstanden«, sagte er, ohne zu zögern.
»Also gut«, erwiderte ich zufrieden.
Der Kellner brachte einen frischen Kaffee, und ich nahm einen Schluck, und gleich noch einen. Nun war ich bereit, ihm zuzuhören.
»Ich heiße Kemal«, sagte er, als wäre das schon etwas, das man nicht so leicht zugibt. »Kemal Arsan. Wie Sie schon wissen, bin ich Arzt, Internist, in einer Privatklinik in Mecidiyeköy. Und die erwähnte Dame ist dort Krankenschwester.«
»Wie heißt sie?«
»Begüm Kalyon.«
»Weiter!« Noch ein Schluck Kaffee.
»Na ja, wir sind seit etwa einem halben Jahr zusammen, aber das haben wir geheim gehalten, wie schon gesagt.«
»Mich geht es ja nichts an, aber warum hat sich nicht einer von Ihnen eine andere Stelle gesucht?«
Er sah mich an, als sei ich ein völliger Dummkopf, was ich vielleicht ja auch bin. Ich holte eine Zigarette aus der Tasche und hielt sie mir an die Nase. »Glauben Sie etwa, heutzutage findet man so leicht eine andere Arbeit? Nein, auch als Arzt nicht. Und für eine Krankenschwester ist es noch schwieriger. Wir hätten höchstens heiraten können, dann sagt keiner mehr was.«
Ich blickte ihn vielsagend an, und er begriff auch gleich. »Das hatten wir auch schon ins Auge gefasst. Für irgendwann später. Aber jetzt ist sie verschwunden, seit vier Tagen schon!« Ratlos breitete er die Arme aus.
»Und sie meldet sich nicht am Telefon und ist auch nicht zu Hause?«
»Genau.«
In höchst bedeutsamer Manier ließ ich die Hand mit der Zigarette sinken und führte mit der anderen Hand die Kaffeetasse zum Mund. Trank aber noch nicht. »Fällt Ihnen nicht irgendein Grund ein, warum sie verschwunden sein könnte?«
»Nein. Es schien alles in Ordnung zu sein. Gerade das beunruhigt mich ja so.«
»Wissen Sie, ob sie Freunde hatte, abgesehen von ihren Kollegen?« Ich stellte die Tasse ab und hielt mir wieder die Zigarette an die Nase. Obwohl sie nicht angezündet war, strömte mir ein Duft in die Nase, der irgendwie milder, harmloser, schlichter war als sonst.
»Ich kenne nur eine Freundin von ihr, auch eine Krankenschwester. Sie arbeitet als Selbstständige, macht Hausbesuche und so. Ist gut im Geschäft.«
»Sind sie eng befreundet? Und wie heißt sie?«
»Firdevs. Den Nachnamen weiß ich nicht.«
»Und die Telefonnummer?«
»Nein, nur wo sie wohnt, weil wir ein, zwei Mal zusammen bei ihr waren. Wie gut sie befreundet sind, weiß ich nicht, wir haben damals nur herumgeflachst.«
»Verstehe.« Nun steckte ich die Zigarette in den Mund und feuchtete sie sorgfältig an.
Irgendwie wussten wir plötzlich nicht, wie wir das Gespräch fortsetzen sollten. Sollte ich ihn fragen oder nicht? Ich beschloss, es zu tun. Ich nahm ein Streichholz aus der Schachtel, und bevor ich es an der Reibfläche ansetzte, fragte ich: »Wenn Sie Ihre Freundin wiederfinden, was sagen Sie dann als Erstes zu ihr?«
»Ist das nicht eine recht persönliche Frage?«
»Nein, es ist Teil der Ermittlungen«, versetzte ich mit möglichst ernster Miene.
Stimmte ja sogar.
»Ich weiß nicht. Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich werde einfach sagen, was mir in den Sinn kommt.«
»Nun gut.« Ich riss das Streichholz an. Was mir nun in die Nase stieg, roch eher nach flüchtigem, sich verziehendem Pulverdampf.
»Zufrieden mit meiner Antwort?«
»Höchst zufrieden«, sagte ich und wedelte das Streichholz aus.
»Und was geschieht jetzt?«
»Jetzt werde ich Ihre Freundin finden. Und Sie denken einstweilen nach, was Sie ihr dann sagen werden.«
»Das ist alles? Sonst brauchen Sie nichts?«
»Das ist alles. Bis auf ein paar Adressen und Telefonnummern natürlich.«
Zehn Minuten später saß ich an die Wand gelehnt da und rauchte. Wenn die Besitzer des Kaktüs sich mit der Stadtverwaltung herumstritten, war das ihr Problem. Ich jedenfalls war mit ihrem Kaffee zufrieden, und der Rest ging mich nichts an. Kemal Arsan hatte verwundert zur Kenntnis genommen, dass ich mir von all den Straßennamen und Telefonnummern, die er mir aufzählte, rein gar nichts notierte, aber ich hörte ihm einfach weiter zu, ohne eine Erklärung abzugeben. Dann war er aufgestanden und hinausgegangen, diesmal in Richtung Istiklal-Straße.
Tja, ich hatte also wieder einen Job. Ich dachte erst mal gar nicht darüber nach, wie ich die Sache anpacken sollte. Auch nicht darüber, warum ich den Auftrag überhaupt angenommen hatte. Das nämlich wusste ich schon. Das Geld war es nicht. Ich fragte mich vielmehr, warum ich dem eigentlichen Motiv, das mich wieder auf die Straße und zu Leuten hintrieb, die auf meine Fragen falsche Antworten gaben, so wenig Widerstand entgegensetzte. Und warum ich Kunden, die mir nicht die ganze Wahrheit erzählten, das immer wieder durchgehen ließ. Wir sind eben alle nur Menschen. Selbst alle Remzi Ünals dieser Welt.
Ich warf den Zigarettenstummel auf den Boden, ohne ihn auszutreten. Dann ging ich hinein und zahlte. Wohin ich jetzt musste, war mir klar. Den Friseur zwei Straßen weiter würde ich garantiert finden.
Ich fand ihn auch, aber mit Mühe. Die Gegend hatte sich mächtig verändert, doch der kleine Laden schien wild entschlossen, sich dieser Veränderung entgegenzustemmen. Der Friseur mit seinem altmodischen Schnurrbart rasierte gerade einen Mann mit Dreifachkinn. Wann seine Schürze den letzten Waschgang erlebt hatte, war nicht zu ermitteln, was mich aber keineswegs störte. Hinter den beiden alten Friseurstühlen stand eine Ledercouch an der Wand, bestimmt zwei Generationen älter als die Couch in meinem schäbigen Hotel. In einer Ecke stand auf einem Campingkocher ein Aluminiumtopf zweifelhaften Inhalts.
»Haben Sie noch lange zu tun, Chef?«
Der Friseur musterte mich von oben bis unten, dann ging sein Blick wieder hinauf und blieb an meinem Bart hängen, der längst überfällig war. »Bin gleich fertig«, erwiderte er. »Nehmen Sie doch schon mal Platz.«
Ich setzte mich auf die Couch und versank regelrecht darin, so sehr gaben die Federn nach. Der Kunde mit dem Dreifachkinn hatte eine Glatze, aber die hatte wohl nicht der Friseur ihm verpasst, sondern der Zahn der Zeit. Im Spiegel sah ich, dass der Mann mit geschlossenen Augen dasaß. Seine Lider waren nicht weniger eindrucksvoll als das Kinn. Die Oberlippe schmückte ein frisch zurechtgestutzter Janitscharenschnurrbart.
»Einen Tee, der Herr?«
»Nein danke, habe gerade gefrühstückt.«
»Unser Hüso macht aber guten Tee.«
»Danke, geht schon.«
Er schüttelte den Kopf, als hätte ich mir eine einmalige Gelegenheit entgehen lassen. Ich griff zu einer der Zeitungen auf einem Hocker. Es war so ein Revolverblatt, wie es bei Friseuren gern herumliegt. Das Weltgeschehen drehte sich von der ersten bis zur letzten Seite um halb nackte Frauen. Abrüstungsgespräche wurden durch eine Sexbombe illustriert, das Bevölkerungswachstum anhand einer sich im Bett räkelnden und gerüchteweise schwangeren Sängerin, und über die Frage, wie modern die Türkei nun eigentlich sei, klärten Mädchen in Shorts und Kopftuch auf. Ich legte die Zeitung zurück.
Das Dreifachkinn stand auf und schaute sich lang im Spiegel an. Wohlgefällig. »Bitte schön«, sagte der Friseur und drehte mir den Stuhl zu.
Ich setzte mich, stellte die Füße auf die Stütze und lehnte mich zurück. Der Spiegel vor mir war größer als der größte LED-Bildschirm, den ich je gesehen hatte. Stellenweise begann er blind zu werden, doch wie es um einen stand, zeigte er noch zur Genüge: Augen, die viel gesehen, aber auch viel vergessen hatten; Ohren, die nicht die Hälfte von dem glaubten, was sie hörten; ein Mund, der nicht recht wusste, ob er zu dem, was er sagte, auch stehen sollte. Dazu ein Kinn, das nach der Bezeichnung »energisch« geradezu schrie (womit man aber völlig danebenlag), und eine Nase, die es hart ankam, dass ein paar Schläge, die man ihr versetzt hatte, noch immer ungerächt waren. In einem Wort: Remzi Ünal.
Remzi Ünal, der bei der Luftwaffe gekündigt hatte, bei Turkish Airlines rausgeflogen war, sich selbst bei einer achtklassigen Chartergesellschaft, die ein anständiger Frequent Flyer nicht mal dem Namen nach kannte, nicht hatte halten können, und der sogar die Cessna in seinem MS Flight Simulator seit Monaten nicht angerührt hatte. Der ehemalige Kapitän, ehemalige angehende Schwiegersohn und nunmehrige Privatdetektiv Remzi Ünal …
Der Friseur schnürte mir einen weißen Umhang ganz eng am Hals fest und begann, mich mit einem vorsintflutlichen Pinsel einzuseifen, sodass Remzi Ünal allmählich hinter dem Rasierschaum verschwand. Sollte er ruhig ein bisschen wegbleiben. Dann konnte ich mich Begüm Kalyon widmen, der Freundin von Kemal Arsan. Ich würde von Tür zu Tür stapfen und mir auf dämliche Fragen dämliche Antworten anhören. Wem meine Fragen nicht passten, der würde die Augenbrauen zusammenziehen. Und mancher die Faust ballen. So war das nun mal.
Schließlich kam ich zu dem Schluss, dass solch blinde Geschäftigkeit immer noch ehrenvoller war, als nur in Selbstmitleid zu baden. Eine wohltuende Einsicht.
Ich tat es dem Kunden vor mir nach und schloss die Augen, denn so fühlt man sich vor einem Spiegel gleich viel besser. Mit tiefen Atemzügen half ich diesem Gefühl nach. Ganz tief sog ich die Istanbuler Luft ein, die sich durch die offene Tür hereinmühte. Ich beförderte sie durch meinen zusammengeschnürten Hals bis weit nach unten ins Zwerchfell, und was sie noch an Sauerstoff in sich haben mochte, ließ sie von meinem Hara in die Adern, von den Adern in die Haargefäße und von dort in die Zellen fließen. Bald wurde mir leicht schwindlig, aber ich machte weiter. Ich spürte nicht einmal, ob der Friseur mir mit seinem Rasiermesser im Gesicht herumfuhr oder nicht. Nur dass sich mir beim Einatmen der Nabel spannte, merkte ich, und dass die Spannung beim Ausatmen wieder nachließ.
So war der Friseur mit meinem Bart beschäftigt, und ich mit meinem sich wölbenden und wieder zusammenziehenden Körper. Dann löste der Friseur die Schnur um meinen Hals, zog den Umhang fort und trat einen Schritt zurück.
»So, das hätten wir.«
»Danke«, erwiderte ich und fuhr mir dabei mit der Hand übers Kinn, wie man es nach einer solchen Rasur nun mal tut.
»Kann ich mal Ihr Telefon benützen?«, fragte ich dann. »Ortsgespräch.«
»Ich bitte Sie, selbstverständlich. Meinetwegen können Sie auch Präsident Obama anrufen.«
Er zeigte mir das Telefon, und ich wählte die Handynummer von Begüm Kalyon. Der Friseur zählte aus dem Augenwinkel mit, wie viele Tasten ich drückte, und merkte so, dass es sich um eine Handynummer handelte. Er kniff ein wenig die Augen zu, aber das überging ich.
Ich ließ es ausgiebig läuten, aber niemand hob ab.
Etwas anderes hatte ich nicht erwartet, aber einen Versuch war es wert gewesen. Für den Friseur deutlich sichtbar hängte ich auf und wählte danach die Festnetznummer der Frau. Mit dem gleichen Resultat.
Ich zückte einen Schein, mit dem neben der Rasur auch ein Anruf auf einem Handy großzügig bezahlt gewesen wäre, und bedeutete dem Friseur, dass er mir nichts herauszugeben brauchte. »Danke«, sagte er. »Nur, wenn ich mir erlauben darf …«
»Ja, was denn?«
»So wie Sie atmen, das gefällt mir gar nicht. Sie sollten sich mal abhorchen lassen. Nicht, dass Sie was mit dem Herz haben.«
Ich lächelte. »Keine Sorge, ich bin gerade zu einem Check-up unterwegs. Mal sehen, was rauskommt.« Im sicheren Vertrauen, dass sich etwas ganz anderes ergeben würde als eine Gefäßverengung, verließ ich den Laden. Ja, so ein umfassender Check-up konnte schon nicht schaden.
Ich, Remzi Ünal, war auf dem Weg zur Arbeit.
2
Mit der U-Bahn war ich schon ewig nicht mehr gefahren. Ob mein Auto noch funktionierte, war mir egal, ich ging ja kaum noch raus. Es stand noch immer, inzwischen wohl mit hochgestellten Scheibenwischern, vor der Wohnung, in der ich nach dem Umzug gerade mal eine Nacht hatte schlafen können.
Am Taksim-Platz ging ich in die kurzgeratene Istanbuler U-Bahn hinunter und ließ zwei Jetons aus dem Automaten. Um mich herum alle in hochwichtiger Angelegenheit unterwegs.
Am Ende des Laufbands machte ich einen Bogen um einen Geiger. Was er spielte, war beim besten Willen nicht zu erkennen. Das bezeugte auch der leere Geigenkasten vor ihm.
Mit gesenktem Kopf überließ ich mich dem Menschenstrom bis in den U-Bahn-Wagen hinein. Obwohl noch Plätze frei waren, blieb ich neben der Tür stehen und setzte die beim Friseur begonnenen Atemübungen fort, zumindest die unauffälligeren. Nicht der ideale Ort, um sich die Lungen mit frischer Luft zu füllen, aber das geschah mir nur recht.
Ich war nämlich wütend auf mich.
Herumkokettieren, ob ich einen Auftrag annehmen sollte oder nicht, das konnte ich, aber Kemal Arsan zu fragen, ob er von seiner Freundin ein Foto dabeihatte, war mir nicht in den Sinn gekommen. Alt wurde ich. Alt. Oder, schlimmer noch, beim Faulenzen war mein Riecher verkümmert. Falls ich je einen gehabt hatte. Und da war noch was Schlimmeres.
Der Mann nämlich suchte seine Freundin, die seit vier Tagen verschwunden war. Ich aber suchte seit Wochen eine andere Frau gerade nicht. Und auch sie, mit der ich schon fast vor dem Standesamt Beşiktaş gestanden hätte, suchte mich nicht. Und wenn sie mich doch suchte, hätte sie mich dann finden können? Wohl kaum. Leute zu finden, war meine Aufgabe. Von ihr hätte ich nicht mal ein Foto gebraucht. Ihr Aussehen, ihre ganzen Koordinaten hatten sich tief in mich eingegraben.
Und ein Foto hatte ich tatsächlich keines von ihr.
Ich atmete weiter tief ein und tief aus. So wie früher. Die von Millionen U-Bahn-Gästen infizierte Luft fuhr in die tiefsten Winkel meiner Lunge und strömte wieder hinaus. Istanbul in mich hinein, Istanbul aus mir heraus. Das unter meinen Füßen sich regende Istanbul brachte in den äußersten Verästelungen meiner Gefäße die eingeschlafenen Zellen wieder auf Trab.
Die U-Bahn fuhr und hielt. Leute stiegen ein und aus. Ich atmete weiter.
Mir gegenüber saß eine junge Frau, Studentin wohl, und sah mich an. Sie hatte Bücher auf dem Schoß, die sie mit den Händen bedeckte, als sollte ich die Titel nicht lesen. Ich lächelte sie an. Sie lächelte nicht zurück. Egal.
Ich atmete. Jetzt hasste ich mich schon weniger. Für das, was ich getan, und das, was ich nicht getan hatte. Und für das, was ich noch tun würde. Und das schließlich, was Leute mir antun würden. Belügen und betrügen würden sie mich. Mich anschnauzen. Weinen. Mir einen Kuss auf die Wange drücken.
Mein Gott, ich würde vielleicht das ganze Leben eines Menschen verändern!
Seis drum. So war ich nun mal. Ein Privatdetektiv, der auf eigene Faust durch die Straßen von Istanbul zog. Mich kümmerten weder Gerechtigkeit noch Strafe. Ich wollte lediglich nichts tun, wofür ich mich später schämen würde. Oder was den Göttern Schande machte, die seit vielen Jahren in den Metropolen der Welt über meine Kollegen schützend ihre Hand hielten.
Ich bin Remzi Ünal. Mal wirr im Kopf und mal klar. Mal weiß ich, was ich will, und mal nicht. Bin wieder in Action. Wieder hinter jemand her. Atme wieder.
Die U-Bahn-Türen gingen auf und zu. Menschen stiegen ein und aus. Wann kam endlich das verdammte Mecidiyeköy?
Als ich in Mecidiyeköy ans Tageslicht kam, rauchte ich erst mal eine.
Es ging dort zu wie eh und je. Brav stellte ich mich an die Fußgängerampel, und auf behördliche Erlaubnis hin gingen wir alle gemeinsam los.
An einem Kiosk sprach ich den unrasierten Besitzer an. »Könnten Sie mir bitte sagen, wo die Mevlut-Pehlivan-Straße ist?« Als reute ihn schon, mich eines Blickes gewürdigt zu haben, nickte er nur kurz in Richtung Straße. »Zweite links.«
Ich beschleunigte das Tempo. Waypoint 1 dachte ich mir. Hier waren schon weniger Leute unterwegs. Und da sah ich auch schon Waypoint 2 und nahm ihn aus fünfzig Metern Entfernung in Augenschein.
Das Manhattan Medical war so groß, dass es den Ringer, von dem die Straße ihren Namen hatte, locker geschultert hätte. Aus einem breiten zweistöckigen Gebäude ragte ein etwa siebengeschossiger Turm hervor. Die Erdgeschossfassade war aus weiß der Teufel woher importiertem hellgrünem Marmor. Zur Rechten und zur Linken des Turms war in unschicklich großen Lettern das Emblem des Krankenhauses aus zwei übereinanderstehenden M angebracht.
Ich ging auf die automatische Schiebetür zu, auf deren Flügeln natürlich auch jeweils ein riesiges M prangte. Die Tür glitt lautlos auf, und ich sah direkt mir gegenüber den Empfang, an dem vier junge Frauen in hellrosa Einheitskleidung vor ihren Computern saßen. Rechts davon war ein Café, das sich mit einem Starbucks hätte messen können, daneben ein Kiosk, und wer partout kein Geld ausgeben wollte, konnte dahinter Platz nehmen, wo es aussah wie in der Wartehalle eines Flughafens. Linker Hand vier Aufzüge, neben denen aufgeführt stand, wo man sich für welche Krankheit Heilung erhoffen durfte.
Ich steuerte den Empfang an und passte dabei höllisch auf, auf dem glatten Marmorboden nicht auszurutschen. Dann setzte ich eine mittelprächtig besorgte Miene auf, und von den beiden Frauen, vor denen gerade niemand wartete, entschied ich mich für die Blonde. Mit einem künstlichen Lächeln versuchte ich, sie auf mich aufmerksam zu machen. Auf der Brusttasche trug sie ein Namensschild: Sultan Karakum.
Sie klimperte noch kurz auf der Tastatur, dann wandte sie sich mir zu, nicht weniger künstlich lächelnd als ich. »Herzlich willkommen.«
»Na ja, gar so willkommen ist mir die Sache nicht …«
Ihr Blick verriet, dass sie gegen jegliche Anmache durch Patienten oder deren Angehörige geschult war. Sie intensivierte ihr Lächeln noch. Innerlich verfluchte sie mich, keine Frage.
»Wie kann ich Ihnen helfen?«
Ich trommelte mit den Fingern auf den Tisch und sagte: »Ich kenne einen Doktor, der hat gesagt, ich soll mich mal von oben bis unten untersuchen lassen, von wegen Herz und so. Tja, hier bin ich.«
»Ein Check-up also.«
»Mhm. Wohl nötig bei dem Kilometerstand.«
Sultan Karakum griff unter dem Desk zu einem Telefonhörer und drückte ein paar Tasten. Jetzt geht es los, dachte ich. Mit perfektem Dienstlächeln sagte sie: »Ich habe unsere Patientenberaterin gerufen, die kommt gleich und kümmert sich um Sie.«
»Vielen Dank«, erwiderte ich, blieb aber am Empfang stehen. »Darf ich Sie mal was ganz anderes fragen?«
Sie hob die Augenbrauen, als hätte sie für ganz andere Fragen nicht gerade viel Verständnis. Sie sagte aber nichts und sah mich nur an. »Ist Begüm heute da?«, fragte ich, um einen möglichst beiläufigen Ton bemüht.
»Bitte?« Es hörte sich mehr nach Ausrufezeichen an.
»Begüm Kalyon. Die arbeitet hier als Krankenschwester.«
Sultan Karakum stutzte und sah mich an, als hätte ich nach Dr. House gefragt. »Begüm … Die habe ich heute nicht gesehen. Vielleicht hat sie Urlaub.«
»Aha. Na ja, ist nicht wichtig.«
Sie schien sich wieder gefasst zu haben. »Was wollten Sie von Begüm? Sie können mir glauben, unsere Patientenberaterin wird all Ihre Fragen umfassend beantworten.«
»So war es nicht gemeint. Diese Begüm ist die Tochter von einem Freund von mir, und mir ist eingefallen, dass sie hier arbeitet. Da habe ich mir gedacht, ich frag mal, wenn ich schon hier bin.«
»Ja, natürlich. Aber wie gesagt, ist sie wohl in Urlaub.« Sie fixierte auf einmal über meine Schulter hinweg einen Punkt, und ihr Gesicht leuchtete auf, wie vor lauter Freude darüber, dass sie den dämlichen Patientenanwärter gleich los sein würde.
»Ayla«, rief sie ihrer Retterin zu, »der Herr interessiert sich für einen Check-up, kannst du dich bitte um ihn kümmern?«
Ich drehte mich um. Und wenn ich mich nicht beherrscht hätte, hätte ich losgepfiffen. Vor mir stand nämlich eine der schönsten Frauen der Welt und lächelte mich an, als würde ich sogar mit der allerunheilbarsten aller Krankheiten nach zwei Tagen Aufenthalt hier gesünder entlassen werden, als ich es je gewesen war. Und wenn ich schön sage, meine ich damit nicht die Art hirnlose Illustrierten-Tussi. Sie wirkte einerseits so frisch, als habe sie gerade erst ihre Ausbildung abgeschlossen, und andererseits so reif, als habe sie schon in sechs verschiedenen Notaufnahmen heimliche Tränen vergossen. Am meisten fielen ihre braunen Augen auf. Wenn sie einen ansah, fühlte man sich sogleich durchschaut. Auf die Wangen hatte sie hauchzartes Rouge aufgelegt. Als einzigen winzigen Schönheitsfehler hätte man allerhöchstens bemängeln können, dass über ihren Mona-Lisa-Lippen ein kleiner Leberfleck thronte.
Im Gegensatz zu den Frauen am Empfang trug sie ein hellblaues, figurbetontes Kleid. Auf ihrem Namensschild stand Ayla Duman.
Sie war es wohl gewohnt, dass männliche Patienten von ihrer Schönheit geblendet waren.
»Sie haben völlig recht mit dem Check-up«, sagte sie und musterte mich von oben bis unten. »Sollte man ein Mal pro Jahr machen lassen. Vor allem in Ihrem Alter …«
Über diesen letzten Satz lächelte ich gnädig hinweg. Die Stimme der Frau passte übrigens zum Rest der Erscheinung.
»Wann war denn Ihr letzter Check-up?«, fragte sie flötend, damit es sich nur ja nicht als Vorwurf anhörte.
»Ist schon eine Weile her. Früher hatte ich oft welche, beim Flugeignungstest.«
»Ach, Sie sind Pilot?« Jetzt sah sie mir zum ersten Mal richtig ins Gesicht.
»Ehemaliger Pilot.«
»Ich kenne ein paar Piloten, die sind sogar älter als Sie, fliegen aber immer noch.«
Mit einer unwilligen Kopfbewegung zeigte ich an, dass ich das Thema lieber nicht vertiefen wollte.
»Also …«, sagte sie darauf leicht verlegen, »wir haben hier drei Check-up-Programme. Vielleicht sind Sie ja schon auf dem Laufenden …«
»Ich weiß gar nichts.«
Darüber schien sie sich zu freuen. »Dann müssen wir uns mal näher unterhalten. Kommen Sie bitte mit in mein Büro?«
Ich war mehr als bereit, ihr zu folgen. Wir gingen zu einer unscheinbaren Tür neben den Aufzügen, und als Ayla Duman mir dort den Vortritt ließ, strömte mir beim Vorbeigehen ein Blumenduft in die Nase.
Das Büro war ein Zimmerchen mit einem runden, niedrigen Tisch und fünf schlichten Stühlen darum herum. Auf einem Wandbildschirm lief stumm ein Nachrichtensender. Ayla Duman setzte sich mit dem Rücken zum Bildschirm und zog einen roten Terminkalender aus der Tasche. Sie schlug die Beine übereinander und sagte: »Also, dann schauen wir doch mal.«
Zwanzig Minuten später wusste ich über alle Einzelheiten eines meinem Geldbeutel angemessenen Basis-Check-ups für Männer Bescheid. Nach einer ersten Untersuchung durch einen Arzt würden standardmäßig Blut, Urin, Nüchternblutzucker, Cholesterinspiegel, Leberwerte, Blutsenkung und Kreatinin überprüft. Keine Ahnung, was Kreatinin bedeutete, aber das behielt ich für mich. Danach sollten Lungen und Abdomen geröntgt und als letztes ein EKG erstellt werden, dann würde ich mit den Ergebnissen wieder zurück zu dem Arzt kommen. Ayla Duman stellte mir das dar, als sei es die ausgemachteste Sache der Welt, dass all die Fummelei mich als kerngesund erweisen würde.
»Ach!«, sagte ich und schlug mir auf die Stirn.
Sie sah mich an.
»Für diese ganzen Blutsachen und so, da muss ich doch nüchtern sein?«
»Ja.«
»Ich habe aber schon gefrühstückt heute.«
Ayla Dumans Lippen verzogen sich kurz, als wollte sie etwas tausend Mal Erklärtes nicht schon wieder sagen müssen. Dann straffte sie sich wieder. »Wir fangen heute mit der ärztlichen Untersuchung an, dann gehen Sie zum Röntgen und zum EKG. Und zu den Analysen kommen Sie morgen früh dann nüchtern.«
Ich runzelte die Stirn, als ob ich nachdenken müsste. »Wissen Sie was, ich komme am besten morgen wieder, dann wird alles in einem Aufwasch erledigt. Und ich kann mich erst mal an den Gedanken gewöhnen.«
»Wie Sie meinen«, erwiderte sie und stand auf.
»Vielen Dank für die Erläuterungen«, sagte ich. »Ich würde Sie gerne aber noch was fragen.« Ich glaube, vom Ton her fiel ich dabei etwas aus der Rolle.
Ayla Duman hielt inne und sah mich leicht besorgt an. »Ja, bitte?«
»Wissen Sie, in welcher Abteilung Begüm Kalyon arbeitet? Ich würde sie gern kurz sehen, falls das möglich ist.«
Erleichterung bei Ayla Duman. Ich hatte sie nicht zum Essen eingeladen.
»Die arbeitet mal hier, mal da. Heute habe ich sie noch nicht gesehen.«
»Schade«, sagte ich und stand auf. »Vielen Dank noch mal jedenfalls.«
Sie schien zu sinnieren. »Wissen Sie was, jetzt wo Sie mich fragen, fällt mir auf, dass ich sie schon lang nicht mehr gesehen habe. Vielleicht ist sie krank oder was. Waren Sie übrigens schon mal Patient bei uns?«
»Nein, Begüm ist die Tochter eines Freundes von mir, da wollte ich nur kurz mal mit ihr plaudern.« Das schien mir eine hinreichende Erklärung zu sein. War es aber nicht. Ayla Duman schien nicht nur hübsch, sondern auch klug zu sein.
»Hm, der Freund muss Ihnen ja recht wichtig sein.«
»Wichtig genug, dass ich mir Sorgen mache, wenn seine Tochter seit Tagen weg ist.«
»Sehen Sie, jetzt haben Sie mich auch neugierig gemacht. Ich frag mal oben nach.«
»Sind Sie mit ihr befreundet?«
Ayla Duman sah mir in die Augen. Ziemlich lang sogar. Sie fragte sich sichtlich, in was dieser potenzielle Patient sich da auf einmal verwandelte. Dann griff sie zu ihrem Telefon und drückte ein paar Tasten. »Sie ist ein nettes Mädchen. Ich mag sie.« Sie musste am Telefon eine Weile warten und trat von einem Fuß auf den anderen. Mit einer Geste zeigte ich ihr an, dass mir schon klar war, ist ja ein Krankenhaus hier, da geht es immer furchtbar zu. Sie ging nicht darauf ein.
»Ah, Sinem, ich bins, Ayla«, sagte sie schließlich und begann, in dem kleinen Büro herumzugehen. »Pass auf, Begüm ist anscheinend nicht da. Weißt du da was? Ich hab sie schon eine Weile nicht gesehen.« Sie lauschte auf die Antwort und legte dabei unwillkürlich einen Finger auf ihren Leberfleck. »Und sie hat dir nicht gesagt, warum?«
Mich sah sie nicht an.
»Gut, gib mir die Nummer … Doch, doch, gib sie mir nur. Falls Ismet nach ihr fragt, sag ich ihr dann Bescheid.« Als ihr die Nummer durchgegeben wurde, machte sie ein Gesicht wie ein kleines Mädchen, das das Einmaleins auswendig lernt.
»Ich dank dir schön. Keine Angst, ich sag schon nichts. Tschüss.«
Sie wandte sich wieder mir zu. »Wir sind der Tochter Ihres Freundes auf die Spur gekommen«, sagte sie seltsam förmlich. »Ich habe mit der Oberschwester gesprochen, mit der ist sie gut befreundet. Begüm hat ihr gesagt, dass sie ein paar Tage nicht zur Arbeit kommt, aber nicht, warum. Ihr Handy wollte sie ausgeschaltet lassen, deshalb hat sie der Oberschwester eine andere Nummer gegeben, da kann man ihr Bescheid sagen, wenn von der Leitung jemand nach ihr fragt.«
Nach dem Nachnamen von Oberschwester Sinem erkundigte ich mich lieber nicht. »Fällt es nicht auf, wenn eine Krankenschwester nicht zur Arbeit kommt?«, fragte ich.
»Da arbeiten so viele da droben, und noch dazu wird ständig hin und her gewechselt. Wenn nicht gerade ein Arzt direkt nach einer sucht oder die Oberschwester was meldet, kann man schon mal ein paar Tage verschwinden. Später arrangiert man sich dann mit den Kolleginnen, die in der Zeit mehr arbeiten mussten.«
»Vielen Dank«, sagte ich und blieb abwartend stehen. Im Vertrauen darauf, wie klug sie war.
Sie legte wieder den Finger auf den Leberfleck und sagte dann: »Warum sollte ich einem völlig Unbekannten die Telefonnummer meiner Kollegin geben?«
Da hatte sie recht. Ich aber brauchte die Nummer. Ich rang nach einer überzeugenden Antwort. »Wissen Sie was«, fing ich an, ohne einen blassen Schimmer zu haben, wie ich weiterreden sollte. Da klingelte Ayla Dumans Telefon. So wie Telefone klingeln, wenn sie eine Katastrophe ankündigen.
Ayla Duman bedeutete mir zu warten und hob ab. »Ja, gut, ich komme gleich«, sagte sie und legte auf. »Ich muss weg.«
Und ich hatte noch immer kein Argument parat. Da fiel mir zum Glück etwas anderes ein. »Rufen Sie sie doch an«, sagte ich. »Wenn wir sehen, dass es ihr gut geht, bin ich ja schon zufrieden. Und vielleicht rede ich dann kurz mit ihr.«
»Ja, das können wir machen, warum nicht. Also, mal sehen, was sie so treibt.«
Sie drückte erst auf eine Taste ganz unten, um ins Netz zu kommen, dann gab sie die Nummer ein, wobei ich ihr genauestens auf die Finger sah. Nach kurzer Zeit hörte ich aus dem Telefon eine Frauenstimme. Ayla Duman warf ungehalten den Kopf zurück. Sie wartete eine Weile, dann sagte sie: »Begüm, ich bins, Ayla. Ich hab die Nummer von Sinem. Keine Angst, ist nichts passiert, wollte nur mal wissen, wies dir so geht. Ruf mich an, ja?«
Sie legte auf und ging zur Tür. »Tja, Pech. Entschuldigen Sie, ich muss jetzt gehen.«
»Trotzdem vielen Dank. Vielleicht sehen wir uns ja morgen.«
Sie erwiderte nichts und hielt mir nur die Tür auf. Draußen beim Aufzug drückte sie auf einen der Knöpfe. Als sie merkte, dass ich ihr dabei zusah, lächelte sie mich an. Ich lächelte zurück und ging wieder zum Empfang, wo Sultan Karakum gerade mit zwei Frauen beschäftigt war. Daneben kehrte der Hausmeister den Boden. Mir war nach einer Zigarette, aber erst musste ich ein Telefon finden, so was musste es in einem Krankenhaus doch noch geben.
Ich fragte den Hausmeister. Der sah mich an, als wäre ihm diese Frage noch nie gestellt worden. Nach kurzem Nachdenken deutete er mit dem Besenstiel in Richtung Café. Dort fand ich nebeneinander zwei öffentliche Telefone und steckte in das eine meine Kreditkarte. Ich wählte die Nummer, die ich Ayla Duman abgekuckt hatte, und wartete, bis sich der Anrufbeantworter einschaltete. Eine leicht nervöse Frauenstimme sagte in überdeutlicher Betonung: »Wenn du mir was mitzuteilen hast, dann sprich bitte nach dem Signalton. Falls nötig, rufe ich dich zurück.«
Ich habe durchaus was mitzuteilen, dachte ich, und wartete auf den Ton.
»Guten Tag, wenn Sie Begüm Kalyon sind, dann hören Sie mir bitte gut zu. Ich bin Remzi Ünal, ein Freund von Dr. Kemal Arsan. Der macht sich Sorgen um Sie. Rufen Sie ihn bitte unter folgender Nummer an.« Dann gab ich noch die Nummer jenes Hotels an, für das ich mich so schämte. »Das ist ein Hotel. Sie können bei Emre eine Nachricht für mich hinterlassen. Falls Ihr Verschwinden keine beziehungsmäßigen Gründe hat, kann ich Ihnen helfen. Das ist mein Ernst.«
Ich legte auf.
Die Frage, warum ich noch immer kein Handy besaß, verschob ich wieder mal. Wo ich aber schon mal ein Telefon vor der Nase hatte, machte ich gleich weiter und wählte die Festnetznummer von Begüm Kalyon. Wieder nichts, wie zu erwarten.
Nun war es Zeit, hinauszugehen und Waypoint 3 anzuvisieren. Auf dem Weg zum Ausgang tastete ich nach meinem Zigarettenpäckchen; es war an Ort und Stelle. Zum Glück stand noch kein Doktor da, der gesagt hätte, hören Sie mal, bei den Ergebnissen sollten Sie das Rauchen lieber bleiben lassen. Leise lächelnd ging ich hinaus.
Nach der sterilen Krankenhausatmosphäre tat es gut, wieder die unkontrollierte, wilde Luft von draußen einzuatmen. An mein Ohr tönte stinknormaler Istanbuler Straßenlärm. Gleich neben der Tür stand eine Bank. Gestiftet von einer Bank. Zu den Kippen, die schon davorlagen, wollte ich das meinige beitragen.
Wenn man sich schräg auf die Bank setzte, konnte man sowohl das Erdgeschoss des Krankenhauses im Visier haben, wo die Leute wie auf einem tonlosen HD-Bildschirm hin und her gingen, als auch die Straße, auf der vor allem Taxis unterwegs waren. Eines davon würde ich nehmen, sobald ich mit der Zigarette fertig war, denn nach Beschreibung von Doktor Arsan wohnte die Kollegin seiner Freundin im Viertel Teneke, wohin es gerade mal zehn Minuten waren. Dann würde man weitersehen.
Ich tat einen tiefen Zug an meiner Zigarette und ließ den Rauch durch die Nase entströmen. Da sah ich aus dem Augenwinkel, dass sich jemand neben mich setzte, den ich gar nicht hatte herankommen sehen. Ein verwahrloster Typ, mit zerknitterter Hose und Turnschuhen, die schon bessere Tage gesehen hatten. Ich sah ihn nicht direkt an, sondern rückte auf der Bank ein Stückchen zur Seite.
»Hast du mal ne Kippe?«, sagte er.
Nun musste ich mir den Kerl doch mal anschauen. Er war kaum älter als zwanzig, vielleicht sogar noch jünger, aber das Leben auf der Straße hatte ihn schneller reifen lassen als irgendein Muttersöhnchen. Man musste ihn sehr genau ansehen, sonst vergaß man seine Züge sofort. Sein Gesicht war dunkel, oder seit Tagen nicht gewaschen. Die Augen Schlitze, der Mund ein einziger Strich.
Ich hielt ihm mein Päckchen hin, und er nahm sich zwei Zigaretten. Eine steckte er sich in den Mund, die andere in die Tasche seiner verschossenen Weste, die er über einem weinroten T-Shirt trug. Die Zigarette zwischen seinen Lippen hielt er mir wortlos hin, und ich zündete sie ihm an. Er tat einen ersten Zug, sichtlich ohne Genuss.
Ich sah wieder vor mich hin. Bis ich die Kippe zu den anderen werfen konnte, war es noch eine Weile. Tja, Istanbul. Da kann man sich nicht aussuchen, wer sich neben einen setzt. Und wenn der Betreffende eine Zigarette will, gibt man sie ihm gefälligst.
Ich dachte an etwas ganz anderes, nämlich daran, wie weit die Verwandlung, zu der ich in dem antiken Friseurstuhl in Beyoğlu angesetzt hatte, eventuell noch führen konnte. Die Sucherei nach der Freundin eines wildfremden Menschen spülte wieder Geld in meine Tasche. Ich stellte wieder Fragen, bekam wieder Antworten, solche und solche, und ich telefonierte wieder herum.
Sollte ich vielleicht auch jenen anderen Anruf tätigen? Ich merkte, wie sehr ich mich nach der Stimme sehnte, die mir antworten würde. Wie würde die Frau wohl reagieren? Und falls sie nicht gleich auflegte, war ich dann fähig und willens, das Meinige zu tun? Ich wusste es nicht. Um diese verfrühten Gedanken zu verscheuchen, tat ich wieder einen Zug.
»Dein Handy wär jetzt recht.«
Meinte er etwa mich?
Ja.
Er hatte sich leicht zu mir vorgebeugt. Die Zigarette hing ihm im Mundwinkel, und seine Augen waren noch mehr zugekniffen. In der rechten Hand, direkt vor mir, hielt er ein Messer von einer Größe, mit der er es nie und nimmer durch einen der Röntgenapparate geschafft hätte, mit denen man jetzt am Eingang jedes größeren Supermarkts kontrolliert wurde. Es sah anders aus als alle Messer, die ich bisher gesehen hatte. Die Klinge war lang, aber irgendwie zu schmal.
Ich warf meine Zigarette zu Boden. Das Ausdrücken schenkte ich mir, ganz offensichtlich hatte ich andere Sorgen.
Ich wandte mich dem jungen Mann zu, streckte beide Hände in offenbarender Geste aus und setzte ein gewinnendes Remzi-Ünal-Lächeln auf.
»Ich habe kein Handy«, sagte ich ruhig.
Drohend fuchtelte er mit dem Messer.
Absurd. Da hatte jemand dankenswerterweise eine Bank aufgestellt, damit man als Angehöriger eines Patienten in Ruhe eine rauchen konnte, und nun saß ich neben einem vermutlichen Klebstoffschnüffler, der mir ein Messer an den Bauch hielt. Und dem zudem meine Antwort nicht gefallen hatte.
»Keine Mätzchen, her mit dem Handy.«
»Ich habe Zigaretten, aber kein Handy«, erwiderte ich im gleichen ruhigen Ton und ließ dabei ein wenig mein Auge umherschweifen. Kein Mensch schien uns zu beachten.
»Das kannst du deiner Oma erzählen. Los, raus damit, sonst kriegst dus mit Abuzittin zu tun.«