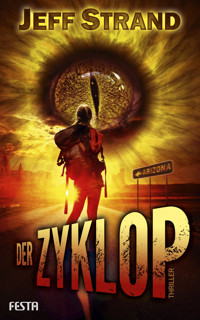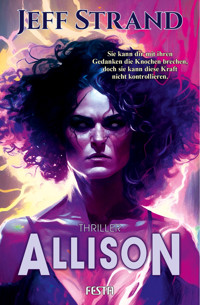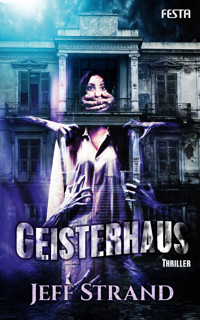4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Mit zwölf Jahren teilten sie sich ein Zimmer im Internat: Alex Fletcher, schüchtern und verängstigt, und der immer wütende Darren Rust. Freunde wurden sie nie. Dafür war Darren einfach zu seltsam mit seiner krankhaften Neugier auf den Tod. Eine Neugier, die ihn in etwas Unheimliches verwandelte. Das ist eine Ewigkeit her. Alex ist längst verheiratet und glücklicher Vater. Doch jetzt ist Darren zurück. Er ist der Faszination des Todes jetzt völlig verfallen. Und er sucht einen Seelenverwandten: Alex. Lass uns töten ist ein unvergesslicher Psychothriller. Jack Ketchum: »Jeff Strand hat den Geist von Richard Laymon zum neuen Leben erweckt. Laymon hätte den Roman geliebt.« Publishers Weekly: »Unglaublich gruselig.« Douglas Preston: »Ein zutiefst beunruhigender Psychothriller. Die verstörende Beziehung zwischen zwei Freunden aus Kindertagen, die mehr als nur Feinde werden ... Unerbittlich, packend und beängstigend.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 338
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Aus dem Amerikanischen von Dirk Simons
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe Pressure
erschien 2006 im Verlag Earthling Publications.
Copyright © 2005 by Jeff Strand
Copyright © dieser Ausgabe 2020 by Festa Verlag, Leipzig
Titelbild: Arndt Drechsler
Lektorat: Katrin Holle
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-86552-844-5
www.Festa-Verlag.de
Prolog
Zeitweise hielten mich nur noch die Kugeln am Leben.
114 von ihnen ruhten in dem Beutel, und in jede einzelne war ein Datum eingeritzt. Das älteste lag knapp vier Monate zurück, ein Donnerstag. Ich hatte den kompletten Morgen in der Badewanne verbracht, Tränenströme auf den Wangen und den Lauf des Revolvers im Mund. Ich hatte sogar Mülltüten an die Wände geklebt, damit der Vermieter nicht neu streichen musste. Ich war mir nicht sicher gewesen, ob Selbstmord tatsächlich das Richtige war, aber ich konnte mich auch nicht dazu zwingen, den Revolverlauf aus dem Mund zu nehmen.
Irgendwann tat ich es doch. Ich legte die Waffe beiseite und nahm die Kugel heraus. Dann kratzte ich 25.12. mit dem Taschenmesser in ihr Gehäuse – als Erinnerung daran, dass ich mich an jenem Tag nicht getötet hatte.
Am Freitag war ich sogar noch länger in der Wanne, ohne es zu tun. Dabei wollte ich es. Sehr. Ich biss so fest auf den Lauf, dass ich, als meine Schneidezähne laut knackten, kurzzeitig glaubte, ein Schuss habe sich gelöst. Ich weiß nicht, was mich letzten Endes davon abhielt, den Abzug zu betätigen – vermutlich Feigheit –, aber unterm Strich bekam ich nur eine weitere ungenutzte Kugel und ein weiteres Datum.
Es wurde zum täglichen Ritual – und manche Tage waren echt, echt übel. Es gab Zeiten, meistens spätnachts, in denen mich nur der Anblick des Beutels voller Kugeln vom Selbstmord abhielt. Wenn ich all diese Tage überlebt hatte, so dachte ich, was sollte mich dann davon abhalten, einen mehr zu überleben?
Andere Male hielt ich mir lässig die Waffe an die Schläfe, wartete eine halbe Sekunde lang und ließ mich dann aufs Sofa plumpsen, um fernzusehen.
Und je schwerer der Beutel voller Patronen wurde, desto leichter fiel es mir, den Abzug in Ruhe zu lassen. Mein Leben drehte sich immer weniger ums Entkommen und mehr und mehr um die Erkenntnis, dass ich mich nicht ewig verstecken konnte. Dass das gar nicht nötig war. Immerhin hatte ich schon 114 Tage geschafft!
Es war Tag 115, als ich beschloss, mein Geld für bessere Dinge zu vergeuden als für unbenutzte Patronen. An diesem ekelhaft kalten Abend ließ ich den Revolver in den Beutel fallen, band ihn zu und ging die sechs Meilen bis zur Winston-Brücke. Auf der anderen Straßenseite schlenderte ein fröhlicher Vater mit seiner Tochter auf den Schultern vorbei, und ich ignorierte ihn nach Kräften, während ich mich dafür wappnete, den Beutel in den Fluss zu werfen und eine neue Ära meines Lebens zu beginnen.
Doch dann dachte ich: Nein, schlechte Idee. Nachher wurde das Ding noch irgendwo angespült, wo Kinder es fanden. Das wäre echt das Letzte, was ich brauchte. Ich beschloss, die neue Ära meines Lebens ohne symbolischen Akt zu starten.
Ich sah erneut zu dem Vater, brach in Tränen aus und ging zur nächstbesten Bar, wo ich mir die Kante gab, bis ich besinnungslos vom Hocker kippte. Ich erwachte vor der Tür, Blut in den Augen, und hatte keinerlei Kleingeld mehr an mir.
In dem Moment hätte ich mich erschossen, ganz ohne Frage. Doch diese Bastarde hatten mir auch den Beutel mit der Waffe und den Kugeln geklaut.
Also lag ich einfach da, zitternd und blind für alles außer meinen Atemwölkchen in der Luft vor mir, und versuchte mich zu erinnern, ob es jemals gute Zeiten gegeben hatte.
Doch, das hatte es. Sogar wundervolle, ehrlich gesagt.
Aber dort beginnt die Geschichte nicht.
Teil Eins
KINDER
1
»Mehr musst du gar nicht tun. Klau einfach die Kondome, und schon gehörst du zum Club.«
Nervös verlagerte ich mein Gewicht auf dem Fahrrad. Es stand direkt gegenüber von dem kleinen Drugstore – auf einer Straße, die zu neun Zehnteln aus Dreck und zu einem aus spitzen Steinen zu bestehen schien. »Ich weiß nicht. Kann ich nicht lieber einen Schokoriegel klauen oder so?«
Paul schüttelte den Kopf. »Es müssen Gummis sein.«
»Und wenn man mich erwischt? Dann komm ich ins Gefängnis!«
Marty kicherte. »Wenn du in einer Zelle landest, machen wir dich zum Ehrenmitglied.«
Ich seufzte. Trotz meiner zwölf Lebensjahre verstand ich, welche Funktion das Objekt ihrer Begierde erfüllte. Ich wusste allerdings auch, dass sie es nie und nimmer benutzen würden. »Wie wär’s damit: Ich klaue drei Schokoriegel. Das ist doch viel schwieriger, findet ihr nicht?«
»Ginge es uns um Schokoriegel, würden wir uns welche kaufen«, erklärte Paul. Er kratzte sich am Arm – genau da, wo das aufgeklebte Kobra-Tattoo prangte – und schob sich dann die dicke Brille hoch. »Außerdem wird hier gar nichts schwierig. Der Typ ist doch halb blind.«
»Aber was wollt ihr denn damit?«
»Was denkst du denn?«, erwiderte Marty. »Sie benutzen natürlich.«
»Von wegen.«
»Aber sicher. Die Dinger ergeben echt die besten Wasserbomben.«
»Kommt schon, Leute«, protestierte ich. »Lasst mich etwas anderes stehlen. Irgendwas.«
Paul nickte. »Okay. Bring uns eine Schachtel Maxi Pads.«
»Auf gar keinen Fall.«
»Gummis oder Maxi Pads. Entscheide du.«
Daheim in Dayton, Ohio, hätte ich nicht einmal einen Strohhalm geklaut, um mir das Privileg zu verdienen, mit Typen wie Paul und Marty abzuhängen. Beide waren gigantomanische Nerds, die sich irgendwie eingeredet hatten, sie würden zu den coolen Halbstarken gehören. Als ich Marty zum ersten Mal sah, nuckelte er an seinem Inhalator, weil sein Versuch, einem Zehnjährigen das Essensgeld aus dem Leib zu prügeln, übel nach hinten losgegangen war. Paul bekam von seiner Mutter noch immer die Kruste von den Erdnussbutter-Marmelade-Stullen abgeschnitten und hatte jeden Morgen einen lieben Zettel von ihr im Gepäck, den er dann demonstrativ zerknüllte und in den Müll warf.
Aber Trimble, Arizona, mit seinen 6000 Einwohnern war kein leichtes Pflaster für Neuankömmlinge. Die Kinder kannten einander hier sehr genau, und das schon ihr ganzes Leben. Die Cliquen waren längst etabliert, und es gab keine Lücke mehr, in die ein schmächtiger, introvertierter, durch und durch unsportlicher Knirps mit hässlichem Muttermal am Kinn reingepasst hätte. Drei volle Wochen lang hatte ich meinen Lunch allein gegessen und gehofft, jemand würde Mitleid mit mir empfinden. Doch die anderen Kinder hatten sich damit begnügt, meine Anwesenheit weiterhin komplett zu ignorieren. Vielleicht dachten sie auch, ich hätte eine ansteckende Krankheit, die durch Sprechkontakt übertragen wurde.
Entsprechend begeistert war ich, als mich Paul und Marty eines Tages nach der Schule zu einer Radtour einluden.
»Feiges Huhn«, sagte Paul gerade. »Gack, gack, gack. So feige!« Er klemmte sich die Hände unter die Achseln und machte Geräusche, die wohl ein Huhn nachahmen sollten.
»Du klingst wie eine Ente«, fand Marty.
»Tu ich nicht.«
»Na dann wie ein behindertes Huhn.«
»Tu ich nicht!«
»Okay, gut – wie ein besonderes Huhn.«
»Was soll das überhaupt heißen?«, fragte Paul. »Behindertes Huhn.«
»Leck mich.«
Ich hoffte inbrünstig, dass sie das Gespräch fortsetzten, bis wir zum Abendessen nach Hause mussten, aber dieses »Leck mich« erwies sich als sein natürliches Ende.
»Na los, Alex«, sagte Paul. »Sonst darfst du nicht in unseren Club.«
»Das will ich auch gar nicht.«
»Nee, klar.«
»Seid ihr sicher, dass er halb blind ist?«
»Der guckt bestimmt nicht einmal hin«, beharrte Marty. »Wir klauen da ständig.«
Mein Magen rebellierte, und ich spürte nahende Kopfschmerzen. Dennoch nickte ich, schlang mir den Rucksack über die Schulter und näherte mich stumm dem Drugstore. Was ich hier tat, war dämlich. So unfassbar dämlich. Echt zutiefst, unbeschreiblich, ekelerregend und absolut komplett oberdämlich.
Aber ich würde es tun.
Ein Glöckchen klingelte, als ich die Tür aufschob. Mr. Greystein sah von seiner Ausgabe der neuen Christian Living auf und runzelte die Stirn. Nach Pauls und Martys Beschreibungen hatte ich einen vertrockneten Opa in den Neunzigern erwartet, aber Mr. Greystein wirkte kaum älter als 50.
Der Drugstore war klein und schlecht beleuchtet, wenig mehr als drei Regalreihen und ein Kühlschrank. Hinter Mr. Greystein hing ein Regal voller Zigaretten.
»Lass den hier an der Theke«, sagte er.
»Was?«
»Deinen Rucksack. Lass den hier bei mir.«
Ich ging hinüber und legte meine Tasche auf die Ladentheke. Der Rucksack sollte das Behältnis sein, das mir meine schändliche Tat ermöglichte. Entsprechend demotivierend war diese Neuentwicklung.
Mr. Greystein schenkte mir einen weiteren abschätzenden Blick, widmete sich dann aber wieder dem Magazin. Ich zog weiter und tat, als untersuchte ich das Süßwarensortiment.
Die Kondomschachteln standen in einem Regal gleich rechts neben der Theke. Selbst mit Rucksack würde ich sie unmöglich einfach stehlen können. Wie sollte ich vorgehen? Warum versuchte ich es überhaupt?
Mein Magen hatte sich vom bloßen Grummeln zum üblen Stechen weiterentwickelt, und die Kopfschmerzen wüteten ganz gewaltig. Ich las die Nährwertangaben eines Snickers-Riegels und überlegte meinen nächsten Schritt.
Ich sollte einfach abhauen. Wen juckte es schon, was Marty und Paul dachten? Vielleicht ließen sie mich ja in ihren Club, wenn ich ihnen einfach einen Schokoriegel spendierte …
Dann fiel mir etwas ein, das ich von Anfang an hätte bedenken sollen. Ich brauchte die Kondome gar nicht zu stehlen. Ich konnte sie einfach kaufen. Marty und Paul würden nie erfahren, dass die Ware nicht geklaut war. Ich konnte ein Lügner sein und kein Dieb.
Allerdings waren mir die Regeln nicht vertraut. Durften Zwölfjährige Kondome kaufen? Schließlich ging es hier nicht um Alkohol und Zigaretten, richtig?
Bevor mir der Mut verging, kehrte ich zur Ladentheke zurück, nahm mir eine wahllose Schachtel Kondome und legte den Snickers-Riegel so lässig daneben, als könnte er Mr. Greystein vom Rest meines Einkaufs ablenken.
Er beäugte mich einen Moment lang. »Wie alt bist du?«
»Zwölf.«
»Wissen deine Eltern, was du hier kaufst?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Glaubst du nicht, du bist ein bisschen zu jung dafür?«
Ein Schulterzucken.
»Ich glaube, du bist sogar viel zu jung. Ich denke nicht, dass ich dir das verkaufen sollte. Ein Junge in deinem Alter kann damit gar nicht verantwortungsvoll umgehen. Oder was meinst du?«
Abermals zuckte ich mit den Schultern.
Er beäugte mich noch einen Moment, dann schlich sich der Anflug eines Lächelns auf seine Züge. »Schau mal. Ich glaube, du hast nicht nachgedacht.« Dabei tippte er gegen die Schachtel. »Das hier sind Kondome aus Lammhaut. Die sind weniger verlässlich als die Latexversion. Zu denen würdest du höchstens greifen, wenn deine Partnerin auf Latex allergisch reagiert. Bist du oder ist deine Partnerin allergisch gegen Latex?«
Ich antwortete nicht.
»Sei nicht schüchtern. Wenn dir das Thema unangenehm ist, solltest du das Zeug erst recht nicht kaufen. Hast du oder hat deine Partnerin eine Latexallergie?«
»Nein, Sir.«
»Na dann willst du eher die hier.« Er schob die Schachtel beiseite, beugte sich über den Tresen und nahm eine andere. »Diese Sorte hat sogenannte Genussnoppen. Weißt du, was das bedeutet?«
»Nein.« Es pfiff mir in den Ohren, dass ich ihn kaum noch verstand.
»Die Noppen helfen bei der Stimulation. Das ist definitiv gut für euch. Es ist nur richtig so. Was allerdings das Gleitmittel betrifft … Du bist noch so jung, dass euch dabei keine Probleme begegnen sollten. Aber bis du mit der ganzen Schachtel durch bist, mag sich das ändern. Was meinst du?«
»Ich weiß nicht.«
»Mit der Einstellung bist du aber kein aufmerksamer Konsument. Du würdest dir doch auch nicht den erstbesten Schokoriegel kaufen, oder? Du würdest dich fragen, ob dir aktuell eher nach Erdnüssen oder Nugat ist, ob die Geschmacksrichtung stimmt und so weiter. Richtig?«
»Kann sein.«
»Natürlich würdest du das. Darf ich nach deinem Namen fragen?«
»Alex.«
»Sag mir, Alex: Glaubst du wirklich, du bist bereit für diese Kondome? Oder findest du, du lässt die Sache lieber noch ein Weilchen bleiben? Die ganze Sache, wenn du verstehst, was ich meine.«
Was als Nächstes passierte, bezeichne ich gern als Schlüsselereignis für den Rest meines Lebens. Das ist wahrscheinlich übertrieben. Der entscheidende Punkt war vermutlich schon mein Entschluss, die Kondome zu stehlen, die Begegnung mit Paul und Marty, der Umzug mit meinen Eltern nach Trimble oder von mir aus auch meine Scheißgeburt. Aber eines weiß ich mit absoluter Sicherheit. In zwölf Lebensjahren, in denen schlechte Ideen beileibe keine Mangelware darstellten, war die nun folgende Entscheidung die schlechteste, die ich bis dato getroffen hatte.
Ich schnappte mir die Schachtel mit den Kondomen und lief weg.
Ich riss die Tür auf, ohne langsamer zu werden, und hechtete über die staubige Straße zu Paul und Marty. »Los!«, schrie ich. »Verschwindet von hier! Na los doch!«
Ohne zu zögern, traten sie in die Pedale. Vor lauter Eile stießen sie mein Rad noch um. Ich hob es vom Boden, vor Panik beinahe hyperventilierend, sprang auf den Sattel und strampelte ihnen hektisch hinterher.
Ich wagte es nicht, hinter mich zu blicken, denn ich wusste, dass Mr. Greystein vor seinem Drugstore stand, ein Gewehr in beiden Händen. Er würde es benutzen, wenn er konnte. Auch bei einem Kind.
Stöhnend biss ich die Zähne zusammen, wartete auf den Knall und das entsetzliche Gefühl, wie mein Schädel platzte. Es blieb aus, doch ich drehte mich immer noch nicht um. Vielleicht lebte ich nur noch, weil er mir nicht in den Rücken schießen wollte?
Ob er die Polizei rief? Ob die mich finden würde?
Mit Sicherheit. In einem so kleinen Ort hatte die Polizei garantiert keine Schwierigkeiten, anhand von Mr. Greysteins Beschreibungen einen Ladendieb aufzuspüren. Erst recht nicht, wenn der Trottel von Dieb seinen Rucksack auf der Theke vergessen hatte!
Ich zog die Handbremse, beugte mich vor und übergab mich in den Straßenstaub.
Geh einfach zurück. Gib die Kondome ab, entschuldige dich und bettele ihn an, nicht die Polizei zu holen. Sag ihm, du zahlst den doppelten Preis … Das Dreifache, wenn er es verlangt. So viel besitzt du zwar nicht, aber nächste Woche gibt es neues Taschengeld …
Weit vor mir bogen Marty und Paul um eine Ecke und verschwanden aus meinem Sichtfeld.
Noch immer kein Schuss. Ich musste zurück.
Stattdessen erbrach ich mich ein zweites Mal. Dann fuhr ich schnellstens nach Hause.
Ich parkte mein Rad hinter dem Haus – für den Fall, dass Mr. Greystein nach ihm Ausschau hielt. Mein Rucksack dürfte ihm meinen Namen und meine Adresse gleich mehrfach verraten haben. Entsprechend unwahrscheinlich fand ich die Vorstellung, er streife persönlich durch den Ort und suche mein Rad. Aber mein Verstand lief ohnehin gerade auf Sparflamme. Ich ging in mein Zimmer, setzte mich aufs Bett und starrte eine Stunde lang auf mein Kopfkissen. Dann rief man mich zum Abendessen.
»Hast du die Hausaufgaben erledigt?«, fragte mein Vater ohne Interesse und biss in seinen Brokkoli.
»Größtenteils.«
»Warum nicht komplett?«
»Zu schwierig.« Außerdem blätterte Mr. Greystein sie vermutlich gerade durch.
Mein Vater erwiderte nichts und aß weiter.
Dann klingelte das Telefon.
Mein Magen zog sich zusammen.
Meine Mutter stand auf, schob ihr Haar zurück und ging in die Küche, wo der Apparat hing. Ich versuchte, mir Makkaroni mit Käse auf die Gabel zu schaufeln, konnte meine Hand aber kaum noch bewegen. Und schon allein der Gedanke, den Bissen herunterzuschlucken, weckte neue Übelkeit in mir.
Und ich wartete. Panisch lauschte ich auf Anzeichen, mit wem meine Mutter wohl gerade sprach. Kündigte sich die Polizei telefonisch an? »Hi, Mrs. Fletcher, hier sprechen Recht und Gesetz. Wir sind unterwegs, um Ihren Sohn zu verhaften. Falls Sie also Möbelstücke haben, die nicht im Kugelhagel durchlöchert werden dürfen, bringen Sie sie am besten schnellstens in die Garage.«
»Mmmm-hmmm«, sagte meine Mom in der Küche.
Dann lachte sie.
Gott sei Dank, es ging nicht um mich. Sofern die Person am anderen Ende nicht mit ein wenig Humor das Eis brechen wollte und ihr erst danach erklärte, dass ihr Sohn ein gesuchter Verbrecher war.
Meine Mutter sprach kaum eine Minute lang, dann kam sie zum Esstisch zurück. Ich sagte ihr, ich hätte Bauchschmerzen (die Wahrheit), und durfte gehen.
Am nächsten Morgen tat mir der Kopf stärker weh als je zuvor. Als hätte ich die ganze Nacht hindurch Glasscherben gegessen und mit rostigen Nägeln heruntergespült. Trotzdem musste ich zur Schule.
In der Mittagspause redete ich kurz mit Marty und Paul. Eigentlich redeten sie mit mir; sie lachten über unsere hektische Flucht und hießen mich in ihrem Club willkommen, während ich sorgenvoll zum Eingang unseres Speisesaals schaute und darauf wartete, dass Mr. Greystein erschien, flankiert von zwei bewaffneten Polizeibeamten. Weil ich weder Hausaufgaben noch Bücher bei mir hatte, bekam ich zwei Stunden Nachsitzen aufgebrummt. Eine lange Zeit, wenn man nichts anderes tun kann, als sich zu fragen, ob Mr. Greystein gerade mit den eigenen Eltern sprach.
Als ich endlich nach Hause kam, saß er tatsächlich auf unserem Wohnzimmersofa. Ich brach sofort in Tränen aus.
»Geh auf dein Zimmer«, sagte meine Mutter und klang weder wütend noch traurig. Ihre Stimme war stattdessen ungewöhnlich leise. »Dein Rucksack liegt am Fuß der Treppe. Mach deine Hausaufgaben.«
Ich schnappte mir den Rucksack, lief nach oben und setzte mich in den offenen Türrahmen, um dem Gespräch unter mir zu lauschen.
Doch ich schnappte nur Bruchstücke auf. »… ein guter Junge«, hörte ich Mr. Greystein sagen.
»… keine Entschuldigung …«, sagte mein Vater.
»… ein schwieriges Alter …«, sagte Mr. Greystein.
Und dann, glasklar zu verstehen, wieder mein Vater: »Wir kümmern uns darum.«
Die Haustür ging auf und wieder zu.
Ich saß da und wartete darauf, heruntergerufen und unvorstellbar streng bestraft zu werden. Doch fünf Minuten verstrichen. Zehn. Zwanzig.
Das war kein gutes Zeichen. Wenn sie so lange überlegten, konnte es nur übel werden. Normalerweise wusste meine Mutter schon Sekunden nach der Tat die passende Strafe – und oft genug sogar schon vor der Tat. Allerdings hatte ich noch nie etwas so Böses getan, es gab also keine Orientierungshilfe.
Eine Stunde.
Niemand rief mich zum Essen.
Ich wagte es nicht, trotzdem runterzugehen.
Zwei Stunden. Drei.
Ich ging ins Bett. Schlaf fand ich nicht.
Der Wecker ging um halb sieben und ich schälte mich aus dem Bett, noch immer angezogen. Als ich aufsah, standen meine Eltern in der Tür. Ich wollte wieder losheulen, zwang mich aber zur Ruhe. Tränen würden sie nur noch wütender machen.
Meine Mutter setzte sich zu mir aufs Bett, mein Vater blieb auf der Schwelle.
»Was hast du mit ihnen gemacht?«, fragte sie.
»Weggeworfen.«
»Warum?«
»Hab sie nicht gewollt.«
»Und warum hast du sie dann gestohlen?«
Ich zuckte mit den Schultern.
»Alex, warum hast du sie gestohlen?«
»Um in einen Club zu kommen.«
»Verstehe. Und denkst du, das war ein guter Grund?«
»Nein.«
»Warum hast du es dann getan?«
»Weiß nicht.«
»Na ich schätze, du findest es besser heraus.«
Ich schluchzte. »Muss ich jetzt ins Gefängnis?«
»Was denkst du?«
Ich schwieg.
»Nein, natürlich musst du nicht ins Gefängnis. Er hat nie die Polizei gerufen. Er will, dass du die Ware bezahlst, und denkt, du solltest ihm im Laden helfen. Für ein paar Stunden, an den Wochenenden. Er meint, du solltest lernen, was Verantwortung heißt.«
Ich nickte erleichtert. Also würde ich keine Zeit hinter Gittern verbringen, wo Mörder, Vergewaltiger und andere Kondomdiebe lebten. »Mach ich.«
»Nein, das machst du nicht. Du kommst auf eine neue Schule.«
»Ziehen wir um?«
»Nein.«
Ich dachte nach. In Trimble gab es nur eine Schule für Kinder meines Alters, und das bedeutete …
»Ich ziehe um?«
»Tut mir leid, Alex.«
»Schickt ihr mich weg?«
»Es ist keine Militärschule, aber eine für Kinder, die mehr Disziplin brauchen. Dein Vater und ich wissen ehrlich nicht, was wir sonst mit dir tun sollen.«
Nun kamen die Tränen, und ich versuchte nicht einmal, sie aufzuhalten. »Aber ich habe doch sonst nichts gemacht!«
»Das stimmt nicht, und das weißt du.«
»Es stimmt wohl! So etwas habe ich nie zuvor gemacht, und ich mache es nie wieder. Versprochen! Bitte!«
»Über die Konsequenzen hättest du dir früher Gedanken machen sollen.«
Ich schüttelte panisch den Kopf. »Ihr dürft mich nicht wegschicken! Das ist nicht fair!«
»Es ist völlig fair«, sagte meine Mutter. »Und du brauchst Hilfe.«
»Gar nicht wahr! Ich beweise es euch. Lasst es mich beweisen. Ich benehme mich, versprochen!«
»Du hattest deine Chance bereits.«
»Aber das war das erste Mal«, sagte ich wimmernd. »Und das letzte.«
Ich saß allein auf meinem Bett, mit zitternden Schultern, und Rotz und Tränen rannen über mein Gesicht.
Ich war ein ungezogenes Kind. Ein verdorbenes Kind. Ein schreckliches Kind.
Ich war ein Dieb und ein Lügner.
Ich verdiente es, auf diese Schule zu müssen. Ehrlich gesagt verdiente ich das Gefängnis!
Ich schreckliches, verdorbenes, durch und durch böses Kind.
Ich sah in den Spiegel, starrte mich einfach an. Dann zog ich die grausigsten Grimassen, die ich zustande brachte. Ich streckte die Zunge heraus, kniff die Augen zusammen und verzog das Gesicht zu einer Fratze, die einem Kind wie mir weit besser stand.
Einem schrecklichen Kind.
Dem schlimmsten Kind der Welt.
Es tat gut zu wissen, wie schrecklich ich war. Es war eine Erleichterung.
Denn andernfalls wäre ich ein furznormaler Junge, dessen Eltern ihn schlicht nicht mehr haben wollten.
Drei Wochen später war es so weit. Mit nichts als meiner Kleidung und einem Koffer mit Mühlebrett, Zauberkasten, einer kleinen Tüte Schokokekse und Farley, meinem Plüschwalross, saß ich im Wagen, unterwegs zur Branford Academy.
2
»Hier an der Branford Academy wirst du die Regeln befolgen«, sagte Mr. Sevin, der Direktor. Er war in den Sechzigern, klein, größtenteils kahl und beinahe absurd dünn. Gebrechlich wirkte dieser Mann aber ganz und gar nicht. Obwohl nur meine Eltern und ich in seinem Büro saßen, redete er so laut, als spräche er zu einer ganzen Aula voller Kinder.
»Du wirst jeden Morgen um Punkt halb sechs aufstehen. Das Konzept eines Snooze-Alarms existiert bei uns nicht. Frühstück gibt es um Viertel nach sechs im Speisesaal. Der Unterricht beginnt um exakt sieben Uhr und endet um halb zwölf, gefolgt von einer Stunde Mittagspause und weiteren dreieinhalb Stunden Schule. Von Punkt 16 Uhr bis 18 Uhr wirst du Hausaufgaben machen, dann gibt es Abendessen. Die Zeit zwischen 19 Uhr und 20:30 Uhr dient weiteren Studien oder Gruppenaktivitäten, und von 20:30 Uhr bis 22 Uhr hast du Freizeit, sofern du dir dieses Privileg verdient hast. Um Punkt 22 Uhr ist Bettruhe.«
Er sah uns an, als wüsste er nicht, ob wir ihn verstanden hatten. Dann nickte er zufrieden. »Kommst du zu spät zum Unterricht, wirkt sich das auf deine Noten aus. Alle Hausaufgaben müssen fristgerecht erfüllt werden, andernfalls erhältst du automatisch eine 6.«
Ich hob die Hand. Mr. Sevin blinzelte so überrascht, als wäre ihm nie eine größere Respektlosigkeit untergekommen. »Ja?«
»Und wenn ich krank bin?«
»Schüler, die tatsächlich krank sind, kommen auf die Krankenstation. Über ihre Unterrichtspflichten wird von Fall zu Fall entschieden. Ich kann deinen Eltern versichern, dass wir medizinisch exzellent versorgt sind. Dir, Mr. Fletcher, versichere ich allerdings, dass es unmöglich ist, uns Krankheiten vorzugaukeln. Die Zeiten, in denen du Bauchschmerzen vorgetäuscht hast, um einem Test zu entgehen, sind vorbei.«
»Das habe ich nie.«
Einen Moment lang rechnete ich fest damit, er würde mir ins Gesicht schlagen. »Mr. Fletcher, mir ist bewusst, dass deine Eltern noch hier sind. Aber ab sofort wirst du die Verhaltensregeln der Branford Academy befolgen, was bedeutet, dass du den Mund hältst, wenn Erwachsene sprechen. Ist das klar?«
»Ja, Sir.«
»Er meinte bloß, dass er sich nie krank stellt, um den Unterricht zu schwänzen«, erklärte meine Mutter.
»Mein Beispiel war rein hypothetisch«, sagte Mr. Sevin. »Und viele neue Schüler, die nicht an unseren hohen Standard gewöhnt sind, schieben Krankheiten vor, um ihren Pflichten zu entgehen. Entsprechend deutlich möchte ich hier sein: Das wird nicht gelingen. Ihr schlaft zu viert pro Zimmer. Die entsprechenden Regeln erklärt man dir, wenn du im Schlaftrakt ankommst. Verstößt du gegen sie, werden dir Privilegien aberkannt, darunter Freizeit, Post – eingehende wie ausgehende – und Hofverbot bis Samstag. Diese Strafen gelten stets für alle vier Jungs in einem Zimmer. Du bist also nicht nur für dein eigenes Verhalten verantwortlich, sondern für das deiner Zimmergenossen. Irgendwelche Fragen?«
Wir hatten keine Fragen.
Mr. Sevin sah mich an. »Es ist nicht üblich, dass wir Schüler im laufenden Semester annehmen. Aber wir hatten kürzlich einen Schulverweis. Ich hoffe, diese Ausnahme erweist sich nicht als Störung.«
Er klang, als müsste ich ihm dankbar sein, dass er mich bleiben ließ. Ich wollte ihn schon fragen, in welchem magischen Universum er lebte, wo dieses Höllenloch ein Grund für Dankbarkeit sein sollte, aber auf derartige Kommentare reagierte er bestimmt nicht gnädig.
Meine Eltern unterschrieben ein paar Dokumente, dann nannte man uns den Weg zu Wohnheim B. Während des fünfminütigen Marsches schwieg ich und zwang mich, nicht die verzweifelte Frage zu stellen, die mir auf der Zunge lag. Doch als wir das viergeschossige Gebäude aus weißem Backstein betraten, konnte ich nicht mehr anders. Ich klang sogar, als würde ich betteln.
»Gibt es denn gar nichts, was ich tun kann, um nicht hierzubleiben?«
Es gab nichts.
Es gab keine Führung, die den Namen verdiente. Der Typ, der hier das Sagen hatte, wirkte genervt, als wir ihn bei der Zeitungslektüre störten. Er wies in die Richtung, in der ich meine Post finden würde (sofern ich dieses Privileg behielt), und führte uns zwei Treppen hinauf zu Zimmer 308. Er schloss die Tür auf und winkte uns hinein.
Es war nicht so schlimm wie erwartet. Allerdings hatte ich schon mit nackten grauen Wänden, eisernen Gittern und Matratzen aus Stein und ohne Kissen und Decken gerechnet. Oder mit individuellen Folterkammern, komplett mit behaartem Gentleman mit Henkersmaske. Stattdessen sah ich Etagenbetten an den Seiten des Zimmers und zwei Tische mit jeweils zwei Stühlen. Der Raum war penibel sauber, zumindest für meinen Geschmack, doch drei Poster – eins von einem Dalmatiner, eins von einem Mops und eins von Star Wars – brachten etwas Leben hinein.
»Die Siebtklässler sind noch nicht zurück«, sagte der Typ. Er hatte sich nicht vorgestellt. »Sie besuchen ein Museum, glaube ich. Das dauert wohl noch ein bis zwei Stunden. Keine Ahnung, ob Sie so lange was essen gehen wollen oder so.«
Ich dachte schon, meine Mutter würde ihn bitten, mich bei sich zu behalten. Doch: »Das klingt gut. Alex, hast du Lust auf McDonald’s?«
Ich nickte.
Ich sagte nichts während meiner letzten Mahlzeit und schaffte den Big Mac auch kaum zur Hälfte. Meine Eltern redeten darüber, was für eine tolle Chance das alles für mich sei, welche wundervollen Türen sich für meine Zukunft öffnen würden und welch schönen Urlaub wir drei im Sommer verleben würden. Ich tat so, als würde ich mich mit ihnen freuen. Vielleicht fühlten sie sich dann weniger schuldig.
Nach dem Mittagessen gingen wir in eine Shoppingmall, um letzte Vorräte zu besorgen. Da mir aber keine einfielen, gingen wir einfach anderthalb Stunden ziellos durch die Gegend, bis es Zeit wurde.
Als wir zurückkehrten, stand derselbe Typ da. Meine Mutter weinte ein wenig bei der Verabschiedung, und mein Vater tätschelte mir die Schulter und trug mir leise auf, tapfer zu sein. Dann führte mich der Typ nach oben und öffnete die Tür, ohne anzuklopfen.
»Da wären wir«, sagte er, und als ich eintrat, schloss er die Tür kommentarlos hinter mir.
Ich blieb reglos stehen. Die drei Jungs glotzten mich an, von Kopf bis Fuß. Zwei saßen auf dem Boden, wo sie Karten spielten. Der andere saß am Tisch und las ein gebundenes Buch.
»Hey«, sagte einer vom Boden. Er war groß gewachsen und übergewichtig, hatte ein teigiges Gesicht, kurzes blondes Haar und eine Brille mit Drahtgestell.
»Hi«, würgte ich hervor.
»Was ist mit deinem Kinn passiert?«
Schamvoll hob ich die Hand zu dem rosafarbenen Klecks auf meinem Kinn. »Ich kam so zur Welt.«
»Sieht cool aus.«
»Danke«, sagte ich und entspannte ein wenig.
»Wie heißt du?«
»Alex.«
»Alex wie?«
»Fletcher.«
»Ich bin Peter McMullen.«
Der zweite Junge am Boden hatte ebenfalls kurzes Haar, allerdings schwarzes. Außerdem war er von durchschnittlicher Statur. Er legte seine Karten weg. »Und ich bin … Jeremy!« Es klang, als kündigte er eine Rockband an. Er machte sogar die Jubelgeräusche eines Publikums nach.
»Hi.«
»Willst du mitspielen?«, fragte Peter. »Crazy Eights.«
»Klar.«
Ich setzte mich zu ihnen auf den Boden. Der Junge am Schreibtisch hatte dunkle Haut und dichtes schwarzes Haar, das ihm fast über die Augen ging. Das war ein gutes Zeichen, denn dann würde man mir ebenfalls keinen Militärschnitt aufzwingen. Der Junge sah von seinem Buch auf, als wartete er darauf, dass man ihn vorstellte. Als das niemand tat, las er einfach weiter.
»Was bringt dich hierher?«, fragte Peter und mischte.
»Ich hab geklaut.«
»Cool! Was denn?«
Ich wollte schon die Wahrheit sagen, bremste mich aber. »Süßigkeiten.«
»Mehr nicht?«
»Nee.«
»Die haben dich hierhergeschickt für ein bisschen Schokolade?«
»Und ein paar andere Sachen«, sagte ich schnell. Was sie wohl von mir denken mochten, wenn sie wüssten, dass meine Eltern nur einen Grund gebraucht hatten, mich loszuwerden? Mit einem Kind, das so unerwünscht wie ich war, musste ja etwas nicht stimmen!
»War es wenigstens guter Süßkram?«, fragte Peter.
»Snickers.«
»Ja, das ist ziemlich gut. Hätte ich wahrscheinlich auch gestohlen.« Er nickte anerkennend und teilte die Karten aus.
»Warum bist du hier?«, fragte ich.
»Weil ich dumm bin.«
»Auf seiner alten Schule hatte er schlechte Noten«, sagte Jeremy.
»Jepp. Weil ich dumm bin.«
»Ich wüsste gern, warum 1, 2, 3, 4, 5 und 6 Schulnoten sein sollen, aber die 7 nicht.« Jeremys Stimme wurde ein bisschen tiefer, als er diese clevere Beobachtung formulierte.
»Weil niemand dümmer als eine 6 ist, du Dummkopf.«
»Und wer ist so dumm?«
»Na ich.« Peter rollte mit den Augen und ließ die Zunge heraushängen. So sah er wirklich ziemlich dumm aus.
»Ich meine ja nur.« Jeremy stand auf. »Wenn wir in der Schule Sachen lernen sollen, müsste es auch darauf eine Antwort geben.« Er lief zum Tisch, an dem niemand saß, und notierte sich etwas auf einem Spiralblock.
»Was macht er da?«, fragte ich Peter.
»Sich witzig vorkommen.« Peter nahm Jeremys Karten vom Boden und betrachtete sie.
»Ist es schlimm hier?«, fragte ich.
»Manchmal. Nicht immer. Es kann auch cool sein, aber dafür musst du deine Hausaufgaben pünktlich fertig bekommen, dein Zimmer sauber halten und nie zu spät kommen. Es gibt Zeug, für das sie das komplette Zimmer bestrafen. Aber ich sag dir schon, was du machen musst.«
»Danke.«
»Guckt ja nicht auf meine Karten«, sagte Jeremy und klappte seinen Block zu.
»Nie und nimmer«, erwiderte Peter.
»Du hast sie doch schon in der Hand.«
»Aber nur, um sie vor Darren zu beschützen.«
Der Junge vom Tisch sah wieder von seinem Buch auf. »Haha.«
»Hihi«, sagte Peter.
»Hoho«, ergänzte Jeremy.
Dann sahen sie erwartungsvoll zu mir. »Harrharr«, sagte ich.
Jeremy setzte sich und nahm Peter seine Karten ab. »Was ist jetzt? Spielen wir, oder wie? Und wer hat diesen Müll ausgeteilt, hm? Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass jede Figur auf den Karten einen zweiten Kopf statt eines Popos hat? Das sind alles Po-Köpfe.«
»Den Witz hast du schon mal gebracht«, sagte Peter.
»Wären sie dann nicht eher Arschgesichter?«, fragte ich.
Jeremy stutzte und legte die Karten erneut weg. »Wartet kurz«, sagte er und ging zu seinem Tisch zurück.
»Warum bist du eigentlich hier?«, fragte ich, als er den Block zum zweiten Mal aufschlug.
»Ich bin Peters Babysitter.«
»Nee, im Ernst.«
»Meine Eltern haben schon meine großen Brüder hier abgesetzt, und weil das denen so gutgetan hat, bin ich auch hier. Aber nebenbei verdiene ich Geld als Peters Babysitter.«
Ich sah zu Darren hinüber, dem ich dieselbe Frage stellen wollte, doch er las längst wieder in seinem Buch.
Also spielten wir Karten, etwa eine Stunde lang. Ich war traurig, ängstlich und ich vermisste meine Eltern, aber ich spürte, dass ich mit Peter und Jeremy prima zurechtkommen würde.
Um zehn vor sechs versammelte sich das gesamte Wohnheim im Freien. Wir stellten uns in einer langen Reihe auf und gingen gemeinsam zum Speisesaal, der im Nachbargebäude lag. Als wir auf unseren Plätzen saßen, ließ ich den Blick schnell schweifen. Insgesamt mussten an die 400 Kinder hier versammelt sein, von zwölf bis 16 Jahren. Zehn Schüler schoben Servierwagen an den Tischen vorbei und reichten uns je ein in Zellophan gewickeltes Tablett und eine Milchtüte.
»Donnerstags ist das da dein Job«, erklärte mir Peter.
Zum Essen gab es Hackbraten, Püree, Karotten und ein Brötchen.
Alles schmeckte unbeschreiblich mies. Der Hackbraten schmeckte wie der Kartoffelbrei, und der schmeckte arg nach den Karotten. Nur das Brötchen schmeckte nach überhaupt nichts.
Erfolgreich kämpfte ich gegen die Tränen an, als ich mich an den Hackbraten meiner Mutter erinnerte. Dabei war der, ehrlich gesagt, auch nie super gewesen.
Nach dem Essen führten Peter und Jeremy mich kurz über das Gelände. Es gab zwei Wohnheime, eine Bibliothek, ein Schul- und ein Verwaltungsgebäude sowie einen Sportplatz. Selbst mit meinem miserablen Orientierungssinn hatte ich keine Angst, mich hier zu verlaufen.
Als wir wieder auf unserer Stube waren, spielten wir Karten. Peter erzählte mir von Killer Fang, seinem Cockerspaniel, der aktuell sein heimisches Zimmer bewachte und seine wertvollen Besitztümer vor bösen Eindringlingen beschützte. Peters größter Wunsch war es, so behauptete er zumindest, die Branford Academy endlich zu überzeugen, Jeremy gegen diesen Hund auszutauschen.
Jeremy betonte mehrfach, dass Hundeliebhaber oft ihren Lieblingen ähnlich sähen. Dabei deutete er anschaulich auf das Poster mit dem Mops.
Darren las einfach sein Buch.
Um zehn Uhr hieß es: Licht aus. Wir gingen schlafen. Ich war schrecklich müde, hatte ich doch die Nacht zuvor kaum geschlafen. Dennoch fiel es mir nun schwer.
In der folgenden Nacht schlief ich, wenn auch aus purer geistiger Erschöpfung. Die gesamte erste Woche schlief ich recht ordentlich und wachte nur zweimal weinend auf. Zum Glück weckte ich meine Zimmergenossen dabei nicht. Oder stellten sie sich nur schlafend, damit ich mich nicht schämen musste?
Erst in der dritten Woche schlief ich richtig durch, und allmählich gewöhnte ich mich auch an die Routinen auf der Branford Academy. Die Lehrer waren unfassbar streng, aber die Schulbücher waren leichter als zuvor, und ich kam schnell in den Stoff rein. Ich achtete darauf, Hausarbeiten pünktlich abzugeben, und ich lernte gewissenhaft für jeden Test. Es gab keine Probleme.
Die Wohnheimregeln waren sehr eindeutig: Die Zimmer waren allzeit makellos sauber zu halten und wurden mindestens einmal pro Woche spontan kontrolliert. Nach 22 Uhr herrschte Ruhe. Nächtliche Gänge zur Toilette blieben uns aber großzügigerweise gestattet.
An das Essen gewöhnte ich mich nie. Jede Mahlzeit war so übel, dass der Koch sie absichtlich versauen musste. Die ersten sechs, sieben Gerichte hätte ich noch mit Inkompetenz entschuldigt, alle weiteren waren aber ein Beweis für Bosheit.
Peter und Jeremy nahmen mich bereitwillig bei sich auf, und zu dritt hingen wir oft ab wie die besten Freunde. Mit Darren redete ich kaum, obwohl wir im selben Zimmer wohnten. Wenn er nicht lernte, las er, kritzelte fieberhaft in sein Notizbuch oder starrte einfach ins Leere.
Meinem Zuhause hätte ich sie wohl nie vorgezogen, aber allzu übel erschien mir die Branford Academy während dieser ersten drei Wochen gar nicht.
Doch 23 Tage nachdem meine Eltern mich dort abgesetzt hatten, wurden meine Zimmergenossen bestraft. Meinetwegen.
3
Dabei hatte ich den Geschichtsaufsatz gar nicht vergessen! Nur die letzte Seite musste irgendwie aus der Büroklammer gerutscht sein.
Ich konnte natürlich zurück ins Wohnheim rennen, aber dann kam ich zu spät zum Unterricht. War das besser als unvollständige Unterlagen? Ich war noch nie zu spät gekommen, daher würde ich vielleicht mit einer Verwarnung davonkommen.
Selbstverständlich war es verboten, auf den Wegen zu rennen, aber es galt nur als kleines Vergehen. Bei meinem bisher makellosen Verhalten brachte mir auch das vermutlich nur einen Rüffel ein.
Der Zusammenstoß war allerdings übel. Richtig übel.
Ich lief blindlings gegen Mr. Wolfe, meinen Mathelehrer. Die Blätter, die er trug, flogen in alle Richtungen, manche getragen vom Wind. Durch, wie ich gerne denke, göttlichen Beistand war es nicht er, der zu Boden ging, sondern zum Glück nur ich.
Wolfe sagte kein Wort und begann schlicht, seine Unterlagen einzusammeln, die zum Teil auf der Wiese gelandet waren. Nach einem erschreckend langen Augenblick der Unentschlossenheit ging ich ihm zur Hand. Ein paar Minuten später reichte ich ihm meinen Stapel.
»Pass beim nächsten Mal besser auf«, sagte er.
Ich ging in mein Wohnheim, um die letzte Seite meines Aufsatzes zu holen. Und zwar vorsichtig!
Als wir an dem Abend vom Essen zurückkamen, hing etwas Rotes an unserer Tür. Mein Magen zog sich zusammen. Es handelte sich um ein hellrotes Schild, ähnlich wie die »Bitte nicht stören«-Schilder aus den Hotels. Offiziell hießen sie »Verweis«, wir Schüler nannten sie aber »Blutzeichen«. Man sah sie schon vom Ende des Ganges aus, und genau das sollte man auch. Der ganze Flur wusste es, wenn eine Tür »blutig« war. Seit meiner Ankunft an der Branford Academy hatte ich erst eine gesehen, unten im zweiten Stock. Damals waren wir alle hingegangen, um sie anzugaffen wie die Touristen. Ich wusste, wie ernst diese Schilder waren.
»O Scheiße«, sagte Jeremy, als wir den Gang entlanggingen.
»Was haben wir gemacht?«, fragte Peter.
Ich hatte ihnen den Vorfall vom Nachmittag nicht beschrieben. Selbst jetzt redete ich mir noch ein, es sei bloß ein Zufall und einer von ihnen der wahre Übeltäter. Vielleicht hatte Peter ja heißen Kaffee über einen Lehrer geschüttet oder Jeremy auf Mr. Sevins Auto gekübelt. Irgend so was.
Jeremy rannte voraus und nahm das Schild von unserer Klinke. Wir liefen ihm nach, und als er es hochhielt, konnten wir unsere vier Namen darauf lesen, säuberlich in Blockschrift. Die Ermahnung sollte sofort erfolgen.
Wenigstens würden wir nicht lange warten. Jeremy hatte mir von Zimmergenossen erzählt, die vor Jahren an einem Montag das Blutzeichen bekommen hatten, aber erst am Freitag bestraft werden sollten. Am Donnerstag hatten sie sich vier Stricke genommen und sich in ihrem Zimmer gemeinschaftlich aufgehängt. Drei von ihnen starben, einer brach sich bloß das Genick. Er lebte inzwischen in einer Irrenanstalt, war querschnittsgelähmt und brüllte dauernd vor Entsetzen, weil ihm eine grausame Pflegerin rote Schildchen an die Tür seiner Gummizelle hängte.
Die Geschichte war nicht gerade glaubhaft. Warum brauchte ein Querschnittsgelähmter eine gepolsterte Zelle? Und warum sollte deren Tür innen eine Klinke besitzen, an die man Dinge hängen konnte? Dennoch drehte sich mir nun beinahe der Magen um, und ich verstand, warum blutige Türen einen Menschen in den Wahnsinn treiben konnten.
Schweigend gingen wir zurück zur Treppe, verlorene Männer auf dem Weg der Verdammten.
Wir gingen zum Verwaltungsbau. Mr. Sevins Bürotür stand offen, und seine Sekretärin bat uns zu warten. Wir saßen auf unbequemen Plastikstühlen vor seinem Tisch.
»Wie ich höre, gab es heute Nachmittag einen Zwischenfall?«, fragte Mr. Sevin und sah mich über den Rand seiner Brille an.
Ich ignorierte die tadelnden Blicke, die mir Peter, Jeremy und Darren zuwarfen, nur mühsam. »Ja, Sir.«
»Mr. Fletcher, dir ist doch bewusst, dass unsere Schüler ihre Hausarbeiten stets mit in den Unterricht bringen müssen. Oder?«
»Ja, Sir.«
»Diese Anforderung ist wahrlich nicht schwer zu verstehen. Und unter normalen Umständen würde dein Verhalten eine schlichte Verwarnung rechtfertigen. Doch aufgrund des … äh, unglücklichen zusätzlichen Aspekts der Situation muss ich leider dein gesamtes Zimmer bestrafen.«
»Aber es war ein Unfall«, beharrte ich.
»Ein Unfall, der sich nicht wiederholen wird«, sagte er. »Für euch vier ist der Ausflug nach Perkinville an diesem Wochenende gestrichen. Stattdessen bleibt ihr hier in der Schule und macht euch nützlich.«
Jeremy stöhnte hörbar.
»Die anderen haben gar nichts gemacht«, sagte ich.
»Mr. Fletcher, kritisierst du etwa die Methoden der Branford?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Wenn ich eine Frage stelle, erwarte ich eine verbale Antwort, keine Pantomime.«
»Nein, Sir.«
»Gut. Dann sorgst du hoffentlich in Zukunft dafür, alle notwendigen Unterlagen bei dir zu haben, wenn du dein Zimmer verlässt, und bewegst dich weniger turbulent über das Gelände.«
»Ja, Sir.«
»Gut. Ihr dürft gehen.«
»Was für eine Scheiße«, murmelte Jeremy und ließ sich aufs Bett fallen.
»Tut mir ehrlich leid«, sagte ich zum sechsten oder siebten Mal, seit wir das Verwaltungsgebäude verlassen hatten. »Ich wollte euch keinen Ärger machen.«
»Auf Perkinville freue ich mich schon den ganzen Monat«, sagte Jeremy. »Warum hast du denn nicht einfach an die blöde Hausarbeit gedacht?«
»Hab ich doch schon gesagt: Die Seite ist rausgefallen.«
»Weil du so turbulent bist«, sagte Peter grinsend. »Ich hasse turbulente Menschen. Ich finde, wir sollten alle ein bisschen weniger turbulent sein. Jeremy, wisch dir diesen turbulenten Ausdruck aus dem Gesicht!«
»Das ist nicht witzig.«
»Doch, irgendwo schon.«
»Nein, ist es nicht. Wir wollten doch ins Kino!«
»Du weißt gar nicht, was turbulent bedeutet«, sagte Jeremy. Dann drehte er sich auf die Seite und starrte mich an. »Halt dich eine Weile von mir fern, okay?«
»Wie soll das denn gehen?«, fragte Peter. »Ihr wohnt im selben Zimmer, du Spinner.«
»Halt’s Maul.«
»Halt du doch deins.«
»Lass ihn, Peter«, sagte ich. »Er hat jedes Recht, wütend zu sein. Ich wäre das garantiert auch.«
»Aber er muss sich nicht anstellen wie ein verweichlichtes Arschloch.«
»Ich bin kein Arsch«, sagte Jeremy. »Das ist bloß unfair, weiter nichts.«
»Pff! Die gesamte Schule ist unfair. Deshalb sind wir doch hier.«
»Warum streitet ihr euch nicht noch lauter?«, fragte Darren. »Dann bekommen wir noch mehr Schwierigkeiten. Wäre es nicht toll, wenn wir bis ans Lebensende auf dem Schulgelände bleiben müssten?«
Alle schwiegen.