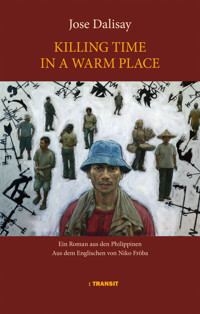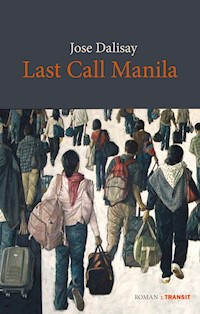
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Transit
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Zinksarg trifft auf dem Manila International Airport ein, in dem laut Begleitschein eine Tote namens Aurora V. Cabahug liegt. Ein Polizist, der den Sarg in ihre Heimatstadt transportieren soll, kennt den Namen der Frau – er hat sie erst gestern als Sängerin »Rory« in einer Bar gesehen. Er erfährt, dass die Tote die Schwester von Rory ist, die unter deren Namen nach Saudi-Arabien als Dienstmädchen vermittelt wurde. Aus der Recherche, warum sie das tat, ob und warum sie umgebracht wurde, wie sie auf den Philippinen und dann in Hongkong und Saudi-Arabien gelebt hat, entwickelt sich ein wunderbar erzählter Einblick in eine Gesellschaft, in der es fast in jeder Familie mindestens eine Frau oder einen Mann gibt, die in weit entfernten Ländern, in Westeuropa, Arabien, Skandinavien oder den USA arbeiten, um dort Geld für ihre Familien zu verdienen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Für meine Mutter Emilia.
Und mit herzlichem Dank für die Unterstützung durch Mr. David T. K.Wong, die University of East Anglia und die Rockefeller Foundation.
Jose Dalisay
Last Call Manila
Aus dem Englischen übersetzt von Niko Fröba
Diese Veröffentlichung wurde unterstützt durch den National Book Development Board, Translation Subsidy Program, Philippines.
Die Übersetzung aus dem Englischen wurde mit Mitteln des Auswärtigen Amts unterstützt durch Litprom e.V. – Literaturen der Welt
© 2008 Jose Dalisay
Originalausgabe:
Jose Dalisay, Soledad’s Sister (2008, 2009,2018)
ANVIL PUBLISHING, INC.
Mandaluyong City, Philippinen
© 2023 für die deutsche Ausgabeund Übersetzung:
TRANSIT Buchverlag
Postfach 12 03 07 | 10593 Berlin
www.transit-verlag.de
Layout und Umschlaggestaltung unter
Verwendung des Gemäldes »Diaspora« (2007)
von Antipas Delotavo: Gudrun Fröba
eISBN 978-3-88747-450-8
Inhalt
Die Frau in der Kiste
Die Verwandtschaft der Toten
Eine Busladung voller Regines
Der Anblick von Trauer
Bis zur Unkenntlichkeit
Vollmond in Hongkong
Ein Berg frisch gewaschener Wäsche
Der Tatort
Über Wasser gehen
Ein neues Zuhause
Eine Schwesternschaft aus Trauer
Das kreischende Holz
Eine auffällige Verfärbung
Die märchenhafte Fontäne
Glossar
Die Frau in der Kiste
An einem wolkenverhangenen Abend, einem Samstag im August, landete am Ninoy Aquino International Airport, zweihundertsiebenunddreißig Kilometer westlich von Paez, eine Leiche in einem Zinksarg, der in einer Holzkiste befördert wurde. Der Begleitschein gab den Namen der toten Frau als »Cabahug, Aurora V.« an. Um 18 Uhr 34, gerade als in der City die Autofahrer ihre Scheinwerfer einschalteten und eine Million Gasöfen laut angeworfen wurden, kehrte Aurora V. Cabahug in ihrem Flugzeug zur Erde zurück, obwohl noch nicht ganz; sie lag tief unten im Frachtraum der Gulf Air 747, da, wo es am kältesten war, nur durch eine dünne Wand getrennt von Tiger-Orchideen und Aprikosen. Sie war sehr früh in Jeddah los geflogen, viel früher als es den Anschein hatte, denn die Maschine flog vor der Zeit her – viertausenddreiundfünfzig Meilen von Jeddah nach Bangkok, machte einen Zwischenstopp von einer Stunde und fünfundzwanzig Minuten, um die Orchideen und andere kostbare, verderbliche Dinge zu laden, bevor sie ihre Fracht über nochmal eintausenddreihundertachtundsechzig Meilen nach Manila brachte. Binnen einer Stunde war sie entladen, flog wieder zurück nach Jeddah, wieder über Bangkok, am nächsten Morgen sollte sie wieder um 10 Uhr 20 startklar sein – während nochmal drei Tage im gekühlten Zoll-Lager vergingen, bis Aurora V. Cabahugs Körper wieder in der mikrobenfreundlichen Wärme ihres Landes ankam.
Es war eine Reise über fünftausend Meilen und das Tageslicht begleitete sie fast über den ganzen Indischen Ozean. Das Flugzeug war bis auf den letzten Platz besetzt, als es Bangkok verließ, wo ein Jet der Thai Airways mit Ziel Manila, von Frankfurt kommend, Probleme mit der Hydraulik hatte und dreiundzwanzig der sechsundachtzig philippinischen Passagiere in die Gulf Air-Maschine umgebucht wurden. Die neu Zugestiegenen besetzten alle noch freien Plätze, verstauten zollfreie Hifi-Geräte oder andere Mitbringsel und brachten so Zahnarzt und Handwerker, Pianist und Nagelpflegerin, Professor und Installateur zusammen. Wie immer klatschten und jubelten die philippinischen Arbeiter auf ihren Plätzen, als die Reifen des Flugzeugs auf dem Boden aufsetzten; einige schlugen ein Kreuz, schlossen die Augen und murmelten ein Gebet. Die Flugbegleiter und die saudi-arabischen Geschäftsleute waren daran gewöhnt, aber einige Filipinos, die in Bangkok, von Seminaren in Leuven oder Pilgerreisen nach Rom kommend, umgestiegen waren, fühlten sich gestört und peinlich berührt von dem Applaus, der die Kabine füllte, und schauten angestrengt nach vorn oder auf ihre Uhren und Zeitschriften. Ihre weniger vornehmen Landsleute pressten die Nasen gegen die Fenster, als ob sie erwarteten, dass die Flughafenlichter erloschen und das Flugzeug kehrtmachen könnte, zurück in die blendend helle Wüste.
Am Ninoy Aquino stiegen insgesamt drei Piloten, acht Flugbegleiter und zweihundertsiebenundsechzig Passagiere aus dem Flugzeug in die Gangway zur Ankunftshalle. Die Crew eilte durch einen Extraausgang an den Immigrations- und Zollschaltern vorbei zu einem Van, der sie schnell in ihr Hotel am Rande der Bucht bringen sollte. Alle anderen, mit teuren Einkäufen unterm Arm, marschierten in die stickige Empfangshalle mit Passkontrolle und Gepäckausgabe, dem Zoll, und einer lächelnden Menge hinter den Absperrungen. Außerhalb warteten schnurrende Taxis und Jeepneys* und ein heftiger Platzregen, der Brillengläser und Fenster beschlagen ließ und die Leute zu schnellen, bequemen, manchmal desaströsen Entscheidungen zwang. Die Mittagsnachrichten am nächsten Tag brachten eine Geschichte über zwei Maurer und einen Elektriker, die ihre Jahreslöhne, verdient in Al-Khobar, an eine Gang verloren hatten, die ihnen eine billige Fahrt nach Novaliches in ihrem Toyota Tamaraw angeboten hatten; nach unbestätigten Berichten verbrachte eine Kosmetikerin aus Dammam, die ihren Freund im Regen übersehen hatte, die Nacht in einem Motel in Pasay mit einem hilfsbereiten Polizisten, der sie in seinem Jeep mitgenommen hatte; auch die Flugbesatzung, die so schnell aus dem Flughafen geflohen war, verlor eine Menge Zeit, weil der Fahrer ihres Nissan-Vans wegen eines Verkehrsstaus eine, wie er meinte, Abkürzung nahm und dann auf einer engen Straße hinter einem Lastwagen, beladen mit Fahrrädern und Matratzen, hängen blieb. Der Regen verwandelte verzinkte Blechdächer in straff gespannte Trommeln, prasselte auf eilig ausgerollte Planen und suchte den schnellsten Weg zurück ins offene Meer, wurde aber an jeder Kurve aufgehalten.
Die tote Frau erwarteten keine solcher Komplikationen, sie hatte alle Flugpläne und plötzlichen Wetterumschwünge hinter sich gelassen. Es gab ein Problem mit ihrer Leiche – niemand war da, dem man hätte sagen können, dass sie da war, aber sie konnte nichts dafür, jetzt und für immer. Und es gab kaum etwas, das jemand für sie tun konnte, außer dieser eher kümmerlichen Geste, sie umsonst nach Hause zu fliegen, ein Paragraph in einem Gesetz, das Menschen betraf, die gestorben, aber noch nicht beerdigt waren.
Die mit * gekennzeichneten Begriffe und Namen werden im Glossar erklärt.
Der Totenschein, in einer Plastikhülle auf ihren Sarg geklebt, gab einfach nur an, dass sie ertrunken sei. »Ertrunken, Forensik Jeddah.« In den letzten Momenten, als sie noch atmete – entweder kurz davor oder kurz danach – war der Körper mit Wasser in Berührung gekommen, hatte es geschluckt oder war von ihm geschluckt worden. Es waren keine weiteren Dokumente dabei – kein Polizeibericht, kein Autopsiebericht, nur der Schein mit einem Stempel der Flughafenpolizei vom Abdul Aziz Airport in Jeddah. Das Konsulat und die lokale Polizei dort hatten ihren Pass nicht ausfindig machen können – der normalerweise von den Arbeitgebern ausländischer Arbeitskräfte einbehalten wurde im Tausch für eine Iqama* oder einen zeitlich begrenzten Identitätsausweis, aber selbst diese Arbeitserlaubnis war bei der Leiche nicht gefunden worden. Und deswegen hatte es einige Zeit gedauert, bis die Behörden ihre Identität feststellen konnten; jedenfalls war ihr aufgedunsenes Gesicht keine Hilfe. Erst als ihre völlig durchnässte Abaya* getrocknet war, ergaben sich aufgrund der billigen Qualität und des schlechten Schnitts erste Hinweise, die auf eine Frau von niedrigem Status deuteten. Keine saudische Frau aus Jeddah war in den vergangenen drei Tagen als vermisst gemeldet worden, was ungefähr der Zeit entsprach, in der die Leiche im Wasser gelegen hatte, und so wurden Untersuchungen angestellt über vermisste oder geflohene Dienstmädchen oder Arbeiterinnen – eine Suche, die zu nicht weniger als hundertdreiundsechzig Treffern führte allein für die letzten sechs Monate und die alles beinhaltete von sudanesischen und russischen Prostituierten bis zu indonesischen Köchinnen – aber ein Bericht erschien besonders treffend, und der hatte mit dem plötzlichen Verschwinden vom Arbeitsplatz einer aus den Philippinen stammenden Aurora V. Cabahug, sechsundzwanzig, zu tun. Sie war als vermisst gemeldet, gemeinsam mit einem indischen Dienstmädchen namens Meenakshi, die vermutlich auch weggelaufen war. Bei einer höflichen Befragung behauptete Cabahugs Arbeitgeber, nichts weniger als ein saudischer Prinz, vertreten durch einen Bediensteten namens Yusuf, dass die beiden schon vor etlichen Tagen verschwunden seien und dabei wertvolle Sachen hätten mitgehen lassen, unter anderem einen goldenen Montblanc-Füller, den Prinz Khaled auf seinem Nachttisch hatte liegen lassen; trotz des väterlichen Vertrauens und der Fürsorge seines Herrn, so Yusuf, hätten sich alle beide als undankbar und diebisch erwiesen.
Und so wurde die Leiche zur Untersuchung den zuständigen Stellen in der Botschaft und von dort der »OWWO Manila«, dem Overseas Workers Welfare Office, übergeben. Falls niemand beim Frachtlager des Flughafens Manila wegen dieser Aurora V. Cabahug einen Anspruch anmeldete, müsste ein Angestellter der OWWO über viele Treppen in den Keller steigen, wo Knie und Ellbogen auf Rohre stießen, ein Raum voller aneinandergereihter Stahlschränke, und sich dann durch feuchte, muffige Aktenordner wühlen, um simple Fakten über ihr Leben, Geburtsdatum, Geburtsort, Familienstand, Größe, Gewicht, Heimatadresse, herauszufinden.
Niemand war da, der sie sehen wollte; niemand wusste überhaupt, dass sie da war, weil ein philippinischer Vizekonsul in Riad verschiedene Todesfälle, seine Landsleute betreffend, durcheinandergebracht hatte. Es waren in dieser Woche drei in verschiedenen Aktenbergen: einer in Jeddah, einer in Riad und ein weiterer in Yanbu. Und diese Akte hatte er als erste nach Manila geschickt, die Akte eines enthaupteten Mannes, bestraft, weil er auf die Frau seines saudischen Arbeitgebers im Streit über verschwundene Juwelen eingestochen (und, wie vor Gericht vorgebracht, unzüchtige Blicke auf die älteste Tochter geworfen) hatte. Dieser Vizekonsul namens Quirante hatte eine harte Woche hinter sich, noch härter als sonst, weil eine weitere Gruppe verängstigter Dienstmädchen Zuflucht in der Botschaft gesucht hatte, und es gehörte zu seinen vielen Aufgaben, ihnen Schlafplätze zuzuteilen und sie mit Bettwäsche zu versorgen in den provisorischen Unterkünften, die sie für solche Fälle eingerichtet hatten. Sein einziger Trost war, dass hin und wieder eines dieser verzweifelten Gesichter ungewöhnlich hübsch sein konnte, und mit viel feierlichem Getue würde er ihr den besten Platz und Süßigkeiten besorgen, um sich dann die gerechte Entlohnung für diesen Extra-Service abzuholen. Wenige Nächte, bevor der Körper der Frau nach Hause flog, hatte ihm sein auserwähltes Opfer, eine Näherin aus Muntinlupa, in die Nase gebissen, wie eine in die Enge getriebene Hündin, und in seinem Schmerz und seiner Wut, die noch am nächsten Morgen zu spüren waren, vertauschte er die Papiere der toten Frau mit denen des enthaupteten Mannes, was zu ihrem sofortigen Abtransport vom Botschaftsgelände und bald darauf zu ihrem Abflug führte.
Und so kam es, dass eine siebenköpfige Familie in einem Jeepney den weiten Weg von Lingayen auf sich nahm, um die zwei Körperteile von Filemon Catabay entgegenzunehmen, der vor zwei Monaten hingerichtet worden war. Sie hatten von seinem Tod auf dieselbe Weise erfahren wie viele andere, nämlich aus den regelmäßigen Nachrichten von Radio DZXL, zwischen einer engagierten Diskussion über eine berühmte Schauspielerin, die gerüchteweise abgetrieben haben sollte, und Werbung für eine neue und wirksamere Wurmkur für Tiere. Die Mutter des Mannes war gerade dabei, einen Fisch auszunehmen, als ihr Enkel mit den Neuigkeiten zu ihr gelaufen kam; der Fisch in ihrer Hand begann zu zappeln und sprang dann in einer letzten Muskelzuckung aus ihrer Hand, als ob er ins Leben zurückgefunden hätte.
An der Tatsache, dass hier der Körper einer Frau, der in der Kiste lag, vor sich hinmoderte und auf trauernde Hinterbliebene wartete, war nichts Komisches, absolut nichts. Der einzige, der dieser Situation etwas Belustigendes abgewinnen konnte, war ein Sicherheitsbeamter namens Al Viduya, der glaubte, schon alles gesehen zu haben, was zwischen zwei Menschen auf diesem Flughafen passieren könnte, inklusive einem schnellen und heftigem Liebesakt zwischen einem abreisenden Parlamentarier und seinem Büroleiter – der auf den Namen Marvin hörte – in der Flughafentoilette.
Als die Kiste ankam, hatte Al gerade sein Abendessen beendet, Fisch mit schwarzen Bohnen, zwei Schalen Reis, eine Tasse dünnen Kaffees und eine Banane, das er an einem Imbissstand direkt hinter der Flughafenbegrenzung eingenommen hatte. Eine seiner neuen Hilfskräfte, ein Mädchen aus Ozamis, errötete, als er irgendwas von einem Sonntagsspaziergang im Luneta Park fallen ließ, wie entspannend und preiswert es sei, die Nacht im Gras zu verbringen, wie es viele Paare taten. Ich gebe ihr eine Woche, dachte er, als er Fischreste aus seinen Zähnen polkte – oder waren es die Reste einer jungen, klebrigen Banane? – und dann in Richtung Frachtlager schritt. Der Platzregen hatte sich verausgabt, während er aß, und der Asphalt war überall bedeckt mit großen, öligen Wasserlachen. Al musste über Pfützen springen und hüpfen, damit seine frisch polierten Schuhe sauber und trocken blieben. Er spürte das dringende Bedürfnis, eine zu rauchen, aber seine Schicht begann eine Stunde früher als sonst, weil sein Kollege es eilig hatte, zu seinem Termin in Sta. Cruz zu kommen. Es war nicht mehr als eine kleine Gefälligkeit; »Du erntest, was Du säst«. Bruder Mike liebte es, im Park zu predigen, und Al hatte keine Zweifel, dass sich sein Entgegenkommen mehr als auszahlen würde. Aber vielleicht nicht schon heute Abend. Eine laut jammernde Großfamilie hatte sich schon vor dem Tor postiert, umklammerte kleine, schmutzige Taschentücher und fasste sich gegenseitig an die Hände. Sie hatten sich eng an die Mauer gestellt, direkt unter dem schmalen Dachüberhang, um sich vor dem Regen zu schützen, allerdings nicht allzu erfolgreich. Ihre Kleider und Sandalen waren durchnässt, was aber niemandem etwas auszumachen schien.
Ihre Anwesenheit konnte nur eines bedeuten: die Ankunft einer neuen Leiche im Kühllager. Was immer es auch war, es brachte die eng aneinander gedrängte Gruppe brauner Gesichter, die nicht genau wussten, wohin sie schauen oder wie sie sich zu fühlen hatten, dazu, sich gegenseitig zu trösten, während sie gleichzeitig in ihrem tiefsten Inneren zerbrachen, so wie die junge Frau, wahrscheinlich die Schwester, die immer wieder auf den Arm ihres Begleiters schlug; der Mann schenkte ihr aber keine Beachtung und schien sich mehr dafür zu interessieren, was in der Ankunftshalle passierte, wo eine Menge von Autogrammjägern sich um einen schwarzen Mann mit Sonnenbrille und glänzend grünem Anzug scharte. Und dann waren da noch die Kinder, insgesamt vier, von einem stillen, vielleicht vierzehnjährigen Jungen bis zu einem kleinen Mädchen, das sich an die Hand einer älteren Frau klammerte, die anderen beiden, ein Junge und ein Mädchen, stritten sich um etwas, was das Mädchen festhielt, ein Foto oder eine Karte. Al konnte es nicht erkennen, aber das Ganze lief aus dem Ruder und ihr älterer Bruder brachte sie zum Schweigen, er schien der einzige zu sein, dessen Augen die Betonmauer durchbohren konnten und der schon wusste, was dort zu sehen war. Er war völlig durchnässt, seine Igelfrisur glitzerte wie eine goldene Krone.
Die Frau in dem dunkelbraunen Kleid war vermutlich seine Großmutter, die zwei älteren Kinder wirkten wie betäubt oder fehl am Platz, so als ob sie einen Fehler gemacht hätten, sich hierher bringen zu lassen, wo doch zu Hause Moskitonetze auszubessern oder Reisplätzchen zu formen waren. Al fragte sich, wo die Ehefrau oder der Ehemann waren, normalerweise saßen oder standen sie in einer Ecke, der Ehemann angeschlagen wie nach einem k.o., die Frau kettenrauchend, von ihrer besten Freundin zuverlässig versorgt. Niemand hier war in einer solchen Konstellation zu sehen. Die Großmutter starrte auf die Tür, auf der CARGO stand, die aber geschlossen war, und selbst wenn sie geöffnet gewesen wäre, würden sie nichts sehen, wenn er es nicht erlaubte. Al allein konnte die Tür an dieser Seite der Halle aufschließen. Man konnte noch Frachtgüter von ankommenden Flügen hineinbringen und ein anderer Wachmann kontrollierte die großen Tore auf der Rückseite. Die offizielle Bürozeit war vorbei, alle Angestellten waren mittags nach Hause gegangen. Auf dieser Seite war also Al der einzige, der den Schlüssel hatte, den Schlüssel zu allem, was aus fernen Ländern eintraf und worauf die Leute warteten.
»Wir wollen ihn sehen«, sagte die schluchzende Frau, als Al sich der Tür näherte.
»Wen sehen?«
»Meinen Bruder.«
»Meinen Vater! Meinen Vater!«, sagte das Mädchen mit dem Foto in der Hand.
»Meinen Sohn … Filemon, oh mein Filemon…«, jammerte die alte Frau.
Al konnte alles kommen sehen: die aufsteigende Spirale von Emotionen, die einige Menschen in Familien hineinsog, andere aber ausschloss. Es war seltsam, wie, abgesehen von Filmen, Trauer so ganz für sich sein konnte. Man konnte in eine Trauerhalle gehen und in jedem Raum weinte eine Familie wie besessen über den Verlust eines Familienmitglieds, aber niemand kümmerte sich auch nur einen Deut darum, ob sich im benachbarten Raum die Leiche des Präsidenten befand oder eines Mädchens, das mit dem Verkauf von Sampaguitas seine Geschwister ernährte und von einem Lastwagen überfahren worden war. Man trauerte nur um die eigenen Leute. Und, war Al überzeugt, man konnte nur so trauern. Er hatte vor fünf Jahren seinen einzigen Bruder wegen Tuberkulose verloren, er vergoss drei Minuten lang Tränen im Hospital, und fuhr dann mit einem Jeepney zurück zur Arbeit. Manchmal, im Luneta Park, ertappte er sich dabei, wie er bei Bruder Mikes Predigten zu weinen begann, aber es war nicht aus Trauer oder etwas ähnlichem; es fühlte sich einfach gut an, so gut, dass jeder, der neben ihm stand, auch zu weinen begann. Es war wie in einer Familie, einer großen und glücklichen Familie. Auch die Menschen hier vor der Tür werden darüber hinweg kommen, wichtigere Dinge finden, für die es sich zu arbeiten und beten lohnt.
»Kann ich meinen Sohn sehen?«, fragte die Mutter.
»Er kam heute Abend, mit dem Flug aus Jeddah«, sagte die Schwester.
»Wo ist Papa?«, fragte der kleine Junge.
»Wie ist sein Name?«, fragte Al gegen seinen Willen und schloss auf.
»Filemon Catabay«, sagte der ältere Sohn.»Filemon Catabay senior.«
Mutter und Schwester wollten Al folgen, als er hineinging, aber das hatte er erwartet und einen Fuß in die Tür gestellt.
»Sie können hier nicht hinein, tut mir leid, das ist ein gesperrter Bereich.«
»Wir haben Monate auf ihn gewartet«, bettelte die Schwester, und Al wollte ihr sagen, dass von dem Mann nach all dieser Zeit wohl nicht mehr viel übrig sei und dass der arme Filemon sicherlich nichts dagegen hätte, wenn sie ihn erst einen Tag später sähen. Aber Al ließ das lieber sein. Nur ein Jahr früher hätte er sie schroff abgewiesen, aber er lernte gerade, dass Geduld und Nachsicht die christlichsten aller Tugenden waren, und das ließ ihn ein vergleichsweise großzügiges Angebot machen.
»Sie müssen warten, bis das Büro morgen früh aufmacht. Es müssen Dokumente geprüft und Papiere unterschrieben werden. Es ist alles nicht so einfach, wie Sie glauben…«
»Ich bin ganz nass«, rief der kleine Junge.
»Sie haben ihm den Kopf abgeschlagen«, sagte das kleine Mädchen tapfer zu Al, als ob sie ihm gerade erzählen wollte, wie sie einen wackligen Zahn verloren hatte.
»Catabay«, wiederholte Al leise, wie für sich, den Namen des Mannes. »Ich kann euch nicht hineinlassen. Aber ich kann überprüfen, ob die Leiche hier ist. Wartet. Ich schau nach.«
Normalerweise weinten die Leute, wenn er das Wort »Leiche« sagte, dennoch glaubte er, dass es ihnen half, mit der schrecklichen Tatsache fertig zu werden, umso schneller würden sie zuversichtlich auf ihr kommendes Leben blicken. Al ging hinein und schloss die Tür hinter sich. Er hätte sich schlafen legen können in genau dieser Minute und war sich sicher, dass sie immer noch dort sein würden, bereit anzustürmen, wenn er am nächsten Morgen die Tür aufmachte. Aber für Al kam es gar nicht in Frage, selber in den Sarg zu schauen, so kurz nach seinem Abendessen. Er war mit Brettern zugenagelt, das war das Eine, und er hatte weder die Befugnis noch den Wunsch, ihn aufzubrechen. Das einzige, was er tun konnte, war den Namen herauszufinden. Oft war das alles, was diese Leute brauchten, um mit ihren Leben klar zu kommen – und, in vielen Fällen, mit ihren neuen Freundinnen oder Freunden, die ihnen in dieser schwierigen Zeit Halt gaben.
Er schlug den Kragen seiner Jacke nach oben und lief durch eine andere Tür in den Kühlbereich. Das fluoreszierende Licht warf eine grünliche Blässe auf die Kartons und Kisten, hoch gestapelt auf Paletten. Einige spezielle Artikel, lebensrettende Medikamente und ähnliches, aus Ländern wie der Schweiz oder den USA importiert, wanderten in Tiefkühltruhen und Kühlschränke mit Thermostaten. Wenn im Gebäude der Strom ausfiel, sollte ein Generator in Standby automatisch anspringen, aber Al wuss te aus Erfahrung, dass das nicht passierte; er oder wer immer gerade Dienst hatte, würde den Generator manuell starten müssen, weil irgendwas mit diesen Messgeräten und deren Armaturen nicht stimmte, die niemand zu kennen oder zu kontrollieren schien. Einmal, während eines Spannungsabfalls, entdeckten sie, dass der Generator kein Benzin hatte. Letztendlich kriegten sie die Kühlung wieder in Gang, hatten eine Stunde an die brütende Hitze verloren, und froren alles wieder ein, ohne groß nachzudenken. Aber eine Charge Medikamente war inzwischen verdorben und tötete später einen pensionierten Polizeihauptmann irgendwo auf den Visayas-Inseln. Zumindest sagten das die Anwälte bei der Untersuchung, die folgte; einige Verwandte wurden von der Versicherung ausbezahlt und die beteiligten Wachmänner, Al war nicht unter ihnen, gefeuert. Deshalb fühlte sich Al doppelt verantwortlich für jegliche Zwischenfälle unter seiner Aufsicht. Seine Arbeit hing ab von all diesen Kisten, sein Leben, seine Sardinen und seine Philipp Morris.
Irgendwo hinter ihm klingelte das Telefon und unterbrach das scheppernde Surren der Klimaanlage. Al ignorierte es wissentlich; ziemlich sicher war es irgendein nervöser Importeur, der wissen wollte, ob seine Ladung schon reingekommen war, damit er das Wochenende mit Jet-Ski und seiner Freundin in Subic verbringen und sich seinen Gewinn ausmalen konnte. Lass ihn warten, dachte Al, oder lass es ihn so machen wie die Catabays und persönlich an der Tür nachfragen. Nach sechs- oder siebenmaligem Klingeln verstummte das Telefon, um dann sein Gebimmel zu wiederholen. Al ging weiter in den Raum hinein, weg vom Klingeln, bis er in die Ecke kam, wo die in Kisten verpackten Särge normalerweise eingelagert wurden. Es war gerade nur eine da – frisch eingetroffen, das war sicher, die zwei Leichen von gestern hatten links gelegen und waren an diesem Morgen weiter transportiert worden zu ihren letzten Zielorten. Mindestens eine tauchte pro Tag auf dem Rollfeld und in seinem Lagerhaus auf, manchmal zwei, manchmal mehr, wie etwa die Opfer eines Feuers oder Autounfalls sehr weit weg, zu weit, um etwas davon gehört oder gesehen zu haben. Er hatte eine Geschichte in der People Tonight gelesen darüber, dass erst im vergangenen Jahr mehr als sechshundert Leichen durch den Flughafen geschleust worden waren. Selbst er, der die meisten dieser Fälle bearbeitet hatte, war überrascht von der Zahl, die wie eine dieser gezielten Übertreibungen der Medien erschien, um die Regierung in Verlegenheit zu bringen, für die er gestimmt hatte. Aus seiner Sicht sahen sie alle gleich aus, und es war leicht, den Überblick zu verlieren. Al hatte mal einen Steward gefragt, wieviele Menschen in eine 747 passen. Sechshundert Leichen. Das war so, als ob zwei vollgeladene Jumbojets in der Luft kollidiert und alle, vom Kapitän bis zum kleinsten Knirps, tot wären – und man musste mit der Gewissheit leben, dass so etwas in der Art jedes Jahr passierte. Es waren nicht die Zahlen, die Al so wütend machten, als vielmehr die Dummheit der Leute. Er selber war noch nie im Ausland gewesen – das stand auf der Liste seiner Gebete ganz oben, neben dem Lottogewinn und das richtige Mädchen zu treffen. Aber unabhängig vom göttlichen Willen konnte er nicht glauben, wie leichtfertig seine Landsleute ihre einmalige Chance zum Glück wegwarfen. Er erinnerte sich an die Story einer Boulevardzeitung über zwei philippinische Seeleute, die auf einem norwegischem Schiff mit Ziel Südkorea starben. Gut, Seeleute sind zu allen Zeiten auf See gestorben, aber diese zwei Landsleute hatten kleine Stücke von Rentierhorn – Rudolph aus dem berühmten Weihnachtslied war das einzige Rentier, das Al überhaupt kannte – in ihre Penisse implantiert, was einen schweren Tetanus, eine Virusinfektion und einen qualvollen Tod mitten auf dem Ozean zur Folge hatte. Ihre Witwen forderten Entschädigung und erhielten jeweils um die 13.000 Dollar plus ausstehender Gehälter. Insofern war es keine totale Verschwendung, dass die Leben der Seeleute so endeten, aber – ganz nebenbei – was für eine Verschwendung von Penissen, ganz zu schweigen von Rentierhorn.
Al kniete sich mit einem Bein auf den Boden neben die Kiste, um nach irgendeinem Hinweis zu suchen; manchmal kritzelte ein Ermittler oder sonstwie Befugter den Namen auf die Kiefernkiste mit Kreide oder einem Filzstift, vor allem wenn sie zu mehreren ankamen. Er fragte sich, ob es für all diese Leute nicht besser wäre, gleichzeitig zu sterben und damit mit allem durch zu sein, oder ob dieses stetige Eintrudeln von Catabays, Pamintuans und del Rosarios ewig weiter gehen sollte. Bevor er weiter darüber nachdenken konnte, fand er die Plastikhülle, eine Art Frachtbrief für den Flug, an die Kiste geklebt, in dem er (er wischte das Kondenswasser von der Hülle) den Namen der Verstorbenen in Großbuchstaben entziffern konnte: CABAHUG, AURORA V. Er sah nochmal hin, um sicherzugehen, dass es stimmte, kicherte über seinen Fund, und stand dann auf, um die Trauernden zu trösten, die alle um die falsche Person geweint hatten.
»Er ist nicht hier. Es ist ein Sarg da drin, aber der gehört zu einer anderen Person.« Al hielt die Tür halb geöffnet, blieb aber drinnen, um das Gespräch so kurz wie möglich zu halten. Er wollte auf die Toilette und sich eine Zigarette anzünden.
Für ein paar Sekunden herrschte Schweigen. Was sollten sie empfinden: Freude, Erleichterung, Wut, Empörung? Sollten sie ihm glauben, diesem Pförtner, der keine Ahnung davon hatte, was für ein Mensch Filemon war, nicht mal, wie er ausgesehen hatte.
Schließlich kam der Stiefbruder, der mit seinem Jeepney den ganzen Weg von Lingayen gefahren war, um die Leiche heim zu holen, wieder zu Sinnen. »Was meinst du mit ›Er ist nicht hier‹«, schoss es aus ihm heraus. »Schau nochmal. Das Office sagte, dass sie ihn heute erwarten. Da muss irgendein Fehler sein. Du musst dich irren.«
Al hörte schlagartig auf zu grinsen: »Sie haben Recht, da hat es einen Fehler gegeben – aber ich hab ihn nicht gemacht. Aurora – kennen Sie eine Frau mit dem Namen Aurora? Sie ist die Frau in der Kiste.«
»Welche Frau?« Die Mutter klang noch verlorener als zuvor. »Wo ist mein Sohn?«
»Vielleicht zurück in Dubai oder Kuwait oder von wo immer er kommen sollte. Es tut mir leid, aber hier drin gibt es nur eine Leiche. Sie kam mit dem Jeddah-Flug, aber es ist nicht Ihr Sohn.«
»Bitte lassen Sie uns schauen…«
»Das geht nicht. Die Kisten sind versiegelt. Und hier darf keiner rein.«
»Wo ist Papa?«, fragte das ältere Mädchen.
»Sie haben seinen Kopf abgeschnitten«, sagte ihr kleiner Cousin.
»Was können wir tun?«, fragte ihr Onkel.
»Rufen Sie nochmal im Office an. Rufen sie dort an oder kommen Sie Montag wieder, morgen ist niemand da.«
»Wir leben in Lingayen. Wir sind mit einem Jeepney gekommen.«
»Dann schlaft drin, Leute tun das ständig. Ihr könnt die öffentlichen Toiletten benutzen – nicht zum Waschen natürlich, sonst verbraucht ihr das ganze Wasser in den Tanks.«
Filemons Schwester und ihr Mann sahen sich und ihre Kinder an. Der Älteste war am Schluchzen, das Gesicht den anderen abgewandt, wobei nicht richtig klar war, weshalb er weinte. Al blieb an der halboffenen Tür stehen, er sehnte sich danach, reinzugehen und sich zu erleichtern. Er wusste, dass er – oder wer immer die Morgenschicht am Montag hatte – diese Leute wiedersehen würde.
»Verdammt«, sagte der Mann. »Wir sind den ganzen Weg gefahren für nichts. Sechs Stunden lang. Für nichts!«
»Wir können hier warten bis Montag, ich hab ein bisschen Geld, wir können was zu essen kaufen«, schlug seine Frau vor.
»Ich habe Dodong versprochen ihm mit diesen Dachplatten zu helfen, die er aus Calasiao abholen muss morgen…«
»Dodong kann warten, jemand anderes kann für ihn fahren. Bitte, Mar, es ist nur ein Tag, ich bin sicher, die Kinder stört es nicht.« Das kleinste Mädchen war ihres, es lehnte an den Knien ihrer Großmutter und lutschte am Daumen.
»Lasst uns in den Park gehen«, rief der kleine Junge, »ich will Fahrrad fahren im Park!« Zwei Jahre zuvor, kurz bevor er sie verlassen hatte, hatte Filemon die Kinder in die Großstadt mit ihren Grünanlagen an der Bucht mitgenommen.
»Sei ruhig«, sagte seine ältere Schwester, die sich an ihren Vater noch sehr genau erinnerte.
»Bist du sicher, dass wir ihn am Montag mitnehmen können«, fragte der Stiefbruder Al, der langsam mit den Nerven am Ende war.
»Das kann ich euch nicht sagen, ich besitze keine Airlines, ich mache die Regeln nicht. Vielleicht wird er bis dahin hier sein, vielleicht nicht…«
»Vielleicht ist mein Sohn noch am Leben«, sagte die Mutter. »Vielleicht haben sie jemand anderem den Kopf abgeschlagen. Diese Frau – diese Frau da drin –, wie sagtest du, war ihr Name?«
»Aurora, Aurora, äh, Sulpicio«, sagte Al, den richtigen Nachnamen hatte er schon vergessen. Alles außer »Catabay« lief auf dasselbe hinaus. »Schaut, es gibt hier nichts für euch zu tun. Nehmt meinen Rat an: Lauft ein bisschen rum und schnappt frische Luft. Es ist ein schöner Ort, in den besseren Ecken. Passt einfach nur gut auf euer Geld auf.«
»Oh, wir haben nicht viel – nur was das Dorf aufbringen konnte, damit er ein ordentliches Begräbnis bekommt, und eine Spende vom Abgeordneten…«
Ihr Mann schien überrascht und war sofort in heller Aufregung: »Hast du das ganze Geld mitgenommen?«
»Kann man zuhause irgendjemandem trauen?« Sie trug ihre Tasche um die Schulter und drückte sie fest an sich. Tief in der Tasche, in mit Gummis umwickelten Bündeln, waren fast zwanzigtausend Pesos. Es hätte mehr sein sollen, aber sie hatte, was niemand wusste, bereits die achttausend abgezogen, die sie Filemon – oder besser gesagt seiner Ex-Frau Rosalie, bevor sie ihn wegen einer christlich-apokalyptischen Sekte verließ – für ihre pleite gegangene Geflügelfarm geliehen hatte. Daran war nichts Falsches, entschied die Schwester; Filemon hätte ihr das Geld selbst gegeben, wenn er gekonnt hätte, und nun konnte er. Auf der anderen Seite, man konnte es auch als Gemeinkosten sehen; es war kein Witz und mit Sicherheit kein Spaß, eine so hochemotionale und komplizierte Angelegenheit zu managen wie diese, die auch noch ihre Arbeitszeit als Kassiererin in einem Kaufhaus in Lingayen verkürzte. Wenn ihr Bruder einfach seine diebischen Hände zurückgehalten hätte, nichts von all dem hätte passieren müssen. Tatsächlich, je mehr sie darüber nachdachte, wurde der Katalog von Filemons Fehlern und Fehltritten immer länger. Von der Zeit, da er das Geld klaute, das für das Kleid für ihre Abschlussfeier gedacht war, damit er seinem angehimmelten Clubtänzer einen Sony Walkman kaufen konnte, bis zu der Zeit, da er die Geschichte erfand, den Jeep ihres Vaters an einen Freund ausgeliehen zu haben, der ihn dann angeblich an eine Straßengang verloren hatte. Es war fast so, als hätte die Gerechtigkeit ihrem Bruder persönlich auf die Schulter getippt.
»Nein«, sagte ihr Mann, nachdem er ein bisschen überlegt hatte. Er dachte an die neuen Reifen, die sein Jeepney dringend brauchte. Sie waren schon zweimal runderneuert worden, und dieses Wochenende würde auch nicht helfen.
»Ich will meinen Sohn sehen. Ich habe ihm soviel zu sagen.« Die Tochter umarmte ihre Mutter und zog sie zur Seite. »Wir sind Montag wieder hier«, sagte sie zu Al, der müde nickte, die Tür schloss und dem Herrn dankte.
»Wir gehen in den Park, wir gehen in den Park«, begann der kleine Junge zu singen, der heimlich auf gerade unpassende Freuden wie Zuckerwatte und Wasserspiele hoffte.
»Morgen«, seufzte seine Tante. »Wir sollten das Beste aus unserer Zeit machen. Wir könnten sogar zur Megamall gehen…«
»Ich bleibe hier«, sagte ihr Neffe mürrisch.
»Sei nicht so dumm und so bockig. Du hast gehört, was der Mann sagte. Wir warten hier umsonst. Komm schon, sei nett. Ich besorg dir auch was in der Mall morgen.«
Der Junge blieb standhaft. Die Frau nahm seinen Bruder und seine Schwester zur Seite. Ihr Mann nahm die Tochter Huckepack.
»Wir werden im Jeep sein«, sagte die Frau zum Sohn des Toten. »Du weißt, wo wir parken. Lauf nicht zu weit weg. Ich hole uns bald was zu Essen.«
»Diese arme Frau«, sagte die Mutter, während sie sich ihren Weg zurück zum Parkplatz bahnten, wo in die wartende Menge Bewegung kam wegen der bevorstehenden Ankunft des Nordwest-Fluges aus San Francisco via Tokyo Narita. Autos und Jeeps stauten sich an der Einfahrt, um einen Parkplatz zu ergattern. Die Mutter blieb an der Bordsteinkante stehen, zupfte die Tochter am Arm. »Was glaubst du, was hatte sie wohl für eine Familie?«
Die Verwandtschaft der Toten
Die simple, wenn auch verwirrende Wahrheit war, dass die Frau, die in der Kiste verwesen sollte, sehr lebendig war; jemand anderes lag darin, auch wenn das noch niemand wusste.
Für den Angestellten, der die Akten im Keller nach Auroras persönlichen Daten durchforstete – wobei er immerzu Flüche ausstieß über den Geldmangel seiner Dienststelle, der die Anschaffung von Computern und Deckenventilatoren verhinderte –, gab es keinen Grund, weiter zu suchen als nach dem ersten Ordner, der zu dem vorliegenden Fall passte, nämlich: CABAHUG, AURORA V., der Einfachheit halber gelistet zwischen CABAGNOT, CHARLSON D. und CABAHUG, EUGENIA M.
Da waren Haushaltshilfen, Köche, Fahrer, Tänzer, Klempner, Konstrukteure, Schweißer, kräftige Seeleute und andere Vertreter aller möglichen Dienstleistungen und Gewerbe, die ihre Küchen, Ställe, Klassenzimmer, Fruchtstände, Videoke*-Bars, Schuh- und Gummifabriken verlassen hatten auf der Suche nach besseren Jobs – auf tobender See oder brennendem Sand, von Singapur bis Stockholm, London bis Lagos, Riad bis Reykjavik, in zwielichtigen Kaschemmen und auf Bohrinseln, in Pflegeheimen und Konservenfabriken, Welle um Welle über all die Meere und Ozeane hinweg, die ihre Inseln umschlossen.
Nach Einschätzung der eigenen Regierung gab es über acht Millionen dieser Oversea Workers überall auf dem Planeten gegen Ende des Jahrhunderts – ein langes Jahrhundert, in dem vermutlich ein paar wenigen Filipinos aufregende Dinge widerfahren waren, während es für die meisten anderen eher irgendein trostloser, nicht enden wollender Donnerstag gewesen war. Eine nervöse Folge von Kriegen und Revolutionen hatte ihnen kaum etwas gebracht, das wirklich neu und großartig war, die Armen und Verzweifelten schlossen sich den Mutigen und Gelangweilten in der Schlange der Abreisenden an, umklammerten ihre gefälschten Designertaschen und ihre frisch gedruckten Pässe.
Für viele von ihnen war dieser Sprung nach Hongkong und Singapur (und von dort nach Dubai, Frankfurt und noch weiter) der allererste Flug in ihrem Leben. Sie würden Land verkauft, sich tief verschuldet oder schwere Verhandlungen mit Gott und einem Arbeitgeber geführt haben für diesen schicksalhaften Sprung in ein neues Leben. Vor der Abreise würden ihre Augen funkeln vor purem Ehrgeiz, der sie zu außergewöhnlichen Gelöbnissen und Versprechungen verleitete: sich niemals zu ändern, niemals zu vergessen, und niemals ohne Erfolg in der Tasche zurückzukehren. Sie würden klatschen und nervös kichern, sobald das Flugzeug abhob, und noch eine Stunde später würden sie, wie benommen, unfähig sein, die ganze Weite des Horizonts zu erfassen. Ihre Ziele würden zu tröstlichen Mantras auf ihren Zungen werden, schwer und beladen mit dem Mysterium des bisher unbekannten: O-sa-ka, LON-don, ROT-ter-dam, DOha, Ni-CO-sia, Bei-RUT.