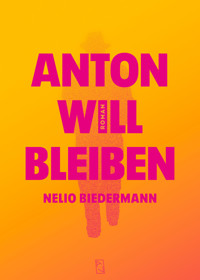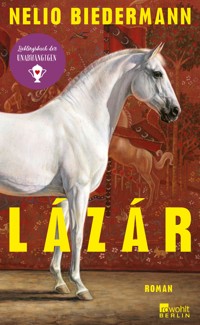
19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ausgezeichnet als Lieblingsbuch der Unabhängigen 2025 | Nominiert für den Schweizer Buchpreis 2025 Alles beginnt, sogar das Ende, als Lajos von Lázár, das blonde Kind mit den wasserblauen Augen, zur Welt kommt. Seinem Vater, dem Baron, wird der Sohn nie geheuer sein, als ob er dessen Geheimnis ahnte. Mit Lajos' Geburt im Waldschloss bricht auch das 20. Jahrhundert an, das das alte Leben der Barone Lázár im südlichen Ungarn für immer verändern wird. Der Untergang des Habsburgerreichs berührt erst nur ihre Traditionen, aber alle spüren das Beben der Zeit, die schöne Mária ebenso wie der geisterhafte Onkel Imre. Als Lajos in den zwanziger Jahren sein Erbe antritt, scheint der alte Glanz noch einmal aufzublühen. Doch die Kinder Eva und Pista – der das Dunkle so liebt – müssen erleben, wie totalitäre Zeiten ihre wuchtigen Schatten werfen – und lernen, gegen sie zu bestehen. Ein Roman wie eine Welt, die überwältigende Saga einer Familie, getrieben von der Liebe und der Sehnsucht nach ihr, in den Strudeln des 20. Jahrhunderts. Fesselnd und berührend, zugleich voller Leichtigkeit, voller Träume und Geheimnisse, in denen sich die ganze Tragik und Schönheit der Existenz spiegelt. Und – ob angesichts historischer Katastrophen oder schöner Sommertage – die ewige Frage, wie man leben soll.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Nelio Biedermann
Lázár
Roman
Über dieses Buch
Alles beginnt, sogar das Ende, als Lajos von Lázár, das blonde Kind mit den wasserblauen Augen, zur Welt kommt. Seinem Vater, dem Baron, wird der Sohn nie geheuer sein, als ob er dessen Geheimnis ahnte. Mit Lajos’ Geburt im Waldschloss bricht auch das 20. Jahrhundert an, das das alte Leben der Barone Lázár im südlichen Ungarn für immer verändern wird. Der Untergang des Habsburgerreichs berührt erst nur ihre Traditionen, aber alle spüren das Beben der Zeit, die schöne Mária ebenso wie der geisterhafte Onkel Imre. Als Lajos in den zwanziger Jahren sein Erbe antritt, scheint der alte Glanz noch einmal aufzublühen. Doch die Kinder Eva und Pista – der das Dunkle so liebt – müssen erleben, wie totalitäre Zeiten ihre wuchtigen Schatten werfen – und lernen, gegen sie zu bestehen.
Ein Roman wie eine Welt, die überwältigende Saga einer Familie, getrieben von der Liebe und der Sehnsucht nach ihr, in den Strudeln des 20. Jahrhunderts. Fesselnd und berührend, zugleich voller Leichtigkeit, voller Träume und Geheimnisse, in denen sich die ganze Tragik und Schönheit der Existenz spiegelt. Und – ob angesichts historischer Katastrophen oder schöner Sommertage – die ewige Frage, wie man leben soll.
Vita
Nelio Biedermann, geboren 2003, ist am Zürichsee aufgewachsen. Seine Familie stammt väterlicherseits aus ungarischem Adel, seine Großeltern flohen in den 1950er Jahren in die Schweiz. Biedermann studiert Germanistik und Filmwissenschaft an der Universität Zürich. Sein Roman «Lázár» wird in mehr als zwanzig Ländern erscheinen.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2025
Copyright © 2025 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Copyright © 2025 by Nelio Biedermann
Covergestaltung Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Coverabbildung Jaime Corum
ISBN 978-3-644-02354-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für meine Familie
Ein blonder Dichter wird vielleicht verrückt.
Alfred Lichtenstein
Das Glaskind
1
Am Rand des dunklen Waldes lag noch der Schnee des verendeten Jahrhunderts, als Lajos von Lázár, das durchsichtige Kind mit den wasserblauen Augen, zum ersten Mal den Mann erblickt, den es bis über seinen Tod hinaus für seinen Vater halten wird.
Es war der Tag der drei Könige – der Wald schluckte das letzte trübblaue Licht. Das Zimmer, in dem der Junge geboren wurde, lag im Westflügel des Waldschlosses, gleich neben dem blaugestrichenen, das nie jemand betrat.
Während die Hebamme in seinem Rücken das Kind wusch, stand Sándor von Lázár am Fenster und suchte das Unterholz ab. Es war ihm, als hätte er etwas im Dickicht verschwinden sehen.
Er stand dort, spürte die Kälte des Glases und tastete mit seinem Blick den Waldrand entlang, ließ ihn über die Rinde der Stämme gleiten und von Baum zu Baum huschen, als sich plötzlich ein Riss in ihm auftat. Sofort fühlte er die altbekannte Angst, die vertraute Panik in seinen Körper strömen und alles überschwemmen – da blinzelte er, und der Riss schloss sich wieder. Erleichtert atmete er auf. Er war nicht wie sein Bruder, nicht wie seine Mutter, nur etwas unruhig war er, was niemanden verwundern durfte, schließlich hatte seine Frau gerade ein Kind geboren, unter dessen transparenter Haut man die kleinen Organe sehen konnte.
Das Abendessen nahm der Baron nur in Gesellschaft seiner sechsjährigen Tochter ein, die sich ganz und gar nicht über die Geburt ihres Bruders freute. Als Ida, das deutsche Kindermädchen, Ilona ins Zimmer geführt hatte, hatte diese das schrumpelige, bläulichblasse und völlig verquollene Geschöpf mit ernstem Ausdruck angesehen, die braunen Augen zusammengekniffen und trocken gesagt: «Es ist sehr hässlich.»
Dann war sie zu ihrem Vater geeilt, der ihr bleiches Gesicht nicht hatte deuten können und das Fenster deshalb geschlossen ließ, und hatte ihm auf die glänzenden Lederschuhe und die braunkarierte Hose gekotzt.
Nun – der Baron hatte sich umgezogen – saßen sie zu zweit am Esstisch, der lang genug war, um zwanzig Gästen ein Spanferkel, eine Gans, einen Fasan und drei Hasen zu servieren. Sie schwiegen, denn sie waren es gewohnt, dass Mária Konversation machte, die in weiche Seidenkissen gebettet im Westflügel lag und, das Kind an ihre Brust gedrückt, auf seine kleinen Atemzüge, Imres beständiges Räuspern im Zimmer nebenan und die Geräusche des Schlosses lauschte und sich fühlte, als würde sie in den Kissen versinken, als wären die Taschen ihrer dunkelblauen Strickjacke mit schweren Steinen gefüllt, deren Gewicht sie hinabzog, sie immer tiefer in den Decken, der Matratze und den Gänsefedern verschwinden ließ. Es war kein schlimmes Gefühl, kein rasendes Fallen oder panisches Ertrinken, wie sie es aus ihren Träumen kannte, es war ein einfaches Eintauchen, ein stilles Aus-dem-Leben-Schwinden; es war alles, was sie wollte.
Ihr Vater war noch immer wütend auf sie, das konnte Ilona an den energischen Bewegungen sehen, mit denen er sein rotes Fleisch schnitt. Sie wusste, dass er ihren Blick auf sich spürte – er spürte jeden Blick sofort –, aber sie konnte ihn nicht lösen von seinem dichten, buschigen Schnurrbart, der über seinem kauenden Mund auf und ab tanzte.
Sah ihr Vater auf, schaute sie schnell auf ihren riesigen Teller. Sie verstand nicht, wie man auf einen so wunderschönen Teller aus kostbarem Herend-Porzellan, den filigrane Schmetterlinge, Libellen, Vögel und Haselzweige schmückten, ein so grobes Stück Fleisch legen konnte. Zum Glück brannte der Kronleuchter nicht, die Gaslampen an der tapezierten Wand zeigten schon mehr als genug. Der Trick war, die Augen an den oberen goldverzierten Tellerrand zu heften, sodass es aussah, als würde man auf das Essen schauen, während man eigentlich nur im unteren Augenwinkel erkennen konnte, was man gerade zerschnitt.
Sie hörte ihren Vater kauen und wusste, ohne aufzusehen, wie er währenddessen den Blick durch den Saal schweifen ließ. Er war unglaublich stolz auf all diesen Besitz, dabei begriff sogar die kleine Ilona, dass er nichts damit zu tun hatte und sie ihren Reichtum allein jenen Menschen verdankten, die ihr von all den Gemälden entgegenblickten und trotz der zahlreichen Witze, die sie ihnen erzählte, nicht einmal die Andeutung eines Lächelns schenkten.
Nach dem Essen begab sich Sándor in das angrenzende Rauchzimmer, steckte sich eine Zigarre an und ging eine Weile schweigend auf und ab. Bisher hatte er jegliche Gedanken an das neugeborene Kind verdrängt, doch nun, da er allein war, konnte er sich nicht länger gegen sie wehren. Er rauchte und legte die Stirn in tiefe Falten, dachte nach, ohne sagen zu können, worüber.
Herrn Török, den Landarzt, hatte das Kind nicht weniger verwundert – «So etwas, muss ich sagen, habe ich in meinen vielen Jahren als Arzt noch nie gesehen, Hochwohlgeborener Baron. Aber das Kind scheint gesund zu sein, die Organe funktionieren, und die Haut ist zwar außerordentlich dünn, aber sie hält. Nur das Sonnenlicht könnte ihm gefährlich werden.»
Das Kind war also gesund, was die Sache nicht einfacher machte. Einfach wäre eine Totgeburt gewesen.
Bei dem Gedanken an die nächsten Jahre seines Lebens, über die ein durchsichtiges Kind bestimmen würde, erwog Sándor für einen winzigen Augenblick die Möglichkeit, den Jungen von der Brust seiner schlafenden Frau zu heben, ihm im Badezimmer die kleine Nase und den Mund zuzuhalten und ihn anschließend wieder auf Márias Brust zu betten. So würde er weiter seinem gewohnten Leben nachgehen können, das er im Großen wie im Kleinen, im gemächlichen Lauf der Jahre wie im verschachtelten Dahineilen des Alltags darauf ausgelegt hatte, alte Traditionen zu wahren und neue zu schaffen. Schon als Kind hatte er es kaum erwarten können, später einmal mit derselben Feierlichkeit wie sein Vater den Geschäften des Alltags nachzugehen –
Den dunkelgrünen Siegelring in das rote Wachs zu drücken. Verträge zu unterzeichnen. Geschäftspartner zu empfangen. Die Taschenuhr aus der Weste zu ziehen. Das Weinglas zum Mund zu führen.
Nach dessen Vorbild folgte das Leben des Barons einer strengen Routine. Er stand bei Sonnenaufgang auf, schob die nadelgrünen Vorhänge zur Seite, um auch seine Frau zu wecken (denn er konnte Langschläferei nicht ausstehen), ging ins Badezimmer, um sich die Wangen, das Kinn und den Hals zu rasieren, strich sich den Schnurrbart mit Olivenöl ein und kleidete sich dann vor den verquollenen Augen Márias an, um ihr zu demonstrieren, wie tüchtig, gepflegt und überlegen er war. Anschließend begab er sich in den Speisesaal, um die Zeitung zu lesen.
Mária verließ das Bett erst, wenn die Schritte ihres Mannes im Flur verhallten. Im Bad griff auch sie zum Rasiermesser, dessen Griff noch warm war, um sich mit den präzisen Bewegungen jahrelanger Übung an der weichen, porzellanweißen Unterseite ihrer Arme feine Schnitte zuzufügen, die so schmal waren, dass kaum Blut floss und sich die Wunden innerhalb eines Tages wieder schlossen. Zurück blieb ein fast unsichtbares Muster aus fadendünnen, rosigen Narben, das außer Pál nie jemandem aufgefallen war.
Der junge Knecht hatte es bemerkt, als er der Baronin an einem ungewöhnlich warmen Frühlingsnachmittag auf ihren Schimmel geholfen und ihr die Zügel gereicht hatte. Dabei war der Ärmel von Márias Bluse hinaufgerutscht und hatte ihren Unterarm freigelegt. In den wasserblauen Augen Páls hatte sie sofort erkannt, dass er die Narben gesehen hatte, ja für einen Moment hatte er mit seiner groben Hand sogar nach ihrem Unterarm greifen wollen, dann aber nur gefragt: «Wieso tun Sie das, geehrte Frau Baronin?»
Mária hatte den Jungen mitfühlend angeschaut, ganz so, als wäre er derjenige mit den vernarbten Armen, und dann geantwortet: «Damit ich weiß, dass ich noch lebe.»
Als Pál der Baronin am Abend aus dem Sattel geholfen hatte, war er ebenso traurig gewesen wie drei Stunden zuvor. Mária war es vorgekommen, als würde sie ihn zum ersten Mal richtig sehen. Sie hatte ihm ein zartes Lächeln geschenkt, und er war rot geworden und hatte schnell den Sattel in den Stall getragen. Aber Mária war ihm gefolgt, hatte seine breiten Schultern bestaunt und sich wenige Schritte hinter ihm kaum hörbar geräuspert.
Neun Monate später kam Lajos zur Welt.
2
Bis der Baron den Jungen musterte und seiner Frau die Frage stellte, vor der sie sich so lange gefürchtet hatte, vergingen zweieinhalb Jahre. Anders als erwartet, hatte die Angst mit den Wochen, Monaten und Jahren, die seit der Geburt verstrichen waren, nicht nachgelassen, sondern zugenommen, denn die Frage würde kommen, das war gewiss, und mit jeder Minute wuchs die Lüge, trieb ihr Wurzelnetz tiefer in den Boden, spannte ihr Blätterdach weiter und weiter, bis es irgendwann ihre Familie, das Waldschloss und ihr ganzes Leben überschatten würde.
Aber Mária ließ sich von ihrer Angst und der wuchernden Lüge nicht unterkriegen, im Gegenteil, sie beschloss, sich ihr zu stellen, ihre Sinne zu schärfen für den Tag, an dem die über allem schwebende Frage die Lüge aufzudecken drohte.
Dafür musste Mária das Lügen lernen. Ihre Mutter war eine strenggläubige Christin, die nur Grau trug und täglich drei Stunden in der Bibel las – eine vor dem Frühstück, eine vor dem Mittagessen und eine letzte vor dem Abendmahl. In ihrem ganzen Leben war nicht eine Lüge über ihre dünnen, hellrosa Lippen gekommen, und nach diesem Maßstab hatte sie auch ihre sechs Kinder erzogen. Logen sie doch einmal und wurden dabei erwischt, mussten sie hundertmal das Vaterunser schreiben, mit der linken Hand und der ältesten Feder, ohne dass ein einziger Buchstabe verwischte.
Deshalb ist es umso erstaunlicher, mit welcher Schnelligkeit, Konsequenz und Raffinesse Mária das Handwerk zu beherrschen lernte. Dabei war die Methode, mit der sie übte, so einfach wie erfolgreich: Sie log, wann immer sie konnte. Jede Frage, die ihr gestellt wurde, beantwortete sie falsch, selbst wenn sie so banal war wie jene, ob sie zum Abendessen Paprikahühnchen oder Wild bevorzuge. Und mit jeder Lüge, die ihren Mund verließ, streifte sie ein Stück ihres kindlichen Ichs ab, ließ sie einen Teil jenes Vaterunser schreibenden Mädchens zurück und gewann dagegen an Selbstvertrauen, Gerissenheit und Schalk, sodass ihr, als Sándor endlich die Frage stellte, vor der sie sich so lange gefürchtet hatte, schlagartig bewusst wurde, dass ihre Angst völlig unbegründet gewesen war, denn zu lügen fiel ihr mittlerweile leichter, als die Wahrheit zu sagen.
Zu der Frage kam es so: Familie von Lázár saß um den Esstisch und aß Gulaschsuppe. Mária gab eine als Wahrheit ausgegebene Fantasiegeschichte zum Besten, und die anderen hörten schweigend und mit den Gedanken anderswo zu. Sándor dachte gerade darüber nach, wo die Liebe hinging, wenn sie verschwand, als sein Sohn ihm plötzlich ein Stück Rindfleisch gegen die Brust schleuderte. Der Baron blickte ungläubig auf, sah seinen Sohn im Kinderstuhl sitzen und wusste für einen Augenblick nicht, wer dieser junge Mensch war.
Er saß dort, das schneeweiße Hemd mit rotbrauner Sauce bespritzt, an der Stelle des Herzens das Stück Rindfleisch, und konnte nicht sagen, wer dieses Kind war. Zwar wusste der Baron, dass es für sein Leben von Bedeutung war, aber weshalb, fiel ihm nicht ein. So, jeder voreingenommenen Betrachtung enthoben, sah er Lajos zum ersten Mal, wie er wirklich war: blondhaarig, blauäugig, quallenhäutig.
Da fiel es ihm wieder ein: Das sollte sein Sohn sein. Dabei glich er ihm kein bisschen.
«Bist du dir sicher, dass das Kind von mir ist?», fragte er spaßeshalber und gleichzeitig erkennend, dass er sich vor der Antwort fürchtete.
Doch Mária, die diese Szene in ihrem Kopf schon tausendmal durchgespielt hatte, sagte beiläufig: «Aber natürlich, mein Lieber. Wieso würde er sonst Hayo dem Ersten so ähnlich sehen?»
Die Antwort war riskant, denn es gab weder ein Porträt noch eine Beschreibung von diesem Urvater des Lázár’schen Geschlechts, der als Vierzehnjähriger mit nichts als einem blauschwarzen Raben auf der Schulter und etwas hartem Brot im Beutel der Donau folgend nach Budapest gekommen war, sich zum Goldschmied hatte ausbilden lassen, in der Belagerung von Szigetvár gekämpft, die Schlacht dank seiner außerordentlichen Feigheit überlebt und anschließend, um seiner angeborenen Einsamkeit etwas entgegenzusetzen, sechzehn Kinder gezeugt hatte.
Aber das machte nichts, denn sobald Mária dies gesagt hatte, malte sich der Baron sein eigenes Porträt, ganz nach Lajos’ Vorbild. Und seine Freude darüber, dass sein Sohn dem berühmten Hayo glich, war so groß, dass er ganz vergaß, dem Kind eine Ohrfeige zu verpassen.
Anfangs dachte Mária, die Frage würde wiederkehren – doch sie blieb aus. Manchmal hatte Sándor zwar das unterschwellige Gefühl, die wasserblauen Augen oder das strohblonde Haar von irgendwoher zu kennen, aber Pál war einige Wochen nach der Geburt des Kindes an den Folgen eines Huftritts gestorben, sodass er nur noch als verlorengegangene Erinnerung im Gedächtnis des Barons herumtrieb.
Die Baronin hatte ihr Schlafzimmer nach Páls Tod sechs Tage nicht verlassen. Es war keine bewusste Entscheidung gewesen, keine Totenwache oder in die Länge gezogene Schweigestunde, auch keine hartnäckige Migräne oder Grippe, wie Sándor, der sofort in eines der Gästezimmer gezogen war, gedacht hatte. Nein, sie hatte sich schlicht nicht erheben können. Den ganzen Tag hatte sie nur im Bett gelegen und an die Decke gestarrt. Manchmal hatte sie dabei geweint, und manchmal war sie vor Erschöpfung weggedämmert und hatte von wasserblauen Augen geträumt, in denen sie hatte schwimmen können, und sich gefühlt wie mit Pál, wenn er, nachdem sie in der hintersten Box des Stalls miteinander geschlafen und noch nackt nebeneinander im Heu gelegen hatten, mit seinen rauen Fingern über ihre schmale Wirbelsäule gestrichen und gesagt hatte: «Ich könnte sie so leicht zerbrechen. Wie einen trockenen Zweig. Das wäre das Einfachste, dann könnte ich eine Hälfte haben und dein Mann die andere.»
Am siebten Tag nach seinem Tod war sie aufgestanden und hatte dort weitergemacht, wo sie aufgehört hatte. Und doch schien sie nicht ganz zurückzufinden, denn die Angewohnheit, mit dem toten Pál zu sprechen, und die Augenringe, die sie sich während der sechs schlaflosen Nächte zugezogen hatte, wurde sie nicht mehr los. Es war kein Wunder, dass Sándor mit zunehmender Panik an seinen Bruder und seine Mutter dachte.
Seine Mutter, die nach dem Tod seines Vaters, wirre Worte vor sich hin flüsternd, immer wieder in den Wald gelaufen war, der das Schloss umgab. Dieser Wald, der sie anzog wie der Mond das Meer. Dieser Wald, der selbst ein Meer war. Dieser Wald, der den Vater auf der Jagd verschluckt hatte. Dieser Wald, der anstelle des Vaters einen toten Hirsch ausgespuckt hatte. Dieser Wald, der dem Hirsch eine Girlande aus Efeu ins Geweih gehängt und einen Fliegenpilz in den Mund gesteckt hatte. Dieser Wald, der den Hirsch zu ihnen laufen ließ, bis er vor dem Klavierzimmer mit den großen Fenstern zusammengebrochen war. Dieser Wald, der seiner Mutter Zeichen geschickt. Dieser Wald, der sie gerufen. Dieser Wald, der sie entrissen.
Dieser Wald, der seinen Vater verschluckt, seine Mutter getötet und seinen Bruder verrückt gemacht hatte.
Sein Bruder. Ein Mann in den Dreißigern, der ein intelligentes, verschlossenes Kind gewesen war, das tote Schmetterlinge und Käfer gesammelt, Vögel beobachtet und Pflanzen gezeichnet hatte. Dessen Naturschwärmerei mit dem Verschwinden des Vaters ein jähes Ende gefunden hatte. Auf einmal war die Weite des Waldes kein Freiheitsversprechen mehr, sondern eine dunkle Drohung. Auf einmal fürchtete er sich, fürchtete sich vor den Schatten, die die Äste in sein Zimmer warfen, vor den Farnen, die seine Knöchel streiften, vor den Vögeln, die aus der Tiefe des Walds nach ihm riefen.
Eines Abends, als Imre nach dem Essen in sein Zimmer trat, saß ein Mann auf seinem Bett. Er war gekleidet wie ein Jäger und saß, ohne sich zu rühren, in der Dämmerung. Nur seine grünen, katzenhaften Augen huschten in seinem dunklen Gesicht hin und her. Wie Imre ihn erblickte und Licht machte, war der Mann verschwunden; auf dem Nachttisch lag ein Buch, das den Titel Nachtstücke trug.
3
Imre verschlang die Nachtstücke.
Ein erstes Mal las er sie noch in derselben Nacht jenes Tages, der später so schwer und bedeutend in seinem Lebenslauf liegen sollte wie ein großer, flechtenbewachsener Findling, der den Strom der Zeit in eine neue Richtung lenkt.
Er versuchte, das Bild des Jägers zu verbannen, zog die Vorhänge zu und legte sich angezogen aufs Bett. Es war so dunkel, dass er seinen eigenen Körper nicht sehen konnte; kurz war er sich nicht sicher, ob er überhaupt noch existierte. Durch die Decke hörte er seine Mutter, hörte sie sprechen und sprechen, über sich und die Köchin, der sie nicht traute, der sie immer unterstellte, Essen mitgehen zu lassen und den armen Kindern und Witwen im Dorf zu schenken, über ihn und seinen Bruder, der eindeutig der weniger hübsche, aber auch der klügere und willensstärkere sei, derjenige, der den besseren Nachfolger abgegeben hätte, über die Perlenkette, die sie nie ablegte und trotzdem ständig suchte, über das fohlende Pferd, ihr Porträt und den Maler, mit dem sie den Vater betrogen hatte, was sie nun bereute wie nichts zuvor. All diese Worte, dieser ganze Fluss an aufgestauten Sätzen floss durch die Decke zu ihm hinab, ergoss sich über ihn, drang in seine Kleidung, seine Haut und seine Knochen, bis er nur noch aus dieser flüssig gewordenen Verzweiflung, diesen verwässerten Schuldgefühlen, diesem Wahnsinn zu bestehen schien. Dabei sprach seine Mutter doch zum Vater, dabei ging ihn das alles doch gar nichts an. Aber wie konnte man das schon trennen, wie konnte er es überhören, wenn er aus demselben Fleisch und Blut war wie sie, wie der verschwundene Mann und die trauernde Frau, die tagsüber stumm und reglos wie ein Stein am Fenster saß und in den Wald blickte, mit irren Augen, die an jeder Rinde abrutschten, an keinem Blatt Halt fanden, wie ein Tier von Baum zu Baum sprangen? – Es war unmöglich.
Das erste Nachtstück war eine Erzählung, die den Titel Der Sandmann trug. Imre las sie im Schein der Lampe, die auf dem Tischchen neben seinem Bett stand, in einem Zug durch. Als er das Buch neben die Lampe legte, fiel ihm auf, dass seine Hand zitterte, dann, dass auch sein Arm sich unruhig hin und her bewegte, und schließlich, dass sein ganzer Körper bebte. Den Blick auf den schwarzen Einband des Buchs geheftet, wartete er darauf, dass der Anfall verebbte.
Dann lag er wieder still. Die Mutter war zu Bett gegangen. Er hörte seine Organe – das Herz, den Magen, den Darm –, hörte, wie sie arbeiteten, wie sie ihn am Leben erhielten, wie er von ihrem Funktionieren abhängig war. Er erinnerte sich –
Erinnerte sich an Grimms Märchen, die ihm Johanna, das österreichische Kindermädchen, früher erzählt hatte und die sich oberflächlich kaum von der Geschichte gerade eben unterschieden. Deshalb war es ihm auch vorgekommen, als sei die Erzählung eines jener Märchen, zu denen er als Kind eingeschlafen war und an die er seit Jahren nicht mehr gedacht hatte.
Nur war Hoffmanns Geschichte bloß als einfaches Märchen getarnt, eigentlich aber zutiefst psychologisch und, ohne dass er sagen konnte, weshalb, von unermesslichem Trost für ihn. Erkannte er sich selbst im empfindsamen, rasend fantasievollen Nathanael wieder? Vielleicht. Wobei es ihm eher vorkam, als hätte sich die dunkle Erzählung in seine Magengrube gegraben und etwas zutage gefördert, von dessen Existenz er schon immer gewusst hatte, das er nun aber zum ersten Mal vor sich sah.
Nachdem sich auch sein rasender Atem beruhigt hatte, löschte er das Licht und versuchte zu schlafen.
Vergeblich.
Er zündete die Lampe wieder an, setzte sich auf, richtete die Kissen in seinem Rücken, schlug das Buch auf und las die nächste Geschichte – und die nächste – und die nächste. So ging es, bis er den Zyklus zu Ende gelesen hatte, und dabei reihten sich in seiner überhandnehmenden Müdigkeit die einzelnen Erzählungen zu einem dunklen Band aneinander, ohne dass noch eine Trennung zwischen ihnen bestand. Die Figuren traten aus ihrem Umfeld heraus, begegneten und begrüßten sich, der Advokat Coppelius schüttelte dem Hofrat Reutlinger die Hand, und Ignaz Denner schlitzte dem Erzähler Theodor die Brust auf. Als Imre schließlich die Augen zufielen, war er es, dessen Brust aufgeschlitzt wurde, und um die Sache noch komplizierter zu machen, war er auch der mit dem Messer.
Während Imre das Buch anfangs noch verschwiegen und nur nachts darin gelesen hatte, schlich es sich nach und nach in seinen Alltag. Zum Beispiel lag es, einige Tage nachdem es in seinen Besitz übergegangen war, für alle sichtbar auf der Ottomane im Studierzimmer, obwohl sich Imre sicher war, dort nicht gelesen zu haben.
Bald trug er die Erzählungen aber auch selbst ans Tageslicht, indem er eine nach dem Frühstück, eine nach dem Mittagessen und eine weitere nach dem Abendmahl las, immer und immer wieder. So konnte das Buch auch von Sándor nicht unbemerkt bleiben, dessen Beschützerinstinkt für seinen schwächlichen, verträumten Bruder seit dem Verschwinden des Vaters in Verachtung umgeschlagen war. Denn nun war Imre der Herr im Haus, nun musste er den Familiennamen in Ehre halten und die Geschäfte abwickeln. Doch stattdessen fraß er sich mit diesen Schauermärchen und Schundnovellen, diesen Teufelsgeschichten und Geistergespinsten voll und verlor nach und nach den Verstand.
Anfangs merkte man es kaum. Imre sprach zwar dauernd von diesem Buch, aber wenigstens war er nicht mehr so verschlossen. Und konnte man ihm wirklich vorwerfen, dass er lieber las, als sich um die Geschäfte zu kümmern? Immerhin war er noch fast ein Kind und hatte sich, anders als Sándor, nie für die Fischteiche, die Viehzucht, die Weizenfelder und die Holzwirtschaft der Familie interessiert. Auch als er einmal mit zwei verschiedenen Manschetten und falsch gebundener Krawatte zum Frühstück kam, erstaunte das niemanden, denn war es nicht verständlich, dass ihn der Tod des Vaters, dessen Leiche immer noch nicht gefunden worden war, mitnahm? Erst als er eines Tages nicht zum Abendessen erschien, begriff Sándor, dass sich der Verstand seines Bruders vor ihren Augen zersetzte.
Er hatte schon mit der Suppe begonnen, als Béla, der Diener, den er geschickt hatte, Imre zu holen, an den Tisch trat und sagte, der Bruder spreche im Salon mit jemandem und habe nicht auf das Klopfen reagiert. Sándor stutzte. Mit wem mochte er sprechen? Sie hatten keine Gäste, und die Bediensteten, mit deren höflicher, fast schon unterwürfiger Art er nicht umgehen konnte, mied Imre in der Regel. Sándor legte den Löffel am Tellerrand ab, erhob sich und sagte: «Entschuldige, Mutter, ich bin gleich zurück.» Dann folgte er Béla zum Salon.
Tatsächlich hörte er schon im Flur, dass sich Imre mit jemandem unterhielt. Er klang aufgebracht und verstummte auch nicht, als Sándor kräftig an die Flügeltür klopfte. Mit wem redete er bloß? Sándor hämmerte noch einmal gegen die Tür, dann trat er ein. Imre stand mit dem Rücken zu ihnen und schien sie nicht zu bemerken. Er trug weder Schuhe noch Socken und ging wild gestikulierend vor den englischen Jagdszenen und Familienporträts auf und ab. Außer ihm war niemand im Raum.
Kurz darauf übernahm Sándor die Geschäfte. Der Bruder wurde zur Erholung in ein Sanatorium in den Schweizer Alpen geschickt. Er blieb ein halbes Jahr, kehrte mit einer Geschlechtskrankheit und gelben Augen wieder, bezog ein spartanisches Zimmer im Westflügel, das man zur Beruhigung seiner Nerven blau streichen ließ, und blickte täglich viele Stunden in den Wald. Dort, zwischen den dichtstehenden Bäumen, sah er die Figuren Hoffmanns. Manchmal auch die Mutter, die täglich in den Wald lief, um das Jagdschloss des Vaters zu suchen, das es nicht gab und nie gegeben hatte. – Bis sie eines Tages nicht mehr wiederkam.
4
Es gab weder ein Porträt noch eine Fotografie von Imre. In keinem Archiv, in keinem Fotoalbum, auf keinem Nachttisch und auf keiner Kommode.
Kam der Fotograf aus Pécs, um die Eltern mit den herausgeputzten Kindern, Mária auf ihrem Schimmel, Sándor und seine Freunde nach der Jagd, die Gewehre über den Schultern und den erlegten Rothirsch vor sich im Gras, oder das Waldschloss und seinen nach englischer Art angelegten Garten zu fotografieren, schloss man ihn im blauen Zimmer ein, damit er auch nicht zufällig im Hintergrund zu sehen war. Dabei hätte er ein gutes Modell abgegeben mit seinem schmalen Gesicht, der geraden Nase und den Bernsteinaugen, vermutlich ein besseres als Sándor, bei dem sich das Aristokratische über seine Art zu sprechen, zu essen und sich zu kleiden manifestierte, Dinge, die er hatte erlernen müssen und die er manchmal, in Momenten der Selbstversunkenheit oder Anspannung, vergaß, wodurch seine ganze Ausstrahlung in sich zusammenfiel. Imre, der von den Gesichtszügen bis zu den Händen adlig wirkte, konnte dagegen barfuß durch den Garten irren und immer noch edel aussehen.
Manchmal träumte Mária, dass ihr Mann sie nackt und gesattelt auf allen vieren zu seinem Bruder ins blaue Zimmer trug, wo sie ihn an einen der Bettpfosten band und zusehen ließ, wie Imre und sie sich liebten.
In Wahrheit hatte sie kaum mehr als ein paar Sätze mit ihm gewechselt, da ihr Zimmer im Ostflügel lag und er seines nur zum Essen verließ. Doch auch dies tat er nicht mit ihnen. Einerseits, weil Sándor ihn für seine Krankheit, die er als Schwäche und Kapitulation vor dem Schicksal sah, verachtete, andererseits, weil sie häufig Gäste hatten, vor denen man die Schattenseiten der Familie mit allen Mitteln geheim hielt.
Auch Lajos war es nicht erlaubt, am langen Tisch zu sitzen, solange er den einwandfreien Umgang mit Messer und Gabel nicht beherrschte, sodass er mit seinem Onkel und Ida im kleinen Salon essen musste, denn mit dem Verrückten allein gelassen hätten ihn die Eltern nie.
Dennoch entwickelte sich während der Mahlzeiten eine Art von Freundschaft zwischen den beiden. Lajos war der Mann mit den flinken Händen, die immer in Bewegung waren, nie stillhielten, stets über den Saum des Tischtuchs, den Rand des Weinglases und die Spitzen der Messer strichen, als müssten sie zwanghaft die Enden aller Dinge abtasten, spätestens seit dem Tag sympathisch, als dieser ihm mit einem Augenzwinkern eine goldbraune Bratkartoffel in die Schale schleimigen Milchgrießes gelegt hatte.
Der Milchgrieß, den er im damaligen Glauben, es gäbe nichts Besseres für Kinder, tagein, tagaus vorgesetzt bekam, war während seiner frühen Kindheit das Schlimmste, das er sich vorstellen konnte. Jeden Morgen, jeden Mittag und jeden Abend fragte er sich, was er nur getan habe, um dies zu verdienen, und andauernd überlegte er sich neue Dinge, um seine Eltern zufriedenzustellen. Würden sie ihn lieber mögen, wenn er in der Eingangshalle nur noch auf die schwarzen Marmorfliesen träte? Oder wurde er bestraft, weil er sich zu selten räusperte? Oder bei Regen zu oft sang? – Er kam nicht dahinter, die Welt der Erwachsenen war zu kompliziert und undurchsichtig.
Nur Imre schien ihn zu verstehen. Außerdem war er so gut zu ihm wie niemand sonst, denn wann immer Ida aus dem Fenster blickte, schaufelte er ihm etwas von seinem Essen in die Schale. Dazu erzählte er diese fabelhaften Geschichten, in denen all die Waldwesen und Gestalten vorkamen, denen Lajos manchmal am Waldrand begegnete.
Ilona beneidete Lajos darum, dass er im kleinen Salon seinen Milchgrieß essen durfte. Nicht nur, weil sie beim Essen der Innereien ständig daran denken musste, wie die Köchin ihre fleischigen Hände in den dunklen, blutigen Bauch des Tiers gegraben, wie es in der Küche gestunken und wie sich die fetten, glänzenden Schmeißfliegen auf die Fleischklumpen niedergelassen hatten, sondern auch, weil sie Erwachsene nicht ausstehen konnte. Sie verstand nicht, wie man dem Leben so stumpf gegenübertreten, wie man sich einfach von den Jahren überrollen lassen konnte, bis eines der Räder zu schwer war und einen erdrückte. Außerdem fand sie Erwachsene lächerlich. Am schlimmsten war der Vater mit seinem peinlichen Ernst, seinen bedächtigen Bewegungen und seinem peniblen Anstand, der ihm wichtiger war als alles andere.
Natürlich fand sie auch die übrigen Erwachsenen lachhaft, Doktor Török zum Beispiel, wohl der albernste Mensch, den es gab. Doch im Gegensatz zum Vater war ihr der Doktor sympathisch, denn er schien sich seiner Eigenart durchaus bewusst und wackelte, da er die heilende Wirkung der Komik kannte, wann immer er ans Bett eines kranken Kindes gerufen wurde, mit seinen großen, abstehenden Ohren.
Auch die Köchin, die mit ihrem gewaltigen Hintern nicht durch die Tür der Eiskammer passte, oder den Knecht, der sich immer tief und theatralisch verbeugte und «Ich wünsche Ihnen einen ganz vorzüglichen Tag, Fräulein Baronesse» sagte, wenn er ihr über den Weg lief, fand sie auf diese sympathische Art lächerlich. Ihren Vater dagegen konnte sie nicht ausstehen.
Als es so weit war, dass Lajos endlich auch am langen Esstisch mit den vierundzwanzig Stühlen sitzen durfte, deren Rückenlehnen das Familienwappen zierte, verstand er plötzlich, weshalb Ilona ihn immer beneidet hatte: Die Essen waren eine Qual. Die ganze Zeit fürchtete er, das schwere Silberbesteck fallen zu lassen, worauf der Vater – da war er sich ganz sicher – aufspringen und ihn an den Handgelenken ins Nebenzimmer zerren würde, um ihn dort zu verprügeln, während die Gäste betroffen schweigend weiteräßen.
5
Das Summen einer zwischen Rollladen und Fenster gefangenen Biene. Schmale Lichtstreifen, die in das Zimmer fielen und sich auf dem geblümten Bettlaken, dem Perserteppich, den gedrechselten dunklen Möbeln und der gelben Tapete niederließen. – So begann der Tag.
Ilona öffnete die Augen, sah das gelbe Licht, das ganz anders als im Waldschloss in ihr Zimmer drang, und begriff, dass Frühling war.
Zu Hause hatte sie Mühe, morgens aufzustehen, und fand kaum etwas schlimmer als das schrille Klingeln des Weckers, das sich erst in ihre Träume bohrte und sie dann gewaltsam aus diesen herausriss, aber hier, in Hévíz, wo es keine Wecker, sondern nur das Summen der Biene und allenfalls das Läuten der Glocken gab, stand sie gerne auf.
Hier erwartete sie aber auch nicht gleich nach dem Aufwachen ihr Vater, der nichts weiter tun musste, als mit der aufgeschlagenen Zeitung zu rascheln, um sie schlechtgelaunt zu Frau Majors Unterricht erscheinen zu lassen. Nein, hier stand sie auf, ging barfuß zum Fenster, freute sich über das Parkett, das sich anders als daheim anfühlte, und zog die Rollläden hoch. Im Waldschloss war das Idas Aufgabe und meist das letzte Mittel, um sie aus dem Bett zu kriegen.
Ilona öffnete das Fenster. Die Biene flog zwischen den grünen Ästen der Kastanien davon. Auf der Straße wichen Fußgänger, Kutschen und Gemüsehändler mit Holzkarren dem Automobil aus, in dem Herr Fehér wie jeden Samstag die Allee auf und ab fuhr. Ilona legte sich zurück unter die Decke.
Sie liebte es, bei offenem Fenster im warmen Bett zu liegen, die frische Morgenluft, den Tau auf den Blättern und die geblümte Bettdecke zu riechen, die, seit sie denken konnte, mit Lavendelseife gewaschen wurde. Doch am meisten mochte sie es, die Geräusche der Straße zu hören, die in das Zimmer drangen, ohne die Ruhe darin zu stören.
Wenn sie so im Bett lag, war alles wie im Jahr zuvor. Und unten auf der Allee hatte sich nichts verändert, seit sie sich wieder hingelegt hatte, das wusste sie, ohne rausschauen zu müssen, denn sie hörte den knatternden Motor von Herrn Fehérs Auto, die Pferdehufe auf dem Pflaster, das Schnalzen der Kutscher, die Rufe der Obst- und Gemüsehändler und die hellen, freudigen Stimmen der Frauen. Dieser Gedanke, dass all das ganz unabhängig von ihr existierte, dass diese kleine Welt vor dem Fenster auch da war, wenn sie ihren Blick nicht darauf richtete, beruhigte Ilona wie kein anderer.
Doch nicht nur für Ilona bedeuteten die Wochen in Hévíz die schönste Zeit des Jahres. Auch Mária blühte in der Kurstadt auf, was nicht an der entspannenden Wirkung des körperwarmen Thermalseewassers lag, sondern vor allem daran, dass sie unter Menschen war. Das Sehen und Gesehenwerden war ihre Kur, der Blick der anderen das einzige Mittel gegen das Gefühl, nicht wirklich zu existieren, bloß ein Konstrukt aus Wörtern und Gedanken zu sein.
Hier in der Stadt hatte sie dieses Gefühl nie. Nur manchmal, wenn sie eine besonders weiße Wolke sah oder in der Zeitung auf ein Wort stieß, das sie noch nicht kannte, dachte sie daran, aber so, wie man an einen vertrauten Schmerz denkt, von dem im Nachhinein bloß eine vage Erinnerung bleibt. Der Gedanke, dass all das, die Zeitung, in der sie las, der Sessel, in dem sie saß, die Lesebrille, die sie trug, oder der Himmel, an dem die Wolke stand, nichts als eine sprachliche Schöpfung war, kam ihr dann so verrückt vor, dass sie schmunzelnd den Kopf schüttelte.
In der Regel hatte sie aber gar keine Zeit für solche Gedanken, denn die Osterzeremonien beanspruchten jede freie Minute. Ständig musste man beten, essen, rot bemalte Eier suchen und so tun, als habe man hinter dem Kirschbaum oder der Hibiskushecke den Osterhasen verschwinden sehen.
Die Wochen danach waren nicht weniger voll von Ablenkung. Tagsüber versuchte sie, sich im warmen Thermalwasser von den Strapazen der Feiertage zu erholen, wobei sie ständig Bekannte traf, mit denen sie über andere Bekannte tratschen musste, abends waren sie zu Diners oder kleinen Bällen eingeladen oder besuchten das Kasino, das Freilufttheater oder eine Kinovorstellung. – Die Möglichkeiten waren endlos, die Welt, die im Waldschloss zusammenschrumpfte, entfaltete sich wieder vor ihr.
Als das gelbe Zimmer erfüllt war vom Duft der Kastanien, hörte Ilona durch die Wand, die ihr Schlafzimmer vom Esszimmer trennte, das leise Tellerklirren, das sie immer an eine orientalische Bauchtänzerin denken ließ, an deren schmalen Handgelenken unzählige goldene Armreife klimperten. Wie einfach es war, sich an einem solchen Morgen an die märchenhaftesten Orte zu träumen, wo man doch selbst vor lauter Schönheit um einen herum kaum atmen konnte! Denn es war Frühling, und der tiefe, dunkle Wald war weit weg, und hier in der Stadt waren die Bäume nur Verzierung, hier säumten die Kastanien in Reih und Glied die Hauptstraße und bewegten nur morgens und abends ihre tiefgrünen, reich belaubten Kronen, in denen die Türkentauben saßen und gurrten. Manchmal rollte Herr Fehér in seinem Automobil oder eine Droschke über das holprige Pflaster der Allee, und dann streiften die Zylinder der schwarzgekleideten Kutscher beinahe die tiefsten Äste der Kastanien. Und über allem war der Himmel – unendlich, unglaublich blau.
Schlug die Standuhr im Flur neun, verließ Ilona das Bett, schloss das Fenster und zog sich hinter dem Wandschirm das Nachthemd aus und ein besticktes Kleid an. Kam sie dann an den Tisch, war Ida gerade dabei, die letzten Speisen aufzudecken.
Auch ihr Körper war voller Frühling, obwohl es für Außenstehende aussah, als wüte ein winterliches Fieber in ihr, denn ihre Wangen waren glühend rot, ihre Stirn brennend heiß, ihre Augen von einem fiebrigen Glanz, und ihre Hände zitterten, wenn sie die Schalen und Schüsseln auf den Tisch stellte.
«Geht’s dir nicht gut, Kind?», fragte Mária vor jeder Mahlzeit.
Worauf der Vater antwortete, bevor Ida den Mund aufmachen konnte: «Aber sicher geht’s ihr gut! Wie soll’s ihr auch schlecht gehen bei uns?»
Es war Morgen, und dann war es Abend, und dazwischen raste die Zeit, denn bei all dem Rummel und Sonnenschein vergaß man völlig, auf ihr Verstreichen zu achten. So verflossen die Stunden – die Tage – die Wochen.
Der Vater blieb nie länger als sechs Tage, dann reiste er ab, um sich wieder den Geschäften zu widmen und im Waldschloss nach dem Rechten zu sehen. Die Zeit ohne ihn war noch schöner, weil nun gelacht werden durfte – sogar bei Tisch. Außerdem durfte die gute Ida spätabends, wenn die Kinder schon schliefen, ihren Paul hereinlassen und mit ihm in ihrer Kammer verschwinden, denn die Baronin wusste, wie es war, wenn im Körper der Frühling und das Fieber tobten und man keinen ruhigen Ort hatte, um den Kampf zu schlichten.
Nur schliefen die Kinder gar nicht, wenn der langjährige Diener der Grünfelds an die Tür des roten Backsteinhauses klopfte. Oder zumindest nicht beide: Die dreizehnjährige Ilona erwartete die schweren Schritte des unbekannten Mannes im Treppenhaus jeden Abend mit schmerzhafter Spannung und heißer Vorfreude, denn das dumpfe, rhythmische Klatschen und die unterdrückten animalischen Laute, die kurz darauf durch die Zimmerdecke zu ihr drangen, lösten ein unerklärliches Kribbeln in ihrem Unterleib aus, das sich anfühlte wie die Vorahnung von etwas Großem, Bedeutendem, und gegen das seltsamerweise nur ein zwischen die Schenkel geklemmtes Kopfkissen half, an dem sie ihren Unterleib rieb.
Frühmorgens, noch bevor die Kastanien ihre tiefgrünen Kronen bewegten, musste Paul gehen. Dann zog er sich an, gab der schlafenden Ida einen Kuss auf die heiße Stirn, verließ das Backsteinhaus, überquerte die einsame Straße und betrat das Haus der Grünfelds. In den Ästen der Kastanien gurrten die ersten Tauben, und Mária, die von den schweren Schritten im Treppenhaus geweckt worden war, dachte an ihren Pál – und Ida, die durch den Stirnkuss wach geworden war, dachte an ihren Paul.
6
Jakub Jakubowskis beste Jahre lagen weit zurück (wenn es sie überhaupt je gegeben hatte). Er hatte vier Jahrzehnte an der äußersten östlichen Grenze der gewaltigen Monarchie, an der Schwelle zur fruchtbaren gelben Ukraine, als Schreiber eines Hauptmanns gedient. Sein Leben war eintönig wie die weite Landschaft gewesen, die Tage kaum voneinander zu unterscheiden. Da der Gedanke, das Habsburgerreich könnte endlich sein, undenkbar war, gab es nicht viel zu tun – sie waren bloß eine der tausend kleinen Städte an der gesicherten Grenze des riesigen Imperiums. Die Soldaten exerzierten, putzten ihre Gewehre, Stiefel und Säbel, besuchten abends das Kasino und danach das Bordell. Manchmal blickten sie in den endlos weiten Himmel oder in die ewiggleiche gelbe Einsamkeit der Ukraine und verfluchten den Kaiser für seinen Größenwahn.
Jakub Jakubowski sah den Himmel und die Landschaft nur im Sommer, denn er betrat das Schreibzimmer, das an das Büro des Hauptmanns grenzte, frühmorgens und verließ es erst am späten Abend wieder. Dazwischen schrieb er Briefe.
Die Briefe waren ausnahmslos Liebesbriefe, die er im Namen des Hauptmanns an dessen sieben, im ganzen Reich verteilte Freundinnen und Frauen schrieb. Er las auch die Briefe, die sie dem Hauptmann zurückschickten, sodass er nach kurzer Zeit selbst das Gefühl hatte, von sieben Frauen in der ganzen Monarchie geliebt zu werden. Gleichzeitig wurde er immer weicher und unsoldatischer, denn der tägliche Kontakt mit der Liebe schliff ihn ab.