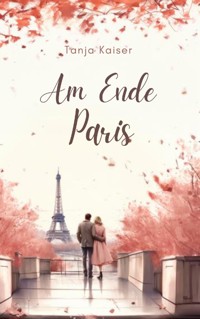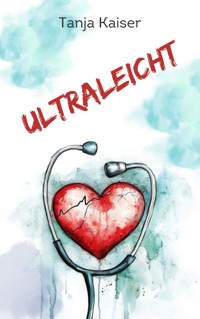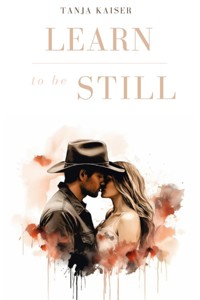
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Wenn sich im Leben eine Türe schließt, sollte man manchmal mit Hammer und Nagel sicherstellen, dass das Ding auch zubleibt." Diese Erkenntnis muss auch Elifa machen, als sie den smarten Caleb trifft. So sehr sie sich auch von ihm angezogen fühlt, so wenig nachvollziehbar sind seine Handlungen und Reaktionen für sie. In einem Strudel aus Liebe und Leidenschaft versucht sie, die fehlenden Teile zusammenzufügen, nur um dann zu erkennen, dass das Wissen darum besser im Dunkel geblieben wäre. Eine Geschichte über Leidenschaft und große Gefühle, echtes Leben und die Dramen, die es mit sich bringt. Und der Einsicht, dass niemand ein unbeschriebenes Blatt ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 546
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kapitel 1:
Ich sah hinaus durch das runde Bullauge auf den Parkplatz und fragte mich ein weiteres Mal, welche Ausgeburt der Hölle die Idee gehabt hatte, in dieses verdammte Büro ein Fenster einzubauen, das man nicht öffnen konnte.
Fenster waren zum Öffnen da, jedes Kind wusste das.
Fenster machten Sinn, jedenfalls in meiner Welt, und EIGENTLICH ja auch in der Welt jedes halbwegs klar denkenden Menschen mit mehr als drei Gehirnzellen.
Aber nein, dieses riesige runde Ding ignorierte diese Tatsache komplett.
Irgendein Architekt hatte vermutlich sogar einen Preis für diese Fensterlösung bekommen, wegen der ich mich mir nun die meiste Zeit wie ein Fisch im Aquarium fühlte.
Das riesige Bullauge mit dem dunklen Rahmen nahm fast die ganze Wand ein, und trotzdem war es in dem Büro immer stickig und im Sommer zu warm.
Die Sonne knallte rein, natürlich hatte man auch auf ein Rollo verzichtet, und zugunsten der Optik konnte man stattdessen unter dem Brennglas vor sich hinkokeln, als sei man ein Bratwürstchen auf dem Grill.
Und so hechelte und kokelte ich also in Sommer vor mich hin, und wünschte mir einfach eine Klimaanlage herbei, für die offenbar im Angesicht des sauteuren Fensters kein Geld mehr übrig gewesen war.
Aktuell war das zwar nicht zu befürchten, der Herbst stand vor der Türe, aber trotzdem hätte ich nichts gegen ein wenig mehr Frischluft gehabt.
Immer wieder hatte ich darüber nachgedacht, dass es in Deutschland für alles Vorschriften gab. Für die Größe von Gurken, Kartoffeln, Toiletten und eigentlich auch allem anderen.
Wieso gab es dann eigentlich keine Vorschrift dafür, wie weit man das Fenster eines Büros öffnen können musste?
Das runde Fenster mochte ja vielleicht von außen sehr modern und zeitgemäß wirken, für denjenigen der dahinter saß, war es jedoch vielmehr der wahr gewordene Wohnalptraum.
Im oberen Teil gab es zwar ein kleines Viertel, welches man kippen konnte (gefühlte 2,5 Zentimeter, also auch komplett überflüssig), dieses brachte allerdings an warmen Tagen auch keine richtige Abkühlung. Geschweige denn, dass die wenigen Zentimeter dazu in der Lage waren, die Sauerstoffzufuhr in angemessener Weise zu gewährleisten.
Traumhafte zustände also, für die mich vermutlich absolut niemand beneiden würde.
So manches Mal hatte ich in den letzten 10 Jahren davon geträumt, bei geöffnetem Fenster auf die ehemals gegenüberliegenden Obstbäume zu schauen. Das wäre schön gewesen, aber auch damit war es nun auch endgültig vorbei, denn diese gab es nicht mehr.
Das Gewerbegebiet, in dem ich jetzt offensichtlich arbeitete, nahm immer größere Züge an, und kürzlich mussten auch meine Obstbäume und Wiesen diesem Fortschritt weichen. Ein Gebäude nach dem anderen entstand, und ich konnte nur dabei zusehen.
Ich kam mir schrecklich alt vor. Die Zeit war gerast und ich hatte es nicht mitbekommen.
Mit Anfang dreißig kam es mir vor, als würde alles an mir vorbeischnellen, und dieser Fleck, an dem ich meine Tage fristete, veränderte sich so schnell, dass ich kaum mitkam.
Diese Art von Veränderungen, mit ihren unfassbaren Geschwindigkeiten, waren mir unangenehm. Ich brauchte keinen Fortschritt, für mich konnte gerne alles auf ewig so weiter laufen, wie es schon immer gewesen war. Warum Veränderung wünschen, wenn doch eigentlich alles gut war?
Als wir hier gebaut hatten, war hier nichts gewesen.
Nichts außer Feldern, Obstbäumen, und hinter unserem Gebäude Wiesen mit Schafen. Fast idyllisch. Aber schon damals war klar, das dies ein Industriegebiet werden würde und wir nicht auf ewig allein.
Darüber nachgedacht hatte ich lange nicht, immerhin war über Jahre auch nichts passiert, aber irgendwann rollten die Bagger, und stille Panik hatte mich ergriffen.
Was würde werden, wenn statt grüner Wiesen plötzlich Fertigbauten meine Aussicht versperrten?
Dass es mich allerdings so treffen würde, wenn die Bäume endgültig verschwanden, damit hatte ich nicht gerechnet. Auch wenn Veränderung mir pauschal zuwider waren, so überraschte mich das Stechen in meiner Brust dann doch. Wie schade um das wenige Grün, wie schade um meine ehemals sensationelle Aussicht.
Für unsere Firma jedoch war das eine tolle Sache, wir hatten damals recht günstig den Boden gekauft, in der Aussicht auf die Dinge, die sich verändern würden.
Jetzt zahlte sich diese Weitsicht eindeutig aus, denn mehr und mehr wurden wir zum Mittelpunkt eines weiter wachsenden Industriegebietes.
In den vergangenen Jahren waren außerdem um mich herum eine Reihe Wohnhäuser gewachsen, da der Baugrund erschwinglich war, und die Verkehrsanbindung eigentlich ganz gut. Für ein Wohnhaus schien es mir äußerst unpassend hier, aber viele andere schien es nicht zu stören, und so hatte der Bau der Wohnhäuser lange vor dem der Industrie begonnen. Geschäfte waren erst vor kurzer Zeit dazu gekommen, mittlerweile war ein reges Treiben um unser Gebäude herum entstanden, und schon in wenigen Jahren würde es hier völlig anders sein.
Das erste Haus, dem meine Obstbäume vor dem Fenster weichen mussten, war modern. Wobei das noch untertrieben war. Fast futuristisch stand es auf der leichten Anhöhe hinter den Firmenparkplätzen, und lachte mich jeden Tag aufs Neue aus.
Es strafte meine Naivität ab, denn lange hatte ich geglaubt, dass genau an diesem Platz sicher nicht gebaut werden würde, und schien die Strafe für jedes Unrecht, dass ich vielleicht mal begangen hatte.
Ich mochte diese Art Bauten nicht, ich mochte Altbau.
Abgenutzt und mit Geschichte, gerne auch etwas schief und krumm. Ein Gebäude wie das vor meinem Fenster, entsprang meinen Alpträumen genauso, wie das runde Fenster in meinem Büro.
Was brachte es, zwar modern, aber ungemütlich und vor allem unpraktisch zu sein?
Kastenbauten und Fischglasfenster brauchte niemand, ich jedenfalls ganz sicher nicht, und auch wenn es dafür vielleicht einen Design-Preis gab: Es sah einfach dämlich aus.
Ein wenig erinnerte es mich an die Zeichnung eines kleinen Kindes, bei denen Häuser einfach nur aufeinandergestapelte Vierecke waren.
Das Haus sah aus wie ein rechteckiger Kasten, auf dem ein kleinerer Kasten obenauf stand, und bestand fast nur aus nicht durchsichtigem Glas.
Das allein wäre für mich schon Grund genug, dort nicht zu wohnen. Ich konnte mir nicht vorstellen, mich dort frei zu bewegen, auch wenn ich wusste, dass die Glasfronten vermutlich nicht wirklich durchsichtig waren.
Trotzdem würde ich mich dort beobachtet fühlen, und was war den überhaupt das Problem mit Wänden? Ich mochte Wände, Fenster die man öffnen, und Türen, die man schließen konnte.
Wo mochte man dort seine Schränke aufbauen, so ganz ohne Außenwände? Stellte man die Schränke einfach vor die Glasfront, und tat, als wäre sie eine Wand?
Machten Glaswände dann überhaupt sinn?
Und wenn es dort keine Schränke gab, wo verstauten die Leute dort dann ihre Sachen?
Ich dachte an all die Dinge, die in meiner kleinen Wohnung standen, und fragte mich, ob andere Leute vielleicht einfach nicht so viele Dinge besaßen, die sie unterbringen mussten.
Es gab ja Menschen, denen Dinge nicht wichtig waren, das war mir klar, aber jeder musste in meinen Augen doch irgendetwas haben, dass ihm wichtig war. Materielle Dinge ohne tatsächlichen Wert, die ihn an etwas erinnerten.
Bilder, Bücher, Geschenke aus der Vergangenheit, Kindheitserinnerungen oder irgendwas dergleichen. Ich selbst hatte davon viele.
Kleine Dinge die mich an Situation, Menschen oder Lebensereignisse erinnerten. Und wann immer ich sie sah, oder berührte, war ich wieder dort. In der Situation, in dem Gefühl, in der Phase in der ich sie bekommen hatte. Oft führte ich diese Gefühle ganz bewusst herbei, wenn ich mir mal wieder meiner Einsamkeit und meines Singledaseins allzu bewusst wurde, zum Beispiel.
Ich kramte dann meine Kiste voll Erinnerungen heraus, und suhlte mich in den Erinnerungen an Zeiten, in denen ich jemanden gehabt hatte. Ich fragte mich, was wohl daraus geworden wäre, wenn die Dinge anders gelaufen wären, oder ich anders gehandelt hätte. In meiner Logik war das ein Lernprozess, um zu wissen, wie man es beim nächsten Mal besser machen konnte.
Ich war mir sicher, dass alle Beziehungen irgendwie nach dem gleichen Muster ablaufen würden. Junge trifft Mädchen, Frau trifft Mann, man lernte sich kennen und verliebte sich, kam zusammen, um dann festzustellen, dass nicht alles rosa-lila ist. Und dann musste man weitermachen oder aufgeben.
Die wenigen Beispiele, die ich kannte (verschwindend wenige), bei denen es auch noch nach Jahren rosa-lila war, konnte ich an einer Hand abzählen.
Und all diese Beziehungen schienen mir todlangweilig und nicht erstrebenswert. Ich wollte Dramen und Leidenschaft, wie in meinen Romanen oder den schnulzigen Liebesfilmen, die ich mir immer wieder ansah.
Da draußen musste doch mehr sein als Alltag. Wie konnte man sich zwischen Abendessen und dem Abendfilm lebendig fühlen?
Ich war mir sicher, dass mein Singledasein dafür die bessere Alternative war. So konnte ich tun und lassen was ich wollte und mir bei Bedarf irgendeine kurzfristige Ablenkung gönnen.
Dass es Menschen gab, die diese Art von Erinnerungen nicht hatten, oder vielleicht nicht brauchten, konnte ich mir einfach nicht vorstellen. Wie überlebte man, wenn man nicht auf das Gefühl zurückgreifen konnte? Wie überlebte man, wenn man nichts hatte, an das man sich klammern konnte? Keine Fotografie, oder kein Stofftier, das einen an etwas wirklich großes oder intensives erinnerte?
Das Gebäude vor meinem Fenster lag still und stolz vor mir, und das viele Glas reflektierte das wenige Sonnenlicht, das darauf schien.
Ich vermutete in dem Glashaus ein Büro mit angeschlossenem Wohnraum, denn in meinen Augen würde nur das sinn ergeben. So ein Haus, so außergewöhnlich und auffällig, diente sich er irgendeinem Zweck. Nur wohnen wäre sich zu wenig, das hier war ein Statussymbol, und auch dafür hasste ich es.
Statussymbole waren etwas für Leute, die sonst nichts hatten. Oder sich über Dinge definierten, weil sie selbst einfach nichts zu bieten hatten.
Ich war seit seinem Bau nie näher als 500 Meter heran gegangen, obwohl alle anderen aus dem Büro den Bau und die Fertigstellung live miterlebt hatten.
Schon alleine die Lieferung der riesigen Glasfronten hatte einer Großveranstaltung geglichen, und tagelang hatte es kein anderes Thema gegeben.
Das gerade ein solches Haus hier gebaut wurde, war schon annähernd ein Skandal, denn zwischen all den langweiligen Fertigbauten und Betonklötzen, fiel ein Haus aus Glas eindeutig auf.
Fast hatte es mich gewundert, dass nicht irgendein Fernsehsender oder zumindest die hiesige Presse an dem Spektakel teilgenommen hatten, denn gefühlt hatte jedes Lebewesen mit Beinen dem Theater beigewohnt. Außer ich, die trotzig einfach alles ignoriert hatte.
Als es endlich fertig geworden war, hatten die anderen Brot und Salz organisiert, um den neuen Nachbarn willkommen zu heißen. Ich war nicht dabei, denn auch hier hielt mein Trotz über die Verbauung meiner Aussicht mich davon ab. Für mich war es weder willkommen noch erwünscht, und somit auch die damit verbundenen Personen.
Wer auch immer dort arbeitete oder wohnte, er entsprach ganz sicher nicht mir, und daher konnte ich auf ein Kennenlernen wohl auch getrost verzichten.
Es sah aus, als handelte es sich um mindestens zwei Stockwerke, aber durch die Fensterfront war das nicht wirklich ersichtlich. Alles wirkte für mich viel zu eckig und steril, und auch wenn alle sich vor Begeisterung fast ins Höschen machten: Ich mochte es einfach nicht.
Wer auch immer hinter diesem Bau steckte, war in meinen Augen vermutlich genauso kantig und steril wie dieses Gebäude, und auf jeden Fall ein Mensch, der mir schon mal pauschal unsympathisch war.
Ganz weit weg von meiner Welt aus Plüsch und Kitsch, und somit auf der Liste der uninteressanten Dinge dieser Welt sehr weit oben im Ranking.
Das einzig Positive was ich dem Ganzen abgewinnen konnte, war, das es offensichtlich über eine Dachterrasse verfügte. Jemand hatte in den letzten Wochen einige Pflanzen aufgestellt, die ich von meinem Platz aus sehen konnte, und auch wenn das nur ein winziger Trost war, so war es doch zumindest eine kleine Versöhnung.
Dachterrassen mochte ich, vermutlich würde ich auf einer wohnen, wenn das den möglich wäre, und zumindest darauf war ich neidisch.
Vielleicht gab es dort eine Frau, die versuchte dem Betonklotz etwas Leben einzuhauchen, und die versuchte, ein Leben dort überhaupt erst möglich zu machen. Ich stellte mir vor, wie sie die Pflanzen pflegte, und im Inneren bunte Decken und Kissen verteilte, um dem Ganzen eine heimelige Atmosphäre zu geben.
Ich zumindest hätte das getan, den anders hätte ich das Haus sicher nicht ertragen können.
Ich seufzte und wand mich wieder meinem Rechner zu, das war dann wohl der Lauf der Dinge, und es gab sicher einen Haufen Leute, die das Gebäude gegenüber sehr schön fanden. Nur weil es mir nicht gefiel, galt das nicht für den Rest der Menschheit, und meine Meinung würde ganz sicher auch niemanden interessieren.
Das Haus musste ein Vermögen gekostet haben, und wer auch immer es gebaut hatte, musste damit seinen Lebenstraum erfüllt haben.
Das allerdings fand ich irgendwie schön, jemand hatte es geschafft, seine Träume erst auf Papier zu bringen und dann wahr werden zu lassen. Ich wünschte mir das für mich auch, allerdings wusste ich gar nicht so genau, wie meine Träume eigentlich aussahen. Wenn ich ehrlich zu mir selbst war, was mir äußerst schwerfiel, konnte ich nicht mal einen halbwegs brauchbaren Zukunftsplan vorlegen, und daher würde schon die Sache mit dem „aufs Papier bringen“, mich sofort scheitern lassen.
Ich gehörte jedenfalls sicher nicht zu den Leuten, die solche Häuser zu Ihren Träumen zählten, und wünschte mir meine Obstbäume zurück.
Kapitel 2:
Ich schloss die Türe meines Büros hinter mir und zog die Lederjacke enger um mich. Eigentlich war ich wohl etwas zu dünn angezogen für den herannahenden Winter, aber Winterkleidung war mir ein Graus, und so zögerte ich lange Hosen und dicke Pullis bis zur letzten Minute hinaus.
An diesem Tag hatte ich cremefarbene Stiefeletten und einen kurzen Cordrock an, und die einzige Jacke, die halbwegs dazu gepasst hatte, war eigentlich zu dünn.
Heute Morgen noch hatte ich geglaubt, ich würde auch mit einer dünnen Jacke irgendwie durch den Tag kommen, aber der kalte Wind vor dem Gebäude belehrte mich eines Besseren.
Dass ich wieder einmal meinen Modegeschmack über das Wetter gestellt hatte, sah mir einfach ähnlich. Mein Dickschädel war einfach uneinsichtig, was diese optischen Dinge betraf, und jedes Mal ärgerte ich mich im Nachhinein darüber. Ob frieren wirklich besser war, als eine unpassende Jacke zu tragen, darüber konnte man eigentlich nicht streiten. Trotzdem tat ich es mit meinem Unterbewusstsein, und immer gewann dabei mein Dickschädel.
Ich war zwar dreiunddreißig, sah aber sehr viel jünger aus, und wirkte auf die meisten Leute fast kindlich. Was meiner Meinung nach auch der Grund für mein Verhalten war, denn warum sollte ich mich erwachsen verhalten, wenn es mir doch ohnehin niemand abnahm?
Ungeschminkt konnte ich nicht mal Alkohol im Supermarkt kaufen, und man ließ mich auch nicht in Filme ab achtzehn, wenn ich nicht sofort meinen Ausweis zeigte.
Ich hatte früher versucht, mich auf jede erdenkliche Art älter zu machen, meine Haarfarbe und meine Kleidung gewechselt, und es irgendwann aufgegeben.
Egal was ich probiert, egal wie elegant oder businessmäßig ich es versucht hatte, immer war ich gescheitert. Also hatte ich einfach beschlossen, dass mir all das egal sein, und ich einfach ich sein würde.
Trotzig trug ich seitdem, was auch immer mir gefiel, und scherte mich nicht mehr um den Rest der Welt, der mich ohnehin meistens langweilte. Sollten doch alle in die gleiche Richtung laufen, ich nahm aus Prinzip die andere.
Wenn ich schon das ewige Kind sein würde, dann würde ich auch das Beste daraus machen, und vor allem meinem Ruf gerecht werden.
Schlussendlich konnte ich ja nichts für mein Aussehen, und schon gar nicht für mein Puppengesicht, auch wenn Frauen mir immer wieder etwas anderes vorwarfen.
Meine Mutter sah mit über 60 immer noch aus wie 50, und ich hatte wohl ihre Gene geerbt, worüber ich vermutlich erst in zehn Jahren wirklich froh sein würde.
Ich schmierte mir keine Anti-Aging-Creme ins Gesicht, machte absolut keinen Sport, und wusste, dass mich Millionen Frauen dafür hassten.
Wie schwierig das Leben als ewiges Kind eigentlich war, verstand im Grunde niemand, und wann immer ich jemandem mein Leid klagte, erntete ich nur Unverständnis.
Nicht ernst genommen zu werden, von oben herab behandelt und bevormundet zu werden, hatte ich mich jahrelang an den Rande des Wahnsinns getrieben.
Jeder glaubte, ich würde Ratschläge und dämliche Kommentare brauchen, weil ich ohne sie nicht überleben würde.
Manchmal ärgerte es mich auch einfach nur, die Leute kauften mir Fachkompetenz einfach nicht ab, und manches Mal wurde ich für das Lehrmädchen gehalten.
Jeder Versuch, das Gegenteil zu beweisen, endete im absoluten Chaos, und meistens lächelten die Leute dann einfach nur. Ich war ein Kind, was sollte man anderes erwarten?
Ich hatte das dringende Bedürfnis ernst genommen zu werden, scheiterte aber regelmäßig an mir selbst, denn zu meinem Aussehen kam noch völlige Planlosigkeit.
Schusselig, leicht abzulenken, das perfekte Opfer für jedes Fettnäpfchen.
Den Rest der Zeit, immer dann wenn gerade nicht genervt davon war, machte ich mir einen Spaß aus meinem Aussehen. Ich trug, was mir gefiel, und machte mir nichts daraus, ob es meinem Alter entsprach. Ich konnte dank Größe 34 alles tragen, und tat dies auch ohne Rücksicht auf Verluste.
Manchmal so schmerzhaft, dass selbst ich für Sekunden zweifelte. Und dann trotzdem einfach damit auf der Straße herumlief.
Mein Geschmack war breit gefächert, und ich trug mal dieses oder jenes, je nachdem was ich gerade für eine Phase durchmachte. Aktuell war sie fast gediegen, aber nächste Woche konnte es schon anders aussehen, und vielleicht entschied ich mich schon in ein paar Tagen, dass ich mich in ein Hippiemädchen verwandeln würde.
Gerüstet war ich für jede meiner Launen, mein Kleiderschrank glich einem Fundus der letzten fünfzig Jahre Mode, und oft kaufte ich meine Sachen in Secondhandshops oder im Internet, weil ich immer nach dem Speziellen suchte.
Wenn alle mit der Masse schwammen, so tat ich es ganz sicher nicht, und bildete mir ein, dass das mein gutes Recht sei.
Was immer mir grade in den Sinn kam, trug ich auch. Aktuelle Mode interessierte mich nicht, denn ich wollte auf gar keinen Fall ein Fashion-Victim sein. Dass der Rest der Welt mich wohl für wahnsinnig hielt, übersah ich großzügig. Mich fragte ja auch niemand, ob ich mit der aktuellen Mode einverstanden war.
Ich machte mich auf den Weg über den Parkplatz zu meinem Auto, und sah schon von weitem ein schwarzes Ungetüm, was meinen kleinen Paul in der Parklücke eingesperrt hatte.
Paul war mein Auto, mein kleiner weißer Paul, der dritte Paul seiner Art, und jetzt gerade eingesperrt von einem schwarzen amerikanischen Monster, das in zweiter Reihe parkte.
Ich fuhr mein Leben lang Kleinwagen, das genügte mir völlig, denn die wenigen Kilometer bis zu meiner Arbeitsstelle, benötigten nun wirklich keinen Luxuswagen.
Wenn ich nicht so faul gewesen wäre, hätte ich nicht mal einen Wagen gebraucht, denn selbst Paul bemerkte erst, dass die Heizung eingeschaltet war, wenn wir praktisch schon vor dem Firmengebäude standen. Weniger als fünf Minuten, und ich fuhr nicht mal im Sommer mit dem Fahrrad.
Außerdem fand ich, dass der winzige Wagen ohne viel Komfort gut zu mir passte. Mir selbst war Luxus völlig unwichtig, mir reichte mein Leben und alles, was sich darin befand.
Man musste zufrieden sein, was in meinen Augen nichts mit materiellem Reichtum zu tun hatte.
Mein Wissen über amerikanisches Blech war gering, aber ich vermutete, das es sich um einen Pick-up handelte. Große Wagen wie diese kannte ich nur aus dem Fernsehen, wirklich gesehen hatte ich noch keinen, und tatsächlich fand ich ihn mehr als übertrieben.
Wofür zum Himmel brauchte man ein solches Ungetüm?
Der Wagen war glänzend schwarz, hatte eine riesige Ladefläche, und irgendwie wirkte er einschüchternd. Paul sah neben dem Wagen aus wie eine Brotdose mit Rädern, und hätte ohne weiteres Platz auf der Ladefläche gefunden.
Während ich mich fragte, wie viele Liter Benzin ein solches Monstrum wohl im Vergleich zu Paul benötigen würde, wurde mir klar, dass das wohl niemanden interessieren würde. Jemand der ein Auto wie dieses fuhr, interessierte sich wohl kaum für Benzinverbrauch und schon gar nicht für Klimaproblematiken.
Auch das war mir persönlich zuwider, Statussymbole jeder Art waren für mich unnötig. Und dieser Wagen war auf jeden Fall ein Statussymbol für irgendwen, der dringend ein solches brauchte…
Ich lief um das Ungetüm, um zu sehen, ob sich jemand darin befand, doch das Cockpit war leer.
Na prima, keifte mein Unterbewusstsein.
Ja, es gab hier nicht genügend Parkplätze, und abends war es brechend voll durch das Fitnesscenter, das ebenfalls einen Betonklotz auf die grüne Wiese gebaut hatte.
Es war eines der teuersten und modernsten, die es hier im ganzen Umkreis gab, und zog daher auch ein dementsprechendes Publikum an.
Es glich eher einem Schaulaufen als Sport, und manche der Frauen waren so aufgedonnert, dass ich mich fragte, ob es sich tatsächlich lohnte, sich zwei Stunden aufzubrezeln, für eine halbe Stunde auf dem Stepper.
Aber darum ging es wohl auch nicht, es war wohl eher eine Partnerbörse der anderen Art.
Vermutlich hörte es sich einfach besser an, seinen Partner in einem Fitnessstudio kennengelernt zu haben, als bei E-Darling…
Teure Wagen reihten sich vor der Tür aneinander, und man kannte sich, selbst wenn man sich eigentlich nicht kannte. Wangenküsschen und belanglose Gespräche waren an der Tagesordnung, und immer wieder beobachtete ich auf dem Parkplatz, wie überschminkte Damen in Legginshosen versuchten, anhand der Wagen den nächsten potentiellen Lebenspartner zu finden.
Ich stand neben dem Ungetüm und fragte mich, ob der Pick-up jemandem von dort gehören könnte. Im Zweifelsfall würde ich ihn ausrufen lassen.
Was war das überhaupt für eine Art? Andere Leute zuzuparken, weil grade nichts anderes frei war?
Parkplatzmangel war meiner Meinung nach überhaupt kein Grund, rechtschaffene Leute vom Feierabend abzuhalten, und ich kochte vor Wut.
Es erinnerte mich fatal an die vielen Mercedesfahrer dieser Welt, die ernsthaft glaubten, dass der Wagen alleine ihnen schon das Vorfahrtsrecht einräumte.
Ich sah mich um und sah absolut niemanden. Nicht mal jemanden, mit dem ich hätte meinen Unmut teilen können.
Mir war kalt und ich überlegte ernsthaft, einen Abschleppdienst oder die Polizei zu rufen, als ich den silbernen Aufdruck auf der Türe des schwarzen Monsters sah.
„Caleb McGeere- Architekt“, darunter eine Handynummer und eine Information zu einer Website.
Ich schielte ein zweites Mal auf den Namen. Vielleicht Ire oder Amerikaner. Würde zu dem Wagen passen.
Für ein deutsches Mädchen ein außergewöhnlicher Name, man traf ja sonst eher auf Thomas oder Christian.
Kurz war ich ein wenig versöhnt mit der Situation, weil ich eigentlich niemand mit einem so coolen Namen kannte. Wie würde jemand aussehen, der einen solchen Namen trug und ein solches Auto fuhr? Ich stellte mir einen Anzugträger mit Solariumbräune vor, mit einer übergroßen Sporttasche und einer teuren, viel zu großen Uhr am Handgelenk. Und einem flammneuen I-Phone. Hatten diese Leute nicht immer ein I-Phone?
Ich gab die Nummer auf dem Display ein, und sah dabei hinauf zu dem futuristischen Glashaus, das nun direkt vor mir auf der kleinen Anhöhe lag.
Eine breite Betontreppe führte wie ein Schleichweg hinauf. Sie war mir nie vorher aufgefallen, vielleicht war sie auch vorher nicht da gewesen, jedenfalls war mir ihr Anblick völlig unbekannt. Vor lauter Ignoranz vor dem Haus, hatte ich auch alles andere, was auch nur im Entferntesten damit zu tun hatte, ganz und gar ausgeblendet.
In den letzten Wochen war außerdem so viel gebaut worden, dass ich irgendwann nicht mehr darauf geachtet hatte. Ich wusste, dass es von der anderen Sichtseite eine breite Straße zu dem Haus gab, und das hier war sicher nur der Hintereingang.
Auch das empfand ich als pure Frechheit, denn warum baute sich jemand eine Treppe zu UNSEREM Firmenparkplatz (den wir in unserer Freundlichkeit mit dem idiotischen Besitzer des Studios teilten, weil wir ihn ja abends nicht benötigten), wenn er doch genügend Platz VOR seiner übertriebenen Hütte hatte?
Während ich immer noch zu dem Haus blickte und das erste Mal dort Licht aus dem Inneren sah, hob jemand am anderen Ende der Handyleitung ab.
„McGeere.“ Nicht unfreundlich. Eher neutral.
„Ja Hallo, ich kann hier nicht weg, sie haben Paul eingesperrt.“
Ich schlug mir mit der Hand vor das Gesicht. Wie blöd musste man sein?
„Wie bitte?“ Die Stimme klang leicht belustigt, tief und warm.
„Ja also ich stehe hier auf dem Parkplatz, und kann nicht weg, weil ihr schwarzes Monster vor meinem Wagen steht!“ Ich klang ein wenig zu hell.
„Ah, ich verstehe. Moment bitte.“
Aufgelegt. Ich ließ das Handy sinken und schämte mich in Grund und Boden. Der Mann musste mich für völlig bescheuert halten. Woher sollte er wissen, wer Paul war, und noch viel mehr- woher sollte er wissen, das ich Paul wie einen Menschen behandelte? Alle meine Wagen hatten den Namen Paul gehabt. Ich war der Ansicht ein Auto, das mich jeden Tag zuverlässig begleitete, hätte einen Namen mehr als verdient.
Hatte er mich überhaupt verstanden? Oder glaubte der Mann, dass es sich um einen schlechten Scherz handelte?
Ich stopfte das Handy zurück in die Handtasche und hüpfte vor Kälte von einem Bein auf das andere. Hoffentlich kam der Typ bald, damit ich in den wohligen Innenraum meines Autos kriechen und nach Hause konnte. Ich erwartete, dass jemand aus dem Eingang des Fitnessstudios spurten würde, aber stattdessen hörte ich Schritte hinter mir.
Jemand kam die Betontreppe herunter, und ich wand mich in Richtung der Schritte, die nun immer näher kamen.
„Es tut mir wirklich sehr leid, ich wollte nur ganz kurz etwas holen….“
Ich konnte dem Rest nicht folgen, denn ich war völlig überrascht über den Anblick, der sich mir bot.
Der Mann, der offensichtlich aus Richtung des Glashauses die Treppe herabkam, ließ keine Zweifel daran, das er Amerikaner war. Er trug Jeans, ganz sicher waren es Levi´s, Cowboystiefel, und eine Lederjacke mit Fellkragen. Außerdem ein kariertes Hemd und einen leicht grau werdenden schmalen Kinnbart.
Auch seine Haare, die ich nur schwer als Frisur betiteln konnte, waren leicht angegraut. In seiner Stimme lag ein kleiner Akzent, nur wenig, gerade genug, um zu ahnen woher er wirklich kam. Er war groß, sicher 20cm größer als ich, schlank, aber nicht dünn. Keine Solariumbräune, was meine Theorie endgültig als falsch abstrafte.
Er erinnerte sofort an eine jüngere Version von Kevin Costner, und ich verlor mich kurz in dem Gedanken, wie ihm wohl ein Pferd stehen würde. Er mochte vierzig sein, vielleicht auch älter, schwer zu beurteilen.
Seine Augen wirkten jung und leuchtend, was eine Einschätzung einfach schwierig machte, und manche Männer ergrauten ja auch schon in jungen Jahren.
Ja, er sah aus wie jemand, der Caleb heißen konnte. Ich blinzelte ihn an.
„….der Carport vor meinem Haus ist noch nicht fertig, deswegen musste ich hier parken, und als ich aus der Parklücke fuhr, hat sofort jemand anderes den Parkplatz besetzt. Dann hab ich gemerkt, dass ich etwas vergessen habe, und dann….“
Der Mann redete immer noch und ich glotzte ihn weiter an, aber er schien es nicht zu bemerken. Oder er ließ es sich zumindest nicht anmerken.
„…ich wollte keine Umstände machen, ich fahre den Wagen sofort weg.“
Er klang sehr ruhig und gelassen. Kein bisschen aufgeregt.
„Ist das Paul?“ Er zeigte auf meinen kleinen weißen Wagen.
„Ja, sie haben ihn eingesperrt.“ Ich schlug mir im Geiste mit der flachen Hand abermals ins Gesicht. Erde tu dich bitte auf.
„Ja, und das tut mir sehr leid. Ich werde ihn jetzt gleich wieder in die Freiheit entlassen.“
Er lächelte, und ich bemerkte, wie mein Gesicht sich ebenfalls zu einem dümmlichen Lächeln verzog.
„Danke.“
Sag was, sag was, sag was, schrie mein Unterbewusstsein, aber ich sah nur zu, wie er in das Ungetüm stieg und mir noch kurz zuwinkte.
Hinter der Scheibe sah ich die leichten Falten um seine Augen, aber trotzdem wirkte er irgendwie jugendlich. Vielleicht war er doch jünger, als ich dachte, die grauen Haare hatten mich wohl auf eine falsche Fährte gelockt.
Der große schwarze Wagen fuhr ein Stück nach vorne um meinem Wagen Raum zum Ausparken zu geben.
Ich sackte in mich zusammen und öffnete Pauls Türe per Fernbedienung. Ich hatte mich nicht mit Ruhm bekleckert, das war mir selbst klar. Kein Mann, kein erwachsener Mann dieser Welt, würde eine Frau wie mich ernst nehmen. Manchmal fanden sie es amüsant, eine Kindfrau mochte ein schönes Spielzeug sein für eine gewisse Zeit. Dann gingen sie. Oder ich ging.
Bei vielen Männern in meinem Alter, oder älter, fragte ich mich dann, ob bei ihnen etwas falsch gelaufen war, weil sie Interesse an einer Frau hatten, die aussah wie zwanzig. Ich schwankte ewig zwischen dem Kind in mir, und dem Verlangen als erwachsene Frau wahrgenommen zu werden, und hatte die Waage dazwischen nie wirklich gefunden. Ich konnte mich einfach nicht dazu durchzuringen, eine klare Position einzunehmen, und oft war es so viel einfacher, ein kleines, hilfloses Mädchen zu sein.
Wieder einmal überlegte ich mir, wie ich mich selbst erwachsener machen konnte, und gab nach unter drei Minuten auf. Sinnlos und verschwendete Zeit. Ich war wie ich war, und musste wohl oder übel damit leben.
Ich startete den Motor und schaltete das Licht ein, um nach Hause in mein Nest zu fliehen, und vor allem, um zu vergessen, das ich mich wieder einmal auf ganzer Linie blamiert hatte.
Kapitel 3:
Ich linste zum hundertsten Mal an diesem Tag hinauf zu dem Glashaus, und wusste doch nicht, was ich erwartete.
Nein, er stand nicht auf der Dachterrasse und winkte mir zu, nein, er stand auch nicht an der offenen Türe und sah zu mir herüber. Ich seufzte. Mein Ärger darüber, wie bescheuert ich mich benommen hatte, war Resignation gewichen.
Ich war nicht dazu in der Lage, einem Mann so zu begegnen, dass dieser mich auch ernst nehmen würde. Vermutlich wusste er nicht mal mehr, wie ich aussah, geschweige denn, erinnerte er sich an die Situation mit mir.
Mein Ärger beruhte eher darauf, dass ich mich einfach nicht gut verkauft hatte, ich hätte ja nicht mal gewusst, was ich mit einem Mann wie ihm hätte anfangen sollen, wenn ich es denn geschafft hätte ihn in ein Gespräch zu verwickeln.
Trotzdem wäre es nett gewesen, wenn er zumindest den Eindruck gehabt hätte, dass es sich bei mir nicht um eine komplett wahnsinnige Frau handelte.
Er war vermutlich zu alt, verheiratet, sonst was. Außerdem war ich nun wirklich nicht das All-american-Girl, was zu jemandem wie ihm gepasst hätte.
Trotzdem ärgerte es mich, denn sicher wäre ich gerne mit ihm befreundet gewesen. Er schien mir anders und besonders, zumindest sehr speziell in seiner Art, und vielleicht würde er mich verstehen. Jemand der als Cowboy in einer deutschen Kleinstadt wohnte, der konnte vielleicht auch ein kitschiges Mädchen ertragen.
Ich trag nur äußerst selten Männer, die waren wie er, eigentlich noch seltener als selten, und genau das ärgerte mich so.
Ich lernte schon so manches Mal Männer kennen, die meisten waren jünger als ich, doch ich verlor schnell das Interesse, weil kaum jemand etwas zu sagen hatte, dass mich auch nur halbwegs interessierte.
Sie alle trugen ähnliche Kleidung und interessierten sich für die gleichen Dinge, für die ich mich einfach nicht begeistern konnte.
Die Männer, mit denen ich arbeitete, hatte ich von der Date-Liste gestrichen, und außerhalb der Mauern meines Büros, war mein Leben auch nicht besonders spannend.
Die meiste Zeit verlor ich mich in Filmen oder Büchern, und wenn ich ausging, dann meistens mit den Leuten aus meiner Firma. Ich war nie der Typ gewesen, der fremde Menschen ansprach, und auch nicht der Typ, der ausging, um irgendwen „aufzureißen“ oder „klar zu machen“.
Insgeheim bewunderte ich Frauen, die dazu in der Lage waren. Wann immer ich in der Vergangenheit Männer kennengelernt hatte, war es immer von den Männern ausgegangen (die meiner Meinung nach schon verrückt waren, weil sie mich überhaupt ansprachen), oder ich lernte sie kennen, weil sie jemanden aus meinem Bekanntenkreis kannten.
Die Mühe, von mir aus jemanden anzusprechen, hatte ich mir praktisch nie gemacht. Es kam, was kam, das reichte mir. Jetzt hatte ich die Gelegenheit einen fremden Mann kennen zu lernen verstreichen lassen, vielmehr hatte ich sie in der nächsten Pfütze versenkt, und ärgerte mich darüber maßlos.
Der Amerikaner war nicht auf den ersten Blick mein Typ, aber immerhin ein Typ, und immerhin war er nicht jünger als ich. Aber er hatte durchaus etwas, das mich anzog und Interessierte.
Irgendwie war das aufregend, ein Amerikaner, und dann noch ein Cowboy, hier direkt vor meiner Nase. In meiner Welt, in der praktisch nie etwas passierte, war selbst das schon ein Highlight.
Wer eigentlich mein Typ Mann war, konnte ich ohnehin nicht festlegen. Mein Männergeschmack veränderte sich ständig, heute so und morgen so. Es gab einfach zu viele Optionen und Möglichkeiten.
Oft ließ ich mich von den Büchern oder Filmen beeindrucken, die Männer dort waren einfach anders, als die Männer in der realen Welt, und mein Muster veränderte sich praktisch stündlich.
Wahlweise war es der zurückhaltende Typ, der erobert werden musste, oder der resolute Typ, der eroberte. Je nachdem welche Geschichte mich gerade in ihrem Bann hatte, und welcher Film gerade im DVD Player lag.
In meiner Vorstellung würde ich das Herz des passenden Mannes ohne weiteren Umstand im Sturm erobern, ebenso wie es die Frauen in den Büchern oder Filmen schafften. Er würde mir einfach verfallen, ohne das ich etwas dafür tat, und ich wäre Wachs in seinen Händen.
Nur leider war die Realität davon meilenweit entfernt.
Ich fand Caleb nicht unattraktiv, sicher nicht, aber er passte auch zu keiner Figur aus meinen Romanen und auch zu keiner Filmfigur, die mir zusagte.
Ja, seine Ähnlichkeit mit Kevin Costner war offensichtlich, aber da ich nicht Whitney Houston war, konnte diese Geschichte eben nicht „Bodygard“ sein. Und ob ich dazu geeignet war, eine Rolle in „Der mit dem Wolf tanzt“ zu übernehmen, daran hatte ich massive Zweifel.
Sein Haus gefiel mir ja eigentlich auch nicht, mit jemandem, der neue Häuser baute, statt alte wieder aufzubauen, konnte ich eigentlich nichts anfangen. Vielmehr war es mir zuwider.
Ich war der festen Überzeugung, es gab genug Häuser, die es verdient hatten wieder aufgebaut zu werden. Wozu dann neue bauen? Vor allem solche, die so aussahen wie das Glashaus, und die einfach nur hässlich waren?
Kein Mensch auf der Welt sollte wie ein Tier im Zoo in einem Haus aus Glas leben müssen.
Trotzdem war unser Zusammentreffen zu einem weiteren Tiefpunkt geworden, bei dem ich im Geiste eine Kerbe in meinen imaginären Bettpfosten machte. Mal wieder eine neue, versauten Chance.
Ja, es gab eine Menge Kerben. Auf der einen Seite die Kerben, die ich machte, wenn ich es tatsächlich schaffte, die Aufmerksamkeit eines Mannes für einen kurzen Zeitraum auf mein kindliches Ich zu ziehen. Auf der anderen Seite die versauten Chancen, durch dummes, unpassendes Benehmen. Die Kerben auf dieser Seite überschritten die der anderen um ein Vielfaches.
Ich gab mir einfach nicht genug Mühe, glaubte ich zumindest, aber für mehr fehlte mir auch jeder Antrieb.
Geistesabwesend schüttelte ich den Kopf, um den Gedanken daran zu vertreiben, und fuhr meinen Arbeitscomputer herunter. Ich zog meine Jacke an und grapschte nach meiner Tasche, warf einen letzten mal Blick durch mein Aquarium-Fenster, und schaltete beim Rausgehen das Licht aus.
Sich Gedanken, um bereits eindeutig versaute Chancen zu machen, das brachte einfach nichts.
Bei meinem Weg zum Ausgang rief ich „Tschüss!“ durch die Gänge, und von mehreren Seiten folgte undeutlich eine Antwort.
Auch das war eines meiner täglichen Rituale, und auch das Echo gehörte ohne Zweifel dazu. Kaum jemand würde sich seiner Antwort bewusst sein, man rief einfach zurück, auch wenn man gerade gar nicht so genau wusste, wer dort seinen Feierabend einläutete.
Eine der vielen Türen auf dem Flur öffnete sich, und ein roter Schopf Locken erschien.
Maren erschien, die Sekretärin des Chefs, und eine gute Freundin. Die Masse winziger roter Locken umrahmte ihr helles Gesicht mit den leuchtend grünen Augen, und fielen ihr bis über die Schultern. Sie war hübsch, keine Frage.
Hübscher, runder und weiblicher als ich, wie ich an jedem neuen Tag festsstellen musste.
„Hey, was machst du am 29.? Wir wollten mit ein paar Leuten in die Stadt was trinken, willst du nicht mitkommen?“
Ich war sofort Feuer und Flamme. Ausgehen! Mein Unterbewusstsein klatschte erfreut in die Hände.
„Ja super! Ich bin auf jeden Fall dabei. Wer kommt noch mit?“
„Die üblichen Verdächtigen. Wir dachten an eine Kneipentour. Wir haben uns nach langem Hin und Her auf den 29. geeinigt, weil dann die meisten können.“
Das kannte ich schon, es dauerte ewig, einen Zeitpunkt zu finden, an dem alle konnten. Irgendwas war immer, und andere hatten eindeutig mehr rote Kreuze in ihrem Terminplan als ich. Ich hatte eigentlich fast immer Zeit, und nur selten etwas Besseres zu tun.
Wir planten diese Abende oft schon Monate vorher, und trotzdem waren am Ende nie alle dabei. Diesmal waren es nur knapp vier Wochen, das war schon fast kurzfristig, aber ich freute mich schon jetzt.
„Ich bin dabei, sag mir nur Bescheid, wann ich wo sein soll.“
„Ja auf jeden Fall, ich freue mich schon!“
Maren hüpfte in der Tür auf und ab und grinste von einem Ohr zum anderen. Seit sie geheiratet und ein Baby bekommen hatte, kam sie nicht mehr viel raus, und die Abende, an denen sie mit uns unterwegs sein konnte, waren ihr einziges Highlight.
Sie hatte einen guten Mann gefunden, einen stillen Lehrer, der auf das Baby und sie gut aufpasste. Trotzdem schien sie über jede Ablenkung froh, um die Windeln und das Babygeschrei für eine kurze Weile zu vergessen, und auch ich war froh über eine kleine Abwechslung.
Ich mochte diese Abende und die Leute, ich mochte mein Umfeld auf der Arbeit, und hatte mich häuslich eingerichtet in diesem kleinen Universum. Ich kannte alle seit Jahren, und musste mir keine Gedanken machen, so war mir das mehr als angenehm.
Auch wenn man mich deshalb für schrullig hielt, so fand ich doch, dass man nicht verändern musste, was eigentlich ganz in Ordnung war.
Mein Job fiel mir leicht, Zahlen waren mein Ding, und es strengte mich nicht an. Ich machte die Abrechnung für dieses Unternehmen, und saß gerne mit den Zahlen alleine in meinem Büro.
Es war mein Bunker, in den mich jeden Tag aufs Neue verzog, und dabei meinen Gedanken nachhängen konnte. Allein zu sein machte mir nichts aus, jedenfalls nicht unter diesen Umständen, und irgendwie fühlte ich mich hier Zuhause.
Ab und an besuchte mich einer der Kollegen auf eine Tasse Kaffee, und ich war mir sicher, so die nächsten zehn Jahre auch noch verbringen zu können.
Beim Rausgehen kramte ich nach dem Autoschlüssel, und als ich über den Parkplatz zu Paul blickte, sah ich, das dass schwarze Ungetüm neben ihm stand.
Vor lauter Glotzerei auf das Glashaus, hatte ich es nicht einmal bemerkt.
Innerlich kicherte ich, denn Paul sah neben ihm noch immer aus wie ein Briefkasten mit Rädern. Das sowohl der eine als auch der andere als Auto betitelt wurden, ergab eigentlich keinen Sinn, denn sie schienen so absolut nichts gemeinsam zu haben.
Ich drückte den Rücken durch und fühlte mich gleich besser. Vielleicht hatte das Universum doch ein wenig Mitleid mit mir.
Ich ging Richtung Paul und hatte die irrsinnige Hoffnung, er könnte in dem Wagen sitzen. Aber warum sollte er das? Es war kalt und ungemütlich, sogar ich hatte eine Jeans an, und die meiste Zeit des Tages hatte es geregnet. Ungemütlich und herbstlich, kein Wetter bei dem man sich länger als nötig draußen aufhalten würde, wenn es nicht einen triftigen Grund dafür gab.
Außerdem brannte Licht in dem Haus aus Glas, also war er wohl dort, und nicht hier in seinem Wagen.
Mein Unterbewusstsein ließ die Schultern hängen.
Ich drückte den Schlüssel und wollte die Türe öffnen, doch dies war eindeutig nicht möglich. Das Monster stand so dicht an meiner Fahrertür, dass ich auf keinen Fall würde einsteigen können.
Die Türe wäre höchstens zwanzig Zentimeter weit aufgegangen, und auch wenn ich schlank war, so schlank dann doch nicht.
In diesem Moment wurde mir klar: Deutsche Parklücken waren definitiv zu klein für amerikanische Autos. Der Wagen stand praktisch mit beiden Reifen auf der Markierung der Parkplätze, wobei diese zugegeben schon mehr als ungeschickt eingezeichnet waren. Aufgrund der enormen Parkplatznot, waren die Markierungen so eng wie möglich gesetzt, und jeder der ein wenig breiter gebaut war, hätte auch mit einem normalen Wagen seine liebe Mühe gehabt.
Ich wusste nicht ob ich lachen oder weinen sollte. Das hier war nicht ein Wink vom Schicksal, sondern die Holzhammer-Methode.
In meinem Kopf entstanden drei Notfall-Pläne: Einsteigen durch den Kofferraum (nein, wohl eher nicht), einsteigen über die Beifahrerseite (ja, das ginge eigentlich), oder ihn weiteres Mal anrufen und es diesmal besser zu machen.
Plan Nummer drei war mir am sympathischsten, auch wenn ich mir nicht sicher war, ob ich es tatsächlich diesmal besser anfangen könnte als beim letzten Mal. Den Plan, über die Beifahrerseite einzusteigen, sortierte ich komplett aus, obwohl es sicher möglich gewesen wäre, denn der Wagen neben meinem, stand weit genug entfernt, um dort die Türe zu öffnen. Aber warum sollte ich mich verbiegen und über die Mittelkonsole krabbeln? Es war schließlich nicht mein Fehler?
Ich stand 1A in der Begrenzung meiner Parklücke, und er war derjenige, der mit den Reifen auf der weißen Markierung stand. Außerdem war das meine Chance, mich selbst noch einmal in ein etwas helleres Licht zu stellen. Vielleicht würde ich mich weniger doof verhalten, etwas Interessanter dabei wirken, und vielleicht kamen wir dann ins Gespräch.
Ich kramte schon in der Tasche nach dem Handy, aber ich beschloss, dass das nicht meine Lösung sein konnte. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich am Telefon diesmal besser anstellen würde, ging gegen null.
Telefonieren war ohnehin nicht mein Ding, ich sprach lieber von Angesicht zu Angesicht, und sicher würde ich am Telefon nicht besser dastehen können.
Stattdessen straffte ich nun also die Schultern, ging die Treppe hinauf zu dem Glashaus, und sah es das allererste Mal von der Vorderseite.
Kapitel 4:
Enttäuscht stellte ich fest, dass das Haus von vorne genauso hässlich war wie von hinten.
Glas soweit das Auge reichte, viel Metall, und nur in der unteren Etage war die Front durchsichtig. Der Rest der Fenster war undurchsichtig, und ich sah nur mein eigenes Spiegelbild darin. Ich konnte in einen großen Raum sehen, hell erleuchtet und modern eingerichtet, mit einem großen Tisch, auf dem Modelle von Häusern standen, und vielen Stühlen darum. Alles war weiß, bis auf den Boden und die Möbel. Und eckig.
Es sah ein wenig aus, als hätte jemand Schuhkartons ineinandergesteckt, um daraus ein Haus zu bauen. Wie Lego, schoss es mir durch den Kopf.
An den Wänden hingen Bilder, alle ohne Farbe, mit Gebäuden darauf, und am Ende des großen Raumes sah ich einen riesigen Schreibtisch aus dunklem Holz.
Er passte überhaupt nicht zu der restlichen Optik, und ich sah, das Berge von Papier darauf lagen und ein aufgeschlagener Laptop.
Alles war in warmes Licht getaucht, und sah trotz seiner kühlen Eckigkeit heimelig aus. Zumindest einladender als bei mir vor der Türe, und eindeutig weniger windig.
Ich sah mich um auf der Suche nach der Eingangstür, aber sah sie nicht sofort.
Erst als ich genauer hinsah, erkannte ich, dass eine der Glasscheiben ganz am Rand einen Türgriff hatte.
Selbst das kam mir absurd vor. Warum versteckte jemand eine Tür so gut, dass sie nicht sofort als diese zu erkennen war? Auf der Scheibe stand noch einmal in gleicher Schrift wie auf dem Monster, um was für ein Büro es sich hier handelte.
Ich wollte mit dem Finger gerne die Buchstaben entlangfahren, aber ich verbot es mir selbst.
Kindisch.
Der Gedanke, dass er den Wagen vielleicht absichtlich so geparkt haben könnte, schoss mir durch den Kopf. Vielleicht wollte er mich wiedersehen? Ich schüttelte mich, diese Vorstellung war fast absurd. Sowas geschah in Büchern, ab er nicht hier bei mir. Ich drückte die Klinke und trat ein. Wirklich gerechnet hatte ich nicht damit, dass die Türe wirklich unverschlossen sein könnte, aber wenn da hier eine Art Laden war, war es eventuell auch gar nicht so ungewöhnlich.
„Hallo?“
Keine Antwort. Ich machte drei Schritte weiter in den Raum.
„Halloooo!?!“
Schritte.
Ich drehte mich in dem großen Raum und sah ihn die Treppe, die mitten im Raum hinauf auf eine zweite Ebene führte, herabkommen.
Wieder trug er Cowboyboots und Jeans, ein schwarzes Hemd, die Ärmel hochgekrempelt. Eine große silberne Gürtelschnalle ließ keine Zweifel daran, das hier ein Cowboy vor mir stand. Ihm fehlte eigentlich nur der Hut, und er hätte sofort in jedem Western mitspielen können.
Seine Haare waren nicht sehr kurz, und genau wie der Bart schon etwas angegraut, noch mehr als ich es in Erinnerung hatte. Bei unserer ersten, sehr kurzen Begegnung, hatte ich gar nicht so genau betrachten können.
Er sah irgendwie strubbelig aus, auf eine sexy Art, und alles in allem, passte er überhaupt nicht in dieses Haus, und erst recht nicht in das Leben, das ich damit verband. Er hätte sehr viel mehr in eine Blockhütte gepasst, oder einen Saloon.
„Na, wen haben wir denn da.“
Er sah mich an, aber seine Worte ließen nicht wirklich auf einen Gemütszustand schließen. Mein Gehirn versuchte, den Tonfall zu analysieren, aber kam zu keinem schlüssigen Ergebnis.
Er klang nicht verärgert, aber auch nicht sonderlich erfreut. Irgendwie neutral.
Wie konnte jemand so neutral sein? Schon bei dem Telefonat hatte ich es so empfunden, als gäbe es keine Gefühlsregungen in seiner Stimme, und schon damals war es mir merkwürdig vorgekommen. Transportierte man nicht immer irgendetwas? Gewollt oder ungewollt?
„Ist was mit ihrem Paul?“ Das klang schon etwas freundlicher.
„Ja, sie haben ihn schon wieder eingesperrt“, piepste ich.
Sein Mund verzog sich zu einem schiefen Lächeln.
„Das kann ich mir kaum vorstellen.“
„Doch, ich kann die Tür nicht öffnen, sie stehen zu dicht davor.“
Er zog die Stirn kraus.
„Tatsächlich?“
„Ja, ich bin ja schon dünn, aber so dünn nun auch nicht!“
Mein Unterbewusstsein tippte mit dem Finger an die Stirn. Du hast sie nicht alle beisammen.
Er grinste noch breiter.
„Dünn ist nicht der richtige Ausdruck, würde ich sagen.“
Ich fand das etwas anzüglich, und ich wollte etwas sagen, aber das große ERROR in meinem Gehirn hinderte mich daran. Er bewegte sich Richtung Ausgangstür, und griff im Vorbeigehen nach seiner Lederjacke und seinen Autoschlüsseln, die auf einem kleinen Tisch lagen.
Wie? Das war es jetzt schon wieder? Kein Smalltalk, nichts?
Die Fragezeichen über meinem Kopf schienen zu leuchten wie Neonreklamen, aber auch das schien er nicht zu bemerken.
Mein Unterbewusstsein ließ die Schultern hängen, traurig tapste ich hinter ihm her Richtung Paul, und überlegte krampfhaft, wie ich ein Gespräch würde anfangen könnte.
Vielleicht hätte ich mir vorab die Zeit nehmen sollen, mir zumindest ein oder zwei Floskeln für den Beginn eines Gespräches zu überlegen, aber jetzt war es dafür wohl zu spät. Mir fiel einfach nichts ein, jedenfalls nichts, was mich würde interessanter machen.
Kaum waren wir bei den Autos angekommen, sah er nur kurz auf den kleinen Spalt zwischen meinem und seinem Wagen, und schüttelte den Kopf.
„Nächste Woche ist der Carport fertig. Dann passiert sowas nicht noch mal.“
Mein Unterbewusstsein warf sich auf den Boden und trommelte wie ein Kleinkind auf den Boden.
Nein, nein, nein!
„Danke“, piepste ich, anstatt endlich etwas Vernünftiges zu sagen.
„Also, ich bin Caleb. Es tut mir leid, wird nicht mehr vorkommen.“
Er hielt mir seine Hand entgegen und ich griff automatisch danach. Sein Händedruck war fest und seine Hand schlank und sehnig. Das gefiel mir, auch wenn mir klar war, dass es vermutlich das einzige Mal sein würde, dass unsere Hände sich berühren würden.
„Elifa.“
„Elifa? Was ist das für ein Name?“
Er zog die Stirn in Falten, eine Reaktion, die ich nur zu gut kannte.
„Ich weiß es nicht.“
„Wie, sie wissen es nicht?“
„Ich weiß es nicht. Meine Mutter hat ihre erste große Liebe an eine Elifa verloren. Deswegen heiße ich so.“
„Das ist nicht besonders nett.“
„Ich kann nichts dafür.“
Er sah mich verwirrt an. Wie oft schon hatte ich diese Frage beantwortet? Sicher eine halbe Millionen Mal.
Ich wusste es wirklich nicht. Ob mein Name eine Bedeutung hatte, aus welchem Land er kam, ich wusste es einfach nicht. Das Einzige dem ich mir sicher war, war, dass ich den Namen der Frau hatte, die meiner Mutter die erste große Liebe ausgespannt hatte. Wieso, weshalb, warum, ich wusste es nicht.
Irgendjemand hatte mal die Vermutung geäußert, der Name sei biblisch, aber dabei war ich mir auch nicht sicher. Keiner in meiner Familie war sonderlich gläubig gewesen, und ich sparte mir die Suche nach der Antwort in dem dicken Buch.
Ich hatte den Namen immer gehasst, ich musste, wann ich mich irgendwo vorstellte, eine Erklärung abgeben. Und meine Erklärung war alles andere als witzig, kreativ oder interessant. Immer wieder hatte ich mir einen anderen Namen gewünscht.
Irgendeinen, der nicht so erklärungsbedürftig wäre, und dessen Erklärung nicht automatisch zu peinlicher Stille führte.
Ich sah ihn an und sagte nichts mehr. Dass mit meinem Namen nicht punkten konnte, das war mir schon klar. Also besser nichts mehr sagen.
Er zog die Schultern straff und sah von mir weg, während ich wie ein Häufchen Elend noch immer versuchte, eine halbwegs gute Figur zu machen.
„Na dann auf gute Nachbarschaft, Elifa. Fahren sie nach Hause, es ist kalt.“
Ich nickte, weil mir noch immer keine witzige, kreative oder irgendwie sinnvolle Wortabfolge eingefallen war. Warum hatte ich geglaubt, tatsächlich einen Geistesblitz zu haben?
Er stieg in das Ungetüm und fuhr es aus der Parklücke, damit ich an Pauls Türe kam.
Das war sie also gewesen, die zweite Chance. Und ich hatte sie mal wieder mit Konfettiregen verstreichen lassen.
Als ich vom Parkplatz fuhr, sah ich im Rückspiegel, wie er kurz die Lichter des Monsters blinken ließ, als wollte er sich verabschieden.
Wie ferngesteuert fuhr ich die wenigen Kilometer nach Hause, und analysierte im Kopf die Situation bis ins Detail. Darin war ich gut.
Alles bis zum Letzten hunderte von Malen durchspielen und analysieren. Ich fand, ich hatte mich viel besser angestellt als bei unserem letzten Treffen, und mein Unterbewusstsein klopfte mir anerkennend auf die Schulter. Auch wenn es nicht wirklich gut gelaufen war, blamiert hatte ich mich nicht. Ich hatte mich zumindest nicht vor ihm in den Matsch geworfen, war heil die Treppe hinuntergekommen, und hatte auch nicht, wie sonst üblich, einen Monolog über die Erklärung meines Namens begonnen.
Manchmal war mir genau das passiert, ich hatte versucht, es anders aussehen zu lassen, und immer war mein Gegenüber ab einem gewissen Punkt in ein Wachkoma gefallen.
Auch wenn es nicht so ganz so verlaufen war, wie ich es mir gewünscht hatte, zumindest hatte er nicht die Flucht ergriffen und war schreiend davon gelaufen.
Man sollte sich auch über kleine Erfolge freuen können, redete ich mir ein, und außerdem hatte er sich offiziell vorgestellt, das war auch schon ein Fortschritt.
Ein Fortschritt wozu, das wusste ich nicht. Schließlich war der Mann zu alt, zu merkwürdig, und vor allem zu uninteressiert, eindeutig.
Aber ich sah das Ganze als Feldversuch. Er war nur ein weiteres Übungsobjekt, um endlich einen Mann zu finden, der mich zu einer erwachsenen Frau machen würde.
Ich war mir sicher, dieser Mann würde irgendwann kommen, und ich würde über Nacht, meinem Alter entsprechend, erwachsen und reif werden. Das war mein Mantra. Irgendwann, beim richtigen Mann, würde ich mich über Nacht verändern, da war ich mir sicher.
Ich hatte ihn eben nur noch nicht getroffen.
Ich würde morgens aufwachen, wäre eine andere, und der Rest der Welt würde das sofort erkennen.
Meine Wohnung lag in der Innenstadt, nicht weit entfernt vom Stadtkern, und ich parkte wie immer auf meinem mir angestammten Parkplatz.
So gefiel mir das, immer der gleiche Parkplatz, immer der gleiche Ablauf.
Als ich die Türe zu meiner Wohnung öffnete, hörte ich schon das erfreute Fiepen von Artos. Jeden Abend war er der Einzige, der mich erwartete, und auch der Einzige, der sich aufrichtig über meine Anwesenheit freute.
Artos war mein Hund, mittelgroß, mittelschwer und mittelklug.
Ich schmuste kurz mit ihm, und fragte ihn irrsinnigerweise, wie denn sein Tag verlaufen war, wissend, dass dieser Tag für ihn genauso aufregend gewesen war, wie jeder meiner Tage für mich.
Unser Tagesablauf war immer gleich und wenn nicht gerade die Welt untergehen würde, würde sich daran auch nichts ändern. Ich machte jeden Tag die gleiche Arbeit in meinem Büro, Artos ging nach unserem Morgenspaziergang regelmäßig zu meiner Vermieterin ein Stockwerk tiefer, um sich dann den Rest des Tages verwöhnen und den Wanst kraulen zu lassen. Bis sie ihn kurz vor meinem Feierabend zurück in meine Wohnung brachte.
Das Arrangement mit meiner Vermieterin war eine gute Situation für alle. Ich musste mir keine Sorgen um das Wohl meines Hundes machen, Greta, meine Vermieterin, hatte über Tag eine Aufgabe, der sie sich aufopfernd widmete.
Seit Ewigkeiten lief das schon so, und zumindest Artos schien damit mehr als zufrieden. Ich an seiner Stelle wäre das wohl auch gewesen, denn sie las ihm jeden Wunsch von den Augen ab.
Greta war der Typ Mensch, den der Rest der Menschheit als verrückt einstufen würde, denn sie war ebenso unangepasst wie ich. Sie trug meistens bunte, sehr weite Oberteile, die sie selbst nähte und trug Sommer wie Winter Tücher auf ihrem Kopf.
Selbst gebatikt natürlich, und ökologisch abbaubar.
Die anderen Nachbarn blickten misstrauisch auf sie, aber für mich war sie einfach die perfekte Person.
Ich mochte sie, sie war genauso anders wie ich, und auch wenn uns sicher dreißig Jahre trennten, ich zählte sie zu meinen besten Freundinnen.
Greta war im Rentenalter und alleinstehend, was ihr im Gegensatz zu mir, wirklich nichts auszumachen schien.
Sie war lustig und lieb, und kümmerte sich mit Leidenschaft um Artos.
Ohne sie wäre es mir nicht möglich gewesen, Artos zu behalten, er war das Überbleibsel meiner letzten unglücklichen Beziehung, die nun auch schon mehr als zwei Jahre zurücklag. Im Nachhinein war ich mir sicher, dass ich Artos bekommen hatte, weil der Mann dachte, ich würde Verantwortung durch den Hund lernen, und dadurch erwachsener werden. Außerdem sollte er wohl meine Mutterinstinkte wecken, was er wohl auch getan hatte.
Allerdings hielt das Ganze nur sehr kurzfristig an, und auch der Mann hatte das dann irgendwann bemerkt.
Anstatt Verantwortung zu übernehmen, begann ich den Hund wie einen Erwachsenen zu behandeln, und fand, dass ihm das ganz gut gefiel. Ich sprach mit ihm, führte Monologe, und irgendwann sprach ich mit dem Hund, anstatt mich mit dem Mann auszutauschen. Mir schien das sinnig, denn Artos widersprach mir nicht, und war bei weitem nicht so langweilig wie der Mann. Dieser verschwand dann schnell wie der Wind, und Artos und ich blieben alleine zurück, was weder ihn noch mich sonderlich störte. Wir waren ein eingespieltes Team und hatten uns in unserem Leben heimelig eingerichtet.
Er war der perfekte Gefährte, er störte sich nicht an meinem Plunder, meinen Büchern, und erst recht nicht an meinem Micky-Maus-Socken.
Ich kniete mich hinunter zu dem Hund und ließ mich ausgiebig abschlecken.
Wenigstens einer, dessen unantastbaren Liebe ich mir sicher sein konnte, und der Einzige, der einen Dauerplatz auf meiner Couch hatte.
Kapitel 5:
Nachdem ich den ganzen nächsten Tag damit verbracht hatte, NICHT aus dem Bullauge hinüber zu dem Glashaus zu glotzen, ja sogar in Versuchung war, das Fenster zuzuhängen, ging ich abends im Nieselregen hinaus zu Paul.
Schon von weitem sah ich das Monster neben ihm stehen, und für einen Moment lang wünschte ich mir, meine Türe möge BITTE doch wieder zugeparkt sein. Diesmal wäre ich perfekt vorbereitet.
Insgeheim fragte ich mich, ob mein Leben wirklich so langweilig war, dass ich mich an so einer Geschichte so lange aufhielt. Ja, war es. Eindeutig.
Die meisten meiner Freunde und Bekannten hatten Familien gegründet und wenig Zeit, ich jedoch war völlig anders. Ich hatte keine Ahnung ob ich selbst jemals Kinder würde haben wollen, geschweige denn, ob eine Heirat für mich in Frage kam.
Ich war Lichtjahre von diesen Dingen entfernt, und das aufregendste in meinem Leben, waren die Bücher, die ich las.
Kinder mochte ich, wenn es die von anderen waren, und fand langweilig, wie andere ihre Beziehungen führten. Jeden Abend zur gleichen Zeit am Abendbrottisch sitzen, passte nicht in meine Welt.
Ich aß, wenn ich hunger hatte, und wenn mir danach war, auch in der Badewanne. Zweimal die Woche schniefte ich vor dem Fernseher zu irgendeinem meiner traurigen Liebesfilme, von denen ich jeden einzelnen schon hundert Mal gesehen hatte, und fand meine Welt soweit ganz in Ordnung.
Einen Mann, wie in diesen Filmen oder meinen Büchern, gab es hier ganz sicher nicht, und solche Dinge passierten niemals in Wirklichkeit. Trotzdem wollte ich lieber so leben, als mich mit der 40% Lösung zufriedenzugeben.
Wie genau der Mann meiner Träume sein sollte, konnte ich nicht mal annähernd sagen. Aktuell sah mein Schema so aus: Cool sollte er sein und klug, ein wenig überheblich und gradlinig. Außerdem sollte er ehrgeizig und weltgewandt sein.
So viel wusste ich schon mal. Jetzt gerade jedenfalls.
Das ich selbst nichts davon war, blendete ich dabei aus, und verließ mich darauf, dass ich das ganz sicher mit anderen Eigenschaften wett machen könne.
Ich hatte mich in der Vergangenheit an den verschiedensten Männertypen versucht, aber keiner wollte mir so recht zusagen. Ich hatte Männer versucht, die mich als ihren Besitz angesehen hatten, was ich zeitweise als sehr angenehm empfunden hatte, da ich selbst keinerlei Entscheidungen treffen musste.
Und eine Menge Männer, bei denen sich sehr schnell herauskristallisiert hatte, dass ihnen eine Mutter mehr gebracht hätte als ich. Diese Art war mir noch unangenehmer, denn ich wollte eigentlich keine Verantwortung für irgendwen übernehmen. Alles in allem war weder das eine noch das andere auf Dauer zu ertragen, wobei ich im Zweifelsfall die Männer vorzog, die mich als ihr persönliches Eigentum empfanden. Sie gaben mir immerhin das Gefühl, etwas Besonderes zu sein, und nahmen mir alle wichtigen Entscheidungen ab. Eine nette Abwechslung für ein paar Wochen.
Das ich mich jetzt so an dem Cowboy aufhielt, schob ich auf die ermüdendende Langweile der letzten Wochen, und darauf, dass mir einfach ein Abenteuer fehlte. Egal welches, und praktisch egal mit wem.
Auch wenn er dem aktuellen Schema nicht entsprach, so lautete die Devise: Arbeiten mit dem, was einem zur Verfügung steht.
Ich stieg in meinen Wagen, dessen Türe sich traurigerweise völlig öffnen ließ, und sah den Papierzettel an der Windschutzscheibe. Sofort sah ich hinauf zu dem Monster neben mir, aber auch diesmal war das Fahrerhaus leer.
Der Zettel klebte nass auf dem Glas, und ich konnte nicht erkennen ob etwas darauf stand. Ich fragte mich, wer auf die blöde Idee kam, bei Nieselregen einen Zettel an meiner Scheibe zu befestigen, kam aber zu dem Entschluss, dass das auch egal sei. Das hier war für meine Verhältnisse schon aufregend.
Jemand hatte sich die Mühe gemacht ihn dorthin zu legen, und vielleicht hatte es zu dem Zeitpunkt noch nicht so wahnsinnig geregnet.
Neugierig öffnete ich die Fahrertür wieder und stieg aus, um den Zettel von der Scheibe zu klauben.
Das war schwieriger, als ich erwartet hatte, er klebte fest auf der Scheibe und bewegte sich nicht, als ich danach griff.
Ganz vorsichtig piddelte ich an dem Papier, ich wollte auf keinen Fall, das er sich in seine Einzelteile auflöste, bevor ich die Chance hatte, ihn zu betrachten.
Bei meinem Glück standen die Chancen dazu nicht ganz schlecht, schließlich war ich die Königin des Unglücks.
Vielleicht war das der Liebesbrief meines Lebens, und ich würde ihn nicht lesen können, weil ich ihn entweder zerstören würde, oder einfach nichts mehr lesbar war.
Glücklicherweise war das Papier doch kräftiger, als ich befürchtet hatte, es sah aus wie eine Karteikarte oder etwas Ähnliches. Ich schüttelte ihn etwas, und winzige Tropfen landeten auf meinen Händen und meiner Jacke. Mit schwarzem Edding stand etwas darauf, die Farbe war etwas verlaufen, aber nicht völlig:
„Auf die gute Nachbarschaft einen Kaffee?“
Nichts weiter.
Ich wusste sofort, von wem der Zettel war, und mein Magen hüpfte auf und ab. Nur einer konnte das geschrieben haben, und war das nicht wahnsinnig romantisch?!
Ich sah hinauf zu dem Glashaus und drückte dabei den Zettel dümmlich an meine Brust. Das war ja so aufregend!
Mein Unterbewusstsein schüttelte resignierend den Kopf und hielt sich eine Pistole an den Kopf.
Du bist so peinlich!
Es hatte ja recht, bei mir war Hopfen und Malz verloren, aber es war ja auch nicht so verzweifelt wie ich. Auch wenn das etwas wenige Worte für einen Liebesbrief waren, immerhin war es ein Brief, und immerhin beinhaltete er eine Einladung.