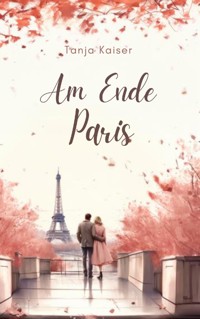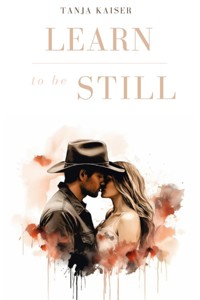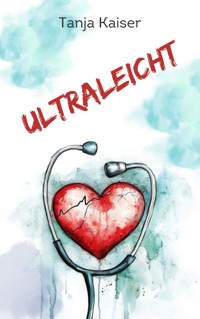Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Spencer hatte sich das Sterben irgendwie anders vorgestellt - weniger öde, definitiv weniger nervig und ganz bestimmt spektakulärer. Dass man als Geist in der Welt zurückbleibt, eher unsichtbare Beobachterin als Teilnehmerin, stand nicht auf ihrer Liste von Dingen, die nach dem Tod zu tun sind. Doch hier ist sie, tot, durchsichtig und planlos. Was macht man als Geist? Spencer entscheidet sich für das Naheliegendste: Sie sucht den Mann ihrer Träume. Nein, nicht so romantisch, wie es klingt. Er ist der gutaussehende Unbekannte mit dem schicken Anzug und dem charismatischen Hut, den sie monatelang durch das Schaufenster ihres ehemaligen Arbeitsplatzes beobachtet hat. Aber dieser Mann ist mehr als nur ein hübsches Gesicht mit Sinn für Mode. Seine Verbindung zur Kunstwelt eröffnet Spencer eine völlig neue Perspektive – und vielleicht, nur vielleicht, einen Weg, ihre neue, spektrale Existenz sinnvoll zu nutzen. Wer hätte gedacht, dass das Totsein so unterhaltsam sein könnte?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Prolog:
Mein Blick schweifte über die gegenüberliegende Straßenseite und die sich dort befindende Fensterfront.
Ich scannte den Asphalt zu beiden Seiten der Straße, dann die schmutzige Glasfläche, nur um dann enttäuscht zu sein. Wie so oft.
Immer wieder nahm ich mir vor es nicht zu tun, nicht ständig dorthin zu sehen, nicht immer zu suchen und zu hoffen, aber es gelang mir einfach nicht.
Manchmal sah ich ihn dort, hinter der eigentlich zu stark reflektierenden Fensterscheibe, und jedes Mal hörte mein Herz dann für einige Sekunden auf zu schlagen.
Ich sah eigentlich nicht ihn, nur einen Schatten, den ich für ihn hielt, aber das alleine reichte schon.
Zu wissen, dass er dort drüben seiner Arbeit nachging, beruhigte mich, zu wissen, dass es ihm gut ging, war alles, was ich brauchte.
Für mehr würde es für jemanden wie mich eben nicht reichen, mehr konnte ich nicht erwarten. Näher als jetzt war ich ihm nie gekommen, würde es vermutlich auch nicht, und sicherlich wusste er nicht mal, dass ich überhaupt existierte.
Dass es mir je so ergehen würde, daran hatte ich nie geglaubt. Ich war nicht so, ich schmachtete nicht, und vor allem beobachtete ich keine fremden Männer, deren Leben eindeutig außerhalb meines Dunstkreises lagen.
Ich war mir meines Lebens und meinem Stand in der Gesellschaft mehr als bewusst, immerhin hatte ich mehr als dreißig Jahre Zeit gehabt, mir darüber klar zu werden, und hatte schon vor sehr langer Zeit eingesehen, dass Männer in Anzügen niemals mit Frauen wie mir ausgehen würden.
Er war mein Geheimnis, meine nie endende Suche, und tatsächlich verging kein einziger Tag, an dem ich nicht an ihn dachte.
Manchmal, an den einsamen Wochenenden, dachte ich darüber nach, trotzdem die Straße entlang zu gehen, um meine Suche nicht zu durchbrechen.
Auch wenn die Wahrscheinlichkeit gering war, so konnte er auch an den Sonntagen vielleicht hier sein, und nur der letzte Funken Stolz hielt mich davon ab, die Straße auch an diesen Tagen entlangzuwandern, nur um ihn für Sekunden zu sehen.
Der letzte Funken Stolz, der verschwindend gering noch in mir schlummerte, sagte jedoch etwas anderes. Er hielt mich ab, versicherte mir, dass jemand wie er weit außerhalb meiner Möglichkeiten war, und ich mich mit all dem einfach nur lächerlich machte.
Warum ich ihn trotzdem suchte, trotzdem jeden Tag aus dem Fenster hinaus nach ihm Ausschau hielt, darüber sprach ich nicht.
Nie hatte ich mich mit einer meiner Kolleginnen darüber gesprochen, nie mit einer meiner Freundinnen. Zu dumm schien mir meine Hoffnung, er würde mich vielleicht irgendwann entdecken und mir zuwinken, zu abwegig der Gedanke, er könnte sich vielleicht geschmeichelt fühlen.
Männer die waren wie er, die trafen Frauen, die anders waren.
Frauen in Kleidern, mit perfekten Proportionen und guten Manieren. Sicher würden sie gebildet sein, sich sicher in der Welt dort draußen bewegen, und vermutlich würden sie nicht, wie ich es tat, am Ende des Monats von Nudeln mit Tomatensoße leben.
All die Lieder über Liebe, über Verlust und Begehren, über Herzschmerz und Sehnsucht, ich hatte sie nie verstanden. All die vielen Worte über dunkle Nächte, farblose Tage und die ewige Suche, es war mir immer unsinnig und wenig nachvollziehbar vorgekommen.
Erst nachdem ich ihn gesehen hatte, oder zumindest das, was ich zu sehen geglaubt hatte, bildete sich in mir eine Ahnung von all dem.
Egal was ich tat, ich dachte an ihn, und sah mich in jeder freien Minute nach ihm um. Egal wie trist meine Tage waren, sobald er auftauchte, fühlte ich mich besser.
Immer war es, als würde die Sonne aufgehen, als würde ich aus einem tiefen Schlaf erwachen, und kaum war er in meinem Sichtfeld aufgetaucht, strahlte das Licht eindeutig heller.
An Tagen an denen ich ihn nicht sah, oder an den Wochenenden, fühlte ich mich leer.
Alles, obwohl ich ihn weder je wirklich getroffen, geschweige denn ein Wort mit ihm gewechselt hatte.
Der bloße Anblick seiner Gestalt, seiner Andersartigkeit, hatte etwas mit mir gemacht. Von der ersten Sekunde an, hatte ich eine Verbindung gespürt, die mir bei praktisch allen anderen Menschen fehlte.
Ich war nicht so, ich suchte nicht danach, und doch hatte er sie geknüpft, ohne dass er sich darüber bewusst war. Schon nach dem ersten Blick auf ihn, hatte ich sie gespürt.
Er war mir nah gewesen, als würde mich ein unsichtbares Band zu ihm ziehen, und erschrocken hatte ich innegehalten.
Ich musste wahnsinnig sein. Wahnsinnig, oder extrem verzweifelt.
Vielleicht aber auch eine Mischung aus beidem, oder die Antwort war sehr viel einfacher: Vielleicht war er mein Schicksal, aber ich nicht seins.
Kapitel 1:
Das erste Mal hatte ich ihn vor über einem Jahr gesehen, an einem regnerischen Tag ohne Sonne, schon damals hatte mein Atem ausgesetzt, und ich hatte meinen Blick nicht von ihm nehmen können.
Eigentlich war ich nicht der Typ für so überschwängliche Gefühlsregungen, nicht mal für Schmachtereien, aber ich hatte einfach nichts dagegen tun können.
Es fühlte sich an, als ob ein winziger Teil von mir schon immer auf diese Begegnung gewartet hätte, und als hätte ich einfach vorher nie einen Grund gehabt, so zu empfinden.
Ein wenig schien es, als hätte ich einen Teil des fehlenden Puzzles meines Lebens gefunden, von dem ich nicht mal gewusst hatte, dass es existierte.
Erschrocken über mich selbst hatte ich nach meinem Brustkorb gegriffen, als würde ich den drohenenden Herzinfarkt fürchten, aber alles, was ich unter der heißen Haut spüren konnte, war, das mein Puls raste.
Gebannt hatte ich ihn beobachtet, jede seiner Bewegungen in meinem Gehirn abgespeichert, und war mir schon damals sicher gewesen, dass mir das kein zweites Mal passieren würde.
Nie und nimmer konnte man mehr als einmal jemanden treffen, der eine solch starke Wirkung auf einen hatte.
Erst wenige Tage hatte ich in dem etwas heruntergekommenen Friseurladen gearbeitet, ich war so froh gewesen, endlich wieder einen Job zu haben, und voller Freude hatte ich an diesem Tag einer Reihe älterer Damen Dauerwellen gemacht.
Das ich mich je darüber freuen würde Dauerwellen zu machen, damit hatte ich nie gerechnet, aber nach Monaten der Arbeitslosigkeit, hatte mir selbst das Spaß gemacht.
Ich hatte nette Kolleginnen, endlich wieder ein festes Einkommen, und die Sicherheit, dass ich in meiner kleinen Wohnung würde bleiben können.
Lange Zeit hatte es anders ausgesehen, es gab einfach keine Arbeit in dem winzigen Ort, und ich hatte mich mehr oder minder mit dem Gedanken angefreundet, dass auch ich in eine größere Stadt würde ziehen müssen.
Vielen hier war es ähnlich gegangen, die Straßenzüge wurden immer leerer, und die Anzahl der leeren Geschäftsräume war höher, als die der vorhandenen.
Die wenigen die noch überlebt hatten, der Zeitungsladen und ein Bäcker, standen kurz von der Rente. Niemand würde die Geschäfte übernehmen, niemand würde die Tradition weiter führen.
Übel nehmen konnte man es niemanden, immerhin lebte auch der Bäcker nicht von der Hand in dem Mund, und anstatt sich das Groschengrab am Ende der Straße ans Bein zu binden, hatte der Sohn des Bäckers eine Banklehre begonnen.
Überall in den kleinen Städten war es so, und auch hier war der Verfall der Innenstädte deutlich zu spüren. Wer die Möglichkeit hatte, verschwand von hier, und immer weniger junge Leute blieben, aus Angst, sie würden den Absprung später nicht mehr schaffen.
Auch ich hatte mit dem Gedanken gespielt, schon nach Monat zwei meiner Arbeitslosigkeit, und ich hatte Bewerbungen an jeden nur halbwegs erreichbaren Ort versendet.
Viele meiner Bekannten hatte das Gleiche getan, hatten versucht, an einem andern Ort Fuß zu fassen, nur mich hatte es eigentlich nie in die Ferne gezogen.
Eigentlich wollte ich nie fort, dass hier war meine Heimat und mein Umfeld, und die nächste größere Stadt, würde mir als Lebensmittelpunkt sicher nicht gefallen.
Ich war ein Dorfmädchen, herangewachsen zu einer Dorffrau, und daran würde auch ein Umzug vermutlich nichts ändern. Man war, was man eben war, und jeder würde merken, dass die große Stadt für jemanden wie mich nicht gemacht war.
Große Gebäude und mehrspurige Straßen waren nichts für mich, und eigentlich machte es mir auch Angst.
Trotzdem hatte ich es in Erwägung gezogen, mich damit auseinandergesetzt, und am Ende hatte der Zufall mich praktisch in letzter Sekunde erreicht.
Das Angebot des Salons hatte mich gerettet, nicht nur wegen des bevorstehenden Umzugs, sondern auch, weil ich den Glauben an mich selbst und meine Fähigkeiten schon fast aufgegeben hatte. Frisörinnen gab es wie Sand am Meer, ich war nur eine von vielen und nichts Besonderes, und am Ende gab es wirklich keinen Grund, gerade mich einzustellen.
Auch der Salon im fünf Kilometer entfernten Nebenort, in dem ich nach meiner Lehre gearbeitet hatte, war alles andere als ein moderner Laden gewesen. Ländlich wie wir lebten, war für moderne Schnitte und Färbemittel einfach kein Bedarf vorhanden gewesen, und auch das sprach nicht für meine Fähigkeiten. In einem modernen Laden in einer großen Stadt, wäre ich damit nicht wirklich weiter gekommen, und für Fortbildungen fehlte mir eindeutig das Kleingeld.
Erdig und einfach wie die Menschen hier eben waren, hatte ich Frisuren geschnitten, die schon die Damen vor mir über Jahre hinweg genauso empfohlen hatten. Niemand hier wollte auffallen, keiner aus der Masse herausstechen, und selbst ein blondgefärbter Schopf, galt fast schon als Extravaganz.
Gekannt hatte ich es nie anders, und eigentlich hatte ich mich damit abgefunden.
So hatte ich ausgeharrt, gehofft, und am Ende war auch mein alter Arbeitsplatz dem Fortschritt gewichen. In dem Moment, in dem in einem der großen Kaufhäuser der Umgebung, einer dieser Läden eröffnet hatte, in denen jeder Schnitt nur 12 Euro kostete, war es mit uns bergab gegangen, und am Ende hatte meine Chefin den Laden schließen müssen, weil sie einfach nicht mehr von den Einnahmen leben konnte.
Wir saßen hier irgendwo im nirgendwo, nicht weit genug von der nächsten größeren Stadt, um uns nicht zu schaden, aber weit genug weg, um vom Rest der Welt abgeschnitten zu sein.
Das Ganze war ein Kreislauf, den man nicht aufhalten konnte, und deren Abwärtsspirale sich unaufhörlich drehte. Die fehlenden Arbeitsplätze führten zu Abwanderung und dazu, dass die Leute außerhalb arbeiteten. Also kauften sie auch außerhalb, und sie hielten auf dem Heimweg bei den großen Kaufhäusern, deren Preise jenseits von denen, eines kleinen Ladens lagen.
Also blieben als Kunden für die hiesigen Geschäfte nur die älteren Leute, die früher oder später wegsterben würden.
So makaber es klang, so war doch völlig klar, dass sie nach und nach auch noch den letzten Laden würden schließen müssen.
Dass ich nun diese Stelle bekommen hatte, weil eine andere Dame in Rente gegangen war, hatte sich als echter Glücksgriff herausgestellt. Ich konnte hierbleiben, in meinem gewohnten Umfeld und in der Nähe meiner Freunde, und dafür nahm ich Lockenwickler und Dauerwellen nur all zu gerne in Kauf.
Im Grunde war es auch gar nicht so schlecht, immerhin kannte ich die meisten der Kunden schon lange, und von Stress oder Hektik konnte nun wirklich nicht die Rede sein.
Ich verdiente zwar nicht viel und meine Tage waren oft lang, aber am Ende zählte für mich nur eins: Ich hatte einen Job, ein Dach über dem Kopf, und sicher würde ich kein Magengeschwür wegen zu viel Stress bekommen.
Bei uns tickten die Uhren noch anders, die Leute nahmen sich noch Zeit, und für die meisten war ein Besuch beim Frisör ein besonderes Erlebnis. Nicht wie dort draußen in den großen Städten, wo die Sekunden unaufhörlich schneller tickten.
Hier galt es nicht, den Schnitt möglichst schnell zu beenden, es ging darum, ein Erlebnis daraus zu machen.
Wie lange mein Glück andauern würde, daran dachte ich lieber nicht, denn auch meine neue Chefin stand praktisch selbst schon vor dem heißersehnten Rentenalter. Ein paar Jahre noch, und sie würde vermutlich ebenso die Türe schließen, aber vorerst gab ich mich damit zufrieden, dass ich zumindest bis zu diesem Tag in Sicherheit war.
So hatte ich eben auch an diesem Tag an meinem Platz in der Nähe des Schaufensters gestanden und hatte in den grauen Regen gesehen.
Die Einkaufspassage war leer gewesen, niemand ging bei diesem Wetter vor die Türe, und ich hatte auf das Schaufenster der gegenüberliegenden Kunstgalerie gesehen.
Den Platz am Fenster hatte ich mir ausgesucht, denn er gab mir das Gefühl, nicht den ganzen Tag in einem geschlossenen Raum zu sein.
So nah an der Scheibe wollte eigentlich niemand arbeiten, denn man war nicht nur auf dem Präsentierteller, sondern fühlte auch Hitze und Kälte sehr viel stärker.
Sobald die Sonne auch nur etwas schien, brannte sie durch die Scheibe auf meinen Arm, und an solchen Tagen wir diesem, kroch die feuchte Kälte durch die einfache Verglasung zu mir hinüber.
Trotzdem wollte ich keinen anderen Platz als diesen, die Aussicht und auch die Temperaturschwankungen gefielen mir eigentlich, und nur hier nahm ich am Leben dort draußen teil.
Wenn wenig zu tun war, oder ich auf das Klingeln einer der Frisierhauben wartete, beobachtete ich manchmal das magere Treiben auf der Straße, oder ich sah hinüber zu der Galerie, und verlor mich in den Bildern der Auslage.
Obwohl ich erst wenige Tage hier war, hatte ich mir jedes der Gemälde in dem Fenster bereits eingeprägt.
Am ersten Tag noch war ich verwundert gewesen, denn eigentlich passten weder die Bilder noch der Laden an diesen Ort, und ich hatte mich gefragt, warum er mir nicht schon viel früher aufgefallen war.
Ich lebte immerhin schon sehr lange hier, und war sicher tausend Mal an ihm vorbei gelaufen, ohne ihn jemals wirklich gesehen zu haben.
Wie wenig man die Dinge in seiner Umgebung wirklich wahrnahm, war mir erst da klar geworden. Alles, was schon immer unverändert war, sah man einfach nicht mehr.
Den Laden jedenfalls hatte ich nie als diesen erkannt, und vermutlich nicht ein einziges Mal in die Auslage des Fensters gesehen.
Ölgemälde waren nicht gerade mein Geschmack, und für Kunst interessierte mich auch nicht, aber würde man nicht trotzdem einen solchen Laden sehen?
Ich jedenfalls hatte es nicht getan, und verstand es einfach nicht. Es schien, als sei ich all die Jahre vorher blind gewesen oder als sei er über Nacht einfach erschienen, ohne das es irgendjemand bemerkt hatte.
Jetzt allerdings hatten die Bilder und ich uns aneinander gewöhnt, und jeden Tag sah ich hinüber, um zu sehen, ob vielleicht die Auslage sich geändert hatte.
Die Ballerina auf der Leinwand rechts, die Landschaft, die mich jedes Mal an Irland erinnerte, direkt daneben.
Ob eines der Bilder wertvoll war, zweifelte ich stark an, immerhin war ihr einziger Schutz eine dünne Glasscheibe aus den siebziger Jahren, und alles in allem wirkte der Laden, als hätte auch er schon bessere Zeiten erlebt.
Dunkel und wenig einladend hatte ich ihn gefunden, und mich sofort gefragt, wer einen solchen Laden überhaupt besuchen würde. Oder was es dort geben würde, was es nicht auch an jedem anderen Ort auf der Welt geben würde.
Gemälde wie die im Fenster, würde heute niemand mehr aufhängen, und jeder Sammler würde vermutlich ein Original wählen, bevor er sich so etwas in sein Wohnzimmer hing.
Schnell wurde mir klar, dass der Laden ebenso aus der Zeit gefallen war, wie diese ganze Stadt. Die Zeit war vor Jahrzehnten stehen geblieben, nichts hatte sich weiterentwickelt, und das würde irgendwann der Untergang von allem sein.
Genauso wie der Laden, in dem sicher niemand mehr seine Wanddeko kaufte, stand ich hier auf Pfeffer-und Salz-Linoleum. Linoleum, der ende der Sechziger topmodern gewesen war, und der schon vor einem Jahrzehnt hätte gewechselt werden müssen.
Ebenso ging es wohl dem Besitzer gegenüber. Heute bestellte man seine Wanddeko im Internet, man hing Bilder seiner Familie oder der Kinder auf, und kaum ein Mensch hatte noch ein Ölgemälde in seinem Wohnzimmer hängen.
Die Zeiten für Gemälde waren sicher vorbei, genauso wie die Zeiten, in denen man Kunst wie diese überhaupt als ansprechend empfand.
Warum also gab es ihn noch, obwohl all die anderen schon längst aufgegeben hatten?
Wie dieser Laden überleben konnte, während selbst Pizzaläden pleite gingen, war mir ein Rätsel.
Anfangs war ich mir nicht mal sicher, ob er überhaupt je geöffnet war und erst, als ich ihn gesehen hatte, hatte sich diese Frage beantwortet.
Ich jedenfalls hatte den Laden am Anfang als eher abschreckend empfunden, und auch die Bilder hatten mich wenig angesprochen. Zu altmodisch, zu staubig, und einfach nichts, für die einfache Landbevölkerung.
Bis ich ihn sah, und mein Leben einen ganz neuen Sinn ergab.
Der Hut war es gewesen, der mir als erstes aufgefallen war. Ich hatte mich gewundert, denn niemand trug in dieser Zeit noch einen.
Ich hatte die Straße hinab gesehen, so wie ich es immer tat, und hatte die Silhouette langsam näher kommen sehen, bis zu dem Punkt, an dem ich erkannte, wie ungewöhnlich sie war.
Ich hatte den Kopf gereckt und versucht, in all dem Grau etwas zu erkennen, und stellte überrascht fest, dass nichts an diesem Mann in die heutige Zeit passte.
Sein Anzug war ebenso grau wie der Tag gewesen, und fast schien er mit der Fassade des Hauses und dem Asphalt der Straße zu verschmelzen.
Er ging schnell, als hätte er es eilig, und seine langen Beine gefielen mir sofort. Lang und schlank, mit festen Schritt, souveräner, als ich es jemals sein würde.
Überhaupt fand ich ihn ansprechend, jedenfalls seine Figur, denn vielmehr als das sah ich ja nicht. Große, schlanke Männer sprachen mich an, auch wenn ich mir, was das betraf, keine Illusionen machte.
Ich war alles andere als der Prototyp einer Traumfrau, und sicherlich hatte jemand wie ich, kaum Chancen auf so einen eleganten Mann.
Der Hut verdeckte sein Gesicht, und alles was ich überhaupt erkennen konnte, war die stahlblaue Krawatte, die in all dem Grau hervorstach.
Wie ungewöhnlich er wirkte und wie außergewöhnlich seine Anwesenheit an diesem Ort eigentlich war, hatte mein Gehirn in diesem Moment ausgeschaltet.
In einer kleinen Stadt wie dieser, gab es keine Männer in Anzügen, schon gar nicht an einem normalen Wochentag, und erst recht nicht mit Anzügen, die so perfekt passten.
Nicht mal der Mann in der örtlichen Bank trug einen Anzug, höchstens vielleicht ein Hemd mit Krawatte, und mehr würde hier auch gar nicht hinpassen.
Dass er allerdings nicht nur den Anzug und den Hut trug, sondern außerdem noch Krawatte und Einstecktuch, hatte mich wirklich erstaunt.
Fast schien es, als sei er aus einer Zeit lange vor meiner hierher katapultiert worden, und als würde er selbst nicht bemerken, wie wenig er in das Bild der Stadt passte.
Man passte sich einander an, man versuchte, nicht aus der Masse herauszustechen, und doch konnte ich mir nicht vorstellen, dass dieser Mann jemals etwas anderes tragen konnte.
Ich hatte wortlos auf den Mann gesehen, inständig gehofft, er würde auch nur einmal aufsehen, damit ich sein Gesicht sehen konnte, aber es war nicht geschehen.
Stattdessen war er in Windeseile in der Galerie gegenüber verschwunden, und die Türe hatte sich hinter ihm geschlossen.
Von diesem Tag an hatte ich hunderte von Malen zu der Galerie gesehen. Wann immer ich Zeit hatte oder auch nicht, hatte ich Ausschau gehalten.
Manchmal sah ich ihn wieder, immer trug er Anzug und Hut, und nie sah ich sein Gesicht.
Manchmal ging ich nach der Arbeit hinüber auf die andere Straßenseite, und sah durch die Glasfront in den Laden, in der Hoffnung, ihn dahinter zu entdecken.
Leider sah ich ihn nie, nicht mal einen anderen Menschen, und um den Laden zu betreten, fehlte mir der Mut.
Auch wenn ich seine Schatten manchmal hinter der Scheibe vermutet hatte, so hatte ich ihn nie dort drin gesehen, und manchmal fragte ich mich, ob überhaupt jemand dort arbeitete. Nie sah ich Kunden oder irgendjemand anderes dort, und nie schien das Licht im Inneren des Ladens.
Wie man unter diesen Umständen damit Geld verdienen sollte, dass verstand ich nicht. In meinen Augen mussten Läden geöffnet sein, hell und einladend wirken, und vor allem mussten sie Angestellte haben.
Hier allerdings schienen alle diese Theorien hinfällig, und egal wie sehr ich mich vor dem Schaufenster reckte und streckte, dort war einfach niemand.
Selbst wenn ich ihn erst kurze Zeit vorher hatte in den Laden gehen sehen, und panisch über die Straße gehechtete war, um einen Blick auf ihn zu werfen, war der Laden immer leer gewesen.
Es war, als hätte dieser ihn verschluckt, als sei er durch den Laden hindurch in ein anderes Universum geflüchtet, und meine Suche daher völlig sinnlos.
Anfangs glaubte ich schon fast, ich hätte mir ihn und seine Anwesenheit nur eingebildet, aber auch das ergab keinen Sinn.
Sicherlich hatte ich irgendwann mal von Männern geträumt, mir den Traummann ausgemalt, aber nie hatte er einen Anzug getragen, und nie war er Besitzer einer staubigen Galerie gewesen.
Überhaupt hatte ich aufgehört, von Männern zu träumen, schon vor sehr langer Zeit, und auch einen Prinzen mit einem Gaul erwartete ich nicht mehr.
Vielmehr war völlig klar, dass ich vermutlich nicht für die ganz große Liebe gemacht war.
Ich war betrogen worden, verletzt und erschüttert, und hatte selbst ähnlichen Schmerz zugefügt. Nie war eine meiner Beziehungen problemfrei gewesen, was zugegebener Maßen auch an mir lag, und irgendwann hatte ich es aufgegeben.
Und jetzt stand ich fast jeden Abend nach der Arbeit vor der Fensterscheibe der Galerie, glotzte hinein, und suchte nach dem Unbekannten.
Mehr als einmal versuchte ich meine eigene Angst zu überwinden und einzutreten, aber nie schaffte ich es.
Was sollte eine wie ich, die lediglich die Haare irgendwelcher Leute schnitt, in einer Kunstgalerie? Es gab nichts, was ich hätte sagen können, nichts, was ich hätte tun können, was nicht völlig sinnlos und deplatziert gewirkt hätte.
Auch wenn der Laden nicht gerade nobel war, so würde ich trotzdem nicht dorthin gehören, und zu allem Überfluss hatte ich auch keinerlei Ahnung von Kunst.
Ich hätte keine clevere Frage stellen können, nichts sagen können, was ihn vielleicht zum Lachen gebracht hätte.
Mal abgesehen der wirklich bekannten Gemälde, und den Namen, die wohl jeder kannte, wusste ich über diese Welt absolut nichts.
Wer gerade genug zum Überleben hatte, gab sein Geld ganz sicher nicht für Gemälde aus, und vermutlich würde ich mich beim Versuch, mit ihm in ein Gespräch zu beginnen, völlig lächerlich machen.
Monate vergingen so, ohne das ich die Chance gehabt hatte, an all dem etwas zu ändern. Er kam, er ging, nie sah ich sein Gesicht, und egal wie lange ich aus dem Fenster starrte, nie sah er zu mir herüber.
Fast hatte ich mich an diesen Zustand gewöhnt, er war mir vertraut wie alles andere in dieser Straße, und ihn aus der Ferne zu sehen, reichte mir am Ende.
Ich lächelte, wann immer ich ihn sah, und manchmal stellte ich mir vor, er würde zu mir in den Laden kommen. Nur leider geschah das nie.
Irgendwann in all der Zeit hatte ich Grete, meine Chefin, nach dem Besitzer des Ladens gegenüber gefragt. Sie hatte mit den Schultern gezuckt, und ratlos ausgesehen, ohne meine Frage zu beantworten.
Lediglich das es den Laden ewig gab, wusste sie, und meine Frage danach schien sie zu verwundern. Als hätte sie selbst sich die Frage nie gestellt, als hätte sie selbst den Laden ebenso wenig wahrgenommen, wie ich es einst getan hatte.
Dass sie ihn weder kannte, noch weiter erwähnte, wunderte mich.
Frisörläden waren Informationszentren, eine Tatsache, die sich vermutlich nie ändern würde. Was der Frisör nicht wusste, das gab es nicht, und was der Frisör nicht weitertratschte, dass auch nicht.
Jede noch so kleine Information wurde zwischen Stuhl und Schere weitergegeben, reflektiert und diskutiert. Das gerade Grete nicht mal wissen sollte, wer ihr direkter Nachbar war, konnte ich kaum glauben.
Mal ganz abgesehen von der Tatsache, dass ich mir kaum vorstellen konnte, dass ihr ein Mann wie dieser, nicht aufgefallen sein sollte.
Direkt nach ihm zu fragen traute ich mich nicht, aus lauter Angst die anderen könnten mich damit aufziehen.
Einem Mann im Anzug hinterherzuschmachten, der eindeutig nicht der gleichen Liga angehörte, würde genug Tratsch für Wochen liefern. Für meine Schwärmerei belächelt zu werden, oder am Ende noch als Stalkerin zu gelten, machte mir Angst.
So schwieg ich, wartete auf die wenigen Momente, in denen ich ihn sah, und hoffte einfach, dass auch er irgendwann auf mich aufmerksam werden würde.
Kapitel 2:
Ich hörte das Knacken meiner eigenen Knochen und spürte, wie der Airbag sich in voller Wucht gegen meinen Oberkörper drückte.
Den Knall hatte ich nicht gehört, nicht mal den Aufprall auf den anderen Wagen, und auch an das Geschehen an sich, konnte ich mich nicht erinnern.
Was war passiert?
Noch vor wenigen Minuten hatte ich glücklich den Laden verlassen, weil Grete mir frei gegeben hatte. Der letzte Termin hatte abgesagt, sonst lag kein weiterer an, und ich hatte beschlossen, einzukaufen.
Mir etwas besonders zu gönnen von dem Trinkgeld des Tages, weil ich das sonst nie tat, und mich dazu in meinen winzigen Wagen gesetzt.
Nur in den nächsten Ort, nur wenige Kilometer mit dem Wagen, bis hin zu dem kleinen Kaufhaus, in dem ich die meisten meiner üblichen Einkäufe tätigte.
Ein wenig Brot, vielleicht etwas Käse und Obst, eine Kleinigkeit, für die ich sonst einfach zu geizig war.
Glücklich und zufrieden war ich gewesen, mit mir, meinem Leben und den Menschen darin.
Ich hatte ihn gesehen, das bedeutete für mich, es war ein guter Tag, und auch sonst waren die Stunden gut verlaufen. Die Kunden waren freundliche gewesen und ich hatte mehr Trinkgeld als sonst bekommen, was mich für meine Verhältnisse übermütig gemacht hatte.
Ich gönnte mir selten etwas, ich sparte eisern, immer aus Angst, die nächste Welle Unglück würde mit der nächsten Jahreszeit kommen. Nur heute hatte ich mir vorgenommen, mir selbst etwas Schönes zu gönnen. Vielleicht ein Halstuch, oder nicht ganz so teures Parfum, irgendetwas, was ich mir sonst nicht kaufen würde.
Ich war gefahren und sicher nicht zu schnell gewesen, aber irgendetwas war passiert, und jetzt hörte ich die Sirenen des Krankenwagens leise in weiter Ferne.
Mühevoll hatte ich den Kopf gehoben und er schien tonnenschwer. Dumpf hörte ich Stimmen und Unruhe auf der Straße, ohne das sie zu meiner Welt zu gehören schienen. Es fühlte sich an, als sei ich in einer Blase eingeschlossen und als hätte ich die Welt dort draußen ausgeschlossen.
Selbst Zeit schien keine Rolle zu spielen, denn obwohl mir alles wie Sekunden vorkam, musste es sehr viel länger gewesen sein. War ich ohnmächtig gewesen?
Mein Körper schien taub, und ich sah hellrotes Blut auf dem weißen Airbag. Blut?
Woher kam all das Blut?
Panisch suchte mein Geist nach Schmerz, nach irgendetwas, dass sich nach einer ernsthaften Verletzung anfühlte, aber dort war nichts.
Mühsam versuchte ich, einen Arm oder nur irgendein anderes Körperteil zu bewegen, aber es gelang mir einfach nicht. Bleischwer schien alles an mir, und es kam mir vor, als würden schwere Steine als Last darauf liegen.
Ich hörte die Sirene näher kommen und hob den Kopf, um nach dem weißen Wagen zu sehen, aber alles, was sich sah, war der andere Wagen, der direkt vor meiner eigenen Fensterfront klebte.
Durch die gesplitterte Scheibe konnte ich den anderen Wagen kaum erkennen, und nur die Umrisse ließen überhaupt darauf schließen.
Dass er da war, das wusste ich allerdings, denn der Rauch des Motors drang durch das leicht geöffnete Fenster zu mir in den Innenraum.
Auch den anderen Fahrer sah ich nicht, nicht mal, ob es überhaupt einen gab, und vom Seitenfenster aus erblickte ich endlich den Krankenwagen. Er stand in einiger Entfernung hinter einer Reihe anderer Autos, und ich sah das Blaulicht aufgeregt leuchten.
Es würde Hilfe kommen, endlich.
Der erneute Versuch, einen Arm zu heben, um auf mich aufmerksam zu machen, misslang. Tonnenschwer tat er seinen Dienst nicht, und egal wie sehr ich mich auch konzentrierte, er reagierte einfach nicht.
Es gelang mir einfach nicht, ihn zu heben oder auch nur zu bewegen, und dumpf hörte ich Stimmen.
„Holt Hilfe, sie verblutet!“
Die Stimme klang panisch, und ich versuchte, den Kopf weiter zu ihr zu drehen.
Eine junge Frau stand direkt vor dem Fenster und sah auf mich hinab, aber es sah nicht so aus, als würde sie mich wirklich wahrnehmen. Ihr Blick haftete auf dem Blut, und hektisch versuchte sie, die Tür meines Wagens zu öffnen.
Das Klacken des Türgriffs ergab einen absurden Takt, fast hätte ich darüber gelacht, aber auch das gelang mir einfach nicht.
Jeder Muskel meines Körpers schien schlapp und reglos, und eigentlich verstand ich nicht mal die Aufregung um mich herum.
Es tat mir nichts weh, auch wenn dort Blut war, und außer der immer größeren Müdigkeit, ging es mir eigentlich ganz gut.
Zu sprechen gelang mir nicht, die Worte fanden einfach keinen Weg nach draußen, und so langsam hätte mich die Panik übermannen sollen, tat es aber einfach nicht.
Stattdessen spürte ich tiefe Ruhe, fast wie kurz vor dem Einschlafen, und meine Augen schienen schwerer und schwerer zu werden.
Sekunden rannen wie Minuten an mir vorbei, jedes Zeitgefühl schien praktisch ausgelöscht, und erneut fragte ich mich, warum noch immer kein Arzt oder Ersthelfer zu sehen war.
Stand der Krankenwagen nicht bereits seit Ewigkeiten dort? Hatte ich ihn nicht schon lange vorher gesehen, und müsste nicht schon längst jemand anderes versuchen, die verdammte Türe endlich zu öffnen?
Erneut sah ich auf die Frau, deren Gesicht panisch glühte, während sie weiter erfolglos versuchte, die Türe des Wagens endlich zu öffnen.
Es ruckelte, sie wendete viel Kraft auf, aber nichts geschah.
In Anbetracht des anscheinend schweren Unfalls wunderte es mich nicht, dass es ihr nicht gelang. Sicher war der Rahmen verzogen, und sicher würde sie diese Türe nicht alleine öffnen können.
Ein Mann kam dazu, offenbar ein Sanitäter, und ich fühlte, wie seine Hand zu meinem Hals glitt. Er sprach mit mir, aber ich hörte die Worte nicht wirklich, während ich mir alle Mühe gab, die Augen offen zu halten.
Die Müdigkeit schien übermächtig, als würde sie mit aller Macht an mir saugen, und kurz war ich in Versuchung, ihr einfach nachzugeben. Hilfe war da, es würde in Ordnung sein, die Augen zu schließen. Es würde in Ordnung sein, der Müdigkeit nachzugeben, und endlich in ihrer Dunkelheit zu verschwinden.
Alles schien in Zeitlupe an mir vorbeizuziehen, und eigentlich verstand ich nichts davon.
Was auch immer das Blut verursachte, es konnte nicht so schlimm sein, denn Schmerz war dort keiner. Lediglich diese schreckliche Müdigkeit und das dumpfe Gefühl in meinem Kopf, dass jedes Wort unmöglich machte.
Was war mit dem Fahrer des anderen Wagens? Warum rief niemand nach Hilfe für ihn?
Ich versuchte, erneut zu sprechen, irgendwie auf mich aufmerksam zu machen, aber kein Ton drang aus meiner Kehle. Stattdessen drang ein Schwall Blut aus meinem Mund, und fühlte die warme Flüssigkeit mein Kinn hinabrinnen. So viel Blut!
„Sie stirbt!“
Die Frau zerrte noch immer an der Tür meines Wagens und ich sah aus dem Augenwinkel zwei weitere Sanitäter nähereilen.
Hilfe, dort war Hilfe. Sie würden mir helfen und die Dinge in Ordnung bringen.
Der Sog verschluckte mich, keine Chance, weiter dagegen anzukämpfen. Ich musste schlafen, die Augen endlich schließen, und diesen schlimmen Traum endlich hinter mir lassen.
Ja, vermutlich war es ein Traum, einer von der schlimmen Sorte, die einem so wahnsinnig realistisch vorkamen.
Wenn ich jetzt die Augen schloss, endlich schlief, dann würde ich später aufwachen, und all das hier wäre vergangen.
Die Dunkelheit verschluckte mich, zusammen mit den Stimmen um mich herum, die ich einfach nicht verstand.
Erschrocken rang ich nach Luft und griff mir an den den Hals. Wo war ich?
Blitze aus Erinnerungen flammten auf, und ich versuchte mich aufzurichten, was mir erstaunlich leicht gelang.
Kein Schmerz, kein Blut, nichts, was an den Unfall erinnerte. Hatte ich nur geträumt?
Ich sah mich um und erkannte ein Krankenzimmer, aber keinen anderen Menschen.
Einzig und alleine ein kleiner Kasten neben mir piepte in einem konstanten Ton, und ich sah die grüne Linie auf dem ansonsten dunklen Monitor.
Meine Hände lagen auf dem Laken, unter mir eine weiche Matratze, deren Stoff ich deutlich zu spüren schien. War ich in einem Krankenhaus?
Praktisch zeitgleich riss jemand die Türe auf, und erschrocken sprang ich aus dem Bett auf den Boden des Zimmers.
„Sofort reanimieren!“
Ein junger Mann im weißen Kittel und zwei weitere Frauen liefen an mir vorbei in Richtung des Bettes, und sich sah zu, ohne zu verstehen, was hier gerade geschah.
„Adrenalin und Sauerstoff, beeilt euch!“
Die aufgeregte Stimme verstand ich nicht, immerhin ging es mir doch ganz gut, und ich öffnete den Mund um ihnen zu sagen, dass alles in Ordnung war.
Moment. Ich sah auf die Gestalt in dem weißen Krankenbett und sofort wurde mir schlecht. Das war ich, jedenfalls eine mir sehr ähnliche Person, und ich sah wirklich alles andere als gesund aus. Dem Impuls mich zu übergeben widerstand ich, und krallte mich stattdessen an den Türgriff der neben mir liegenden Toilette.
Was war hier los, und warum sah ich mich selbst in diesem Bett liegen?
In dem Gewusel aus Menschen, die offenbar versuchten, die Person in diesem Bett wiederzubeleben, konnte ich mich selbst erkennen.
Eine Version von mir selbst, die mir unheimlich war, denn sie schien weder zu atmen noch zu reagieren.
Leblos schlaff, als sei alles Blut bereits aus ihr verschwunden, lag die mir so ähnlich sehende Puppe dort, und schien doch nichts mit mir gemein zu haben.
Ich sah auf meinen Arm, der noch immer mein Arm war, und dann auf den der Frau in dem Krankenbett. Ja, das war ich, die dort lag, eindeutig an der schmalen Narbe am Unterarm erkennbar, die von einem Armbruch herrührte.
Ich erinnerte mich genau an dien Tag, an dem sie entstanden war, als ich von dem kleinen Mauervorsprung in den Garten des Nachbarn gesprungen war, und die Höhe einfach unterschätzt hatte.
„Wie konnte das passieren?!“
Der junge Mann, der offenbar der Arzt war, klang aufgebracht. Er kletterte auf das Bett und ich sah, wie er begann eine Herzdruckmassage zu machen. Die Beine über meinem Körper beugte er über mir, und der weiße Kittel bedeckte meine Beine fast gänzlich.
„Ich weiß nicht, vorhin ging es ihr noch ganz gut. Die ganzen letzten Wochen waren konstant gewesen, ich weiß nicht, was da los ist!“
Auch die Frau klang aufgebracht, und beide sahen ratlos auf meinen leblosen Körper.
Wochen? Der Unfall war doch gerade erst passiert?
Nur allzu deutlich erinnerte ich mich an den weißen Airbag, das Blut, und an die aufgeregten Stimmen.
Ich schluckte und versuchte, die Fetzen von Erinnerungen aneinanderzureihen. Ich hatte einkaufen wollen, war mit einem anderen Wagen kollidiert, und dann wohl ohnmächtig geworden. Vor ein paar Stunden, wie es mir vorkam, keinesfalls länger.
Diese Leute mussten sich irren, vermutlich verwechselten sie mich mit jemand anderem, aber das konnte ja vorkommen.
Vielleicht war all das hier ein riesen Irrtum, eine Verwechslung, und wer überhaupt wusste, ob nicht noch eine ganze Menge anderer Menschen eine Narbe auf ihrem Arm mit sich trugen?
Ich trat näher an das Bett und erkannte den Ansatz dunkler Haare auf dem Kopf der Person, die dort vor mir lag.
Das war ich, keine Zweifel. Es waren meine Haare, meine Gesichtszüge, meine Ohren, die für den Rest meines Kopfes noch immer zu klein schienen.
Kurz war ich in Versuchung den dunklen Ansatz zu berühren, aber ich traute mich einfach nicht.
Noch immer saß der Arzt auf mir, gab sich alle Mühe etwas zu beleben, bei dem es nichts mehr zu beleben gab, und alles an das ich denken konnte, waren die Zentimeter dunkler Haare, die dort einfach nicht sein konnten.
Das konnte nicht sein. Ich hatte sie blondiert, gestern erst.
Als Frisörin konnte man sich solche Dinge nicht erlauben, so glaubte ich zumindest, und ich achtete penibel auf solche Details. Dorfladen hin oder her, ich selbst war das Aushängeschild meiner Arbeit.
Haare wuchsen etwa 1cm pro Monat, und wenn ich das hier richtig sah, war der Ansatz sicherlich seit mindestens einem Monat nicht gefärbt worden. Vier Wochen!
„Das sieht nach einer Embolie aus! Warum war niemand bei ihr!“
Ja, genau, warum war niemand bei mir gewesen? Ich nickte still, als wolle ich dem jungen Arzt recht geben, und bemerkte erst dann, dass irgendetwas an dieser Situation mehr als falsch war.
Das war ich in dem Bett, und auch ich, die daneben stand. War ich etwa tot? Oder kurz davor?
In Filmen war das oft so gewesen, dass man selbst sich beim Sterben zusah, und war es bei mir nun auch so?
Starb ich hier gerade, und musste mir selbst dabei zusehen?
Ich schlug die Hände vor den Mund und fühlte den Schauer meinen Arm hinauf kriechen. Was, wenn ich wirklich starb? Was würde dann mit mir passieren?
„Wir haben alle zwei Stunden nach ihr gesehen, aber wir können doch nicht immer hier sein! Immerhin liegt sie hier schon vier Wochen, und die ganze Zeit ging es ihr gut!“
Die junge Frau rammte äußerst unsanft eine viel zu große Spritze in meinem Arm und ich sah, wie der Arzt noch immer voller Inbrunst auf meinen Brustkorb drückte.
Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, um in Panik zu verfallen, schoss es mir durch den Kopf.
Ich war anwesend bei meinem eigenen Tod, und konnte lediglich dabei zusehen, wie dieser junge Mann alles dafür tat, dass ich vielleicht doch noch würde zurückkommen können.
Er schien daran zu glauben, jedenfalls machte es den Eindruck, also glaubte auch ich daran.
Gib nicht auf! Ich versuchte, alle Kraft in den Gedanken zu legen, damit er ihn vielleicht würde hören können. Alles was mir blieb, war auf seine Fähigkeiten zu vertrauen.
Er schien jung zu sein, sicherlich nicht viel älter als ich, und für mich sah das alles stimmig aus. Auch wenn ich natürlich keine Ahnung von all dem hatte.
Gab es da nicht dieses Ding mit dem Elektroschock? Was sie in Filmen immer verwendeten, und bei denen alle Anwesenden vom Verletzten zurücktreten mussten? Warum benutzten sie das nicht?
Ich sah mich um und erkannte, dass es ein solches Gerät hier nicht gab. Was für eine Schlamperei. Wenn ich jetzt starb, nur weil sie dieses Ding hier nicht hatten, dann wäre das ja wohl ein Skandal.
Gib nicht auf! Mach weiter!
Ich hörte das Knacken meiner Rippen, immer dann, wenn er einen weiten Druck ausübte, und sah, wie anstrengend es für ihn war.
Er schnappte nach Luft, aber der Monitor blieb weiter schwarz.
„Dr. Krietsch, ich glaube, es ist vorbei. Sie kommt nicht zurück.“
Die zweite Schwester, die bis jetzt noch keinen Ton gesagt hatte, legte sanft eine Hand auf die Schulter des Arztes.
„Nein! Weitermachen, geben sie ihr mehr Adrenalin!“
Fast automatisch trat ich um das Bett herum zu dem Mann, der gerade all das tat, obwohl ich ihn nicht kannte. Nie hatte jemand sich so für mich eingesetzt, und jetzt würde ich ihm nicht mal dafür danken können.
Meine Wut über das fehlende Gerät, von dem ich geglaubt hatte, es würde mich retten, verschwand augenblicklich.
Der leblose Körper hob und senkte sich unter dem Druck seiner Hände, und ich sah, wie eine der Schwestern die Schläuche aus meinem Mund und der Nase entfernte.
So schnell ging das? Sie entschieden es war vorbei, und schon war es vorbei?
Auch diese Situation hatte ich mir immer anders vorgestellt, sehr viel spektakulärer und auch irgendwie weniger einfach.
Wie entschied man einfach so, dass es vorbei war?
„Das funktioniert nicht, sie ist schon viel zu lange weg!“
Die Schwester legte erneut eine Hand auf den Arm des Mannes, der augenblicklich aufhörte, meinen Brustkorb weiter zu bearbeiten.
Sofort sank er in sich zusammen, und jede Emotion verschwand aus seinem Gesicht.
Wo ich eben noch Panik und Aufregung gesehen hatte, war jetzt nur noch Resignation zu sehen. Er blickte vorbei an dem leblosen Körper auf das weiße Laken darunter, und schien, als hätte er soeben einen großen Kampf verloren.
Ein wenig stimmte das ja auch, immerhin hatte er um mich gekämpft, und auch wenn ich schon vorher vermutlich dem Tod sehr viel näher als dem Leben gewesen war, beeindruckte mich sein Kampfgeist.
Er hatte an mich geglaubt, bis zu letzten Minute, und er hatte auch geglaubt, dass ich es würde schaffen können.
„Warum hab ich es nicht gesehen?“
Es klang, als gebe er sich die Schuld an meinem Ableben, und ich horchte auf. Hatte er versagt, und ich stand deshalb jetzt gerade neben meinem toten Körper?
„Ich habe sie selbst überprüft, vor gerade mal einer Stunde. Sie hatte gute Vitalwerte, und auch ihr Blutdruck war stabil. Wenn es eine Embolie war, dann konnte keiner von uns das ahnen.“
Die Schwester zog den Mann von meinem Körper, und ich trat einen Schritt zur Seite, weil er nun direkt vor mir stand.
Ich konnte sein Aftershave riechen, eine Sorte, die mich an irgendjemanden aus meinem Leben erinnerte, und nahm die Wärme seines Körpers deutlich wahr.
Nur er schien mich weder zu sehen noch zu spüren.
„Sie war doch noch so jung, sie hätte es schaffen müssen.“
Er schien aufgelöst, eine Reaktion, die ich nicht von einem Arzt erwartet hatte. Er, der sicher hunderte ähnliche Fälle erlebt hatte, würde doch nicht immer genau so reagieren?
Sofort tat er mir leid, immerhin war ich der Grund für seine Niedergeschlagenheit, auch wenn ich daran ja wohl kaum hätte etwas ändern können.
„Sie war schon fast tot, als sie hier ankam. Das wissen sie doch selbst. Und hier zu liegen, im Koma, hat mit „schaffen“ so wirklich nichts zu tun. Selbst wenn sie irgendwann aufgewacht wäre, wäre ihr Leben nicht mehr existent gewesen. Ihr Gehirn hatte viel zu lange keinen Sauerstoff, und vermutlich hätte sie nur noch vegetiert. Es ist sicher besser so, glauben sie mir.“
Was für eine absurde Situation. Eine Schwester erklärte einem Arzt, wie all das hier lief? War er erst so kurz in seinem Job, dass er all diese Dinge noch nicht kannte?
Schlagartig fühlte ich mich noch schlechter, auf keinen Fall wollte ich die Erste sein, mit der er einen solchen Moment erlebte. Wenn ich die Erste war, die er verloren hatte, würde er sich für immer an mich erinnern.
Die Frau strich erneut über seinen Arm und ich beschloss genau in diesem Moment, dass ich sie nicht mochte. Das sie glaubte, mein Leben sei nicht mehr wichtig gewesen, fand ich eine fürchterliche Frechheit.
Immerhin war es mein Leben, so klein wie es vielleicht auch gewesen war. Sicher hatte auch ich kein Interesse daran, komatös in einem Krankenhaus zu liegen, aber trotzdem.
Der Arzt allerdings tat mir leid. Er hatte alles versucht, hatte um mich gekämpft, und schien nun ernsthaft geknickt.
„Mag sein. Aber es gibt auch immer Wunder.“
Er strich sich durch die blonden Haare und schien verzweifelt, was mich dazu brachte ihn ebenfalls am Arm zu fassen. Er schien Trost zu brauchen, etwas das ihn aufmunterte, und es war mir ein Bedürfnis, ihm das zu geben.
Mein Geist formte die Worte „es ist in Ordnung“, und ich gab mir alle Mühe es zu transportieren. All meine Kraft legte ich in diesen einen Gedanken, und blendete dabei alles andere aus.
Sekunden später griff der junge Mann sich an den Arm, an genau die Stelle, die ich berührte, und ich zog erschrocken die Hand zurück.
Hatte er mich gespürt? Hatte er meine Hand gespürt?
Das Gefühl von Glück stieg in mir hoch, und ich wollte auf der Stelle hüpfen. Er hatte mich gespürt, also war ich nicht wirklich tot, und wenn er es konnte, dann würde vielleicht auch irgendjemand anders merken, dass ich noch immer hier war.
Glücklich sah ich auf meine Hand, und dann auf den jungen Mann, der irritiert auf die Stelle an seinem Oberarm sah, als könnte er sich das Gefühl nicht erklären.
Die Schwester schob den toten Körper, der vor nicht all zu langer Zeit noch meiner gewesen war, aus dem Zimmer.
Ich sah zu, und verstand einfach nicht, warum ich mich so gar nicht darüber aufregte.
Sicher wäre das der Zeitpunkt für Panik, und wenn schon nicht dafür, dann doch zumindest für Angst.
Aber nichts davon war der Fall. Es war, als sei das hier nicht die Realität und als beträfe es mich nicht wirklich.
Gut, ich war tot, oder zumindest war es mein Körper, aber warum regte es mich nicht auf? Warum verfiel ich nicht in Panik, schrie herum oder heulte, und fühlte mich stattdessen zufrieden?
Ich sah an mir hinab, alles schien dort, wo es sein sollte, und wer auch immer dort gerade über den ellenlang Flur rollte, konnte unmöglich mit mir zu tun haben.
Eigentlich war meine Stimmung gar nicht mal so übel, das Erlebnis mit dem jungen Arzt hatte mich in Euphorie versetzt, und mal abgesehen davon, dass ich keine Ahnung hatte, wie es jetzt weitergehen würde, ging es mir ja nicht wirklich schlecht.
Warum rief ich nicht um Hilfe? Warum war ich überhaupt noch hier, und klopfte nicht an irgendeine Himmelspforte?
Ich war nie sonderlich gläubig gewesen und schon gar keine Kirchgängerin, aber irgendwie hatte ich geglaubt, der Tod würde anders sein.
Wenn das hier wirklich das „Danach“ war, dann verstand ich nun wirklich nicht, warum irgendjemand sich davor fürchtete. Es tat nichts weh, niemand hielt mir meine Sünden vor, von Feuer und Qualen keine Spur.
Alles was ich sah, war täglicher Trott, gepaart mit all dem, was man vermutlich auf jedem Krankenhausflur dieser Welt sah.