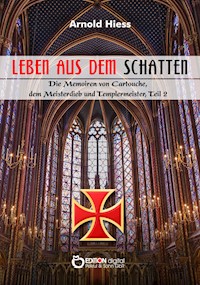
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Autor nimmt den Leser mit auf eine Reise ins 18. Jahrhundert und erschuf gleichzeitig ein detailgetreues Paris der damaligen Zeit, in das man beim Lesen nahezu völlig eintaucht. Im vorliegenden zweiten Teil erzählt Arnold Hiess die wahre Lebensgeschichte des Meisterdiebs zu Ende und lässt dabei das damalige Leben und die dramatischen Ereignisse wieder auferstehen. Mit vielen fesselnden Elementen und historisch korrekten Facetten ausgestattet, wird es dem Leser hierbei nahezu unmöglich gemacht, vor dem Ende der Geschichte in sein eigenes Leben wieder zurückzufinden. Dabei lässt Arnold Hiess die Welt der Tempelritter wieder aufleben, die bis zu ihrer Verfolgung und Auslöschung ihr Hauptquartier in Paris hatten, und forscht nach all ihren Geheimnissen und Schätzen. In brillant erzählten Abenteuern und Zeitreisen erlebt der Leser Geschichte seit der Templerzeit und viele spannende Geschehnisse. Cartouche stellt auf seinem Lebensweg die Liebe in drei speziell gedachten Facetten immer mehr ins Zentrum seines Denkens und entwickelt sich im Alter fast zum Philosophen. Das Buch kann dadurch auch als spektakuläre Lebensanleitung für unser heutiges modernes Leben verstanden werden – ganz abseits herkömmlicher Religionen … Was wirklich zählt im Leben, sind die eigenen Träume und deren Umsetzung – auch gegen den Widerstand vieler Konventionen. Und was wirklich zählt im Leben, ist die Liebe zu einem besonderen Menschen: Wer dieses Glück in sich trägt, sieht mit dem Herzen bereits die neuen Blumenwiesen – auch hinter dem Tod …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 408
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Vermächtnis von Elá
Prolog
Rückblende auf den ersten Teil und Elá
Kapitel 6: Die Tempelritter und des Schicksals tragische Wende (Fortsetzung)
Kapitel 7: Zweifache Mördersuche und der heilige Gral
Der Bote
Alte Freunde
Der heilige Gral
Die Liebe in drei Facetten
Epilog
Personenverzeichnis
Nachbemerkung des Autors
Danksagung
Worterklärungen
Arnold Hiess
Leben auf Messers Schneide
Impressum
Arnold Hiess
Leben aus dem Schatten
Die Memoiren von Cartouche, dem Meisterdieb und Templermeister, Teil 2
ISBN 978-3-95655-991-4 (E–Book)
ISBN 978-3-95655-990-7 (Buch)
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2019 EDITION digital
Pekrul & Sohn GbR
Godern
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Tel.: 03860 505788
E–Mail: [email protected]
http://www.edition-digital.de
Vermächtnis von Elá
Wir haben uns gewünscht zu fliegen,
Blut pocht in den Schläfen,
nur noch reiten, immer weiterreiten,
im gleißenden Licht der Sommersonne,
Seite an Seite,
im gestreckten Galopp,
von einem Rand des Horizonts zum nächsten.
Zwei junge Sterne sind aufgeflammt,
zu erleuchten der Menschen die Tage mit Zuversicht.
Wie einst Helios,
wenn er in seinem Sonnenwagen über den Himmel zog.
Wer denkt an die frühere Dunkelheit,
wenn das Leben irgendwann nur nach Licht streben will,
arglos und vertrauensvoll,
erfüllt mit innerer Schönheit,
die nach außen drängt,
mit heißem Herzen und dem Lachen der Kinder
und mit dem Duft von tausend frischen Blumen auf den Wiesen.
Doch diese Anmut ist nur ein Augenblick
und wird hinwegdämmern wie das Abendlicht.
Der Mut zur Liebe
für das Zarte und Verletzliche und Einzigartige,
für die vielen unscheinbaren Geschöpfe,
deren Stimmen nicht zählen,
wird auf die Probe gestellt werden.
Unterschiedslos und gleichgültig
tötet die Welt die Edelsten,
die Besten und die Mutigsten,
für den Stand unter Mitmenschen
oder wegen fleischlichen Gelüsten
oder dem Durst nach Wissen.
Aber so armselig sie auch sind, die töten:
Man bitte um Gnade für sie beim stillen Sterben.
Und die Erfüllung einer großen Sehnsucht
entwickelt sich wie eine Straße,
die am Horizont verschwindet,
wieder und wieder,
ganz ohne Verheißung auf ein Ankommen.
Aber aus einer anderen Welt
werde ich ein Leuchtfeuer sein,
ein hochloderndes,
ein nie enden wollendes,
ganz wie einst Pharos,
triumphierend und von Menschen unbesiegt!
Schaue immer zu mir,
solange du noch draußen bist,
im Meer des Lebens.
Eines Tages werden wir uns wiederfinden
und eine einzige Flamme sein.
Und den Weg weisen,
denen, die unsere Botschaft verstehen.
Elá, Paris 1726
Paris 1740
Prolog
„Halt, du kleiner Filou!“, polterte ein bärtiger und glatzköpfiger Metzgermeister, als ich durch seine Metzgerei sauste. „Haltet den Jungen, er hat mir drei Würste geklaut!“, schnaubte er durch den Raum, während ich an drei noblen Gestalten in feinen Gewändern vorbeihuschte, vermutlich seine Kundschaft. In einem Zug riss ich die Tür seines Ladens auf und rannte hinaus auf die belebte Straße; der gut genährte Metzgermeister verfolgte mich wütend – doch schon nach kurzer Zeit hatte ich ihn abgehängt – ich versteckte mich hinter einer schwarzen Kutsche, während er strammen Schrittes und um Luft ringend die Straße entlanglief. Puh! Mit meinen gestohlenen Würsten in den Taschen machte ich mich dann auf den Weg zu einer Scheune, ganz in der Nähe meines Elternhauses gelegen, das sich ein Stück außerhalb der Pariser Stadtmauern befand. Wir schrieben das Jahr 1699. Zu diesem Zeitpunkt war ich sechs Jahre alt und in der gesamten Nachbarschaft als großer Lausebengel verschrien. Und wie recht sie hatten! Ich trieb allerlei Schabernack …
„Louis! Hast du die Würste gekriegt? Wir sind am Verhungern.“ – „Ja, Louis, hast du sie? Mir knurrt der Magen.“ Luc und Damian, in meiner Kindheit zwei meiner besten Freunde, riefen mir das fast gleichzeitig zu. Sie hatten sich in einer Scheune voller Weizengarben versteckt. „Was denkt ihr, wer ich bin?! Natürlich habe ich die Würste, ihr Pappnasen!“, sprach ich in belustigtem Tonfall, während ich ihnen die Würste übergab, die sie sofort zu essen begannen. Sie schmatzten. „Gut gemacht, Louis! Ich hatte schon seit gestern nichts mehr zwischen den Zähnen“, erzählte Luc mit vollem Mund, während Damian ihm auf die Schulter klopfte und schelmisch grinste.
Die beiden Jungen kamen aus meiner umliegenden Nachbarschaft und wir kannten uns bereits eine Weile. Es dauerte auch nicht lange, bis wir richtige Freunde wurden. Unsere Kindheit war oftmals hart, da ihre Eltern – genauso wie meine – Weinbauern waren und wir oft kaum Livre hatten, um uns den Bauch richtig vollzuschlagen. Deswegen stibitze ich bereits in meinen jungen Jahren Lebensmittel und sonstige Güter, damit wir es etwas leichter hatten.
Als es ein paar Stunden danach zu dämmern begann, verabschiedeten wir uns und ich marschierte zu meinem Heim. „Einen schönen Abend, Louis! Hattest du Spaß mit deinen Freunden?“, fragte mich meine Mutter, die vor dem Haus auf einer hölzernen Bank saß und die Abenddämmerung genoss. „Natürlich, Mutter. Wir haben einen schönen Nachmittag verbracht“, erwiderte ich ihr. Mutter lächelte und strich sich durch ihre kastanienbraune Haarpracht. Ich grinste schelmisch und öffnete die Tür zu unserem Haus. Als ich meinen schmutzigen Mantel abstreifte und ihn auf einen hölzernen Stuhl legte, stieg mir sogleich Tabakgeruch in die Nase. Etwas weiter vorne saß Vater in seinem Schaukelstuhl, die Arme verschränkt, den Blick zu Boden gerichtet; er nuckelte an seiner Tabakpfeife. Vorsichtig näherte ich mich ihm. Als er merkte, dass ich wieder zu Hause war, drehte er seinen Kopf in meine Richtung und begann zu sprechen: „Bonjour, mein Kleiner! Hattest du einen schönen Tag? Soll ich dir eine Geschichte erzählen, bevor deine Mutter unser Abendessen kocht?“, fragte er mich in ruhigem Tonfall. „Oui, Vater. Ich höre sehr gerne deine Geschichten“, antwortete ich ihm und setzte mich auf den Boden, gespannt auf seine Erzählung. Und so begann Vater zu berichten: „Ich kenne eine Frau, die vor vielen Jahren das Herz eines Mannes erobert und ein kräftiges Feuer entfacht hat. Sie war hinreißend und atemberaubend, einfach wundervoll. Der Mann hatte sich zuvor niemals vorstellen können, jemals eine solche Erscheinung zu treffen. Doch es geschah; sie kam von einem Augenblick auf den anderen in sein Leben: Sie stand an einer Straßenecke und wartete auf ihre Mutter. Und in diesem Augenblick verliebte er sich in sie. Sie hatte kastanienbraunes Haar und ebensolche Augen, ein wundervolles Gemüt und war wie ein Engel. Wie sie sich bewegte, wie sie förmlich durchs Leben schwebte, das raubte ihm den Verstand – aber er traute sich nicht, mit ihr zu sprechen. Und so verging einige Zeit, bis er sie auf einem Volksfest wiedersah. Dieses Mal nahm er sich ein Herz und sprach mit ihr. Charmant versuchte er, ihre Aufmerksamkeit zu erregen und sie zum Tanze einzuladen. Ihren Mund umspielte ein sanftes Lächeln, ihre Augen glitzerten und die beiden tanzten die gesamte Nacht zu den Klängen volkstümlicher Musik. Von nun an sollten sich diese beiden Menschen häufig treffen, und der Mann eroberte nach einiger Dauer das Herz seiner Auserwählten, auch wenn er sich manchmal ihr gegenüber sehr tollpatschig anstellte, sie ihn für einen Idioten hielt und sich auch zierte. Und so vergingen einige Jahre und die beiden waren überglücklich miteinander. Eines Tages war es so weit: Ein Kind wurde geboren – es war das Symbol ihrer unglaublichen Liebe zueinander, und ihr Glück war vollkommen. Obwohl diese beiden Menschen nur von niederer Herkunft waren, besaßen sie dennoch alles, was sie brauchten: Sie hatten ihre Liebe, ihr kleines Anwesen, ihre Arbeit, der sie zusammen nachgingen, und Gott hatte ihnen einen wundervollen Knaben geschenkt. Doch eines Tages wünschte dieser Mann, dass es seiner Familie besser gehen möge, und so begann er mit einem Auftrag, einer Arbeit, die für ihn und seine Familie sehr lohnend sein könnte. Er liebte seine Familie, er würde alles für sie tun, nur um ihr das zu geben, was er sich für sie so wünschte …“ Augenblicklich beendete Vater seine Geschichte; er hatte dabei einen ernsten Gesichtsausdruck, streichelte allerdings sanft über mein braunes Haar und ging zu Mutter, die noch immer vor dem Haus verweilte. Seine Geschichte verwirrte mich zu diesem Zeitpunkt, doch viel später sollte ich verstehen, wie er das alles damals gemeint hatte.
Bald danach aßen meine Eltern und ich gemeinsam an unserem Esstisch zu Abend – eine entzündete Kerze stand auf dem Tisch, es gab eine herrliche Milchsuppe mit Brotkrumen. Meine Eltern sprachen miteinander, während ich an meiner Suppe schlürfte: „Weshalb tust du das, Sébastien? Ich bin zufrieden mit diesem Leben, wir haben doch alles, was wir brauchen.“ – „Du verstehst mich nicht, Marié. Ich muss das tun, ich will euch das bieten, was ihr beide verdient habt.“ – „Aber das musst du nicht, ich bin glücklich. Mein Leben erfüllt mich – ich habe dich, Louis, und unsere Liebe.“ – „Begreifst du das denn nicht? Ich muss das tun – und werde euch ein viel besseres Leben schenken.“ Stille. Kurz darauf seufzte Mutter und verschwand in unserem Schlafgemach. Vater machte noch ein paar Witze, die mich zum Lachen brachten, und kurz darauf begaben auch wir beide uns zu Bett.
Am nächsten Morgen weckte mich meine Mutter. Sie streichelte sanft über meine Wange, küsste mich auf die Stirn und lächelte. Kurz darauf zog ich mir Kniehose und Mantel über, verabschiedete mich von meinen Eltern und ging nach draußen. Ich hatte mit Luc und Damian ausgemacht, sie am frühen Morgen in der nahe gelegenen Scheune zu treffen.
Als ich dort eintraf, waren die beiden bereits anwesend. Ich hatte mir einen Streich überlegt, der auch uns von Nutzen sein sollte.
„Was hast du vor, Louis? Wir kennen dich und dein Grinsen sagt uns alles“, sprach Luc, während er dabei seine rechte Hand auf Damians Schulter legte. Ich lachte auf. „Nichts Besonderes! Wir werden aber heute süße Leckereien zu uns nehmen.“
Die beiden wirkten sehr erstaunt, vertrauten mir aber; schließlich hatten meine Ideen uns immer an so manche Köstlichkeit herangebracht und uns gelegentlich den Tag erheitert …
Ich kannte in der Nähe einen Gemischtwarenladen, in dem in Honig eingelegte Äpfel gelagert wurden. In den Morgenstunden war der Laden jedoch geschlossen und so hatte ich mir bereits zuvor eine List überlegt, um an die Äpfel heranzukommen. Wir trugen allesamt bloß schäbige Kleidung und hausten vor den Pariser Stadtmauern. Ein paar kleinere Anwesen der Weinbauern, das ein oder andere Wohnhaus, eine Metzgerei, eine kleine Kapelle, die Scheune, zwei Betriebsgebäude der Handwerker und eben dieser Gemischtwarenladen eines alten Mannes – mehr war hier, vor Paris, dort, wo ich meine Kindheit verbrachte, nicht anzutreffen. Leise, als wären wir gerade aus einem Gefängnis ausgebrochen, pirschten wir uns an diesem Tage an mein Ziel heran. Die Sonne blendete mich zwar etwas, ich musterte aber meine Umgebung: einige Menschen in einfachen Gewändern, die durch die schlammige Hauptstraße schlenderten, ein bärtiger Mann, der eine Milchkanne in sein Haus schleppte, der Metzger, dem ich tags zuvor – ohne richtig aufzufallen – drei Würste geklaut hatte und der jetzt vor seinem Betrieb wild gestikulierend mit seinen Waren prahlte, und eine alte Frau, die am Straßenrand eine streunende schwarze Katze streichelte. Vom Besitzer des Gemischtwarenladens, mit seinen langen, grauen Haaren und seinem Gehstock nicht zu übersehen, fehlte jedoch jede Spur. Magnificent! Ich spitzte die Ohren, lauschte. Nichts! Die Luft schien rein zu sein. „Und wie kommen wir jetzt da rein?“, fragte mich Damian flüsternd, während wir uns hinter einem Ahornbaum versteckt hielten. Ich grinste bloß, weil ich wusste, was ich in meinen Manteltaschen verstaut hatte. Rasch zog ich eine Steinschleuder hervor und meine Freunde starrten mich überrascht an. „Was willst du mit der Schleuder? Auf die alte Frau schießen?“, lachte Sekunden darauf Luc. „Wartet ab!“, sagte ich, während ich einen Stein vom Boden hob. Kurz darauf legte ich den Stein in die lederne Schlaufe meiner Schleuder, die ich mir vor wenigen Wochen selbst gebastelt hatte. Ich spannte die Schlaufe, ging ein Stück nach links, zielte aus der Ferne auf ein Fenster des Gemischtwarenladens – und feuerte. Es klirrte – das Fensterglas zerbrach. Luc und Damian staunten. Als ich die Schleuder wieder in meine Tasche steckte, blickte ich auf die Straße: Die meisten Menschen bemerkten nicht einmal, dass ein Fenster zu Bruch gegangen war; niemand scherte sich darum. Unsere Chance! Wenig später huschten wir hinter unserem Baum hervor und rannten direkt zu unserem Ziel. Blitzschnell, wie kleine Kobolde, die zu ihrem Gold wollen, sausten wir durch das Fenster ins Innere. Dort angekommen, beäugten wir unzählige Waren: Obst, Gemüse, Brot, Kleidung. Und genau dort, in einem Regal, standen sie – Töpfe, gefüllt mit unserer Beute: die in Honig eingelegten Äpfel. Zügig schnappten wir uns die Beute und stiegen ins Freie; wir hielten alle zwei Töpfe in unseren Händen. „Was soll das? Wo kommt ihr her? Haltet diese kleinen Schurken!“, hallte es von weitem in unsere Richtung. Mon dieu! Der Besitzer des Gemischtwarenladens hatte uns entdeckt, er stand einige Meter hinter uns auf der Straße. Wir begannen zu laufen, der alte Mann brüllte um Hilfe, rannte uns hinterher, konnte uns aber nicht recht folgen, da seine mittlerweile gebrechlichen alten Knochen nicht mit denen junger Knaben mithalten konnten. Einige Menschen beäugten uns erstaunt, schritten aber nicht ein – und so liefen wir immer weiter. Wir kicherten, schnappten nach Luft – und konnten schon nach wenigen Hundert Metern den alten Mann abschütteln. Wir hatten es geschafft – die Äpfel gehörten uns.
Kurze Zeit später befanden wir uns in der Scheune, in der wir uns sehr oft in meiner Kindheit aufhielten. Wir öffneten die Töpfe und süßer Honigduft kam uns entgegen – an diesem Tage verspeisten wir gierig unsere süßen Äpfel, die wir zuvor aus dem Gemischtwarenladen entwendet hatten. Es war ein wahrer Gaumenschmaus …
„Louis, Louis, wenn wir so weitermachen, stecken sie uns noch in die Conciergerie!“, schmatzte Luc, als er in einen der Äpfel biss. Man hörte das Knacken der Zähne in einem Apfel. „Klar, wir sind dreiste Diebe“, sprach sogleich Damian, ehe ich mich zu Wort meldete: „Wir sind Kinder, wir leben beinahe auf der Straße – niemand wird sich um solch Gesindel scheren.“ Doch da hatte ich mich etwas getäuscht, denn schon am Abend sollte sich herausstellen, dass ich mich geirrt hatte.
Wir spielten in der Scheune noch Verstecken und Räuber und Gendarm, ehe ich mich abends auf den Weg zurück zu meinem Zuhause machte.
Fröhlich pfeifend öffnete ich wenig später die Haustüre, legte meinen Mantel auf einen Stuhl und bemerkte nicht, dass meine Eltern schon auf mich gewartet hatten. Sie saßen an unserem Esstisch und blickten etwas verärgert. Meine Mutter begann in lautem Tonfall mit mir zu sprechen: „Louis-Dominique! Vor wenigen Stunden war der Besitzer des Gemischtwarenladens bei uns; er hat uns erzählt, dass du und zwei weitere Bengel – ich nehme an, es waren Luc und Damian – heute nicht nur eines seiner Fenster zerstört habt – nein – ihr kleinen Strolche habt auch noch seine in Honig eingelegten Äpfel gestohlen. Stimmt das, Louis-Dominique?“ Ich wusste sofort, dass Mutter sehr böse auf mich war, denn sie benutzte meinen zweiten Vornamen immer nur dann, wenn ich etwas ausgefressen hatte – und das kam nicht gerade selten vor! Ich blickte verlegen auf den etwas staubigen Fußboden, in den ich mit meinem rechten Fuß Fantasiewesen wischte. „Ja, Mutter … Ich habe dem alten Monsieur seine Äpfel geklaut. Je suis désolé …“ Meine Mutter stand auf, zog ihre Augenbrauen nach unten und sagte verärgert: „Je suis désolé?! Es tut dir leid? Du kleiner Filou wirst deine dummen Taten bei Monsieur abarbeiten. Hast du gehört? Den Schaden, den du angerichtet hast, wirst du mit deinen Freunden in den nächsten Wochen abarbeiten. Du wirst im Gemischtwarenladen helfen, bis deine Taten gesühnt sind. Verstanden, Louis-Dominique?“ – „Oui, Mutter, wie Ihr wünscht …“ Meine Mutter verschwand kurz darauf in unserem Schlafgemach, Vater lächelte. „Setz dich, Louis!“, sprach er, und ich gehorchte ihm sogleich. „Du weißt, dass deine Mutter zu Recht auf dich wütend ist, und du wirst auch deine Taten abarbeiten, aber weißt du was? Du gefällst mir …“ Vater lachte auf, und ich traute meinen Ohren kaum. „Ich war in deinem Alter ganz genauso. Ich habe anderen Streiche gespielt, herumgetobt, Falsches getan. Wie ich das heute gehört habe, hätte ich mich beinahe zu Tode gelacht.“ Vater lachte abermals auf, ehe er wieder zu sprechen begann: „Später wirst du sicher auch eine junge Dame kennenlernen, die dich verzaubern wird. Du musst aber aufpassen; deine Art ist manchmal nicht gerade einfach. Du wirst sie lieben; sie aber vielleicht sogar oftmals mit deiner Art verletzen.“ Sogleich blickte ich verdutzt, zog eine Augenbraue nach oben und unterbrach meinen Vater: „Mädchen? Iiiiiiiihhhhhhhh … Die sind seltsam, ich mag keine Mädchen. Die sind komisch …“ Vater krümmte sich vor Lachen. „Doch, doch, Louis! Eines Tages kommt eine Frau in dein Leben, die dich so begeistern wird, dass du dich in sie abgöttisch verlieben wirst. Du wirst vielleicht sogar so verliebt sein, dass du ihre Nerven strapazierst, sie dann und wann sogar verletzt und möglicherweise ihr gegenüber auch ziemlich viel Mist machst – aber du wirst sie lieben. Pass auf, nicht, dass du mit deiner Art alles zerstörst. Du bist ein Filou, der manchmal mit seinem Humor auch übertreibt. Sei vorsichtig, vielleicht liebt sie auch jemand anderes, aber sie wird dich irgendwie mögen – hilf ihr – probiere es zumindest – sei nett zu ihr, behandle sie gut, zeig ihr, wie sehr du sie liebst, erobere ihr Herz. Und versuche, deine Komödien ihr gegenüber nicht zu sehr zu übertreiben …“ Ich musterte Vater erstaunt. „Außer Mutter mag ich keine Mädchen. Ich habe doch schon gesagt, dass die seltsam und blöd sind.“ Vater lachte und lachte – und ehe ich mich versah, war unser Gespräch zu Ende. Mädchen … Welche Kutsche hatte meinen Vater denn da bloß gestreift?!
Die nächsten Wochen befanden sich Luc, Damian und ich tagsüber meist im Gemischtwarenladen – wir arbeiteten unsere Taten ab. Luc und Damian rollten eines Tages ein Weinfass in die Räumlichkeit und stritten sich dabei heftig: „Vollidiot! Schieb schon! Oder muss ich alles alleine machen?!“ – „Halt dein Maul! Ich mache doch sowieso mehr als du …“ – „Ach … wirklich? Wer hat vorhin die Waren ins Regal gestellt? Ich oder du, Damian?“ – „Du brauchst sowieso etwas Arbeit, sonst wird dir noch langweilig …“ Luc gackerte plötzlich. Und kurz darauf flogen ihre Fäuste durch die Luft. Meine Freunde, die an diesem Tage braune Kappen trugen, kämpften mit hochroten Köpfen miteinander. „Hört endlich auf! Gebt mir die Schuld, ich hatte diese Schnapsidee, die wir nun ausbaden müssen …“, sagte ich bestimmend, als ich versuchte, der Streiterei ein Ende zu setzen. Die Knaben beruhigten sich nach kurzer Zeit. „Louis hat recht. Wir sollten aufhören, er hatte diese Idee, der Dummkopf“, sprach Luc leise und die beiden blickten mich verärgert an. „Kommt schon, machen wir unsere Arbeit, wir sind sowieso bald fertig“, sagte ich und probierte somit, die Sachlage etwas zu entspannen. Sekunden darauf zeigte ich ihnen einige Laib Brot, die sie in die Regale schichten sollten, und widerwillig kamen sie meiner Aufforderung nach. Ich selbst schnappte mir einen Reisigbesen und fegte damit den Fußboden des Gemischtwarenladens sauber; im Laden roch es überall nach Zimt und Hefe, es war heiß und über manch süßer Leckerei summten die Fliegen. Plötzlich hörte ich ein Klingeln – die Tür des Ladens flog in diesem Augenblick auf und der alte Besitzer trat ein. „Bonjour, Louis! Wie ich sehe, seid ihr fleißig am Arbeiten. Habt ihr heute viele Livre eingenommen?“, sagte Monsieur, der an diesem Tag eine feine rote Strickjacke trug, als er mit seinem Gehstock in meine Richtung zeigte. „Oui, Monsieur! Es war Kundschaft hier, ich habe alles, was wir eingenommen haben, in Ihre Börse gelegt.“ Der alte Mann runzelte die Stirn, ging hinter den Tresen, öffnete seine lederne Börse, zählte mit seinen zittrigen, knöchernen Händen die Goldmünzen. Als er damit fertig war, überprüfte er die Waren und begutachtete unsere Arbeit. „Gut gemacht, Louis! Ihr drei Bengel seid ja doch zu gebrauchen. Morgen endet eure Arbeit bei mir – ihr habt eure Schuld gesühnt …“
Und so endete nach einigen Wochen unsere Arbeit im Gemischtwarenladen, eine Arbeit, die ich uns drei auferlegt hatte – wir waren heilfroh, dass wir nun – endlich – wieder unserem Schabernack nachgehen konnten, den wir schon so vermisst hatten.
Im Jahre 1700 änderte sich mein Leben – ich bekam die Pocken, eine Krankheit, die viele Kinder in meinem Alter bereits das Leben gekostet hatte. Doch ich überlebte. Ich schlief wochenlang ununterbrochen – und meine Mutter kümmerte sich rührend um mich; sie gab mir Medizin, pflegte mich gesund und war überglücklich, als ich wieder bei Kräften war. Ein Andenken an diese Zeit zierte ab diesen grauenvollen Tagen Teile meines Gesichts und meines Körpers: Narben. Überall Narben.
Vater war zu dieser Zeit verändert: Er sprach kaum, verschanzte sich in unserer kleinen Scheune und arbeitete immerzu. Auch seine Gemütslage uns gegenüber wurde immer schlimmer. Wenn ich nun etwas ausgefressen hatte, scheute er sich nicht, mir mehrere Backpfeifen zu verpassen. Mutter versuchte, ihn fortwährend zu beruhigen, ihn zu erheitern – doch es gelang nur ganz selten. Er murmelte meist seltsame Sätze, bevor er sich nervös über das Gesicht wischte und wieder in der Scheune verschwand: „Ich muss es schaffen. Ich muss … Ich muss es einfach. Es muss gelingen. Wir werden vermögend sein …“ Ich verstand nicht, aber Mutter streichelte meist über mein Haar, küsste mich auf die Stirn und meinte, dass schon alles sehr bald wieder in Ordnung sein würde. Doch, werter Leser meiner Memoiren, da hatte sie sich leider getäuscht. Es dauerte nur noch wenige Jahre, bis mein gesamtes Leben zusammenbrach …
„Wisst ihr, wo das Nilpferd steckt?“, lachte ich in amüsierter Tonlage …
An einem sonnigen Märztag im Jahre 1702 befand ich mich mit Luc und Damian in unserem Versteck, in der Scheune. Wir lachten, spielten Verstecken, kämpften miteinander; loses Stroh flog durch die Luft. Wir hatten eine Menge Spaß. Doch plötzlich konnten wir eine bekannte Stimme vernehmen. „Louis? Louis? Bist du und deine zwei Ratten da drin? Kommt raus, bevor ich euch hole“, grölte die Stimme. Es war Bennet, ein großer, stämmiger, milchgesichtiger Bursche in unserem Alter, der zu unseren Freunden zählte, auch wenn er hin und wieder ein Scheusal zu mir war. Kurz darauf gingen wir nach draußen ins Freie – Bennet stand auf einem leeren Pferdekarren, gezogen von einem grauen Esel. „Was willst du, Bennet?“, fragte ich ihn. „Nichts! Ich wollte nur sehen, wie es euch Tölpel so geht“, erwiderte der dicke Knabe, der braun gewandet war und dazu eine grüne Pluderhose trug. Er war ein seltsamer Kauz, ein richtiger Raufbold, oftmals höchst aggressiv, hatte ein lautes und loses Mundwerk, erzählte dann und wann nur Blödsinn, und hielt sich selbst dort und da für den Allergrößten. „Louis … Louis … Ich habe gehört, du hast schon wieder Schabernack getrieben und Birnen geklaut. Und mich hast du anscheinend auch schon wieder veralbert“, krakeelte er in meine Richtung, ehe er auf Luc und Damian blickte und weitersprach: „Merkt ihr es denn nicht?! Der Taugenichts veralbert doch nur alle Leute. Was kann der schon? Nichts kann er, der Tölpel …“ Ich grinste. „Pauvre Conard! Du bist doch nicht einmal Franzose! Du bist mit deiner Familie eingewandert und willst jetzt große Sprüche klopfen?! Du solltest unsere Sprache noch üben. Ich glaube, man muss dir mal eine Lektion erteilen, du Dickerchen …“ Luc und Damian lachten; Bennet bekam einen glutroten Kopf und schimpfte auf mich ein: „Ich glaube, ich muss dir mal eine Tracht Prügel beibringen, du Schwachkopf und Pockengesicht!“ Unterdessen hatte ich zweimal mit den Fingern geschnippt; Luc und Damian wussten Bescheid, gingen auf Bennet zu, sprachen mit ihm, lenkten ihn ab, derweil ich so tat, als würde ich mich seinen Tiraden beugen und in die Scheune zurückgehen. Bennet bemerkte nicht, wie ich mich in einem Gebüsch versteckte – mein Ablenkungsmanöver klappte. Drei Herzschläge später pirschte ich mich an den hölzernen Pferdekarren heran. Leise, als wäre ich ein lautloser Löwe auf Beutefang, kletterte ich auf den Karren; Bennet stand mit dem Rücken zu mir – meine Chance! In Windeseile band ich seine Schnürsenkel zusammen, während Luc und Damian grinsten und den großen Reden von Bennet lauschten. Er gab damit an, was er alles konnte, tat und machte. Er war wie ein Gott. Wahrlich! Danach huschte ich zurück, stieg – leise – vom Karren, und klatschte zweimal in die Hände.
Bennet drehte sich erstaunt um. „Was willst du schon wieder, du Kasper?! Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin – ich muss unseren Freunden meine erstaunlichen Taten kundtun.“ Sogleich gab ich dem alten Esel, der am Karren hing, einen strammen Klaps auf das Hinterteil. Der Karren bewegte sich vorwärts, Bennet verlor das Gleichgewicht, ruderte mit den Armen – und stürzte hinunter, mitten in eine Pfütze. Wir drei bogen uns vor Lachen. Als Bennet, von oben bis unten mit Schlamm und Dreck besudelt, kurze Zeit später aufstand, brüllte er: „Seht ihr es jetzt?! Der Kerl veralbert doch nur alle Leute. Dieses widerliche Schwein! Und jetzt werde ich ihm einen Schlag mit meinen riesigen Armen, die schon Bären getötet haben, verpassen …“ Ich entgegnete ihm: „Och, Bennet! Bist du vom Karren geflogen? Komm und hol mich doch, ich bin zwar nicht so stark wie du, aber ich bin ein flinker Zeitgenosse …“ Bennet begann aufgebracht zu laufen – und fiel schon nach einem Meter in die nächste Pfütze, weil ich ihm seine Schnürsenkel zusammengebunden hatte. Abermals gackerten wir drei uns fast die Seelen aus dem Leib. Völlig verdreckt stand Bennet auf, zeigte mit dem Zeigefinger in meine Richtung und grölte: „Du wirst das eines Tages büßen, Louis. Hörst du?! Büßen! Ich bin Bennet, und alle Mädchen vergöttern mich, lechzen nach mir; so etwas kannst du mit mir nicht machen, Louis …“ Danach drehte er sich um und watschelte völlig verdreckt nach Hause, während ihm immer wieder seine grüne Pluderhose nach unten rutschte, er uns sein nacktes, dickes Hinterteil präsentierte und wir uns schlapp lachten. Mädchen? Was wollen eigentlich immer alle mit diesen Mädchen? Die wollen immer so hübsch und beim Spielen immer Prinzessinnen sein, benehmen sich so seltsam und sind immer so schön angezogen. Ich mag keine Mädchen – zumindest dachte ich das zu diesem Zeitpunkt meines noch so jungen Lebens, werter Leser …
Doch sollte wahrhaftig irgendwann ein ganz besonderes Mädchen in mein Leben treten? Wer weiß, wer weiß …
In nächster Zeit trieben wir allerlei Schabernack; auch Bennet war gelegentlich dabei. Obwohl ich seine Art manchmal nicht ausstehen konnte und mir sein Gehabe oftmals zuwider war, mochte ich ihn – man konnte sogar irgendwie behaupten, dass er in meiner Kindheit mein bester Freund war, obwohl das auf den ersten Blick niemals so erschien und ich zumeist mit Luc und Damian die Zeit verbrachte. Er hatte seine eigene Art und die musste man akzeptieren, auch wenn es mir manchmal schwer fiel. Er war auch hie und da falsch mir gegenüber, aber ich respektierte dies, solange er nicht damit übertrieb.
Zu dieser Zeit spielten wir Fangen, sprangen über Zäune, spielten oftmals den Erwachsenen Streiche, ohne erwischt zu werden, und stibitzten Obst von einigen kleinen Marktständen. Äpfel? Klar! Birnen? Wieso nicht! Himbeeren? Auf jeden Fall! Und natürlich Kirschen. Einmal – es war gerade Sommer und brütend heiß – entdeckte ich eine große Menschenansammlung auf der schlammigen Hauptstraße, eine Menschenansammlung, die der Rede eines Gesandten aus Paris lauschte – und sofort hatte ich eine Idee, die uns köstlich amüsieren sollte. Ich hatte mir eine Art Niespulver zusammengestellt, das zu großen Teilen aus gemahlenem Pfeffer und der pulverisierten Wurzel der schwarzen Nieswurz bestand und in einem kleinen Leinensäckchen aufbewahrt wurde. Wir versteckten uns abermals hinter dem Ahornbaum, bei dem wir oftmals Streiche austüftelten, und ich weihte meine Kameraden in meinen Plan ein. Alle feixten. Alle, bis auf Bennet. „Der Schweinehund veralbert doch nur alle Leute. Seht ihr das denn nicht? Ich beispielsweise bin ganz anders, ich bin stark, kräftig und gutaussehend, ihr solltet lieber auf mich hören.“ Luc und Damian grinsten, schauten sich in die Augen. „Und was würdest du heute so machen? Erzähl uns doch mal, was du so vorhättest …“, fragten sie ihn – und Bennet schilderte daraufhin genau den Plan, den ich ihnen Minuten davor bereits erklärt hatte. Wir lachten herzhaft, klopften Bennet begeistert auf die Schulter, und Luc meinte gackernd, dass Bennet der geborene Mann wäre, um uns an schlechten Tagen die Zeit zu erheitern. Bennet legte stolz seinen Kopf nach hinten. Etwas später sagte Damian, dass sie lieber doch auf Louis hören würden; Bennet blickte verärgert und brabbelte Sätze vor sich hin, die wir nicht verstehen konnten. Ein paar Momente darauf setzte ich meinen Plan in die Tat um – und in der Tat, er sollte funktionieren.
Meine drei Freunde warteten hinter dem Baum und ich machte mich an die Arbeit. Ich sah mich um. Nach links, nach rechts, nach hinten. Niemand merkte, was ich vorhatte. Und so startete ich mein Vorhaben. Vorsichtig – wie ein ausgehungerter Wolf, der sich an ein Rehkitz heranpirscht – schlich ich mich an den Menschen vorbei, die vor der Metzgerei der Rede des Gesandten lauschten. Danach kletterte ich wagemutig auf die Metzgerei und tänzelte mich auf den rutschigen Dachziegeln vorwärts. Als ich die Menschenansammlung im Blickfeld hatte, duckte ich mich, grinste etwas schelmisch, und kramte das kleine Leinensäckchen aus meinen Manteltaschen.
Ich öffnete nun das Säckchen und schüttete das Niespulver auf die Menge – kurz darauf begannen alle zu husten und zu niesen – Hatschui! Hatschui! – während ich mich hurtig vom Gebäude schwang. Als ich wieder festen Boden unter meinen Füßen hatte, stibitzte ich noch das weiße Kopftuch einer alten Frau, die sich hustend zu Boden gebeugt hatte und sich nicht richtig wehren konnte, und rannte genau in die Richtung meiner Freunde, die sich noch immer hinter dem Ahornbaum versteckten und herzlich über meinen Streich lachen konnten – sie bogen sich förmlich vor Erheiterung. Doch plötzlich hörte ich eine Stimme. „Dort! Öchü … Öchü … Der Knabe, der dort läuft! Öchü … Öchü … Haltet ihn! Er war das … Öchü … Öchü …“, drang es hinter mir hervor. Und schon klebten zwei Männer an meinen Fersen, die noch immer husten und niesen mussten. „Lauft schon! Schnell jetzt!“, schrie ich meinen Freunden zu – und sie befolgten sogleich meine Befehle, flüchteten. Ich sprang über einen braunen Zaun, rannte weiter, kam ins Straucheln, stolperte beinahe, konnte aber meinen Weg im Laufschritt fortsetzen, während ich das weiße Kopftuch in eine hölzerne Tränke fallen ließ, die mit Wasser befüllt war. Och! Herrje! Die arme Dame hatte nun kein trockenes Tüchlein mehr! Ich lief weiter. Mein Herz schlug heftig, Schweiß perlte auf meiner Stirn. Ich rannte und rannte. Über eine Wiese, am Ahornbaum und an einer alten Holzhütte vorbei – und dann auch an Bennet, der keuchend beinahe zusammensackte. Luc und Damian hatten es bereits geschafft – sie befanden sich nicht mehr in Sichtweite. „Der Dicke! Haltet den Dicken! Er kann nicht mehr!“, riefen unsere Verfolger, während Bennet vor Erschöpfung fast zusammenbrach. Als ich das hörte, drehte ich ab, blieb stehen. „Lauf, Bennet! Ich halte sie auf.“ Mein Kumpane blickte verdutzt, atmete schwer und nickte mit hochrotem Kopf, ehe er weiterlief. Sekunden später standen die beiden Männer vor mir, die mich grimmig anblickten. Ich tänzelte an ihnen vorbei, huschte nach links, dann nach rechts, war einfach nicht zu fassen, schlug Haken wie ein Hase. „Schnapp den Jungen endlich!“ – „Ja wie denn?! Er ist so schnell!“ – „Pack zu!“ – „Wie denn?!“Als ich bemerkte, dass Bennet außer Reichweite und in Sicherheit war, ergab ich mich. Die beiden Männer, die abgetragene, schlichte Kleidung trugen, brüllten mich an, rüttelten an meinen Schultern, derweil ich mit bleichem Gesicht dastand. Ich hatte mir die Suppe eingebrockt, die ich nun selbst auslöffeln musste – denn zur Bestrafung musste ich in den nächsten Wochen einiges für das Gemeinwohl der Bürgerschaft machen: Ich half einigen Frauen beim Flicken von Gewändern, reparierte mit einigen Männern Kutschen, half ein paar Arbeitern bei ihren täglichen Tätigkeiten, musste einen verwitterten Zaun neu streichen, für einige Bürger Holz hacken und erledigte den einen oder anderen Botengang. Aber zumindest bekamen meine Eltern von meinem Streich nichts mit, denn es wurde Stillschweigen vereinbart; schließlich arbeitete ich meinen Schabernack ja auch ab. Meine Freunde bekam ich in diesen Wochen nur sehr selten zu Gesicht, doch als ich meine Schuld gesühnt hatte, trafen wir uns an einem Morgen – es war schon hell – vor einem alten Bauernhaus.
„Ich habe doch gesagt, dass der Kerl krank im Kopf ist. Der bringt uns nur Ärger und veralbert alle Leute. Dieses Bauernschwein!“, grölte Bennet, während er dabei wild mit den Armen herumfuchtelte. „Er hat dir geholfen!“, sagte Luc, ehe ihm Damian zur Seite sprang: „Ja, Bennet! Er hat dir geholfen, sich als der alleinige Sündenbock ausgegeben und seine Schuld abgearbeitet.“
Bennet zog seine Augenbrauen nach unten. „Er ist und bleibt ein Bauernschwein!“
Ich blickte erstaunt. Einige Minuten später öffnete ich die Kellertüre vom Bauernhaus, die sich direkt hinter uns befand und in einen Weinkeller führte. „Kommt mit! Ich muss euch etwas zeigen.“ Meine Freunde nickten und folgten mir in den Keller hinunter – die alte, hölzerne Treppe knarrte und ächzte. Ich ging neben Bennet, ließ mich aber sogleich ein Stück zurückfallen und zwinkerte Luc und Damian zu. Die Knaben verstanden, huschten zurück, während ich mich mit Bennet in den dunklen Weinkeller begab.
Unten angekommen, begann ich zu sprechen; Bennet bemerkte nicht, dass wir bereits alleine waren: „Siehst du diesen dunklen Keller? Hier unten wohnt der Teufel. Kannst du dich noch an meine Worte von früher erinnern, Bennet?! Es gibt einen Keller, in dem der Teufel uns Kinder in die Hölle zerrt – genau in diesem Keller befinden wir uns jetzt“, sprach ich leise, aber bestimmend. Bennet schlotterte vor Angst, bibberte, sprach kein Wort mehr, erstarrte neben mir. Augenblicklich drehte ich mich um, grinste teuflisch und rannte die Treppe nach oben – ich hatte Bennet in den Keller gelockt. „Nein … Nein … NEIN! Louis, du kannst mich nicht hier unten lassen. LOUIS! Hier wohnt der Teufel!“, schrie Bennet verängstigt, als er mir nachhetzte. Oben angekommen, schlossen Luc und Damian sogleich die Türe zum Keller. Zack! Bennetwar nun mutterseelenallein im stockdunklen Keller zurückgeblieben, von dem er dachte, der Teufel würde dort wohnen. Bennet klopfte, polterte auf die Türe, schrie verängstigt, winselte und scharrte mit den Fingern auf dem Holz der Türe. „NEIN! LOUIS! LASS MICH HIER RAUS! DER TEUFEL!“ Ich grinste teuflisch, Luc und Damian lachten schallend. „Ich habe ihn gehört, ich glaube, er kommt schon. LOUIS! BITTE!“ Ich drehte mich um, begab mich ganz nahe an die Türe und begann zu flüstern: „Ich habe ihn auch schon gehört. Der Teufel – er wird dich schon bald holen kommen, Bennet!“ „Nein, Louis, ich habe Angst“, winselte Bennet, während er mehrmals auf die Türe hämmerte. „Louis, es ist zwar lustig und irgendwie hat er es verdient, aber du bist etwas charakterlos“, sagte Luc schlagartig. „Dieses Dickerchen braucht das, er hat es verdient! ALLES, was ich mit ihm tue, hat er verdient. Ihr wisst ganz genau, dass ich mir für ihn den Hintern aufreißen würde“, erwiderte ich, während man noch immer das Gewinsel von Bennet vernehmen konnte. Damian zuckte kurz, ehe er zum Sprechen ansetzte: „Louis-Dominique … du hast zwar recht, aber ich hoffe, dass dir deine Arroganz nicht eines Tages gefährlich werden wird. Ich würde aufpassen, Bennet wird sich das merken.“
„Was will mir der schon tun?! Wir sind Kinder …“ Luc verbeugte sich plötzlich, während er höhnisch Beifall klatschte. „Und da ist sie wieder, die Arroganz des großen Louis-Dominique. Eure Hoheit, darf ich Ihnen die Füße küssen?!“, sprach er, und Damian krümmte sich vor Lachen. „Haltet die Klappe“, erwiderte ich leise, drehte meine Augen nach oben, während man noch immer das Jaulen von Bennet vernehmen konnte: „Louis … Louis … Lass mich raus hier. An meinem Fuß hat gerade jemand gezupft.“ Luc blickte mich sogleich mit ernster Miene an: „Das Leben ist ein Pendel, Louis. Von der einen Sekunde kannst du mit deiner Art und deinem Schabernack vom guten Kerl zum schlechten Menschen werden. Nicht vor uns – wir kennen dich – aber vielleicht vor anderen. Er wird sich das merken und eines Tages in andere Richtungen steuern. Er bewundert dich, liebt dich, Louis, auch wenn er es nur selten zeigt. Er ist sogar etwas neidisch auf dich – du hast alles, kriegst eine Menge, wirst von deinen Eltern geliebt, während er bloß so ein eingewanderter Junge ist. Sei vorsichtig, das Leben ist ein Pendel. Wenn du ihn oder andere veralberst, kann er mit nur wenigen Kniffen den Neid oder gar Hass auf deine Person projizieren. Aber er würde auch einiges für dich tun, vergiss auch das nicht. Außerdem bist du etwas älter als er.“
„Louis! LOUIS! Ich glaube, hinter mir ist jemand. Ich spüre etwas im Rücken …“, winselte Bennet, als er noch immer auf die Türe hämmerte.
Ich blickte etwas nachdenklich, und sprach zu Luc und Damian: „Er hat es dennoch verdient, das ist nur gerecht. Ich weiß, dass er auch einiges für mich tun würde, aber ich reiße mir doch auch immer meinen Hintern für ihn auf. Wer hat letztens eingelegte Äpfel gestohlen, damit er etwas zum Futtern hatte? Wer hat ihn verteidigt, als er von dem einen starken Jungen angeschrien wurde und er sich wieder bloß prügeln wollte? Wer hat ihm vor Kurzem gezeigt, wie man sich eine Steinschleuder baut? Wer spielt mit ihm? Wer hilft ihm? Wer zeigt ihm solch komische Bildung, von der die Erwachsenen immer schwafeln? Wer hat von anderen ein paar Livre gestohlen, damit er sich das geschnitzte Spielzeug kaufen konnte? Wer hat Vaters Pfeife gestohlen und mit ihm Tabak geraucht, obwohl wir beide uns fast in die Hose gemacht hätten? Wer verbringt immer Zeit mit ihm? Wer kommt, wenn er nach mir ruft? Wer tut dies? Wer tut das?“
Damian räusperte sich und murmelte leise: „Ich kenne den nicht, glaube ich.“ „Vollidiot!“, erwiderte ich leise, zog eine Augenbraue hoch und bemerkte sogleich, dass Stille herrschte – Bennet hatte aufgehört herumzuschreien. „Warum hat er aufgehört?“, brabbelte ich überrascht. „Vielleicht ist er tot … Oder es hat ihn wirklich der Teufel geholt …“, lachte Damian. „Haltet die Klappe! Beide!“, sprach ich laut, ging geradewegs auf die Tür zu und öffnete diese in einem Zug. Nichts! Bennet befand sich nicht mehr hinter der Tür. „Wo ist er? Ist deine Geschichte mit dem Teufel wahr, Louis?“, fragte Luc. „Nein! Natürlich nicht! Und jetzt haltet die Klappe“, erwiderte ich nervös und begann nach Bennet zu suchen. Im Keller angekommen, herrschte Dunkelheit, zwei Ratten sausten an mir vorbei. Wo steckte der Kerl? Ich drehte mich nach links, schnellte dann nach rechts – doch keine Spur von Bennet! „BUH!“, hallte es plötzlich neben mir, und ich erschrak. Bennet! Gott sei Dank!
„Ich habe nachgesehen – du hast gelogen, hier ist gar kein Teufel. Du veralberst schon wieder alle Leute, du Kasper!“ – „Woher willst du das wissen?! Es ist stockdunkel.“ – „Der hätte mich schon längst geholt, also bin ich nach unten gegangen und habe gewartet. So habe ich dich gezwungen, die Kellertüre wieder aufzumachen.“ – „Vollidiot! Ich hatte schon Angst um dich. Mach das nie wieder.“ – „Nur wenn du mich nicht mehr einsperrst …“ – „Du hattest es verdient!“ – „Und du bist charakterlos, du Bauernschwein …“
Kurz darauf stiegen wir die Treppe hinauf, doch als wir bereits das Sonnenlicht sahen, knallten Luc und Damian die Kellertüre zu. Es war stockdunkel, wir waren eingeschlossen. „So … jetzt holt euch beide der Teufel!“, witzelte Luc.
„Hast du vielleicht eine Kerze?“, fragte ich Bennet. „Nein, hast du vielleicht einen Apfel? Ich hätte Hunger …“ Und so kauerten wir uns auf den staubigen Boden und warteten in der Dunkelheit darauf, dass uns die beiden Wiesel an diesem Tage die Türe öffneten …
Am nächsten Morgen wanderte ich die Straße entlang, vorbei an mehreren Holunderbüschen, an einer kleinen Weide und an einfachen Wohnhäusern; kurze Zeit später erblickte ich meinen Freund Bennet, der vor seinem Heim mit zwei Mädchen tratschte, die schlichte braune Kleider trugen und schwarze Haare hatten. Ich grinste und hatte eine durchaus lustige Idee parat. Sogleich ging ich auf sie zu, wirbelte um Bennet herum und sagte mit einem schelmischen Grinsen im Gesicht zu den beiden Mädchen: „Passt bloß auf! Der Kerl ist ein ganz falscher Hase, eine sportliche, rote Kutsche in außergewöhnlicher Tarnung!“ Die Mädchen schauten verdutzt, kicherten, während Bennet wie angewurzelt dastand und mich grimmig anblickte. Augenblicke darauf verschwanden die beiden jungen Damen und ich konnte mir ein Lachen nicht verkneifen. Doch plötzlich warf sich Bennet zu Boden, krümmte sich vor Schmerz, tat so, als hätte ich ihm weh getan, weinte und rief nach seiner Mutter, ehe er sich mit schnellen Schritten in sein Haus flüchtete. Ich blickte entgeistert. War der Kerl jetzt total verrückt geworden?!
Luc und Damian kamen in diesem Moment ebenfalls vor Bennets Heim an und fragten, wo er steckte. Ich zuckte mit den Schultern – doch nur ein paar Herzschläge später kam Bennets Mutter wild gestikulierend aus dem Haus heraus und mir schwante Übles. Sie hatte lange schwarze Haare, ein hübsches Gesicht und sprach mit leichtem Akzent. „Du verfluchter Bengel aus der Nachbarschaft! Bennet hat mir erzählt, dass du ihn vom Pferdekarren gestoßen und ihn in einen Weinkeller gesperrt hast. Außerdem weint er gerade, weil du ihn vorhin geschlagen hast. KOMM SOFORT ZU MIR!“
OH! OH! Seine Mutter war fuchsteufelswild, kochte förmlich. Luc und Damian schubsten mich sogleich ein Stück nach vorne und gingen dann ein paar Schritte zurück. Mit gesenktem Kopf ging ich nun langsam auf Bennets Mutter zu. „Stimmt das, Dominique?!“, fauchte sie mich an. Ich bejahte etwas verschämt und wusste, dass schon bald meine Bestrafung folgen sollte. Ich hob den Kopf. Es klatschte. Mit der flachen Hand verpasste sie mir zwei Backpfeifen; meine Wangen waren glutrot. „Die hast du verdient und wenn du Bennet noch einmal etwas tust, werde ich dir ein paar mit meinem Kochlöffel verpassen. Außerdem werde ich dann deiner Mutter erzählen, was du für ein durchtriebener Bengel bist. Die hat allerdings sowieso viel Schuld; sonst würdest du nicht immer alle Leute zum Narren halten. Nimm dir doch mal ein Beispiel an meinem Bennet, der ist immer so ein braver Junge.“ Kurz darauf blickte ich in ihre dunklen Augen, sie zog die Augenbrauen nach unten, drehte sich um und ging zurück in ihr Haus.
„Siehst du, Louis? Wir haben dir doch gesagt, dass du manchmal übertreibst“, lachten Luc und Damian hinter mir. „Hoffentlich passiert dir das nie mit einem Mädchen, das du wirklich gerne hast, und Bennet steht da wie der gute Kerl und lacht sich dann ins Fäustchen.“ Nicht schon wieder diese Mädchen! Zum Teufel mit denen! Doch da hatte ich noch keine Ahnung von der Zukunft.
Es war Sommer zu dieser Zeit und so schlenderten Luc, Damian und ich an diesem Tag einen Feldweg entlang. Bennet war nicht dabei; ich war noch immer etwas erbost darüber, dass er alles seiner Mutter berichtet hatte. Wir befanden uns nun etwas außerhalb unseres kleinen Dorfes, kamen an ein paar verlassenen Häusern vorbei, an deren Wänden Efeu und wilder Wein wucherte. Zwei Störche standen auf ihren Nestern, die sie auf den Schornsteinen der umliegenden Häuser gebaut hatten. Ich blickte nach oben – ein Bussard zog am azurblauen Himmel seine Kreise, spähte auf seine Beute: eine Maus, die in einem Feld an einer Kornähre knabberte. Schlagartig stürzte der Bussard in die Richtung der Maus, packte das quietschende Nagetier und flog mit ihm flügelschlagend davon. Augenblicke darauf kamen wir in einem kleinen Wäldchen an, in dem wir uns in den Sommermonaten meiner Kindheit oftmals aufhielten. Die Waldluft kroch uns in die Nase und wir gingen schnurstracks zu unserem kleinen Lieblingsplätzchen, das sich neben dem Waldweg befand. Ein leichter Wind rüttelte an den Baumkronen – wir hörten die sanfte und beruhigende Stimme des Waldes und konnten Vogelgezwitscher vernehmen. Bei unserem kleinen Lieblingsplätzchen standen unzählige Himbeersträucher, ein paar Hagebutten- und Walderdbeerenbüsche befanden sich direkt daneben. Wir begannen, die süßen Früchte von Mutter Natur zu naschen – wir pflückten und schmatzten; wir pflückten und aßen. Lecker! Plötzlich hörten wir ein Rascheln. Wir erschraken, hielten die Luft an. Eine verängstigte Ringelnatter schlängelte sich in vielen Windungen aus den Sträuchern heraus und flüchtete sich ins hohe Untergras des Waldes. Wir atmeten tief durch; hatten schon einen Wolf vermutet, der uns auflauerte. Puh! Nachdem wir mit dem Naschen fertig geworden waren, liefen wir kichernd zu einem kleinen Teich, der sich am Ende des kleinen Waldstücks befand, und bei dem wir uns ebenfalls sehr häufig aufhielten. Dort angekommen, beobachtete ich meine Umgebung: Der Teich lag vor uns, die Wasseroberfläche war in diesem Augenblick glatt. Ich sah eine kleine Eidechse, die sich auf einem großen Felsen sonnte, der sich in unserer Nähe befand, sah eine Rohrdommel, die durch das Schilf stakste und nach Nahrung suchte, während zahlreiche Libellen über dem Schilf brummten, sah in der Ferne eine alte Jägerhütte, die alt und verfallen wirkte, und spürte einen zarten Windhauch auf der Haut.
Wir schmissen wie meistens ein paar Steine ins Wasser, spielten Fangen und Verstecken und genossen einfach die Ruhe an diesem abgelegenen Ort, weit entfernt vom Rummel unseres Dorfes.
Wir saßen gerade nahe am Teich, als Luc zu sprechen begann: „Weshalb magst du eigentlich keine Mädchen, Louis?“ Ich zog eine Augenbraue nach oben. „Das wisst ihr doch; die sind seltsam. Ich mag die einfach nicht, die verhalten sich so komisch – ich veralbere die lieber manchmal.“ Luc und Damian gackerten. „Wir spielen schon auch hin und wieder mit ihnen – eines Tages werden sie dir vielleicht auch noch gefallen …“ Ich verzog die Mundwinkel zu einem Grinsen. „Da könnt ihr lange warten. Mit Mädchen will ich nichts zu tun haben.“ Luc und Damian lachten herzhaft.
Bis spät in die Nacht hinein verweilten wir drei beim Teich; wir spielten, sprachen und hatten unseren Spaß. Dunkelheit herrschte bereits. Wir blickten zum Himmel: Dann und wann flammte ein Blitz am Horizont auf. Wetterleuchten! Wie Leuchtfeuer!
Wir drehten uns um, und machten uns auf den Weg nach Hause …
In nächster Zeit spazierte ich mit Bennet, der eine feine, weiße Strickjacke trug, einmal zu einem alten, steinernen Brunnen, der ziemlich genau in der Mitte unseres Dorfes lag und aus dem die Erwachsenen immer Wasser schöpften. Für ihr Vieh, für die Felder und Weingärten, für sich selbst. „Weshalb hast du mich bei deiner Mutter verraten? Du weißt doch ganz genau, dass du stärker bist als ich und ich dir gar nicht wirklich etwas tun könnte“, fragte ich ihn mit leiser Stimme. „Ja, obwohl du älter als ich bist, bist du schwächer. Aber du bist auch ein Bauernschwein, das immer alle Leute veralbert, ein Filou, der manchmal nur Schabernack im Kopf hat. Das gehört schon so zu dir, du Kasper! Du hättest mich nicht in den Keller einsperren und vom Karren schubsen sollen“, erwiderte er bestimmend. Ich grinste. „Naja, wenn du meinst. Für meine Begriffe hattest du das allerdings trotzdem verdient.“
Kurze Zeit später kamen wir beim Brunnen an; ein alter Mann stand mit seinen beiden Töchtern dort herum. Der alte, hagere Mann, der seine grauen, langen Haare zu einem Zopf zusammengebunden hatte, trug einen einfachen braunen Mantel, dazu eine weiße Kniehose, und hatte einen grünen Dreispitzhut, mit weißem Hermelin verbrämt, auf dem Haupt; seine Töchter, die weiche Gesichter und lange, braune Haare hatten, die ihnen bis auf die Hüften fielen, trugen purpurfarbene Kleider aus Samt. Bennet schien die Mädchen zu kennen und begann mit ihnen zu sprechen: „Bonjour allerseits! Wir sind gerade vorbeigekommen. Wollt ihr mit mir heute noch spielen?“ Die Mädchen kicherten, stupsten sich gegenseitig mit dem Ellenbogen an. „Wer ist denn dein Freund? Will der auch mit uns spielen?“ Bäääääähhhhhh! Mädchen! „Nein, der mag keine Mädchen, der veralbert bloß alle Leute, das Bauernschwein!“, erwiderte Bennet. Die jungen Damen blickten amüsiert. „Der ist aber süß.“ – „Ja, will der wirklich nicht mit uns spielen?“ „Bei dem müsst ihr vorsichtig sein, sonst gibt er euch böse Tiernamen, der veralbert sogar Mädchen, macht vor nichts und niemandem Halt!“ Die Mädchen lachten. „Ich finde ihn süß.“ – „Ja, der ist niedlich. Vater? Kannst du nicht den Kleinen da einladen. Wir wollen mit ihm spielen.“ Der alte Mann verharrte schweigend, dachte nach. „Eben! Euer Vater will ihn nicht einladen. Da muss er sich zuerst einmal besser anziehen; immerhin trägt er manchmal bloß abgetragene Kleidung. Ich beispielsweise trage heute eine neue Strickjacke, die ich von meiner Mutter bekommen habe. Außerdem ist er gefährlich, krank im Kopf und veralbert bloß alle Leute.“ Die beiden Mädchen lachten herzhaft. „Aber Bennet … Wir wissen, dass du ein Löwe bist und uns immer beschützen willst. Wir spielen gerne mit dir, doch du hast immer nur dann Zeit, wenn es dir passt, behandelst uns hin und wieder schlecht und spielst immer auch mit den anderen Mädchen.“ – „Ja, Bennet, wir mögen dich gerne, du bringst uns oft zum Lachen, beschützt uns immer, aber manchmal weinen wir sogar deinetwegen. Komm schon, Vater, lade den kleinen Kasper zu uns ein.“ Bennet schnaubte; ich blickte entgeistert. Plötzlich fragte mich der alte Mann, ob ich ihn zu seinem Heim begleiten würde; er hätte mir auch ein paar Geschichten zu erzählen, meinte er. Obwohl ich nicht gerade begeistert war und eigentlich nicht mitkommen wollte, weil ich unter keinen Umständen mit den beiden Mädchen spielen wollte, kam ich der Einladung des alten Mannes nach – ich versprach ihm, ein paar Stunden mit ihnen zu verbringen. Ich machte es vor allem, weil ich unbedingt den Geschichten des Monsieur lauschen wollte.
Als ich etwas später mit den dreien weiterzog, blickte ich kurz auf Bennet, der natürlich nicht mitkommen wollte, obwohl er ebenfalls eingeladen worden war. Er schien etwas verärgert zu sein.
Im Haus der Familie angekommen, begrüßte mich eine alte Frau mit langen, grauen Haaren. Sie trug ein schäbiges, altes Kleid und schien beinahe völlig erblindet zu sein; ihr Gesicht war mit Falten übersät. Sie nahm meine Hand, streifte dann langsam über meine Handfläche – sie sah mir jedoch dabei kein einziges Mal in die Augen, weil sie nicht wusste, wo sie genau hinblicken sollte. „Bonjour! Bonjour! Unser Gast hat aber sehr interessante Hände, diese Linien sind außergewöhnlich“, sagte sie leise, ehe sie fortfuhr: „Bevor du unser Heim verlässt, will ich, dass du zu mir kommst. Tust du mir diesen Gefallen?“ Ich blickte etwas skeptisch, bejahte aber. Ich ging dann ein Stück vorwärts, musterte meine Umgebung: Ich sah schlichte, hölzerne Einrichtungsgegenstände, einen weißen Holzofen, mehrere rote Wandteppiche schmückten das Innere des Hauses und ein großes Spinnrad stand in einer Ecke. Augenblicklich entdeckte ich ein Frettchen, das sich unter einem klobigen, alten Esstisch versteckt hatte. Diese kleinen Tiere hielten sich manche Bürger in unseren Zeiten als Haustiere – sie sollten Mäuse fangen, wurden aber meist bereits durch Katzen ersetzt, weil diese nicht so widerlich stanken. Auf dem Esstisch lag eine Elegie, ein Gedicht, das ich ausgiebig betrachtete. „Spiel doch zuerst einmal mit meinen Mädchen und komm dann zu mir. Die Frau, die dich begrüßt hat, ist übrigens meine Mutter – sie ist eine sehr weise Frau. Mein Weib ist vor einigen Jahren von uns gegangen, ich habe lange um sie getrauert“, sprach plötzlich der Monsieur zu mir, während er über meine braunen Haare streichelte. Er wirkte dabei etwas mitgenommen; der Tod seiner Frau hatte ihm sichtlich zugesetzt. Ich lächelte freundlich und nickte.
Und ging danach zu den beiden Mädchen, die sich in einer Ecke auf den Holzboden gesetzt hatten und mit kleinen, geschnitzten Holzfiguren spielten. Ich setzte mich zu ihnen, war etwas nervös.
„Du bist dieser Louis-Dominique, stimmts? Der kleine Wildfang?!“ – „Bennet sagt immer, dass deine Mutter daran Schuld hat und dir negative Gedanken einflößt.“ – „Ja, und hinter deinem Rücken redet er auch manchmal seltsam über dich und später sagt er hin und wieder, dass er das alles für dich macht, damit du auch mal mit Mädchen spielst. Manchmal sagt er sogar, dass er sich bloß mit uns anfreundet, damit du dich mal mit Mädchen beschäftigst.“ – „Manchmal redet er aber auch gut über dich, verteidigt dich.“ Ich schluckte. Ich mag keine Mädchen, was wollen die von mir? Ich rutschte sogleich ein Stück zurück, blickte erstaunt. „Schau! Ich glaube, er ist schüchtern.“ – „Ja, das habe ich mir auch schon gedacht, der ist gar nicht böse.“ – „Weshalb veralberst du manchmal Mädchen, Dominique? Hast du Angst vor Mädchen?“ Die beiden senkten den Kopf zur Schulter, drehten ihre Oberkörper nach vorne. Mir wurde ganz mulmig zumute; ich wusste nicht recht, was ich antworten sollte. „Schau hin!“ – „Ich habe doch gleich gesagt, dass der nur Angst vor uns hat. Wir beißen dich schon nicht, du musst uns nicht veralbern, wir tun dir nichts.“ Mein Kopf wurde rot, ich saß wortlos direkt vor ihnen, wäre am liebsten geflüchtet. „Nicht, dass dir das einmal bei einer besonderen Dame passiert, die du wirklich magst. Hoffentlich sagst du kleiner Kasper dann nicht auch noch ein blödes Wort über sie. Bennet wird jeden kleinen Fehler nutzen, und du hattest heute Glück, dass du nichts über ihn gesagt hast, denn sonst hättest du dagestanden, als ob du neidisch wärst und dich einmischen würdest. Nicht, dass du ihm dann später sogar noch so zu helfen probierst …“ Besondere Dame? Ich? NIEMALS! Bäääääähhhhhhh Mädchen! Doch tja …
Ich spielte dann eine Zeit lang mit den beiden Mädchen, die äußerst nett zu mir waren, sodass meine Panik vor ihnen schnell verstummt war. Ich dachte nach. Und murmelte dann leise einige Sätze vor mich hin: „Ich wollte früher einmal mit einem Mädchen aus der Nachbarschaft spielen – Rosanna. Sie wollte aber nicht, konnte mich nicht ausstehen und ich glaube, das hat mir so einen Schlag verpasst, dass ich manchmal seltsam zu Mädchen bin. Vor allem, wenn ich ein Mädchen wirklich mag und mit ihr spielen will, necke ich sie hin und wieder …“ Die Mädchen grinsten. „Moi! Der kleine Lausebengel ist ja wirklich schüchtern.“ – „Außerdem ist er irgendwie niedlich!“





























