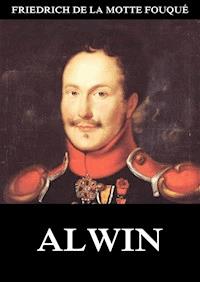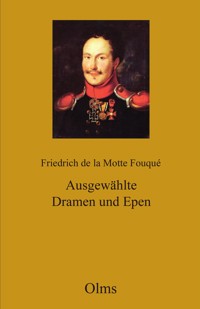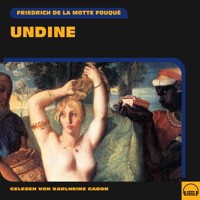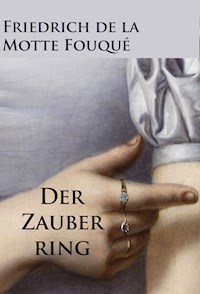Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Dies ist die Autobiographie des 1843 in Berlin verstorbenen deutschen Dichters, der als einer der wichtigsten Vertreter der Romantik gilt und vor allem für sein Werk "Undine" bekannt ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 563
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lebensgeschichte
des Baron Friedrich de La Motte Fouqué
Inhalt:
Friedrich Heinrich Karl Freiherr de la Motte Fouqué – Biografie und Bibliografie
Lebensgeschichte des Baron Friedrich de La Motte Fouqué
Lebensgeschichte, F. de la Motte Fouqué
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849613969
www.jazzybee-verlag.de
Friedrich Heinrich Karl Freiherr de la Motte Fouqué – Biografie und Bibliografie
Lebensgeschichte des Baron Friedrich de La Motte Fouqué
Dem ältesten und Einem der geliebtesten meiner noch lebenden Freunde, Herrn Hofrath Friedrich Rochlitz, in Glaube, Kunst, Wissenschaft und Leben mir innig nahe,
L.M. Fouqué.
I.
Wohl für jegliches Menschenkind ist es ein heilsames und anmuthiges Schaffen, aus reiferen Jahren her mit ernsten, am Lichte der stets näher heraufleuchtenden Ewigkeit erstarkten Blicken umzuschauen nach der durchwalleten Bahn.
Geschieht das im echten Sinne, so bringt es Frieden in die Seele und Klarheit in den Geist.
Voll tiefer Ahnung nannte der mythische Glaube der alten Römer ihren vor- und rückschauenden Janus den Friedensgott.
Friedsam, wenn gleich mit Weinen, aber gehegt und gepflegt von der Hand schützender Liebe, hebt unser Lebenslauf an, und die Kindheit leuchtet in paradiesischer Huld, auch ungünstigste Umgebungen vergoldend mit seligem Frühlicht:
»Weil Kinder halb noch Engel sind,«
wie der Dichter mit Recht spricht.
Friedsam, wenn gleich unter den Thränen des Scheidens, unter den Schauern des Todes, leuchtet die Ewigkeit Dem entgegen, welcher sie während seiner Bahn oftmal angeschaut hat im Geiste des Glaubens, der Liebe, der Hoffnung.
Die Strecke zwischen Ein- und Ausgang des Menschenlebens ist Prüfung, also mannigfacher Kampf, um so sieghafter und gemilderter, je mehr und je bewußter sie beleuchtet wird von jenen beiden Friedenspunkten herein: Anfang und Ende.
Als der Dichter des Zauberringes an den Beginn seines Werkes ging, scheuete er sich nicht, in dem Vorwort, Angesichts der Welt, auszusprechen, er habe den lieben Gott recht herzlich dazu um Beistand angerufen, und hoffte zuversichtlich, das solle helfen.
Von zweien Männern, denen er dazumal den Anfang seiner Dichtung vorlas, schüttelte der Eine mit verdross'ner Bedenklichkeit den Kopf zu jenem Bekenntniß, während der Andre mit vertraulichem Lächeln kopfnickte.
So geht's in der Welt zwischen Kopfschütteln und Kopfnicken hin. Absonderlich regt sich das verneinende Geschüttel stark, wo sich's Einer herausnimmt, von göttlichen Dingen und ihrem Einfluß auf weltliche Dinge zutrauensvoll zu sprechen.
Aber der liebe Gott blieb mit seinem Beistand für das Gedeihen jener Dichtung nicht außen, wie bekannt.
Gleiches Gedeihen erhoffend für das jetzt beginnende Unternehmen, spricht derselbe Mann dasselbe Bekenntniß aus, indem er, um dreißig Jahre später, anhebt, wie folgt, seine Lebensgeschichte aufzuzeichnen, um sie dem Kreise seiner Leser (welchen von jenen beiden Männern sie sich nun zum Repräsentanten erwählen mögen) heiter und offenkundig, und nach besten Kräften wahrhaft, jetzt hinzugeben, und zu hinterlassen dereinst.
Friedrich Heinrich Karl Baron de La Motte Fouqué ward in der uralten Stadt Brandenburg an der Havel geboren, am 12. Februar 1777, und zwar in dem ältesten Theil derselben, auf dem Dom, um welchen her die ersten Christlichen Inwohner sich nach und nach angesiedelt hatten, wie das in den mehrsten Städten Deutschlands zugegangen ist. Seine Mutter stammte aus dem Altsächsischen Hause derer von Schlegell, Tochter des Dessau'schen Hofmarschalls von Schlegell, der, obzwar nie Kriegsmann, durch seine fast sprüchwörtlich gewordne Kühnheit auf den damal dort üblichen Jagdritten sich als wackrer Nachkomme ritterlicher Väter erwies.
Die Geburt des Knäbleins erweckte theilnehmende Freude in der Stadt und auch noch viel weiter umher, schon indem die ausgezeichnet schöne und holdseelige Mutter der Gegenstand inniger Hochachtung Aller, die sie kannten, war. Zudem, nach einer seit mehren Jahren kinderlosen Ehe seines Vaters befürchtete man, den Ritterstamm de La Motte Fouqué aussterben zu sehn, geachtet um der Glaubenstreue willen, in welcher der Aeltervater des Neugebornen sein Vaterland Frankreich und die schönen Burgen und Besitzungen, ihm dort eigenthümlich, als sogenanter Refugié verlassen hatte, geachtet auch um die Heldentugend des Preußischen Generals der Infanterie, August Baron de La Motte Fouqué, des Knaben Großvater. Dieser hatte sein durch ruhmvolle Kriegsbeschwer erschöpftes Alter als Domprobst zu Brandenburg verlebt, als Freund des großen Friedrich, und von diesem – es sei zur Ehre des königlichen Helden ausgesprochen – mit söhnlicher Liebe und Achtung gepflegt. Voll echt ritterlicher Milde und religiösen Pflichtgefühls war der vom General zum Domprobst umgewandelte Refugié stets der Armen eingedenkt, und half allen Bedrängten, wo er es vermogte. Und in seinem schönen Verhältniß zum König vermogte er viel. Die Geburt seines Enkels und Stammhalters erlebte der greise Feldherr nicht mehr, aber der König nahm die Pathenstelle bei dem Kinde mit dem Ausdruck inniger Liebe für den Großvater und ehrender Anerkennung des Stammes huldreich an, und nach ihm ward der Knabe Friedrich geheißen, oder in damaliger Abkürzungsweise – traf sie ja selbst den großen Pathen, eben aus recht inniger Herzensliebe für ihn – Fritz.
Um dessen Wiege her schwebten seltsame Sagen, vielleicht auch Erscheinungen. Die Domherrnwohnung – sogenannte Curie – nämlich, welche sein Vater gemiethet hatte, um den hinscheidenden Helden recht aus der Nähe zu warten, stand im Ruf, »es gehe d'rin um.« Eine gar eigen geheimnißreiche und doch scheinbar in's Gewöhnliche spielende Art, sich auszudrücken für ein Etwas, welches man, näher zu bezeichnen, sich scheut! – Allerdings gab es ein unbegreiflich seltsames Treiben in jener Curie, weshalb sie lange Zeit unbewohnt geblieben war. Auch während sie der Vater des Neugeborenen, ein durch frühen Kindheitsunfall kränkelnder, aber heiter muthvoller Mann, in seinen Jünglingsjahren als Dragoneroffizier ein gewandt rüstiger Reiter, wiederum zu bewohnen angefangen hatte, blieb jenes seltsame Raunen und Getriebe merkbar, ohne daß die Familie sich eben dadurch stören ließ. Als sie aber nach dem Heimgange des glorwürdigen Familienvaters auszog, und sich ein Haus ankaufte in der durch manch freundliches Entgegenkommen ihr liebgewordenen Stadt, wollte Niemand wiederum einziehen in jene Domherrnwohnung, welche deshalb abgebrochen ward. Auch davon gehen im Volke noch mancherlei wunderliche Sagen um. Namentlich soll ein Balken, der das Gemäuer zusammenhalten half, stehen geblieben sein, Jahre hindurch, weil sich daraus bei jeglichem Axthiebe der Zimmerleute zorniges Klage-Getön vernehmen ließ, und Niemand sich mehr an die Arbeit des Abbrechens wagen wollte, bis er endlich von selbst darniederstürzte. –
Dem Baron de La Motte Fouqué mit seiner Frau und seinem neugeborenen Knaben ging in der neuen Stadtwohnung ein gar stillheiteres Leben auf, auch in jeder äußerlichsten Gestaltung. Eine breite, sonnige Straße nach vorn heraus, seitwärts der Blick nach dem Thor, auf der andern Seite ein von der Stadtmauer begränzter Garten mit regelrechten Beeten und Gängen nach damaliger Weise, ein Pförtlein in der Mauer nach dem freien Felde hin, im Innern der Wohnung lichte, hohe, behagliche Gemächer, – das sind die ersten Bilder äußerlicher Umhegung, die sich dem kindlichen Geiste nach Dessem Erwachen darboten, und die noch vorhalten in dem Bewußtsein des nun greisenden Mannes, und zwar nach gewaltig großen Dimensionen, wie sie von späterer Anschauung in der Wirklichkeit öfter zusammengeengt worden sind, ohne doch innerlich ihr seltsam ausgedehntes Recht zu verlieren.
Der Knabe zählte noch nicht zwei Jahre, denn es war beim Ausbruch des Baierschen Krieges, als er mit seiner Wärterin im Garten war, und aus dem Mauer-Pförtchen ein anverwandter Freund des Hauses, Hauptmann Graf Schmettau, vonhinnen ritt, nachdem er Abschied von der Familie auf den bevorstehenden Feldzug genommen hatte. »Da reitet der Onkel in den Krieg;« sagte die Wärterin zu dem Kinde. Und die ummantelte Gestalt, sich beugend auf dem Roß in der niedrigen Pforte, und der Garten mit seinen Gängen und Beeten und Alleen, – das steht noch immer vor meinem innern Auge, wenn gleich wie überzogen von einem Flor, oder Nebel. War es die Liebe für jenen edelritterlichen, freundlichen Mann, schon früh im Herzen des Knaben erwachend? War es die eben so früh aufgetauchte Kriegslust, ihm angeerbt von seinen Vätern, die schon in den alten Kriegen Frankreichs gegen England rühmliche Waffen geführt hatten? Es kam vielleicht aus Beiden, daß jener früheste Moment sich so fest gehalten hat, zwischen dem unbestimmtem Gemeng' anderer Erinnerungen.
Ueberhaupt aber geht es wohl mit dem Feststellen des kindlichen Bewußtseins, wie mit der Gestaltung einer Erdveste aus dem Urgewässer: erst einzelne Kuppen und Inselchen, dem Gefluth entragend, bis dazwischen der Kontinent sich bildet, freigelassen von den verrinnenden Wassern, und nicht allemal bleiben jene zuerst aufgetauchten Punkte die höchsten.
Jeder von uns Allen, meine ich, hegt gewisse früheste Anknüpfungspunkte des nachherig vollen Bewußtseins, die sich auch nicht einmal durch eine Wahrscheinlichkeit oder Muthmaaßung, wie jener obige, als bedeutsam wollen herausheben lassen. Das macht: ein kindlicher, meinethalb auch kindischer Geist sieht mit andern Augen, als der Geist eines Erwachsenen. Nicht allemal mag er Recht haben, jedoch eben so wenig auch allemal Unrecht. Jedenfalls knüpfen sich dort Fäden an, die uns nachher nur allzu oft entschlüpft sind, und die doch ohne Zweifel tief hineinreichen in das Wesentlichste und Allereigenthümlichste unseres wahrhaften Daseins.
Gönne man mir's daher, im Bestreben, mein Selbst auf das treulich gewissenhafteste abzuspiegeln, immerhin, einige Zeit noch in den Gränzen der Kindheit zu verweilen. Hat man's ja dem Jean Jaques Rousseau in seinen Bekenntnissen beifällig vergönnt, und zwar mit großem Recht. Auch um so weniger werde ich späterhin die Geduld meiner Leser mit einzelnen Darstellungen aus dem Jünglings- und Mannesalter in Anspruch zu nehmen haben, die sich ohnehin aus der Feder eines noch Lebenden – so lange ich noch hienieden walle, kann und will ich kein Verstorbener sein, – durch manche billige, ja heilige Rücksicht auf Mitlebende bedingen und beschränken müssen. Ueberaupt wird jene Fortführung für den hiernächst liegenden Zweck mehr literarischen Richtungen zu folgen haben, als unmittelbar persönlichen.
Wer sich aber zu dem Knaben Fritz mit freundlicher Theilnahme neigen mag, wird nachher den erwachsenen Friedrich auch aus leiseren Andeutungen verstehen und würdigen können, gelte es nun dabei Anerkennung, Anklage oder Entschuldigung. –
In der Brandenburger Kinderstube schlief einige Zeit lang, eines Familienbesuches halber, Fritz mit zwei andern Kindern beisammen. Da kam ihm ein entsetzlicher Traum, und eines leisen Schauders kann sich der Sechziger noch jetzt bei'm Aufschreiben nicht erwehren, so kindisch auch die Erscheinung herauskam.
Eine nach damaligem Geschmack ehrbahrlich geputzte Madam war es, die hereintrat, einen Strick in der Linken, ein Messer in der Rechten, und ganz gelassen sagte: »Nun haltet euch hübsch ruhig, Kinder. Denn erst muß ich Euch binden, und nachher Euch schlachten.«
Eben die äußere Gewöhnlichkeit war es, welche dem kleinen Träumer die bedrohliche Kunde so überaus schrecklich machte, und weshalb er so entsetzt aus seinem Schlaf emporfuhr. Ich meine sogar, er habe das wunderliche Ding mehr denn Einmal im Traume gesehen.
Als er's den Spielgenossen wieder erzählte, waren auch Die seltsamlich ergriffen davon, aber auch bald eben so seltsamlich damit vertraut. Eine »Bind-Madam« hieß in der kleinen Genossenschaft jene Erscheinung, und ward fortan – freilich in gar ungeschickter Plastik – häufig aus Papier oder Spielkarten mit der Scheere nachgebildet. Wie man etwa zu fragen pflegte: »Soll ich dir ein Pferd ausschneiden?« – »Oder einen Hund?« – u.s.w. fragte man auch ganz unbefangen, ob eine: »Bind-Madam« ausgeschnitten werden solle. –
Noch ein Phantasiestückchen aus der Brandenburger Kinderstube.
Ein halb erwachsener Vetter, auf dem Brandenburger Ritterkollegium erzogen und dem Knaben besonders lieb, hatte auch einstmal in den Ferien dort Unterkommen gefunden, und neckte den kleinen Fritz mit allerhand Späßen. Fritz, um des ihn störenden Eindruckes los zu werden, sah auf einen an der Wand hängenden Kupferstich in großem Format, worauf neben den Wappenschildern des Havelberger Domkapitels, zu welchem sein
Vater gehörte, die zwei bärtigen Schutzheiligen desselben abgebildet waren. Mit eins überkam ihn eine seltsame Rührung. Thränen drangen in seine Augen. Der fröhliche Vetter sagte mit unwilligem Lachem, »Schäm' dich Fritz! du heulst, weil ich mit dir spaße!« – »Ich weine nicht über dich!« antwortete Fritz. »Ich weine über das heilige Bild!« – Er ist noch oftmal darüber geneckt worden, als sei das nur eine alberne Ausrede gewesen. Dennoch war es wahrhaftig wahr. Mache daraus ein Psycholog, was er kann. –
Der Knabe mochte etwa vier Jahre zählen, als sein Vater ein Landgut ankaufte, Sacro, ganz in der Nähe von Potsdam gelegen. Den märkischen Sand abgerechnet, war's ein kleines Paradies, als Halbinsel umfluthet von der Havel, dorten sehr breit und silberblau, ein Blick drüberhin aus den Fenstern des schönen, wohnlichen Hauses nach der fernen Zugbrücke, welche über einen mächtigen Arm des Stromes hin von Potsdam nach Berlin führt, und somit stets durch regsame Gestalten belebt war. Diese brachte ein zierliches Fernrohr dem Auge nahe, und Fritz ergötzte sich oft an der ihm wie magisch vorkommenden Erscheinung. Ueberhaupt war es, als ob ihn jene räthselhaften Gewalten aus der Brandenburger Curie angehaucht hätten mit einer süß schaurigen Lust für das Unerfaßliche der Geisterwelt. Und doch hatte die Auf-und Abklärung des achtzehnten Jahrhunderts auch in dem Hause zu Sacro, vollends in dieser Nähe von des großen Friedrichs Residenz, vielen Einfluß gewonnen. Hausherr und Hausfrau waren allerdings christlicher Gesinnung, und feierten namentlich stets den Genuß des heiligen Abendmahles mit unendlich tiefster Bewegung, wie ich mich nicht entsinnen kann, einen dergleichen anhaltenden und rührungerfülleten Ernst während der weihenden Tage je in andern Familien wahrgenommen zu haben. Auch jener edle, vorhin erwähnte Graf Schmettau, welcher nach dem Kriege aus dem Heer zurügetreten war, und sich in der Familie angesiedelt hatte, die Landwirthschaft des kränkelnden Hausherrn mit aufopfernder Treue und Rüstigkeit besorgend, war ein praktischer Christ. Aber, wie fast in allen gebildeten Kreisen dazumal, waltete auch hier die Meinnng vor, das achtzehnte Jahrhundert habe nun einmal einen Riesenschritt gethan, und man dürfe nicht zurückbleiben wollen. Dazu kam ein mißverstandener Begriff sogenannter Toleranz, und ein übertriebener Respekt vor der Einsicht Solcher, die sich als auf der Höhe der gerühmten Bildung stehend ankündigten. Was dem ernstfrommen Hausvater dabei allzu anstößig vorkommen mochte, verhüllte mildernd der Gedanke, daß ja doch auch der königliche Freund seines Vaters, der große Friedrich, die unbedingte Denkfreiheit beschütze, und selbst in seinem jetzt annahendem hohen Alter sich als einen von jedem Dogma persönlich freien Philosophen behaupte.
So gerieth denn Fritz, just für den wesentlichst entscheidenden Unterricht, den von göttlichen Dingen, in die Hände neologistischer Hauslehrer und indifferentistischer Prediger. Zwar die Kirche ward gewissenhaft allsonntäglich besucht. Aber was dorten gepredigt ward, war eben die sogenannt reine Moral, und ließ folglich den Knaben ohne alle Gemüthsbewegung, ja, langweilte ihn bis auf den Tod, welches er sich denn doch wiederum nicht selbst gestehen durfte, vor den innern Augen habend seiner Aeltern ernstgetreue Anhänglichkeit an die Kirche und ihre Vorschriften.
Sein erster Hauslehrer – der Knabe mochte noch kaum fünf Jahre zählen – gewann ihm das ganze Herz. Es war ein weicher, inniger, poetisch empfindender junger Candidat der Theologie, zu Halle seine Universitätsjahre beendet habend, welcher seinen kleinen Zögling in dessen ahnungsreichen Anklängen von Ritterlichkeit und Liedeslust gar wohl verstand. Schon dazumal stammelte der kindliche Geist an den Gedichten der zwei Gebrüder Stolberg und Bürgers. Das Lesen hatte er sehr früh fertig erlernt, so auch das Schreiben. Er weiß selbst nicht mehr so recht, wie. Diese Fähigkeiten erschienen – und erscheinen noch jetzt – ihm so natürlich, wie das Gehen; ja, wie das freie Bewegen der Arme. Sein Lieblingslied – Friedrich Stolbergs Lied eines deutschen Knaben – hatte der sinnige Lehrer ihm in Musik gesetzt, und er sang es fertig und endlos, nach der fast recitativischen Weise, die er noch heutigen Tages inne hat, wo die sechs Jahre sich zu drei und sechzig aufzusummiren im Begriff stehn. Ihm war dazumal schon zuweilen, als müsse er selbst Lieder dichten. Nur blieb es damit noch immer beim Anfange, oder bei einzelnen Stellen aus der Mitte. Seine Spiele allzumal jedoch bildeten ein kleines fortgesetztes Ritter–Epos. Als einstmal in solchem Sinne mit dem Lehrer ein ritterliches Gefecht beginnen sollte, worauf sich dieser heitern Sinnes einließ, schlug er dem Knaben, wohl ganz unabsichtlich, das kleine Holzschwert aus der Hand. Fritz brach in lautes Weinen aus, das sich gar nicht wollte stillen lassen. Es war keine Ungezogenheit dabei, auch keine Weichlichkeit. Es war – um dreißig Jahre später las ich's in einem Werke meines Freundes Franz Horn –: »der unsägliche Schmerz des Ueberwundenseins.« Und erst vor diesen Worten ward das Gefühl des Knaben von daherüber mir völlig klar. Glücklicherweise war auch dem Lehrer ein zarter Sinn darüber aufgegangen. Jetzt ein Wort des Scheltens oder gar der Verhöhnung hätte unermeßlich viel verderben können. So aber wußte der Sieger den Besiegten freundlich wiederum zu ermuntern, auch durch Hinweis auf etwa künftige beglücktere Gefechte, und gewann dadurch eine um so schönere Gewalt über ihn.
Warum sollte ich ihn hier nicht nennen, den lieben, freundlichen, auf den Zögling so wohlthätig einwirkenden Lehrer? Er hat nachher ein stilles, der literarischen Welt unbekanntes Pfarrerleben in einem Hildesheimschen Landstädtchen geführt, aber für mich blieb er unvergessen, und seine Erinnerung wird uns noch auf künftiger Lebensstation begegnen, – muthmaßlich einmal gar er selbst. Mit seinem Namen redet sich's aber am Besten von einem geliebten Menschen. Er hieß Fricke.
Einstmal erfreuete er seinen Zögling durch die Kampfgeschichte des Leonidas und Xerxes, die er ihm, wie ich meine, aus einer Uebersetzung der engländischen Dichtung des Glower vorlas. Fritz war ganz hingerissen von der heroischen Schilderung. Nun aber gedachte Fricke noch einen rechten Heldenfunken aus dem Knaben hervorzulocken, indem er fragte: »welcher von den Beiden möchtest du gewesen sein, Fritz? Xerxes oder Leonidas?« – Das Experiment schlug um. Denn bei aller Ehrenfreude über Leonidas schlug die Siegeslust in dem kecken Burschen vor, und er antwortete unbedenklich: »Xerxes.« – Aber auch da widerum gab sich Fricke als ein echt Wissender, oder doch richtig Fühlender in der Erziehungskunde zu erkennen. Statt sich in einen Tadel der Wahl einzulassen, oder auch nur in eine Widerlegung, fand er sich geruhig darin, und arbeitete wohl nur fortan im Stillen auf die Erweckung einer höheren Erkenntniß los. Jedenfalls mochte ihm die grund-ehrliche Unbefangenheit in des Knaben Aeußerung schon recht sein.
Eine Veranlassung zu ernster Ermahnung bot sich bald nachher dar, sie selbst sehr ernster Art. Ein nachgeborner Bruder des Knaben starb, nur wenige Wochen oder Tage nachdem er in der heiligen Taufe den Namen Karl empfangen hatte. Fritz, nach seiner angeboren lebhaften, nur allzu oft in Heftigkeit ausartenden Weise, konnte sich über den Verlust der kleinen lieblichen Erscheinung nicht zufrieden geben. Milde Zusprache wollte nichts helfen. Da sprach Fricke mit an ihm ungewohnt strengem Ernst: »Fritz, versündige dich nicht durch dein wildes Gejammer.« Ein furchtbar heilsames Erschrecken griff in die Seele des Knaben. Er weinte sanft und still fortan um das entschwundene Brüderlein.
Fricke dichtete für das einfache Denkmal des Kleinen eine Grabschrift, in den damal geltenden unregelmäßigen Maaßen, die also anhub:
»Du welktest schon früh, noch unentwickelte Knospe,
Nahmst Kräfte zu herrlichen Tugenden mit in's Grab!«
und schloß mit den allzuschwermüthigen, aber mich stets unaussprechlich rührenden Worten:
»Was hilft es denn also, allhier mit Tagen und Sünden zu wuchern,
Und jener Ewigkeit unwerth zu sein!« –
So sollte denn doch ein Andenken an Fricke zurückbleiben in Sacro. »In Sacro!« möchte man fast lateinisch wiederholen, denn das Besitzthum war in uralter Zeit ein geweihetes Klostergut gewesen und als Solches ein Heiligthum, also ein Sacrum. Daher der Name.
Der liebenswürdige, freundliche Lehrer selbst aber verschwand bald auf immer von dort. Erst sollte es nur eine Besuchsreise bei seiner Familie gelten, aber daraus ward ein Ehebündniß und der Antritt jener Predigerstelle. Wohl mochte ihn das Nichtwiederkommen ahnen. Denn in der Morgenfrühe seiner Abreise hub er heißweinend den Knaben aus seinem Bettchen, setzte ihn liebkosend auf seine Kniee, und konnte sich nur kaum von dem nun auch bitterlich weinendem Kinde losreißen.
Bald darauf sahe Fritz die erste Leiche: seine schon bejahrte Wärterin. Sie war über Nacht unerwartet gestorben. Seine sinnige Mutter führte ihn zu der freundlich lächelnden Todten, und prägte ihm somit ein schönes Bild des letzen Schlafes in die weiche Seele.
Unlängst darauf ward er selbst sehr nahe durch einen furchtbaren Keichhusten an die Ausgangspforte des Erdenlebens geführt. Der aus Potsdam herbeigerufene Leibarzt des Königs sagte dem Grafen Schmettau im Vertrauen: »Der Kleine ist rettungslos verloren. Ich wiederhole meine Besuche nur noch, um die armen Aeltern nicht allzusehr zu erschrecken.« Dennoch gelang es eben ihm, ihnen das noch einzige Kind zu erhalten.
Während man die Krankheitsleiden des gefährdeten Knaben voll schmerzlicher Theilnahme beklagte, war ihm selbst – er kann sich jenes Zustandes noch deutlich genug, wenn gleich fast nur wie eines bedeutsamen Traumes, erinnern – bei weitem mehr wohl, als wehe, zu Muth. Man schaffte herbei, was sein Herz verlangte: Bilder und Bilderbücher und Farben und Pinsel, womit er die Kupferstiche und Holzschnitte – der kolorirten von solcher Gattung gab es damal nur ausnahmweis wenige – unbarmherzig anstrich, oder, wie man's mildernd zu benennen pflegte, illuminirte. (Voll eines Anfluges kritischer Ahnung benannte das eine Kinderwärterin: »Lümmeliren.«) Seltsamlicherweise verlangte dabei das krankende Kind nach einem gewissen, oder vielmehr sehr ungewissem »alten Buche,« was er eben nicht näher zu bezeichnen wußte. Ihm schwebte dabei ein Bild vor, wo eine Frau hoch auf eines kegelförmigen Berges Gipfel saß. Zu beiden Seiten unten standen zwei langbärtige Mannsgestalten, und schaueten nach ihr hinauf: ob als ihre Wächter, ob als ihre Verfolger, ob als sie Anbetende? – Wahrscheinlich das Letztere, denn es mochte wohl ein katholisches Andachtsbuch gewesen sein, eine Heilige auf dem Titelblatt illustrirend, und wer weiß wie! eben unter die weibliche Dienerschaft nach Sacro gerathen. Denn dort hatte es der Knabe früher gesehen. Aber Fritz knüpfte daran seltsamlich romantische Träume, wie etwa an jenes Kapitelbild in der Brandenburger Kinderstube, und wollte sie nun im fiebrigen Zustande entziffern. Unter der dunkeln Rubrik: »Altes Buch« ward ihm Vieles zugetragen, sein Begehr zu stillen. Unter Anderm auch eine gute alte Ausgabe von »Reynicke de Voß,« deren Holzschnitte er dann wiederum rastlos illuminirte, und sie noch in dieser Entstellung vor sich hat. Aber das rechte »alte Buch« war es nicht. Das wußte er wohl. Und es fand sich auch nicht. –
Oder war es mit dem rechten, echten alten Buche vielleicht überhaupt nur eine Vision, die sich durch andere alte Bücher bei dem nachher aufgesproßtem Jüngling und Mann wunderbar erfüllet hat? –
Eines gewiß war ein deutungsreicher Traum, und zwar noch aus den Brandenburger Erinnerungen herüber. Dort nämlich findet sich, wie in mehren alten Städten, ein Rolandsbild, und zwar das edelste, welches mir noch vor Augen gekommen ist. In riesengroßer, geharnischter Gestaltung, ganz gerade, die Schenkel zusammengestellt, gleich den alt-ägyptischen Bildsäulen, völlig geschwärzt durch Wind und Schnee und Sonne, das ungeheuer lange Schwerdt senkrecht emporgehalten, auf dem unbedeckten Haupt eine Mooskrone, oder vielmehr ein Moosbarett, die Gesichtszüge feierlich, seltsam, eigenthümlich, ohne Künstelei, aber sorgfältig festgehalten, daß man dabei versucht wird, an Porträt-Aehnlichkeit zu denken, – so steht der Roland vor dem Brandenburger Rathhause da, und so war er eingeprägt in des Knaben Geist. In einer Krankheitsnacht sah ihn Fritz also vor seinem Bette stehen, keineswegs unfreundlich, aber angestrengt willens, das ungeheure Schwerdt in des Kindes Hand zu geben. Und Fritz ächzte bangend: »Ach du großer Roland, laß ab von mir! Dein riesengroßes Schwerdt zu tragen, bin ich ja noch viel zu klein.«
Die Umstehenden hatten's gehört, und haben's nachher mir vielfach wiedererzählt. Hätt' es aber auch Niemand vernommen oder neuberichtet: Was ich in jenem Traum, und in manchem seinesgleichen auch, vernommen habe, weiß ich unvertilgbar gewiß, ohne es doch, versteht sich, eben für mehr ausgeben zu wollen, als für Geträum. Doch wird Aehnliches oftmal wiederum auftauchen in diesen Erinnerungen, weil sie außerdem Wesentliches einbüssen müßten an ihrer eigenthümlichen Färbung. –
Jedenfalls muß die Lust des genesenden Knaben an den Waffen sich mannigfach deutlich verkündet haben, denn sein hülfreicher Arzt, der oberwähnte Hofmedikus Fraise, – gleichfalls vom Stamme der Réfugiés, – ihn während der Behandlung, sehr liebgewinnend, schenkte ihm einst einen tartarischen Pfeil von einer Reise zur Heilung des Tartar-Chans auf des Königs Befehl nach Asien, zurückgebracht. Fritz war entzückt über die schlanke, buntgefiederte, schöne Rohrwaffe mit eckig geformter Stahlspitze, die sich vor seiner Phantasie zur Ritterlanze gestaltete, und deren Trümmer er annoch aufbewahrt. Aber Leid keimt oft aus Freude in dieser Welt, und er sollte es auch hieran früh erfahren. Seinem dringenden Begehr nach hob man ihn aus dem Bett auf sein kleines braunes Wiegenpferd, und gab ihm den geträumten Heldenspeer in die rechte Hand. Aber wie sorgfältig man den kleinen Holzgaul auch in nur leise Bewegung bringen mochte, und den kleinen ermatteten Reiter unterstützte, dessen leibliche Entkräftung – vielleicht auch dessen phantastische Anregung mit – war zu gewaltig, um in dem Tartarenpfeil ihm nicht einen allzugewichtigen Riesenspeer erscheinen zu lassen, in dem Wiegengaul ein allzumächtiges Kampfroß. Nach wenigen Schwingungen wandelte es ihn wie Ohnmacht an, und man mußte ihn ins Bette zurücktragen, den über seine Schwäche schmerzlich Weinenden. –
Gefühl der Unzulänglichkeit ist aber nicht jedesmal Schwäche. Vielmehr ist es oftmal Anklang neu erwachender Kraft. Und so just war es auch hier.
Bald nachher war Fritz vollkommen wieder hergestellt, und saß bei einem heiteren Festmahl am Oberende der Tafel, seinem sonst gebührenden Kinderplätzchen entgegengestellt, mit einem breiten glänzenden Atlasbande über die Schulder, einem Ordensbande ähnlich, auf welchem der billig triumphirende Freund Fraise einige Jubelverse hatte abdrucken lassen. Doch ist dem an jenem Feiertage zum Erstenmal besungenen Fritz davon gar nichts im Gedächtniß verblieben, als eben nur das farbige Band. –
Einige Zeit nach der vollen Genesung waren die gewissenhaften Aeltern auf einen neuen Hauslehrer bedacht. Auch der kam von der Hallischen Universität, und auch er war ein wackrer, treuer, gewissenhafter junger Mann, – sonst aber in allen Dingen ein herber Gegensatz von Fricke. Vieles hat ihm sein Zögling zu danken, Vieles hat er seinem Zögling geschadet. Ohne tüchtige Einwirkung auf den Sinn jedes Menschen, mit welchem er in Berührung gerieth, konnte seine kraftvolle Natur durchaus nicht bleiben. Sachse hieß er, und war aus Westphalen gebürtig: ein echter Altsachs oder Altsasse, in mannigfachen Seltsamkeiten und sehr vielen Tugenden an die Urväter mahnend. Der erste Eindruck war eben kein besonders günstiger, und ging durch die Vermittelung jenes obangedeuteten Fernrohrs. Man hatte nämlich den Ankommenden genau mit der in Potsdam eintreffenden Post erwarten können, sah also nach ihm aus, wie er etwa den behaglichen Gang nach dem nahen Landgut heranspazieren mochte. Endlich hieß es bei den abwechselnd durch das Fernrohr Blickenden: »der neue Hofmeister kommt!« Fritz eilte hin, und die Reihe kam billig bald an ihn. Nun aber kam es ihm vor, als ob an dem warmen Sommerabend der Erwartete mit einer Pelzmütze auf dem Kopf einhergehe, und ein unauslöschliches Gelächter, beinahe dem der Homerischen Götter vergleichbar, ergriff und erschütterte den Knaben. Im Näherkommen ergab sich's nachher: die vermeintliche Mütze war nur das nach damaliger Sitte wohlpomadirte und gepuderte Haar des Kandidaten gewesen, der, eben des warmen Wetters wegen, mit abgenommenem Hute baarhaupt am Ufer heranwandelte, die Kühlung des Stromduftes zu genießen. Der Gedanke an Wunderlichkeit hatte sich indessen einmal mit dem Bilde des neuen Lehrers verwoben, und zwar, wie schon angedeutet, aller Tüchtigkeit des Mannes unerachtet, hätte Schillers Wachtmeister, wär' er damals vorhanden gewesen, dazu sprechen können: »Dem ist nicht Ohne.«
Bevor jedoch Fritz mit seinem jetzigen Lehrer in die vielfach auf sein Leben einflußreiche nächste Bekanntschaft gerieth, nahmen den Knaben seine Eltern mit auf eine Badereise nach Lauchstädt, während der kaum erst angekommene Lehrer in Sacro zurückblieb.
Lauchstädt mit seinem heitern, damals sehr besuchten Baumgange und seinem hohen, von Gästen wimmelndem Tanz- und Speisesaal hat manchen lebendigen Eindruck in die Seele des Knaben gelegt und in ihr hinterlassen, wie sich denn auch dieser Badeort bei später widerholtem Besuch des Jünglings und Mannes ihm jegliches Mal eigenthümlich bedeutsam erwies.
Zum ersten Mal ahnete damals die junge Seele das Anziehende einer edel-weiblichen Erscheinung. Ein anmuthig blühendes Fräulein war es, die den knospenden Troubadour mit magischer Gewalt, natürlich höchst unbewußt, an sich zog, wozu denn eben wohl auch bei dem auf Wunderbares gern gestelltem Kinde ihre fast magisch zu nennende periodische Stummheit mit beitrug, sie jedesmal um eine bestimmte Abendstunde – ich meine: um 7 Uhr – befallend, und bis zur nächsten Frühstunde anhaltend. Weder ihre Jugendblüthe litt darunter, noch ihre Jugendlust am Tanz, worin sie höchst anmuthig einherschwebte. Auch fehlte es der plötzlich Erstummenden nie an den edelsten und zierlichsten Tanzgenossen. Ein schöner preußischer Husarenoffizier in glänzender Uniform zeichnete sich unter diesen und überhaupt als der wunderbaren Dame entschiedener Verehrer aus. Wie nun der kleine Fritz ihr immer auf allen Schritten und Tritten nachging, sagte einstmal ein Jemand – weiß ich's, wer es war? – »Du Fritz, nimm dich in Acht vor dem preußischen Husaren! der wird dich herausfordern, wenn du seiner Dame so nachfolgst.« – Fritz nahm das Ding ernsthaft genug, wie es denn eigentlich überhaupt, bei aller Fröhlichkeit, vielleicht auch mitunter einem scheinbarlichen Flattersinn, seine Weise war, die Dinge ernsthaft zu nehmen. Aber just erschreckt fand er sich von der Warnung nicht, minder noch abgeschreckt von seinem Nachwandern der schönen Dorette. Vielmehr gewann jetzt erst für den kindischen Ritter das ganze Verhältniß – wenn man's ein solches nennen darf und will – einen ganz eigenthümlichen Reiz durch den bedrohlichen Husaren im Hintergrunde des magisch verstummenden Engels. Wir kommen noch späterhin auf diese Erinnerung zurück. –
Eine andere seltsame Anregung gab es, als Fritz mit einem geliebten Gespielen und Altersgenossen einen damal dort vorhandenen sogenannten Irrgarten betrat, eine buschige Pflanzung, absichtlich so angelegt, daß sie das Wiederherausfinden dem Unkundigen erschwerte. Der Freund wußte Bescheid darin, führte ihn aber mit harmloser Neckerei in die verfänglichen Pfade immer tiefer hinein, endlich sprechend: »Nun, Fritz, wie kommen wir wieder hinaus?« – Vergeblich suchte Fritz nach dem Rückweg. Eine wunderliche Angst bemächtigte sich seiner, und als nun vollends ein leichter Sprühregen vom Himmel zu tröpfeln begann, kam über ihn voll unaussprechlicher Wehmuth der Gedanke: »Zwei verirrte Kinder im Walde, weitab von den Ihrigen, und ein Unwetter ereilt sie!« Es war von keinem Walde die Rede, denn durch ein leichtes Gehege an der Irrgarten-Gränze hätte man leicht ins nahe Feld gelangen können, und somit unbedenklich nach Lauchstädt zurück. Aber das wehmüthige Bild in ihm war stärker, als die Wirklichkeit. Er fing an bitterlich zu weinen, so daß sein lachender Gefährte nur eilen mußte, ihn die paar Schritte wiederum zurückzuführen in die lustige Umgebung der Badegesellschaft.
Furcht war's nicht gewesen. Aber Phantasterei, wenn man's etwa so nennen will. Namentlich die Ahnung eines unaussprechlich trüben Verlassen-Seins, welche sich durch das gesammte Dichterleben dieses Menschen hinzog, und sich nur allzu oft darin auf das allerschmerzlichste erfüllt hat.
Aber auch just in Lauchstädt wiederum trug ihn die Phantasie auf seegenvollsten Ahuungs-Schwingen empor.
Wenn ihn, den an die schönen Räumlichkeiten von Sacro Gewöhnten, die ungewohnt enge Badewohnung bei ungünstigem Wetter zu pressen begann, erschien ihm ein anmuthiges Traumspiel im Wachen, endlos und unermüdlich dasselbe. Und die gütige Mutter spielte unermüdlich das kleine Drama, in welchem es dargestellt ward, mit ihm durch, aber und abermal, und meist wohl ganz unverändert mit denselben Worten. Es ward nämlich angenommen, Fritz sei als Erwachsener wiederum mit der Mutter in Lauchstädt. (Ach, die holde Frau sollte es nicht erleben, den Liebling ihres Herzens erwachsen zu erblicken!) Nun handelte sich's im Spiel-Drama von der wichtigen Frage für den jungen Herrn: Heut nach der sogenannten Allee (dem Sammelplatze der Badegesellschaft) gehn, oder nicht? Selbiger bezeigte zu Anfang wenig Lust dazu. Die Mutter aber regte ihn an, und dann ging er, – nämlich »ab«, wie auf der Bühne, – um gleich wieder aufzutreten, und zu versichern, er danke dem Mütterchen unaussprechlich, ihn nach der Allee dirigirt zu haben, denn dort seien eben heut die zwei Dichterbrüder Stolberg lustwandeln gegangen, und er habe sie nun kennen lernen, und sehr Vieles mit ihnen gesprochen, und er sei ihnen lieb. Die Freude, ja, ich mag wohl sagen: das Entzücken, die Seele des spielenden Knaben dabei durchwallend, war ein Vorspiel schöner Wirklichkeit, wie wir sie für seine Mannesjahre zu schildern gedenken.
Dem Bade-Aufenthalt folgte noch ein kurzer Besuch in Halle bei einer nahverwandten Familie, wo Fritz im Umgang mit seinen Vettern sehr fröhliche Tage verlebte. Jener kleine Irrgarten-Führer war ihm der liebste darunter, und die brüderlichste Innigkeit fand und findet noch jetzt, da beider Locken ergrauen, zwischen ihnen statt. Es ist etwas Herrliches um liebevolle Treue, so durch ein halb Jahrhundert fast unter allen abwechselnden Stürmen und Strömungen des Geschickes, nach dezennienlanger Trennung stets wiederum aufleuchtend in jugendlicher Frische, – ein schönes Wort Christian Stolbergs anzuwenden: »immer alt, und immer neu.« Von dem frühesten Freunde zum ersten Mal geschieden, empfand Fritz eine tiefe Sehnsucht nach ihm, die sich oft in dem grilligen Gedanken aussprach: »Der Karl ist doch ein recht glücklicher Knabe; er ist immer in seiner eignen Gesellschaft.« – Eigentlich war's doch weit mehr, weil Tieferes, damit, als blos grillig. Es steckt eine ernste Ahnung drin eingeschachtelt, oder eingesenkt vielmehr, die jedoch mit raschen Worten an's Licht rufen zu wollen, mir eben so unangemessen vorkommt, als eine Knospe auseinander zu reißen, um ihre Entfaltung zu beschleunigen. – Ueberhaupt nahm Fritz aus Halle manche schöne Erinnerung mit, kindischer Art, wenn man so will, aber gleichfalls tiefer bedeutsam, als es auf den ersten Anblick aussehn mag.
Obenan steht ein Ritterharnisch, im Naturalienkabinet des Waisenhauses aufbewahrt, drüber an der Wand ein großes zweihandiges Schwerdt. Dergleichen, wie der Knab' es bisher nur in Abbildungen und in Träumen erschaut hatte, nun auf einmal wahr und leibhafteg vor sich zu sehn! Ein wirkliches Gewaffen, in welchem einst ein kühner Leib gewaltet hatte, hervorgeschauet aus diesem Visier ein Ritterangesicht! Es war, als ob jene Zeit, dem Knaben aus seinen frühesten Ahnungen her so ehrwürdig und so anziehend, nun plötzlich in Geistergestalt aufgestiegen sei, wie des Dänenkönigs Hamlet Erscheinung vor den staunenden Wächtern seiner Burg. Und doch war wiederum Alles dabei so wirklich, so leiblich. Er durfte des Eisenhandschuh's gelenkige Schuppenfinger berühren, wie zum Handschlag. O, des Ueberglücklichen! Um ein halb Jahrhundert später hat der alternde Mann diesen Handschlag wiederholt, und im heitern Bewußtsein empfunden, er habe sich wegen der Zwischenzeit Gott Lob nicht zu scheuen vor dem alten Eisenmanne.
Zugleich noch andre Waffen enthält jene Sammlung, durch die Missionare eingesandt von den heidnischen Völkern her, und Fritz hatte, nächst jenem ritterlichen Gewaffen, seine innige Freude daran, wie auch an einem großen, sorgfältig ausgeführten Modell des Tempels zu Jerusalem, und andern Herrlichkeiten mehr. Auch das Wunder der Buchdruckerkunst, für dessen Jubiläum er jetzt, diese Zeilen schreibend, Feierdichtungen zu liefern sich aufgefordert sieht, erschien ihm auf dem Hallischen Waisenhause zum ersten Male. Lettern wurden gesetzt, Druckerschwärze darauf getüpft, Papier drüber hingelegt, die Rahmen drüber geschlagen, die Presse angewandt, und heraus zog man auf einem saubern Groß-Octavblatt Fritzens und seiner Vettern Namen. Dem Staunenden konnte nicht entfernt träumen, wie oft noch künftighin die Presse seinen Namen vervielfältigen sollte. Ueberhaupt haben Gutenberg und seine nächsten Genossen keinen eifrigern Bewunderer unter ihren Mitlebenden gehabt, als diesen so spät nach ihnen aufgewachsenen Knaben. Wie viel des Gedruckten auch er schon verhältnißmäßig gelesen hatte, – es vor seinen Augen so rasch unmittelbar aufgesproßt zu sehn, und etwas so Geringes, wie sein Name, so willkürlich illustrirt, – es übertraf all seine Erwartung. Ueberhaupt hatte in seinem Andenken die Saalstadt etwas Magisches gewonnen, wozu die dazumal noch sehr eigenthümlichen Halloren, zu raschen Sprüngen von den Brücken stets bereit, mit das ihrige beitrugen, wie auch selbst die kleinen Wehr-Abstürze des Stroms, desgleichen die breitstille Havel dem Knaben nie dargeboten hatte.
Wie jedoch ihm das Ritter-Gewaffen allen Merkwürdigkeiten der Waisenhaus-Sammlung voranging, ging auch voran in seinem Geist allen sonstigen dort so mannigfach schönen Naturansichten, der Fels von Burg Giebichenstein, gekrönt durch den Trümmer-Fensterbogen, aus welchem Graf Ludwig von Thüringen sich zum Freiheit-rettenden Sprung in die Stromfluth kühn hinunterschwang. Wie von ganz unermeßlicher Tiefe schien dem Knaben der Blick dahinunter. Als er späterhin die Schilderung einer schwindlig hohen, wolkennahen Meeresklippe in Shakespears Lear las, kam es ihm vor, als habe er solch einen Blick schon von dem Giebichensteiner Felsen hinabgethan. Dort auch zeigten sich Eingänge zu unterirdischen Gewölben, und ob die neuere Zeit sie in geringer Tiefe durch ein Vermauern gesperrt hatte, drang doch des Knaben Sinn ahnungskräftig da hindurch in die geheimnißreichen Wundersamlichkeiten der Unterwelt hinein, so wie er sich auch emporschwang über die wohl schon vorlängst zerfallenen Stiegen des verschlossenen, einsam stehen gebliebenen Burgthurmes, um auch dort nach Mysterien zu forschen. So völlig ergriffen von dergleichen war der kleine Träumer, daß ihm, da ihn andre Kinder freundlich einluden, mit in den ganz regelrecht zierlichen Garten hinter dem Amtshause zu kommen, es schier unheimlich zu Sinne werden wollte, als laure eben hinter diesen geschornen Hecken und Lauben irgend etwas ganz unheimlich Arges. Nur mit innrem Widerstreben folgte er, ohne dann freilich irgend was Andres anzutreffen und zu erleben, als ganz gewöhnliche Dinge. Aber droben zwischen den Burgtrümmern war ihm freier zu Sinne gewesen. –
Heimgekehrt nach Sacro war es nun ähnlichermaaßen ein engeres Leben und Weben, was ihn in Empfang nahmen sollte statt jener rückwärts liegenden, obgleich noch stets ihn innerlich geleitenden Bilder aus Lauchstädt und Halle her. Die Lehrstunden bei Herrn Sachse begannen, eigentlich die ersten überhaupt für Fritz. Denn was er früher bei Fricke erlernt haben mochte, war eben nur so ein heitres Spiel gewesen. Sachse nahm Alles, was er trieb, gründlich, kraftvoll, ernst, oft an den Eigensinn streifend, und war dabei, noch außer seiner Gewandtheit im Clavierspiel und Zeichnen, mit vielfach technischer Geschicklichkeit begabt. Ein Geist, wie der seinige, kannte eigentlich kein Feiern. War das eine Schaffen beendet, so kam unmittelbar darauf ein Andres an die Reihe. Den Vormittag nahmen die Lehrstunden von 9 Uhr an bis zur Tischzeit in Anspruch, aber Sachse wußte sich durch überaus frühes Aufstehen einen sehr langen Vormorgen zu bereiten. Nachmittags wollten die Eltern des Knaben aus Grundsatz keine Lernstunden für ihn, und es mochte auch wohl in mancher Hinsicht gut sein. Mit unaussprechlicher Heiterkeit sahe Fritz, wenn nun die Unterrichtszeit vorüber war, das freie Paradies eines ganzen Nachmittags und Abends vor sich liegen. Von Langeweil wußte seine, durch jene schon obangedeutete Phantasieenwelt belebte Seele absolut nichts, so lange man ihn ungehemmt seinen Spielen überließ.
Ob indeß nicht durch eine so ganz und gar bestimmte Abgränzung zwischen Lernen und Spielen eine gewisse Scheu vor dem Lernen, also vor der Arbeit, vor der Anstrengung überhaupt, in die kindliche Seele kam? –
Eine Stimmung etwa, welche man der eines nur stundenweis im Frohn geplagten, und dann zu seiner nothwendigen Erquickung wieder dem freien Athmen überlassenen Sclaven vergleichen möchte? –
Das ist eine andre Frage. –
Mögen Erzieher und überhaupt Seelenkundige und Seelenkündiger sie prüfen. –
Hier stehe sie nur einstweilen als Aufgabe. –
Der Leser gönne dem Schreiber immer noch einiges Verweilen in den Blumengärten der Kindheit.
Schauen doch ernste Lichtblicke und Wolkenzüge mit herein.
Auch eine gewaltige Helden-Gestaltung sieht mit herein.
Ich meine den Pathen des kleinen Fritz: den großen König Friedrich.
Nur von Weitem her freilich hat ihn der Knabe gesehn, wenn beim alljährlichen Einrücken der Berliner Garnison zum Uebungslager um Potsdam die Mutter mit ihm hinausfuhr, die kriegerische Herrlichkeit anzusehn, der Knabe ganz Auge und Ohr für die ihn unaussprechlich anziehende Waffenlust, aber von einem geheimnißreichen Schauer ergriffen, wenn König Friedrich in einiger Entfernung an dem Wagen vorüberritt. Die Mutter stand alsdann, nach damalig ehrerbietiger Sitte, von ihrem Sitz auf, und neigte sich tief, beinahe kniebeugend. König Friedrich, wie er es immer vor Damen zu thun pflegte nach galanter Ritter-Sitte, zog den Hut, ihn dabei etwas seitwärts in die Höhe hebend, just wie man ihn auf manchen noch übrig gebliebenen Gemälden abzubilden pflegt.
Für die ganze Gestalt aber – der kleine, alternd vornübergebeugte Mann, auf seinem hohen engländischen Roß, und dennoch just in dieser Eigenthümlichkeit so wunderbar imposant, – giebt es nichts Aehnlicheres, als jene kleinen Reiterbildsäulen aus Gyps, wie man sie noch jetzt zu verkaufen pflegt und kaufen wird, so lange preußische Herzen schlagen, welches, hoff' ich zuversichtlich, eben so viel heißt, als: bis an das Ende der Zeiten. –
Auch in des Knaben Fritz phantastischen Spielen waltete stets ein preußisches Element. Mehrst freilich athmete er in der Ritterzeit, oft aber auch erschien er sich als preußischer Husar. Hatten ihn ja doch Anschauungen preußischer Schaaren und ihrer Kriegs-Uebungen, nebst den Erzählungen Schmettaus, der den ganzen siebenjährigen Krieg durchgefochten hatte, das mehrst um kriegerische Gegenstände kreisende Gespräch der häufig aus Pots dam zum Besuch kommenden Offiziere, wie auch die Berichte seines Vaters von dem großväterlichen Helden, dessen fast lebensgroßes Kniestück, ein schönes Oelgemälde des Meister Paine, von der heimathlichen Wand zu dem Enkel herniedersah, – hatten ihn ja doch alle diese Eindrücke zumal schon wie zu einem Mitgliede des preußischen Heeres eingeweihet. Auch mit einem gut gearbeitetem kleinen Gewehr, den Kräften des Knaben angemessen, ward unter Schmettau's Leitung das preußische Infanterie-Exerzitium geschickt genug, und jedenfalls sehr eifrig, eingelernt.
Aber das Ritterthum blieb die Hauptsache.
Eine eigenthümliche Vermischung beider Anregungen – Idee und Realität zusammendrängend – zeigte sich in einem Ritterbunde, welchen Fritz mit einem um wenige Jahre ältern Knaben, des Vornamens Rudolf, schloß, dem Sohn eines wackern Garde-du-Corps-Offiziers. Den Orden des Rothen Löwen nannten sie ihr Institut, welches alle möglichen Rittertugenden fördern sollte, und worin etwas gar mystisch Tiefes geahnet ward. Einstweilen beschränkte sich die Genossenschaft noch auf Fritz und Rudolf. Durch nach und nach anzuwerbende Gefährten sollte sich's indeß weiter und weiter ausbreiten, und fürderbestehen durch die Jünglings- und Mannes-Jahre zu ungeheuern Erfolgen hinaus. Namentlich war Fritz auf die Eroberung von Italien bedacht, welche er denn freilich späterhin sich gezwungen sah, an Napoleon Bonaparte abzutreten. Sein Genoß, ein gar frischer Knabe, hielt sich näher an die Wirklichkeit mit seinen Entwürfen. Dagegen überflügelte er den Fritz durch den sich beigelegten Ordensnamen: »Graf Don Fiesko der Unüberwindliche,« während sich Jener einfacher benannte: »Malwend der Tapfere,« den Eigennamen aus Klopstocks: »Hermann und die Fürsten« aufgefaßt habend. »Warum nicht Hermann?« fragt vielleicht Jemand in freundlicher Theilnahme. Zur Antwort: Weil der Knabe überhaupt eine vorzügliche Anregung für solche Namen empfand, die eigenthümlich waren, germanisch, aber noch nicht im leuchtenden Ruhmesglanz funkelnd, eben wohl, damit der jungen Seele was von künftiger Herrlichkeit zu ahnen und zu ersinnen bleibe. Im Uebrigen blieben sowohl der unüberwindliche Graf Don Fiesko, als der tapfre Malwend, mit ihren Verdiensten im Stillen, der Orden vom Rothen Löwen desgleichen, und es fanden sich keine weitere Theilhaber dazu. Aber Fritz und Rudolf blieben befreundet für ihre ganze Lebensbahn, wo dann die Freunde als Jünglinge auch Gelegenheit fanden, sich ritterlich mitsammen vor dem Feinde zu erprüfen. Rudolf ist nun schon längst in die Ewigkeit vorangegangen dem Fritz, und dieser hofft, ihm dereinst voll seeliger Heiterkeit nachzukommen. –
Das gesammte ritterliche und kriegerische Getriebe seines Zöglings war dem wackern Lehrer Sachse eigentlich entgegen, dem System seiner Aufklärung nach, zusagend indeß zu gleicher Zeit auch seinem eignen entschlossen kühnem Sinne, dem zufolge er sich unter Andrem gern an das Reiten wilder Pferde gab, welche zwei Pagen des Prinzen von Preußen, dem Hause befreundet, bisweilen mit aus Potsdam herausbrachten. Die überkecken Jünglinge hatten ihren Spaß daran, den des Reitens keinesweges kundigen Kandidaten sich auf den tollen Gäulen umhertummeln zu sehn. Er merkte das wohl, aber er ließ nicht davon ab, denn er wollte sich in allen Dingen gern selbst erproben, und setzte sich durch seine Kühnheit bei den zwei jungen Edelknaben in Respekt, während eine höhere Hand über ihm waltete, daß er bei den mitunter halsbrechenden Späßen niemals auch nur im geringsten zu Schaden kam.
Auch konnte er sich nicht erwehren, aller systematischen Antiritterlichkeit zum Trotz, dem Fritz allerhand kunstreiches Gewaffen: aus Pappe, Silber- und Goldpapier, köstliche Helme, und aus Holz und Blech vortreffliche Ritterlanzen zu bereiten.
Keinem der festlichen Weihnachtstische fehlte es in diesen Jahren an irgend einer solchen Gabe von des Lehrers kunstreicher Hand für den dadurch innigst ergriffenen Zögling.
Ach, und diese Weihnachtsabende überhaupt! Dies süße, sehnsüchtige, zuversichtliche Harren, den ganzen Tag hindurch, auf die abendliche Bescheerung, sich zum Entzücken steigernd, wann nun mit einbrechender Dämmerung die Kinder in ein entfernteres Zimmer geführt wurden, wissend: jetzt beginnen Eltern und Freunde, die Lichtertische mit dem grünen Festbaum, und der von zartester Liebe erlesenen Gaben aufzuputzen! – Und endlich, nach froher Erwartungen jubelnd schwellender Steigerung, die helle Silberschelle in der Mutter Hand klingelnd: »Herein!« – Und nun die Gaben wie schwimmend im Lichtmeer, Eine nach der Andern durchgemustert, Jedwede eine neuselige Entdeckung, theilnehmend verglichen mit den Herrlichkeiten der Genossen, wir Alle Ein gemüthlicher Jubelchor ohne Dissonanz! Und aufsteigend vor den kindlichen Geistern die kommenden Stunden des Spieles mit diesen leuchtenden Spenden allzumal! –
Wahrlich, es giebt annoch paradiesische Stunden im Leben, wenngleich nur aufleuchtend als Oasen in stäubiger Wüste, oder als Inseln im brandenden Meer.
Durch Brandung geht's zur Landung.
Das erfahren auch die Kinder bereits, wenn freilich nur auf kindische Weise.
Phantastischen Bürschlein, wie Fritz, ergeht es absonderlich merkbar in dieser Manier.
So fand er in Einem jener etwa sechzehnjährigen beiden Pagen Aehnlichkeit mit dem schönen Husarenoffizier von Lauchstädt her, dem Ritter der holden Dorette, und setzte sich' nach und nach in den Kopf, Das sei Einer und Derselbe, nur jetzt in Pagenverkleidung. Die Identität kam ihm bedenklich vor, denn man konnte nicht wissen, ob der Eifersüchtige sich nicht just auf diese Manier in Sacro eingeschlichen habe, um die am Badeort beabsichtigte Ausforderung zu Stande zu bringen. Der Knabe fühlte sich übrigens zu dem anmuthig muntern Pagen ausnehmend hingezogen, und doch wollte die Grille nicht schweigen: »Wenn es nun aber dennoch der Husar wäre!« –
Man urtheile demzufolge, wie seltsamlich ihm zu Sinne ward, als ihm eines Tages der Page, zum Mittagsessen eingeladen, gleich nach seinem Eintreffen, heimlich sagte: »Komm einmal herunter mit mir, Fritz, in die Grotte.« (So hieß ein Eintrittszimmer, seiner Wandmalerei wegen.) »Ich habe dir was allein zu sagen.« Fritz sah ihn groß an und stutzte, wenig Lust bezeigend zu dem verfänglichen Gange. Als aber der Page nicht abließ, dachte der kleine Wünderling bei sich: »Ei, sei es meinethalb der Husar, und komme was da kommen mag! Einmal doch muß das Ding ausgemacht werden!« – Und so ging er kecken Schrittes mit hinunter zu dem »Stell-dich- ein.« – Einen Zweikampf zwar gab es nun nicht in der Grotte, wohl aber eine Waffe: einen ausnehmend hübschen kleinen Hirschfänger zum Geschenk, mit wirklicher Stahlklinge, worauf ein Pandur eingegraben war, mit der zwar nicht sonderlich weder orthographisch, noch poetisch gerathenen Inschrift:
»Ich halte Graffetät, (Gravität)
Marschire Schritt vor Schritt.
Komm ich vor meinen Feind,
So mach ich einen Schnitt.«
Aber Fritz war entzückt, und das nur ihm bekannte Bewußtsein, er sei dem erwarteten Kampfe mit ehrbarem Entschluß entgegengegangen, erhöhete den Werth der Gabe. Er hat nachher als Mann die kleine Waffe an das Söhnchen eines kühnen Waffenbruders verschenkt, und sie kam gewiß in gute Hand. Dennoch hätte er sie wohl lieber aufbewahren sollen. Das Andenken war doch allzueigenthümlich, um es wegzugeben. Jenen auf so wunderliche Weise vermeinten Gegner indeß, den Husaren, hat er nachher als Preußischen General wiedergesehen, und ihm, er selbst Cavallerie- Major, seine früheste Zweikampfsahnung zu beiderseitigem Ergötzen bekannt. –
Ueberhaupt zieht sich durch all seine Kindheitserinnerungen, so heiter, ja fröhlich meist ihr Vorgrund sich darzustellen pflegt, im Hintergrund irgend ein Schatten düstrer Besorgniß vor etwas Feindlichem oder Unheimlichem, welches Gefühl er, der sonst so offenherzige Knabe, sorgfältig vor allen, auch den liebsten Menschen verborgen hielt. Mag sein, daß er sich seiner kindischen Träumereien, und zwar nicht unbillig, schämte. Doch am wesentlichsten zum Schweigen verband, ja gleichsam verpflichtete ihn ein schauerliches Gefühl der Abhängigkeit von unheimlichen Gewalten, deren Rache er sich aussetzen würde, wenn er sie an das Tageslicht zöge. So, wenn ihn die liebevolle Mutter beim Schlafengehn sorgfältig auszog und zu Bett legte, entrang sich oftmal ein banger Seufzer seiner Brust, und wenn ihn dann die Mutter liebkosend fragte: »fehlt dir was, lieber Fritz?« »Ach, sage doch nur, was dir fehlt!« mußte er antworten: »o, gar nichts!« während er in sich voll schmerzlichster Wehmuth dachte: »Wenn du es wüßtest! Aber auch dann ja könntest du mir nicht helfen.« – Das hätte dann freilich die gütige Mutter mit all ihrer Sorglichkeit nichtvermocht. Wer bannet die Träume? Und hier waren es Träume allerverwunderlichster Gattung. Nicht mehr jener riesenhohe Roland aus Brandenburg mit seiner allzugewichtigen Schwerdtesgabe erschien. Winzigklein, wie er in der doch so vorlängst schon beiseit gelegten Bilderfibel zu sehn war, stieg König Xerxes auf, oder es kamen auch zwei moderne Wildfänge, bei Wein und Spiel erzürnt die Degen auf einander zückend, wie sie ein Taschenkalender zur moralischen Warnung dargestellt hatte, ebenfalls die Erscheinungen im kleinen Format geblieben. Und die allzumal wollten ein gewisses geisterhaftes Anrecht auf den Knaben geltend machen, und das ihm recht Entsetzlichste dabei war eben ihre schauerliche Kleinheit. Eine Zeitlang fast allnächtlich kamen diese Traumgesichte wieder, fast ohne alle Variation dieselben, und just um ihrer Einförmigkeit willen fürchterlich, weil ihnen eben das einen Anspruch auf die Realität der Erscheinungen des wachenden Zustandes zu verleihen schien.
Aber noch weit ein wunderlicheres Grauen verfolgte den Knaben eine Zeitlang, selbst während des wachenden Zustandes. Ein Handwerker aus Potsdam – ich meine, es war ein Tapezierer – ward öfters im Hause zu Sacro beschäftigt, und gehörte zu jener Gattung von Leuten, welche späterher Callot-Hoffmann mit dem Beiworte: »skurril« bezeichnet hat. Eine lange, hagre Gestalt war es, mit seltsam scharfgezeichneten Gesichtszügen und insbesondere gar wunderlich in die Höhe gezogenen, ja fast gezerrten Augenbrauen. Ein Mensch, immer gern bereit, über Andere zu lachen, und eben so gern bereit, Andere über sich lachen zu lassen. Mir sind von jeher solche Leute grell zuwider gewesen, fast eben so schauerlich für mich, als Hanswurstgaukler und Wahnwitzige. Ein solcher umstreifender Hanswurst machte einstmalen seine Späße auf dem Vorplatze des Hauses in Sacro, und man meinte den muntern Knaben Fritz durch das Anschauen derselben recht zu ergötzen. Aber Fritz empfand statt der Lachlust nur eben ein ungeheures Grauen, just, wie vor einem gewissen Tollen, mit vom Feuer verkrüppelten Händen, der sich einige Zeit zuvor in den Garten geschlichen hatte, und, an einem Lavendelbeete sitzend, mit verwilderter Stimme an Einemfort sang: »Ich heiß' Meieran, und bewach' den Thymian!« –
Vor beiden Erscheinungen schauert noch jetzt meine Seele. –
Und wie nun jener Handwerker dem Knaben einen ähnlich abstoßenden Eindruck machte, steigerte sich das beinahe zum Entsetzen, als Jemand – ohne Zweifel es nur so ganz gewöhnlicher Weise hinwerfend – sagte: »Der Kerl ist ein Narr.«
Fortan nun schauderte Fritz zusammen, wo ihn jener Spaßvogel etwa flüchtig anredete, oder nur überhaupt in seine Nähe kam, und eben weil er das nie ganz vermeiden konnte, überkam ihn jenes Scheuen vor einem unheimlich mächtigen Anspruch an ihn mit Bezug auf jenen Menschen. Ihm fiel ein: »Wenn nun Der behaupten wollte, du gehörtest ihm als sein eignes Kind an, und man dürfte dich ihm nicht vorenthalten, und er führte dich von hinnen in den Kreis seiner gewiß eben so abscheulich närrischen Familie!« – Insbesondere kam ihm dabei vor die Seele, als ob nach jedem Mittagsessen der skurrile Hausvater spreche: »Nun laßt uns unser gewohntes Tänzchen halten!« und man hüpfe dann im Ringelreigen mit albernen Geberden und noch albernerem Gesinge um den kleinen Rundtisch her, und zwischen äffischen Gestalten der seiner edlen Umgebung abgerechtete Knabe gezwungen mit. –
Furchtbar erschien es ihm, wie nur irgend je seither eine Danteske Vision, vielleicht gar furchtbarer noch, eben der in dieser Verzerrung vorschlagenden Albernheit willen. Zwar sah er mit gesunden Sinnen ein, das Alles sei ganz undenklich, – aber das entsetzliche: »Wenn doch nun!« – und zwar unterstützt durch eine in solchen Anfechtungen erschrecklich zu nennende Obmacht der Phantasie über die andern Geisteskräfte, –
Meinst du, lieber Leser, – uns einmal einer etwas veralteten, aber doch keinesweges so gar verwerflichen Form der Anrede zu bedienen, – meinst du, lieber Leser, der Fritz sei dazumal durch all sein Geträum und in all seinem Geträum bereits verrückt gewesen, oder doch auf dem unrettbaren Wege dazu? –
Vielleicht hätte manch Einer dazumal eben so gemeint, hätte ihm der Knab' sein Geträum kund gegeben, wie er eben jetzt als greisender Mann im Begriff steht, es der ganzen Lesewelt kund zu geben. Und daß der Knabe zu jenem Vertrauen gegen Niemanden gelangen konnte, obgleich von liebreichen und ihn persönlich liebenden Menschen umgeben, sprach eher für den Fortschritt des Uebels, als für dessen Hemmung.
Da er nun jedoch weder damals, noch bis jetzt überhaupt in's Tollhaus gerathen ist, – was hielt und erhielt ihn denn? –
Leider war ihm das göttliche Heilmittel zur Heilung wider alles Weh dazumal in allzu kleinen und abgeklärten – man möchte sprechen, homöopathischen – Portionen gereicht worden, als daß es hinlänglich hätte zu wirken vermocht.
Ihm half einstweilen die Poesie.
Nicht nur allein in jenen obangedeuteten ahnungsvollen Spielen – eine Spielwelt möcht' ich es nennen, die Wirklichkeit gleichsam wie in zweiter Stimme, nach außenhin unhörbar, begleitend, – offenbarte sie sich ihm.
Auch kleine Erzählungen, ja Schauspiele, oder vielmehr Schauspielchen gab sie ihm ein, und gebot ihm, sie aufzuschreiben, was er dann, ob mit noch ziemlich ungeübtem Kiel, in freudigster Stimmung vollbrachte. Gewöhnlich handelte sich's von einem ritterlichen Wüstenleben, wohinein der Held jedesmal durch ein Verirrtsein gerathen war. Andere Mittel und Wege dazu wußte die kindische Phantasie nicht zu ermitteln, aber diese Art, in eine romantische Wunder-und Kampfeswelt überzugehn, schien ihm auch dergestalt plausibel, daß er bei später Fahrt durch einen großen Wald, Brand's Haide genannt, vernehmend, man habe sich verirrt, nichts minder erwartete, als man müsse sich nun dorten eine Hütte bauen, und somit Herrschaft und Dienerschaft fortan das Leben der von ihm mit stehender Bezeichnung so benannten: »Verirrten« beginnen.
Freilich mochte es wohl in der Brands-Haide Verirrte geben, und zwar Verirrte weit schlimmerer Art, als die von dem Knaben Geträumten. Denn die damals sehr dichte Waldung, an der sächsisch-preußischen Gränze gelegen, diente manchem Diebs- und Raubgesindel zum nach seiner Art bequemen Aufenthalt, und man wußte schreckliche Geschichten davon zu erzählen. Zum Durchreisen – unsere Besuche bei den Halleschen Freunden führten uns mehrmal diesen Gang – pflegte man sich zu bewaffnen, auch wohl, wann bei sinkendem Abend sich manchmal unheimlich im Forst irrende Lichter wahrnehmen ließen, absichtlich lautes Gespräch zu führen, um die Räuber durch die Meinung einer größern Anzahl von Reisenden vom Angriff abzuschrecken. Wir übernachteten alsdann auf dem sogenannten »Bergfrieden,« einem Gasthaus mitten in der verrufenen Haide, dessen Name schon für alte Fehdezeiten seine Bestimmung andeutete, den Wanderer zu beschirmen, und zweifelsohne damal eine gefreiete Burg gewesen war.
Alle diese Erinnerungen tauchten in Fritzens kleinen poetischen Gebilden wiederum zu mannigfacher Gestaltung auf.
Einstmal jedoch wollte er sich auch an ein Trauerspiel wagen, und Hölty's elegisch-gespenstige Ballade: »Adelstan und Röschen« sollte den Stoff dazu hergeben. Freilich eine wunderliche Gattung von tragischem Stoff. Auch sollte selbiger gewürzt werden durch einen Zweikampf und eine darauf folgende Fehde zwischen Adelstan und seinem ehemaligen Freunde, jetzt Rächer des verlassenen und gestorbenen Röschens, Ritter Gottfried. Bis zu Adelstans Verlassungssünde und Röschens Tod – beides inclusive – ward die Sache fürdergeführt, und endete mit folgendem Monolog Röschens, nachdem Adelstan, auf einem grünen Anger mit ihr lustwandelnd, sich davongemacht hatte, während sie unvorsichtiger Weise nach einer andern Seite hinsah:
»Siehe, mein Adelstan, diese schönen Blumen. – Wo bist du? – Adelstan! – Er wird wohl nur ein wenig nach einer andern Seite hin spaziert sein. – Adelstan! – Er hört nicht. – Adelstan! – Ach, er kommt nicht zurück. – Er ist entflohen! – Er hat mich verlassen! – Ach, ach, ach! – (Sie stirbt.)«
Weiter wollte nun aber das Trauerspiel nicht vorrücken. Denn die vorgehabten und eigentlich ersehntesten Zweikampfs- und Kriegesscenen ließen sich durchaus an jenes elegische Ende des flink sterbenden Röschens nicht anflicken. Vielleicht waltete doch schon eine Art poetischen Instinktes dabei vor.
Ein Trauerspiel: »Albrecht der Bär und Primislas,« auf die Sage gegründet, dieser Wendenkönig habe sich vor dem Anhaltischen Helden als Besiegter, selbst auf der Flucht noch kühn, den breiten Havelstrom eben hier mit seinem Roß durchschwimmend, gerettet, und nachher sich mit dem Sieger versöhnt, kam just nur zum scenischen Entwurf. Doch gewährte es auch so dem Knaben manche kühnfreudige Stunde.
Aber genug einstweilen vom kindischen Geträum. Herein leuchtete voll bedeutsamlicher Heiterkeit der öfter wiederholte Besuch zweier Königlicher Prinzen, der ältesten Söhne des damaligen Thronfolgers: Prinz Friedrich, jüngst verewigte Friedrich Wilhelm der Dritte, König von Preußen, und Prinz Ludwig, nachher in den Jünglingsjahren zum ausgezeichneten Reiteranführer gereift, aber dann allzufrüh an Krankheit dahingeschieden. Beide, obzwar um mehre Jahre älter als der Knabe Fritz, ließen sich doch, nach der dem Hohenzollerstamm eignen Leutseligkeit, gern mit dem kleinen Burschen ein, das kriegerisch muntere Gemüth in ihm anerkennend, und manche freudige Erinnerung ist ihm aus den damaligen Soldatenspielen zurückgeblieben. –
Nun aber mit dem Jahre 1786 steigen sehr feierliche Momente auf, deren Gewicht schon den neunjährigen Knaben voll unverlöschlichen Ernstes ergriff.
Des großen Königs Friedrich letzte Regierungsjahre bezeichnete eine gewisse strenge Waltung, die wohl eben aus der Ahnung seines nahenden Todes in ihm hervorgehen mochte. Denn ganz im Gegensatze zu solchen schwächlichen Geistern, welche in der Sterbensnähe vermeinen, durch Nachgiebigkeit und minderes Genaunehmen mit den Fehlern Anderer den Ruf der Milde zu hinterlassen, wohl gar auf diese Weise ihre Rechnung auszugleichen, dem höchsten Richter gegenüber, fühlte sich König Friedrich gewissenhaft angetrieben, dasjenige, welches ihm als Recht erschien, mit letzten Lebenskräften noch so fest zu stemmen, als irgend nur möglich. Viele seiner Unterthanen jedoch mißverstanden ihn in diesem Bestreben, und legten es als Härte des erkaltenden Greisenalters aus. Auf dem Landsitze zu Sacro durfte dergleichen wohl am mindesten laut werden, denn man wußte, wie sehr man den Hausherrn dadurch verletze, dessen Bewunderung für den großen König noch in der Erinnerung an des Monarchen huldreich treues Verhältniß zu seinem eigenen tapfern Vater gesteigert war. Tauchten also irgend selbst in Sacro Klagen auf, und ließ Gemurr sich vernehmen, so mochte es anderwärts viel trüber damit aussehen.
Jetzt jedoch, als im Jahre 1786 das Lebensende des Heldenkönigs näher und näher heranrückte, war bie allgemeine Stimmung unverkennbar umgewandelt, ja in einen Gegensatz übergegangen. Man fühlt nur zu oft hienieden erst, wann der Tod uns einen Menschen geraubt hat, was wir an dem Entschwundenen besaßen, so lange er bei uns war. Goethe sagt in dieser Beziehung humoristisch:
– –. »Ist er aber hernach gestorben,