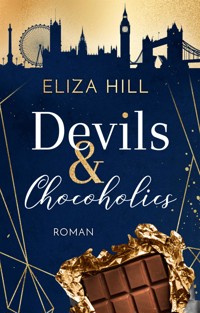4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vampirin Amy Dodge gibt sich gewöhnlich nicht so schnell geschlagen, aber gerade scheint wirklich gar nichts in ihrem "Leben" nach Plan zu laufen: Schlimm genug, dass sie ihren Exfreund mit einer anderen im Bett erwischt hat und dieser für eine horrende Summe aus der gemeinsamen Werbeagentur aussteigen will - ausgerechnet jetzt, wo der Vampirin die Steuerfahndung im Nacken sitzt. Auch die kleine Auszeit in Norwegen, die Amy wirklich bitter nötig hätte, entpuppt sich als reinste Katastrophe: Ihr Auto gibt in strömendem Regen irgendwo zwischen Fjord und Nirgendwo den Geist auf. Als schließlich ein attraktiver Fremder anhält und anbietet, Amy mitzunehmen, bleibt ihr nichts anderes übrig als zuzustimmen. Dabei weiß Amy vom ersten Moment an, dass sie den charmanten Devon Cooper und die Anziehungskraft, die er auf sie ausübt, nicht auch noch gebrauchen kann ... Mit "Lebensretter beißen nicht" gewann Eliza Hill den Wettbewerb von LYX Storyboard.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 619
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Widmung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Epilog
Die Autorin
Impressum
ELIZA HILL
Lebensretter beißen nicht
Roman
Zu diesem Buch
Vampirin Amy Dodge gibt sich gewöhnlich nicht so schnell geschlagen, aber gerade scheint wirklich gar nichts in ihrem »Leben« nach Plan zu laufen: Schlimm genug, dass sie ihren Exfreund mit einer anderen im Bett erwischt hat und dieser für eine horrende Summe aus der gemeinsamen Werbeagentur aussteigen will – ausgerechnet jetzt, wo der Vampirin die Steuerfahndung im Nacken sitzt. Auch die kleine Auszeit in Norwegen, die Amy wirklich bitter nötig hätte, entpuppt sich als reinste Katastrophe: Ihr Auto gibt in strömendem Regen irgendwo zwischen Fjord und Nirgendwo den Geist auf. Als schließlich ein attraktiver Fremder anhält und anbietet, Amy mitzunehmen, bleibt ihr nichts anderes übrig als zuzustimmen. Dabei weiß Amy vom ersten Moment an, dass sie den charmanten Devon Cooper und die Anziehungskraft, die er auf sie ausübt, nicht auch noch gebrauchen kann …
Für meine Leser, ohne die dieses Buch nicht entstanden wäre.
1
Da stehe ich also – in einer Pfütze voller Dreck – und heule bittere Tränen auf die Betonbegrenzung der kleinen Parkbucht, während sich mein Wagen in Rauch auflöst.
Die Straße entlang der steil abfallenden Küste ist schmal und unübersichtlich, ohne einen Hinweis darauf, wie weit es wohl noch bis zum nächsten Ort ist. Und seit ich das letzte Fahrzeug gesehen habe, sind Stunden vergangen.
Hinter der Begrenzung der winzigen Haltebucht rollt der schäumende, vom Sturmwind aufgepeitschte Atlantik gegen die Felswände. Tosend und dunkel klatscht er gegen die Küste und verteilt seine eiskalte Gischt über mir.
Noch nie bin ich mir so klein vorgekommen. Mit nassen Augen starre ich in den Himmel, der die Welt verschlucken möchte, fällt er doch beinahe in die tobenden Fluten, während das strähnige Sonnenlicht die dazu passende, dramatische Beleuchtung liefert.
Der kräftige Nordwind zerrt an meinen Haaren, fährt mit kalten, klammen Fingern unter meine Kleider und facht den Brand unter der Motorhaube weiter an, und ich erinnere mich daran, dass ich meine eigenen Probleme habe.
Ich stehe irgendwo im Gebiet der achtzehnten Abteilung herum, ohne einen Hauch von Zivilisation in Sichtweite. Ich greife in meine Jackentasche, auf der Suche nach meinem Smartphone. Doch als ich es hervorziehe, muss ich feststellen, dass der Bildschirm schwarz ist.
Der Akku ist tot, hat sich verabschiedet, mich allein gelassen und ich kann es einfach nicht fassen. Als wäre dieses Jahr nicht schon schlimm genug! Jetzt habe ich mich auch noch selbst inmitten des Nirgendwo ausgesetzt, bepackt mit einem überquellenden Koffer und Schuhen, die für Laufstege, aber nicht für Wanderungen gemacht sind.
Ich wische mir über die Wangen, weil mir die Schminke verläuft, und umkralle mein Telefon noch etwas fester. Das ist so ungerecht!
Wenn ich vor fünf Jahren gewusst hätte, wie schwer es manchmal ist, in seiner eigenen Haut zu leben, hätte ich es mir zweimal überlegt, mein Leben als Vampirin weiterzuführen. Doch vor solch banalen Dingen wie Herzschmerz und Pech warnt dich niemand, wenn du so eine wichtige Entscheidung treffen sollst.
»Wieso? Was habe ich getan?«, brülle ich wütend gegen die donnernde Brandung an und werfe, meine Contenance vergessend, mein Telefon die Klippen hinunter. »Elendiger Scheißkerl!«, rufe ich den nun zu Elektroschrott degradierten Einzelteilen hinterher, die einmal mein gesamtes Klientenverzeichnis beinhaltet haben.
Ihn zu verfluchen fühlt sich gut an. Ich betitele Sean mit ein paar weiteren Schimpfwörtern, die auf ewig allein zwischen mir und dem tosenden Nordmeer bleiben werden. Ungehört von meiner Schwester, meiner Mutter oder sonst einer Person, die daran Anstoß nehmen könnte. Ich will meinen Ex gerade noch etwas lauter beschimpfen, als sich der Wettergott dazu entschließt, dem ein Ende zu bereiten.
Der Regen ist eisig.
So kalt und dicht, dass ich erschrocken die Arme um mich schlinge und zu meinem Auto rennen will, unter dessen Motorhaube es noch immer vor sich hin kokelt. Ich habe das Bedürfnis, loszuheulen und nicht mehr aufzuhören, während ich die kälteste Dusche meines Lebens bekomme.
Wie lange ich dort neben meinem Auto stehe, weiß ich nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass es langsam dunkel wird und absolut niemand hier vorbeikommt.
Schließlich halte ich es nicht mehr aus. Ich will hier weg. Einfach nur weg aus dem Regen, raus aus meinen triefend nassen Klamotten, um meine zu Eis gefrorenen Glieder aufzuwärmen. Und so greife ich schließlich nach meinem Koffer, umfasse meine Handtasche etwas fester und laufe los.
Meine Füße fühlen sich an, als wäre ich einen Marathon gejoggt. Meine Fußballen bringen mich um, und mein Gesicht, festgefroren, wie es ist, fühlt sich an, als gehörte es nicht länger zu mir. Ich stolpere in ein Schlagloch und spüre, wie ein stechender Schmerz durch meinen Knöchel fährt, doch außer einem leisen Ächzen bringe ich nichts hervor. Meine Tränen sind längst versiegt, und ich konzentriere mich darauf, einen Schritt vor den anderen zu setzen. Die kleinen Steinchen, die den nassen Asphalt bedecken, stellen eine stete Gefahr für meinen Gleichgewichtssinn dar. Der beinahe waagrecht fallende Landregen, bei dem man die Hand vor Augen nicht sieht, ist in ein kümmerliches Nieseln übergegangen, während ich auf meinen hohen Hacken weiter vorwärtsschwanke. Ich wage es nicht, die gesamte Straßenbreite auszunutzen, da die Fahrbahn sich auf eine einzige Spur beschränkt, die sich so eng und unübersichtlich um den Fjord windet, dass hinter jeder Kurve ein Auto hervorbrettern könnte. Bei meinem Glück würde mich der Fahrer zu spät sehen, und ich würde wie ein unschuldiges, unbedarftes Reh mit dem Kühler kollidieren. Selbst die Haarfarbe würde stimmen. Es würde richtig wehtun, und bis wir das nächste Krankenhaus erreichen, würde es Tage dauern, weil das Unfallfahrzeug natürlich nur noch ein Schrotthaufen wäre.
Ich gebe ein Schnauben von mir und gratuliere mir im Stillen zu dieser sehr wahrscheinlichen nächsten Episode in meinem Leben, während das Tosen des Meeres alle anderen Geräusche übertönt.
Ich strauchle gerade ein weiteres Mal, als plötzlich meine lädierten Füße angestrahlt werden und ich den katastrophalen Zustand meiner blauen High Heels bemerke. Die Adern auf meinem Fußrücken sind deutlich durch die fahle, bläulich verfärbte Haut sichtbar.
Es dauert einen Augenblick, bevor ich verstehe, dass es sich um die Scheinwerfer eines Wagens handelt, die meinen Weg erleuchten. Ich bleibe verdattert stehen, blinzle in das Fernlicht, das nach einigen Sekunden abgestellt wird, und male mir weitere mögliche Horrorszenarien aus. Das führt dazu, dass ich meinen dünnen, cremefarbenen Blazer, der vollkommen durchnässt ist, enger um mich ziehe und energisch weiterlaufe, denn ich gebe mich nicht der Hoffnung hin, dass der Fahrer weiblich, blind oder vollkommen asexuell ist. Ich höre das Auto hinter mir bremsen und straffe die Schultern, bin mir dabei schmerzlich bewusst, dass mein Kleid wie ein nasser, halb durchsichtiger Lappen an mir klebt.
Der Wagen hinter mir gibt ein Grollen von sich, als er mich einholt. Ich höre den Rollsplitt unter den Reifen knirschen. Eine lang gezogene Motorhaube schleicht an mir vorbei, deren zwei weiße Längsstreifen auf rotem Grund nichts Gutes erahnen lassen.
Solche Lackierungen findet man nicht auf Frauenautos. Auch nicht auf den Fahrzeugen anständiger Männer. Zumindest behauptet das meine Mutter.
Das Klackern meines Koffers schlägt einen höheren Takt an, weil ich keine Lust habe, mich mit einem sexistischen Dreckskerl herumzuschlagen, während das Fenster mit einem Quietschen heruntergekurbelt wird und der Wagen ein widerspenstiges Schnauben von sich gibt ob des langsamen Tempos.
»Gehört Ihnen das Auto, das vor zehn Meilen den Geist aufgegeben hat?«, höre ich eine dunkle Männerstimme fragen, und ich spüre, wie mein Magen runtersackt, weil sich gerade all meine Befürchtungen bestätigen.
Ich stapfe weiter, zerre meinen Rollkoffer über das nächste Schlagloch.
»Hey, Lady … sind Sie taub?«, dringt es neben mir aus dem Inneren des Wagens. »Sie können ihr Auto nicht einfach so herumstehen lassen. Sie haben nicht einmal ein Warndreieck aufgestellt«, belehrt mich der Kerl, und ich beschließe, ihn zu ignorieren. »Hören Sie mir zu?«
Und ob ich ihm zuhöre.
Denkt er etwa, das wüsste ich nicht? Ich hatte es vergessen, als ich losgelaufen bin. Und als es mir einfiel, war ich schon zu lange unterwegs, um es über mich zu bringen, nochmals zurückzugehen. Außerdem steht mein Auto in einer Haltebucht. Ganz zu schweigen davon, dass hier sowieso niemand vorbeizukommen scheint!
»Hey, ich rede mit Ihnen«, sagt der Kerl mittlerweile ganz offenbar genervt.
Ich ziehe die Nase nach oben und schiebe mein Kinn nach vorn, in der Hoffnung, so selbstsicher zu wirken. »Gehen Sie weg!«
Der Wagen tuckert gemächlich neben mir her. Alt ist die rote Kiste. Sie kann ihren Ursprung, der irgendwo in den Sechzigern des letzten Jahrhunderts liegen dürfte, nicht verhehlen, trotzdem handelt es sich dabei zweifellos um einen Sportwagen.
Ein Umstand, der mich ganz und gar nicht beruhigt.
»Sie werden in den nächsten fünfzig Meilen nichts finden, außer Steinen und Meer.«
Ich bleibe stehen und drehe mich zum Wagen. »Ich komme alleine klar.«
»Sosehr ich es auch bewundere, dass Sie in ihren hohen Hacken umherwandern, und das offenbar schon seit Stunden, sehen Sie leider überhaupt nicht so aus, als ob Sie auch nur einen Tag hier draußen überleben würden.«
»Ich bin immerhin vernünftig genug, um nicht bei einem wildfremden Kerl einzusteigen, der so eine extravagante Schrottschüssel fährt.«
Im Inneren des Wagens höre ich meinen Gesprächspartner leise etwas vor sich hin murmeln, das sich ernsthaft erbost anhört, bevor er Gas gibt und mich stehen lässt.
Ich bin im ersten Augenblick vollkommen baff. Dann erleichtert und schließlich einer Heulattacke nahe, während die Rücklichter um die nächste Kurve biegen.
Fünfzig Meilen? Das ist einfach zu viel … Ich werde Tage unterwegs sein!
Gerade als ich in Selbstmitleid zerfließen möchte, sehe ich einen riesigen Schatten auf mich zuhalten.
Breit und hochgewachsen ist der dunkle Umriss, der mit schweren Schritten auf mich zukommt.
Ich gebe ein verzweifeltes Keuchen von mir. »Kommen Sie mir nicht zu nahe!«
»Ich tue Ihnen nichts.« Seine Stimme vibriert in meinem Magen. Ein finsteres Grollen, das ebenso gut von einem Tier stammen könnte.
Ich schlucke schwer und krame in der Handtasche panisch nach etwas, das sich im Zweifelsfalle dazu verwenden lässt, einen ausgewachsenen Mann zu überwältigen. Doch darin ist absolut nichts Brauchbares zu finden, und so erwarte ich den drohenden Angreifer schlussendlich mit einer Dose Deo in der Hand.
»Legen Sie das weg. Ich habe keine Lust, wie eine Parfümerie zu stinken!«
Ich blinzle gegen den Nieselregen an. Wie kann er in dieser Finsternis irgendetwas erkennen?
Eine Taschenlampe erhellt plötzlich mein Gesicht, und ich kneife die Augen zusammen.
»Sie blenden mich.«
Der Lichtstrahl ergießt sich nun auf den Boden vor ihm, und ich bin zur Salzsäule erstarrt, während seine Motorradstiefel durch eine der vielen Pfützen trampeln.
Seine Gestalt, die sich nun beim Näherkommen deutlich aus der Nacht schält, lässt mich schlucken. Der Fremde ist fast einen ganzen Kopf größer als ich, obgleich ich wirklich sehr hohe Schuhe trage.
Er trägt eine Lederjacke, dunkel und knarzend, welche seinen breiten Schultern die Ausmaße eines Schrankes gibt. Ich stolpere einen Schritt zurück, sehe ich doch meine schlimmsten Befürchtungen bestätigt.
Der kantige Unterkiefer, der von einem kräftigen Bartschatten überzogen ist, gehört zu einem Mann, um den ich unter allen Umständen einen Bogen machen würde. Ich weiß nicht, ob gut aussehend das richtige Wort ist, um ihm gerecht zu werden. Gut aussehend klingt zu langweilig für diese Erscheinung und zu unmännlich. Nichts an diesem Kerl ist weich oder gar zurückhaltend. Seine Nase ist zu breit, zu eigenwillig gebogen. Die Oberlippe viel zu voll, die blutroten Augen liegen zu tief, sehen zu schwermütig aus, die Augenbrauen sind zu dick und zu selbstbewusst geschwungen.
Unrasiert und ungebändigt steht er vor mir, und ich habe Angst. Daran ändert auch seine giftgrüne Surfermütze nichts, die er tief in die Stirn gezogen hat.
Er hebt eine Hand und deutet mit dem Daumen in Richtung seines Wagens. »Kommen Sie jetzt, oder was? Ich habe nicht vor, die ganze Nacht hier zu verbringen«, sagt er und greift einfach so an mir vorbei nach meinem Koffer.
Ich öffne benommen den Mund und schließe ihn wieder, erschlagen von so viel Dreistigkeit, während er offenbar darauf wartet, dass ich seiner wenig charmanten Einladung folge.
»Es zwingt Sie niemand, mir zu helfen«, bringe ich schließlich heraus.
Er legt die Stirn in Falten. »Kommen Sie mit, oder lassen Sie es bleiben. Aber noch mal halten werde ich nicht.«
Wir mustern uns eine Weile. Weshalb ich mich schließlich in Bewegung setze, weiß ich nicht so genau. Vielleicht liegt es daran, wie er die Augen verdreht, oder daran, dass ich mich ohnehin nicht gegen ihn wehren könnte, wenn er es darauf anlegen würde. Jedenfalls trotte ich in Richtung des geparkten Autos, noch immer das Deo sprühbereit.
»Sie haben einen Schaden«, höre ich ihn hinter mir grummeln.
»In der Tat hatte ich den. Deshalb bin ich in dieser unmöglichen Situation«, lasse ich ihn wissen und öffne die Beifahrertür. »Und glauben Sie bloß nicht, dass Sie auf dumme Ideen kommen können!«
Er schnaubt. »Wollte ich Ihnen etwas tun, lägen sie jetzt schon längst am Boden.« Er hört sich amüsiert an ob meiner Aussage, und ich drücke den Rücken durch.
»Sie sollten nicht so mit mir sprechen!«
»Ich habe eine Stunde lang die Küste nach einem Lebenszeichen von jemandem abgesucht, ich rede mit Ihnen, wie es mir passt«, wehrt er meine Beschwerde ab. »Und jetzt schwingen Sie Ihren hübschen Hintern in den Wagen.«
Er macht es mir so einfach, ihn stellvertretend für alle Mitglieder seines Geschlechts zu hassen, dass ich nicht einmal ein schlechtes Gewissen habe, ihm seinen Beifahrersitz zu versauen, so nass und dreckig, wie ich bin.
2
Das weiche Leder gibt ein widerspenstiges Quietschen von sich, als ich auf den Beifahrersitz klettere und kritisch das Innere des Wagens beäuge.
Meiner eingehenden Musterung entgeht der Stapel Zeitschriften nicht, der auf der Rückbank herumliegt, genauso wenig wie die zwei Dosen Cola und die Flasche Blut. Doch nichts ist auf den dunkelroten Sitzen zu entdecken, das für eine Karriere als Massenmörder spricht. Die Flasche Blut erinnert mich nur daran, dass ich mal wieder das Worst-Case-Szenario unterschätzt habe.
In meiner Aufregung habe ich seine blutroten Augen gar nicht richtig registriert. Und jetzt, wo ich mich daran erinnere, spüre ich die Anspannung noch ein ganzes Stück wachsen. Natürlich ist der Kerl ein Vampir. Ebenso wie ich. Natürlich wollte mir das Schicksal nicht einen Vorteil in dieser Episode meines Lebens zugestehen. Wieso muss ich aber auch immer so ein Glück haben? Da strandet man schon im Nirgendwo der achtzehnten Abteilung und dann wird man auch noch von einem vampirischen Schrank aufgegabelt!
»Mist!«, entkommt es mir frustriert.
Ich beobachte misstrauisch durch die Heckscheibe, wie er den Kofferraum öffnet und sein Kopf hinter der Klappe verschwindet. Gespannt warte ich darauf, dass er seine wahren Absichten verrät, indem er eine Axt oder sonst eine Waffe aus dem Wagen zieht und sich mit einem wahnsinnigen Lächeln auf mich stürzt.
Der Kofferraum fällt mit einem Rums ins Schloss, und mein Zeigefinger, der auf der Sprühdose liegt, zuckt nervös. In der Dunkelheit kann ich nicht viel erkennen, und so mache ich mich bereit, ihn zu parfümieren.
Er öffnet die Tür, schiebt seine Füße zuerst ins Auto und lässt den Rest folgen.
Die Lederjacke knarzt.
Seine Augen finden die Sprühflasche.
»Ernsthaft?«, fragt er nur, und mir ist nicht ganz klar, ob er damit meine zur Selbstverteidigung gewählte Waffe meint oder meinen gegenwärtigen Zustand, der ihm seinen Wagen versaut. »Im Handschuhfach ist ein anständiges Taschenmesser.«
»Danke, ich bin versorgt«, presse ich hervor.
Er schenkt mir ein schiefes Grinsen und zieht seine Strickmütze ein wenig tiefer, deren Giftgrün von einem türkisfarbenen Streifen unterbrochen ist, wie mir nun auffällt.
»Wenn Sie das sagen.« Er wartet nicht darauf, dass ich mich rege. Stattdessen greift er nach seinem Gurt, lässt ihn einrasten und startet den Wagen. »Schnallen Sie sich an. Ich habe vor anzukommen, bevor Sie mir meine Sitze auf ewig ruiniert haben.«
Ich warte, bis seine linke Hand das Lenkrad umfasst hält. Als die andere schließlich auf dem Schaltknauf zum Liegen kommt, scheint es mir sicher genug, mich ebenfalls anzugurten. Dabei fällt mein Blick auf meine Beine, und ich gebe ein frustriertes Seufzen von mir. Ich sehe noch schlimmer aus als vermutet.
Meine Zehen stehen in Straßendreck. Matsch hängt an meinen Waden, das schöne Blau meiner High Heels hat sich in ein dunkles Grau verwandelt. Wie meine Ballen und die Ferse aussehen, möchte ich gar nicht so genau wissen.
Sollte ich mir diesen Kerl vom Leib halten wollen, reicht es wahrscheinlich, ihm meine Füße entgegenzustrecken. Ansonsten kann ich dieser Situation keinerlei Nutzen abgewinnen.
Wasser sickert aus meinem Kleid auf den Sitz herab und bildet kleine Bäche auf dem Leder. Meine Beine fühlen sich an wie Blei, mir ist kalt, und ich hasse meinen Exfreund noch ein wenig mehr. Im Grunde genommen ist all das seine Schuld! Alles. Von der Idee, in den Urlaub zu fahren, um den Kopf frei zu bekommen, über die Autopanne bis hin zur Verunglimpfung meiner Fünfhundert-Dollar-Schuhe!
Meine Gedankengänge werden vom laut plärrenden Radio unterbrochen. Heiser und recht aggressiv brüllt mir irgendein Sänger ins Ohr, was für eine Schlampe seine Exfreundin war, und obgleich ich diese Art von Musik eigentlich nicht ausstehen kann, bin ich beinahe versucht, mitzusingen und dabei ein paar Personalpronomen auszutauschen.
Der Sänger schreit weiter, und ich rutsche in Richtung Autotür, weil der Kerl neben mir in der schummrigen Finsternis an Muskelmasse zuzulegen scheint.
Und so beginnen wir unsere Reise durch die Nacht. Ich noch immer mit meinem Deo gewappnet und er konzentriert auf die Straße starrend.
Sein Wagen schaukelt wie ein Schiff auf hoher See, als wir ein besonders heruntergekommenes Stück Straße passieren, und er gibt ein Schnauben von sich. Noch immer hat er mich nicht angefallen, und meine Spannung lässt langsam nach. Er scheint keinerlei Interesse an meiner Wenigkeit zu haben. Weder an meinem Körper noch an der Geschichte, die ich ihm zu erzählen hätte.
Draußen klart es langsam auf, während das Gebläse auf Hochtouren arbeitet. Das kalte Mondlicht fällt strähnig durch die aufgerissene Wolkendecke, und im Auto breitet sich langsam eine angenehme Wärme aus, die mich aufzutauen beginnt. Ich sehe dabei zu, wie sich das fahle Grau meiner Haut in das gewohnte helle Weiß verwandelt, durchbrochen nur von ein paar wenigen kleinen Leberflecken und den Dreckspritzern, die im Dunkeln der Nacht wie ein sehr exzentrisches Tattoo wirken.
Wir fahren schon eine geschätzte Ewigkeit, ohne dass er oder ich einen Ton gesagt hätten. Der Radiomoderator schwafelt gerade etwas von einer Unwetterwarnung für morgen, als ich ein gelbes Leuchtschild mit der Aufschrift »Atlantic« ausmache. Hinter der nächsten Kurve entdecke ich die dazugehörige Fassade eines großen Gebäudes, welches sich im Schatten der Nacht an die Küstenfelsen schmiegt.
Ich könnte heulen vor Glück. »Danke, dass Sie mich mitgenommen haben«, bringe ich raus, weil er mich nicht umgebracht hat und meine Rettung in Sicht ist.
Er blickt kurz zu mir herüber. In der Finsternis sieht er noch ein wenig gefährlicher aus, und die Lederjacke knarrt, als er mit den Schultern zuckt.
»Musste ich wohl«, brummt er und schaltet ein paar Gänge herunter, um seinen Wagen die steile Abfahrt zum Hotel hinunterrollen zu lassen.
Wir rumpeln über den großen, mit Schlaglöchern übersäten Parkplatz, auf dem eine ganze Horde Motorräder und einige Autos herumstehen. Ich fühle mich hintergangen. Wo waren die alle, als ich liegen geblieben bin?
»Eine Meile von hier kommt eine Passstraße runter. Die ist sehr viel stärker befahren«, erklärt mein Fahrer mir da auch schon, als hätte er meine Empörung gerochen. Vielleicht hat er das auch. Wer kann das bei männlichen Vampiren schon so genau sagen? Manche von ihnen scheinen beinahe übermenschliche Kräfte zu haben, auch wenn sie unverwandelt sind. Und dieses Exemplar neben mir scheint sich jedenfalls nicht in ein Würmchen zu transformieren.
Ich erinnere mich an die beeindruckenden Vampir-Rugby-Spiele, zu denen mich Sean geschleppt hat. Die Spieler dort konnten sich in Bären oder Wölfe verwandeln. Sie waren unglaublich schnell und wendig, aber auch blutrünstig. Ich muss zugeben, ich mag diese weitverbreitete Charaktereigenschaft meiner Spezies nicht. Sich zu prügeln ist vollkommen unzivilisiert, und wären wir heute noch darauf angewiesen, Menschen zu beißen, um zu überleben, hätte ich mich niemals wandeln lassen, egal ob meine Mutter oder sonst ein Mitglied meiner Familie oder meines Freundeskreises darauf gepocht hätte.
Ich mag mein Flaschenblut. Ich mag es wohlerzogen und kultiviert. Ist es vom Rest der Welt zu viel verlangt, dies zu akzeptieren?
In Gedanken versunken bemerke ich erst, dass wir angehalten haben, als der Kerl neben mir aussteigt und der kalte Wind ins Innere des Wagens bläst.
Hastig folge ich seinem Beispiel, da ich kein Interesse daran habe, mich länger als nötig in der Nähe dieses Mannes herumzutreiben.
Mit eiligen Schritten komme ich zu ihm, während er meinen Koffer aus den Untiefen seines Wagens zutage fördert.
Er hält mir meine Habe entgegen, und ich glaube, er wartet darauf, dass ich irgendetwas sage.
Mein Hirn fühlt sich an, als bestünde es aus Pappe. Durchgeschüttelt von der schlechten Straße und erstaunt darüber, heil davongekommen zu sein, kann ich nur wortlos mein schweres Gepäck an mich nehmen.
Er wirft sich seinen eigenen Seesack über die Schulter und zückt seine Autoschlüssel, um seinen Wagen abzuschließen.
»Wiedersehen«, brummt er finster. Damit lässt er mich stehen und geht in Richtung des Hoteleingangs davon.
Ich sehe dem Kerl hinterher, dessen lässige Schritte in der Nacht widerhallen, und spüre einen eiskalten Schauer meinen Rücken hinunterrinnen. Er reizt die Skala der körperlichen Überlegenheit mit einer Natürlichkeit aus, die einfach nicht normal ist.
Vampir hin oder her.
Als ich die schwere Glastür aufdrücke und in die Hotellobby stolpere, begegne ich den gesammelten Blicken eines Motorradclubs, der es sich auf den Sitzgelegenheiten bequem gemacht hat. Offenbar stehen die Maschinen vor der Tür nicht nur zu Dekorationszwecken da.
Der Erste winkt mich mit einem wenig Vertrauen erweckenden Lächeln zu sich hinüber, kaum dass ich einen Schritt in den Raum gemacht habe. Die anderen grinsen lüstern in meine Richtung oder geben ein paar blöde Sprüche von sich, die ihren jeweiligen Nebenmann zu einem noch breiteren Lächeln animieren. Einer von ihnen besitzt die Dreistigkeit, mir seine Fänge zu zeigen. Ich hasse es, wenn Männer das tun. Ich weiß nicht, was uns Frauen daran imponieren oder andere Männer abschrecken soll. Es ist etwas zutiefst Ordinäres. Ich lege keinen Wert darauf, in aller Öffentlichkeit gezeigt zu bekommen, dass jemand mich sexuell anziehend findet. Und Beißen ist ohnehin etwas, das ins Bett gehört. Mich an die wenig jugendfreien Episoden erinnernd, in denen ich diese Tatsache beigebracht bekommen habe, beeile ich mich, zur Rezeption zu kommen. Die junge Frau hinter dem Tresen blickt mir kritisch entgegen. Ihr kurz geschnittenes hellbraunes Haar ist mit ein wenig Gel zerzaust, die blauen Augen mit zu viel Kajal umrandet. Sie legt eine Hand auf ihre Hüfte und kaut gelangweilt auf einem Kaugummi. Ihre schlanke Gestalt ist in so etwas Ähnliches wie ein Kostüm gehüllt, das sie aber gekonnt verschleiert, indem sie ihre Bluse bis zum BH aufgeknöpft hat.
Sie schiebt ihren Kaugummi auf die andere Wangenseite, als ich vor ihr zum Stehen komme.
»Ja?«, will sie gelangweilt wissen und mustert mich mit einer Abfälligkeit, die ich einfach nur frech finde.
»Ich brauche ein Zimmer für heute Nacht.«
Sie hackt irgendetwas in ihren Computer, und ich kann dabei zusehen, wie sich ihr Brustkorb hebt und senkt und sie ihren Gummi wieder die Seite wechseln lässt.
Sie zieht eine Augenbraue nach oben, als ich mir meine Haare ausdrücke und darüber nachdenke, wohin eigentlich meine Mitfahrgelegenheit verschwunden ist.
»Zimmer mit Doppelbett? Suite?«
»Nimmst mich mit, Schätzchen?«, johlt einer der Biker hinter mir. Ich ziehe eine Augenbraue nach oben. Wie schaffen Männer es, sich so katastrophal selbst zu überschätzen? Als bestünde die geringste Wahrscheinlichkeit, dass ich mich mit so einem dahergelaufenen, wüsten Raufbold einlassen würde, dessen ohnehin schon zweifelhafte Attraktivität noch einmal erheblich durch seinen ausschweifenden Konsum von Alkohol geschmälert wird.
»Geben Sie mir die Suite«, antworte ich der Rezeptionistin entnervt, sämtliche andere Anwesenden ignorierend. Für schlechte Anmache habe ich heute keinen Nerv mehr. Und für miese Zimmer auch nicht.
»Bar oder mit Karte?«
»Karte.«
Sie drückt ein paar Tasten, rückt ihre Bluse zurecht. Nachdem sie fertig zu sein scheint, sich um ihr Aussehen zu sorgen und wir das Formelle geklärt haben, bekomme ich endlich meinen Schlüssel.
»Dritter Stock«, informiert sie mich liebenswürdigerweise. »Zimmer zwei.«
Wir verabschieden uns mit einem eisigen Schweigen, und sie widmet ihre Aufmerksamkeit wieder den Rockern, die ihr nun, da ich auf dem Rückzug bin, wieder ihr wenig erstrebenswertes Interesse schenken.
Ich wünsche ihr von Herzen, dass sie nachher alle mit ins Bett nehmen kann, während ich meinen Koffer über die dicke, dunkelblau und gelb gemusterte Scheußlichkeit von Teppichboden zerre.
Die Suite ist nicht überwältigend, aber besser als gedacht. Das Doppelbett sieht bequem aus, und das Bad verfügt nicht nur über eine geräumige Dusche, sondern auch über eine Eckbadewanne.
Ich schlüpfe aus meinen zerstörten Schuhen, drehe das Wasser auf. Ich fühle mich ein klein wenig besser, weil das Wasser warm ist und die Minibar auf mich wartet, während der elendige Mistkerl Sean in Helsinki hockt und mich nicht erreichen kann.
Ich lasse meine nassen Klamotten auf die Fliesen klatschen und setze mich auf den Wannenrand, tauche meine zugerichteten Füße ins heiße Wasser und gebe ein zufriedenes Stöhnen von mir.
Die Fersen und die Zehen eingehend abgeschrubbt und die Beine vom hartnäckigen Dreck befreit, sinke ich eine knappe Stunde später sauber ins Bett und mache den Fernseher an.
Ich beschließe, die Sache mit meinem Auto morgen früh zu regeln, lasse mich vom schlechten Fernsehprogramm bespaßen und will mich schließlich auf die Minibar stürzen, um mein Überleben in der skandinavischen Einöde zu feiern. Dazu komme ich jedoch nicht. Der Schlaf übermannt mich, bevor ich auch nur einen einzigen Schnaps hinunterstürzen kann.
Als ich mich das nächste Mal rege, ist es noch finster draußen. Ich setze mich gähnend auf, schiebe den ungeöffneten Kurzen zur Seite, der neben mir auf dem Kopfkissen liegt, und werfe einen genaueren Blick auf meine Armbanduhr. Kurz nach zehn.
Nachdem ich mir den Schlaf aus den Augen gerieben habe, erinnere ich mich an die Unwetterwarnung, die der Radiomoderator gestern erwähnt hat, und klettere mit steifen Gliedern aus dem warmen, weichen Bett.
An diesem Samstagmorgen scheint der Untergang der mir bekannten Welt nahe. Nicht etwa, weil vor Montag keine Fähre mehr geht, oder wegen des schlechten Wetters, sondern weil ich Gummistiefel trage. Mit kleinen Zeichentricktrollen verzierte, hässliche, nach Gummi stinkende Treter. Da hilft es auch nicht, dass ihr einziger Zweck darin besteht, meine übrigen High Heels vor weiteren Begegnungen mit der unbarmherzigen Natur in diesen Gefilden zu bewahren.
Es ist offiziell. Ich bin ganz unten angekommen.
Erstanden habe ich diese Ausgeburt der Modehölle in der kleinen Touristeninformation, die sich dem Hotel angliedert, gemeinsam mit einem Regenschirm, der sich aber den Sturmböen ergeben hat, kaum dass ich zwei Schritte nach draußen getan habe, um der Einöde meines Zimmers zu entkommen. Frustriert werfe ich den Schirm in den nächsten Müll und stapfe über den löchrigen Parkplatz zum Kai hinunter, um den Fährplan zu studieren.
»Schicke Schuhe. Wo haben Sie die denn ausgegraben?«, fragt plötzlich etwas neben mir, und ich drehe mich erstaunt um.
Hinter mir steht der riesige Kerl von gestern, in nicht mehr gehüllt als eine ausgebeulte, verschlissene Jeans und ein schlichtes graues Shirt, über das er ein blau kariertes Hemd gezogen hat. Dazu trägt er noch immer seine schweren Stiefel und die exzentrische, grüne Strickmütze mit dem türkisfarbenen Streifen.
Gerne würde ich sagen, dass sie ihm nicht steht, aber leider tut sie das.
»Verfolgen Sie mich?«, fahre ich ihn an, bevor ich ihm am Ende noch zugestehe, dass er gut damit aussieht.
»Sollte ich Sie verfolgen?«
»Ach, verschwinden Sie … Sie –« Ich überlege, wie ich ihn betiteln soll. »Wie heißen Sie eigentlich?«, entkommt es mir schließlich entnervt.
Seine dicken Augenbrauen wandern nach oben, und seine eigensinnigen Lippen verziehen sich zu einem unverschämten Grinsen, das seine dunkelroten Augen übermütig funkeln lässt. »Kaum haben Sie kein Deo in der Hand, um sich zu verteidigen, fragen Sie nach meinem Namen. Ist das eine neue Art der Selbstverteidigung, oder sind Sie einfach nur im Nebenberuf Parfümeurin?«
»Witzig«, entrüste ich mich und verschränke die Arme vor der Brust.
Er legt den Kopf schief und lächelt noch ein wenig breiter. »Das ist es«, bestätigt er mir ernst und übergeht dabei geflissentlich meinen Sarkasmus. Selbstzufrieden präsentiert er mir seine ausschweifend definierten Muskeln, als er die Hände in die Hosentaschen schiebt. Und dann bekommt dieses Arschloch doch tatsächlich Grübchen, wenn es lächelt.
Ein ungehaltenes Schnauben entweicht mir. »Sie sind wirklich unglaublich.«
Seine Grübchen werden noch ein bisschen tiefer. »Ich bin Devon«, stellt er sich schließlich vor, ehe er einfach davongeht. Schlappt durch die tiefen Pfützen zurück in Richtung Hotel und sieht selbst dabei noch selbstzufrieden aus.
»Wollen Sie gar nicht fragen, wie ich heiße?«, rufe ich ihm ärgerlich hinterher, erbost über so schlechte Manieren.
Er dreht sich im Gehen nach mir um und fasst sich mit einem triumphierenden Gesichtsausdruck an die Mütze. »Das weiß ich bereits … Amy.«
3
Ich blinzle verwirrt gegen den stärker werdenden Regen an und fahre mir durchs Haar, das in der auffrischenden Luftfeuchtigkeit sein Eigenleben entwickelt hat. Die langen Haare schlingen sich widerspenstig um meine Finger, während ich Devons kleiner werdende Rückenansicht mustere. Woher kennt der Kerl meinen Namen?
Hätte ich ihn schon einmal getroffen, würde ich mich an ihn erinnern. Um ihn zu vergessen, ist er definitiv zu auffällig. Auch in der Zeit, bevor ich Sean kennengelernt habe, hätte er einen gewissen Eindruck hinterlassen.
Als Kerbe in meinem Bettpfosten.
Damals konnten die Männer gar nicht beeindruckend und gut aussehend genug sein. Ich war verrückt nach Männern, die nicht durch Intellekt, sondern durch Muskelmasse und Verschlagenheit glänzten. Ein besonderes Faible hatte ich für Vampirrugby-Spieler. Meine Mutter ist beinahe wahnsinnig geworden, wenn ich mal wieder mit einem dieser verwegenen Typen zu Hause aufgetaucht bin. Sie waren vollkommen fehl am Platz. Verschlagen, sexistisch und solche Brocken, dass man sich in ihren Armen wie ein Zwerg vorkam. Ein Affront gegen meine Herkunft und meine Bildung.
Und dann traf ich Sean. Das absolute Gegenteil von dem, was mich bisher angezogen hatte. Gebildet, kultiviert und reich. Einer, der mich »Darling« nannte und sich noch nie in seinem Leben geprügelt hatte. Meine Mutter und meine Schwester vergötterten ihn. Nichts konnte dieser Mistkerl falsch machen. Selbst die Trennung ist in ihren Augen meine Schuld, obgleich das nicht stimmt. Er hat mich betrogen. Niemand kann mir einen Vorwurf machen, dass ich nicht bei jemandem bleiben möchte, der fremdgegangen ist. Dass er nun aus unserer Agentur aussteigen möchte und laut darüber nachdenkt, sich seinen Anteil von mir auszahlen zu lassen, finde ich daher mehr als nur frech, doch leider kann ich nichts dagegen tun.
Ich möchte gar nicht an das Liquiditätsproblem denken, das ich habe, wenn er es tatsächlich durchzieht. Seans Ausstieg als Geschäftspartner kann sich unsere Agentur nicht leisten.
Ich kann es mir nicht leisten.
Ich straffe die Schultern. Sollte es so weit kommen, werde ich nichts daran ändern können. Bis dahin habe ich allerdings größere Probleme als meinen Exfreund. Mein so dringend benötigter Urlaub hat sich in Rauch aufgelöst, und der Kerl, der mich aufgegabelt hat, kennt meinen Namen, obgleich ich ihn ihm nicht verraten habe. Entweder verfügt er über hellseherische Fähigkeiten, oder er hat mir hinterherspioniert. Da mir allerdings kein Vampir bekannt ist, der Gedanken lesen kann, tippe ich auf Möglichkeit Nummer zwei und fühle mich ein kleines bisschen geschmeichelt.
Den restlichen Nachmittag verbringe ich in meinem Zimmer und lese einen Reiseführer über Bergen, den ich mir aus der Touristeninformation geholt habe. Bergen ist von hier aus die nächste Großstadt innerhalb der 18. Abteilung, auf deren Territorium ich mich zurzeit aufhalte.
Eigentlich war ich nur auf der Suche nach einem Hotel, in dem ich meinen Urlaub verbringen kann. Doch mit wachsendem Interesse habe ich die Seiten über die Geschichte dieser 18. Abteilung verschlungen, gab es hier doch seit der Neueinteilung der Welt schon achtunddreißig Abteilungsleiter. So viele wie in keinem anderen der insgesamt sechsundzwanzig Bezirke, in die man die Welt damals im Vertrag von Helsinki 1494 aufgeteilt hat, nachdem über einhundertfünfzig Jahre Krieg geherrscht hatte. Dort einigte man sich nicht nur darauf, die Welt in 26 Abteilungen zu gliedern, sondern auch darauf, dass ihre Herrscher den schlichten Titel Abteilungsleiter tragen sollten, um eventuellen Streitigkeiten um Titelansprüche zuvorzukommen.
Ich gebe ein Seufzen von mir und blättere eine Seite weiter, nur um zu erfahren, dass der erste Abteilungsleiter Olav Jacobson gestürzt wurde, nachdem er ein Vampirrugby-Spiel mit seiner Mannschaft, den »Trolls«, 1517 gegen die »Lions«, die Mannschaft der 26. Abteilung, verloren hatte.
»Unglaublich, wie besessen man hier von diesem Spiel ist«, kommt es mir verdattert über die Lippen. Eigentlich habe ich mich selbst immer für einen großen Fan gehalten, und ich war mir nie zu schade, zu Hause in Helsinki unsere Mannschaft der »Arctic Wolves« anzufeuern, doch deshalb einen Abteilungsleiter zu feuern, scheint mir doch reichlich übertrieben. Sicher, wenn sich die beeindruckenden Spieler im wilden Spiel in ihre Tiergestalt verwandeln und sich, in ihrem Streben an den Rugbyball zu kommen, attackieren, ist das faszinierend, doch kein Grund, jemanden abzusetzen. Allerdings erklärt das die enorm hohe Zahl an Abteilungsleitern, die sie hier in den letzten fünfhundert Jahren benötigt haben.
Mit einem Grinsen auf den Lippen klappe ich den Reiseführer zu, um mir endlich etwas zu trinken zu besorgen, habe ich doch seit gestern kein Blut mehr zu mir genommen. Die Fänge in meinem Zahnfleisch pochen schon leicht, und so rutsche ich vom Bett und streiche meinen grünen Rock glatt, bevor ich in meine High Heels schlüpfe und mir meine Handtasche von der Kommode schnappe.
An der Rezeption sitzt heute eine andere Dame, die weder ihre Brüste entblößt noch sonst einen Hinweis darauf gibt, an sexuellem Kontakt mit ihren männlichen Gästen interessiert zu sein. Stattdessen schenkt sie mir ein freundliches Lächeln, als ich die Lobby durchquere und tippt dann irgendetwas in ihren Computer, während ich mich auf die Suche nach dem Hotelrestaurant mache.
Das Restaurant stellt sich als einfache Bar heraus, in der man etwas zu essen bekommen kann, sollte man dem Koch zutrauen, Pommes in eine Fritteuse werfen zu können. Andere Delikatessen wie Chicken Wings oder einen Burger verspricht die Tafel neben dem Eingang ebenfalls, und so freue ich mich, dass Essen für mich als Vampir ohnehin nicht notwendig ist, und betrete den schummrigen Raum, um mir eine Tasse Blut bei der Kellnerin zu bestellen.
Zu meinem Ärger handelt es sich bei dieser um die unhöfliche Rezeptionistin vom Vortag, die heute noch weniger am Leib trägt als gestern. Ihr kurzer Rock spannt über ihrem Hintern, und ihr Ausschnitt gibt den Blick bis zum Bauchnabel frei, als sie sich nach vorn beugt, um meiner Bestellung nachzukommen.
Ich gebe ein entnervtes Schnauben von mir und lehne mich an die Theke, um den dunklen, holzvertäfelten Raum zu überblicken. Es ist voll geworden im Hotel. Im Halbdunkel der tief hängenden Deckenbeleuchtungen mache ich die Rocker von gestern an einem großen Tisch direkt am Fenster aus, eine zweite Bikertruppe hockt gleich neben der Tür, und auch die restlichen Tische sind schon gut besetzt.
»Kann ich die Tasse mit in die Lobby nehmen?«, hake ich nach, da ich darauf verzichten kann, mich an den Tresen zu setzen.
Sie zuckt mit den Schultern, und ich stelle fest, dass sie schon wieder Kaugummi kaut. »Weiß nicht … warten Sie mal«, bequemt sie sich dann zu sagen und öffnet die Tür zur Küche, um lautstark bei ihrem Chef nachzufragen.
Währenddessen beobachte ich fasziniert, wie ein Vampir, aus der Küchentüre tritt, dessen halblanges Haar mit einem Haarreif an Ort und Stelle gehalten wird. Seine stark gekrümmte Adlernase und sein längliches Gesicht, zusammen mit seinem dürren Körper, lassen ihn wie ein surreales Kunstwerk wirken.
»Hallo«, begrüßt er mich im Vorübergehen, und ich kann nur fasziniert dabei zusehen, wie er hinter der Bar hervorstakst und ein Körbchen mit Hähnchenflügeln zum Tisch mit den Bikern trägt.
»Können Sie mitnehmen«, höre ich es hinter mir sagen, während ich noch immer dem Vampir hinterhersehe, der wie ein Storch im Salat den Raum durchquert. Ich wende mich um und nicke der Kellnerin zu, bevor ich ihr einen Zehner auf den Tisch werfe und darauf warte, dass sie mir mein Wechselgeld zurückgibt. Sie lässt sich Zeit damit, und ich frage mich, wer sie eingestellt hat. Wenn ich so langsam in der Agentur arbeiten würde, hätte ich mich längst selbst gefeuert.
Der Vampir mit dem Haarreif biegt schon wieder ungelenk um die Theke, als mir die Kellnerin endlich mein Geld gibt. Er schenkt mir ein entrücktes Lächeln, und ich komme nicht umhin zurückzugrinsen, während die Kellnerin, ganz offenbar überanstrengt von meiner Bestellung, gegen die Spüle sinkt und ihren Ausschnitt zurechtrückt.
Ich greife nach der Tasse und wandere mit dem warmen Getränk zu dem internetfähigen PC in die Lobby, um nach einem guten Hotel in Bergen zu googeln und meine E-Mails zu kontrollieren, bevor mir noch ein wenig freundlicher Kommentar bezüglich ihrer Arbeitsmoral über die Lippen kommt.
Die Tasse in meinen Händen ist angenehm warm, und ich verharre einen Augenblick mit dem Gesicht über dem dampfenden Getränk, während der PC sich ins Internet einwählt. Dank des Sturms, der draußen herrscht, braucht die Kiste aus dem letzten Jahrhundert eine Ewigkeit, bevor sich der Browser öffnet und ich Zugriff auf die schier endlosen Weiten des Internets habe. Nach eingehender Recherche entscheide ich mich schließlich für das Viersternehotel »La Vague« und buche mir zwei Wochen Luxusurlaub. Als ich jedoch nach der Bestätigungsmail in meinem E-Mail-Fach suche, fällt mir beinahe meine Tasse aus den Händen.
Ich habe eine neue Mail von Sean, in der er mir erklärt, dass er mich nicht erreichen könne und mir nur mitteilen wolle, dass er sich entschieden hat, seinen Anteil an der Agentur zu verkaufen. Sobald ich von meinem Urlaub zurück bin, sollen wir uns zusammensetzen und die Einzelheiten regeln.
Ich fahre mir über die Stirn und starre die drei Zeilen an, die mir den Boden unter den Füßen wegreißen. Obgleich ich insgeheim wusste, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass Sean diesen Schritt geht, ist es wie ein Schlag ins Gesicht. Drei Jahre lang habe ich mir für meine Agentur den Arsch aufgerissen, und nun soll ich sie einfach so verlieren, weil ich nicht mehr das Bett mit diesem Arschloch teile?
»Dreckskerl«, entkommt es mir, bevor ich mich an meine gute Erziehung erinnere und den restlichen Inhalt der Tasse hinunterstürze. Meine Finger zittern, und ich schließe die Augen, um die Tränen zu vertreiben, die mich zu übermannen drohen.
Ich zwinge mich, ruhig zu bleiben. Einen Schreikrampf zu bekommen hilft mir genauso wenig weiter wie loszuheulen oder panisch zu werden, und so massiere ich meine Schläfen und fixiere Seans Namen, der unter der Hiobsbotschaft steht.
Wie konnte ich mich jemals in ihn verlieben? Oder gar glauben, den Rest der Ewigkeit mit ihm verbringen zu wollen?
Wie lange ich dasitze und die einzelnen Buchstaben anstarre, weiß ich nicht. Nur dass mein Kinn vor Empörung zittert, als ich schließlich aufstehe und nach nebenan an die Bar stolziere, um mir den widerlichen Geschmack von Verrat, der auf meiner Zunge liegt, mit Wodka auszubrennen.
Mittlerweile ist der Tresen ebenfalls gut besetzt, und ich lasse mich auf den letzten freien Barhocker fallen.
»Hey«, begrüßt mich ein in Leder gekleideter Kerl und mustert meinen Ausschnitt so auffällig, dass ich nur die Augen verdrehen kann.
»Geben Sie mir wenigstens einen aus, wenn Sie mich schon begaffen«, schnaube ich und knalle meine Handtasche auf die Tischplatte. »Wodka«, ergänze ich noch und schlage die Beine übereinander.
Der Kerl schenkt mir ein Grinsen und hebt die Hand, um bei der Kellnerin zwei Kurze zu bestellen.
Wie aus einem Shot zehn und drei Bier werden konnten, entzieht sich meinem Erinnerungsvermögen, doch als ich schließlich gegen halb drei vom Barhocker rutsche, ist da plötzlich Devon, den ich vorhin schon einmal kurz gesehen habe, als er mit zwei Frauen im Arm verschwunden ist. »Du bist betrunken«, stellt er fest.
Ich gebe ein wenig amüsiertes Schnauben von mir und grabsche nach der Tischplatte, um mich wieder auf die Füße zu hieven. »Bin ich nicht«, wehre ich trotzig ab, die Tatsache ignorierend, dass mein Kopf Karussell fährt.
Anstatt mich einfach in meinem Elend in Frieden zu lassen, umfassen seine großen Pranken meine nackten Oberarme. Seine Handflächen sind rau, und sein Griff ist fest.
»Wieso hast du dich so betrunken?«, hakt er nach, und ich beschließe, diese dumme Frage zu ignorieren. Als ob das nicht offensichtlich wäre. Mein Leben geht den Bach runter!
Seine Hände packen mich noch etwas fester, und ich gebe ein Keuchen von mir. »Lass mich in Ruhe … und überhaupt, Sie tun mir weh … Wieso haben Sie überhaupt Schwielen an den Händen? Niemand hat heute noch Schwielen an den Händen«, stelle ich zusammenhanglos fest. Zu meiner Schande muss ich feststellen, dass ich lalle. Meine Zunge ist schwer, und viel zu langsam kommen die Worte aus meinem Mund. Frustriert greife ich nach meinem Bier, als er mich freigegeben hat.
»Ich arbeite.«
Mir entkommt ein freudloses Lachen. »Seit wann nennt man Frauenbesteigen Arbeit?«
Scheinbar amüsiere ich ihn ganz vorzüglich, denn in seinen dunkelroten Augen steht der Schalk geschrieben. »Ich schraube gern in meiner Freizeit an heißen Teilen. Aber Geld verdiene ich nur damit, Fahrgestelle in Schuss zu bringen.«
Mein Hirn arbeitet auf Hochtouren. »Du reparierst Autos?«
Sein Lächeln wird noch ein wenig breiter. »Kluges Mädchen.«
»Wieso hast du meines nicht gleich repariert?«, will ich wissen und pike ihn gegen die Brust. »Ich bin einen ganzen Marathon gelaufen … und all das nur wegen meines Ex … dieses Arschlochs … Sean.« Ich tippe noch mal gegen seine Brust und ärgere mich darüber, dass ich mich nicht einmal mehr genug unter Kontrolle habe, um den Mund zu halten.
Devon zieht eine Augenbraue nach oben. »Der Motorraum war vollkommen ausgebrannt.«
Stimmt ja, da war was. »Hm«, stimme ich wenig begeistert zu und will mich wieder zur Bar umdrehen, allerdings misslingt mir das, und ich lande mit der Schulter voran an seiner Brust, genau wie mein noch volles Bier, das sich großzügig auf seinem Hemd verteilt.
Er lässt ein amüsiertes Lachen hören. »Ich glaube, du solltest deinen Rausch ausschlafen.«
Ich mache mich mit einem Schnauben von ihm los und lehne mich gegen die Bar, um einen Schluck von meinem Getränk zu nehmen, doch leider habe ich den letzten Rest wohl gerade auf Devon verteilt. »Toller Ratschlag … aber ich verzichte. Ich brauche keine Hilfe von dir … der letzte Kerl, von dem ich Hilfe angenommen habe, nimmt mich gerade aus wie eine Weihnachtsgans … also geh weg mit deinem Gerede.« Mit einem frustrierten Seufzen lasse ich das Bierglas zurück auf die Tischplatte sinken und greife nach meiner Tasche. »Gute Nacht.«
Der Boden unter meinen Füßen schwankt verdächtig, als ich in Richtung Tür gehe, und ich kann die Biker am Tisch nebenan lautstark ihre Hilfe anbieten hören, als ich an ihnen vorbeiwanke.
»Amy, so kommst du nie in deinem Zimmer an«, sagt Devon hinter mir, und ich spüre, wie sich ein Arm um meine Taille schiebt. Er riecht nach billigem Frauenparfüm und Sex. Eine Mischung, die mir in Anbetracht meines Alkoholspiegels beinahe den Magen umdreht.
»Ich kann alleine laufen«, presse ich hervor und versuche meinen Magen unter Kontrolle zu halten.
»Okay … Wie du meinst.«
Ich gleite Richtung Boden, kaum dass sich seine Finger um meine Mitte gelöst haben, und ich gebe ein gequältes Keuchen von mir, als ich mit dem Hintern voran auf dem Teppichboden der Lobby lande.
Devon hat die Dreistigkeit zu grinsen. »Hast du dir wehgetan?«
Ich schüttle den Kopf, während mein Magen Achterbahn fährt.
»Dann komm da hoch.«
Er hält mir eine seiner großen Pranken hin, und ich ergreife sie schließlich. »Versuch nicht zu kotzen, bis du über der Kloschüssel hängst«, brummt er und hievt mich einfach auf seine Arme.
»Ich werde nicht mit dir ins Bett steigen«, bringe ich lallend hervor.
Devon zieht eine Augenbraue nach oben, und plötzlich bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob ich das nicht sogar tun könnte, doch der Gedanke vergeht mir, kaum dass wir uns in Bewegung gesetzt haben.
Mir ist schlecht.
»Sag mir einfach, wo du hinmusst.«
»Dritter Stock … die Zwei«, bringe ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor.
Von dem Weg nach oben bekomme ich nicht viel mit. Ich bin viel zu sehr damit beschäftigt, zu verhindern, keine Sauerei zu veranstalten.
Nach einigem Hin und Her schaffe ich es schließlich, meinen Schlüssel zu finden, als wir vor der Tür angekommen sind, und als er mich auf die weichen Kissen sinken lässt, habe ich meinen Körper sogar halbwegs unter Kontrolle.
»Danke«, bringe ich heraus und sehe mit großen Augen dabei zu, wie Devon sich aus seinem Hemd schält und es angewidert zusammenknüllt.
Devons Körper ist unglaublich. Sein graues Shirt, das er unter seinem Hemd trägt, lässt nicht viel Raum für Fantasie. Die Muskeln sehen aus, als hätte sich ein sehr exzentrischer Künstler bei ihrer Linienführung ausgetobt. Zu schwungvoll, zu überschwänglich sind sie definiert, zu fantastisch sind seine Proportionen. Er sieht aus wie ein Gott, und ich wünschte für einen Augenblick, ich hätte auch seine Hose mit Bier getränkt.
»Versprich mir einfach, dass ich deinem Ex, sollte ich ihm je über den Weg laufen, die Fresse polieren darf«, unterbricht er meine Gedankengänge. »Scheint mir so, als hätte er es verdient.«
Ich gebe ein betrunkenes Lachen von mir und fahre mir übers Gesicht. Bei allen Göttern der Nyx, ich habe ganz vergessen, wie umwerfend Männer sind, die nicht länger im Bad brauchen als man selbst und deren Shirts sich über beeindruckende Muskeln spannen.
»Alles klar?«, hakt er nach, und ich setze mich auf.
»Hm … Vielleicht komme ich auf Ihr Angebot zurück«, seufze ich und versuche aus meinem Oberteil zu kommen, doch die Knöpfe wollen mir nicht gehorchen. Was ich da gerade tue und wieso, weiß ich selbst nicht so genau.
»Cool«, murmelt er nur und wirft sich sein Hemd über die Schulter. »Und jetzt solltest du deinen Rausch ausschlafen, Rotschopf«, empfiehlt er mir mit einem breiten Lächeln, meinen Striptease einfach ignorierend, und dann ist er verschwunden.
4
Ich werde durch den Radau geweckt, der von unten durch die Decke dringt. Eine Frau schreit sich die Seele aus dem Leib, eine andere stimmt mit ein, die Lautstärke schwillt an, und ich ziehe mir mit einem frustrierten Stöhnen die Decke über den Kopf. Doch anstatt mich damit abzuschotten, höre ich die Worte, die sie sich entgegenbrüllen, nur umso deutlicher. »Du hast was getan? Du elendige Hure, du dumme –«
Ich gebe ein Schnauben von mir und reiße die Laken zur Seite, setze mich auf und muss mich auf der Matratze abstützen, um nicht einfach wieder nach hinten zu kippen. Mein Schädel fühlt sich an, als wollte er explodieren.
»Oh! Zu viel Alkohol«, presse ich hervor und erinnere mich an den wenig seriösen Ausklang meines Abends. An meinen Beinahestriptease vor Devon und mein volltrunkenes Gerede. Ich werde ihm nie wieder unter die Augen treten können.
Das Licht des viel zu frühen Morgens schmerzt in meinen übermüdeten Augen, und ich reibe mir übers Gesicht, bevor meine Finger zu meinem Haar wandern, das sich über Nacht in ein heilloses Durcheinander verwandelt hat. Von meinem glanzvollen Styling, auf das ich sonst so viel Wert lege, ist an diesem Sonntag nicht viel übrig geblieben. Nicht einmal abgeschminkt habe ich mich gestern Abend. Das Make-up hat auf die Kissenbezüge abgefärbt, und auch die als wasserfest beworbene Wimperntusche hat ihre Spuren auf dem weißen Leinen hinterlassen.
Ich betrachte die Flecken auf dem Bettzeug nachdenklich. Dass die Sache mit Sean mir so an die Nieren geht, ist zu ärgerlich. Wie gerne wäre ich in dieser Sache ganz die toughe Geschäftsfrau, als die ich mich in den letzten Jahren ausgegeben habe. Jemand, der sich von nichts und niemandem aus der Bahn werfen lässt, weder von Geldsorgen noch von verletztem Stolz.
Mir schwindelt ein wenig, als ich auf die Füße komme.
Elendiger Alkohol. Ich habe noch nie viel vertragen, auch nach meiner Wandlung zur Vampirin nicht und ich bin auch noch nicht vollständig ausgenüchtert, wie ich feststelle, als ich ins Bad stolpere.
Drei weitere Male muss ich noch aus der Dusche krabbeln, weil ich immer wieder etwas vergessen habe. Zuerst mein Duschgel, dann meinen Rasierer, und schließlich ist meine Haarspülung nirgendwo aufzutreiben.
Das Badezimmer schwimmt. Nachdem ich endlich meine Morgenhygiene beendet und mich angezogen habe, herrscht in der Suite heilloses Chaos, bin ich doch auch bei der Auswahl meiner Klamotten nicht wesentlich koordinierter.
Meine Sonnenbrille auf der Nase und meine Handtasche unterm Arm, ziehe ich um kurz nach neun meine Zimmertür hinter mir zu und wandere in meinen Trollgummistiefeln nach unten, da mein Kopf noch immer energisch protestiert und zu dieser frühen Stunde noch nicht High-Heels-tauglich ist.
»Sieh an, sieh an, was kommt denn da hereingeweht?«
Devon, der am Frühstücksbuffet steht und gerade dabei ist, sich einen Kaffee einzuschenken, wirft mir quer durch den ganzen Raum ein breites Lächeln zu. Die breiten Schultern stecken in einem rot-blau karierten Hemd, über das er einen grauen Pullover gezogen hat, die Haare sind heute unter einer weißen Strickmütze versteckt und die langen Beine in dunkle Jeans gehüllt. Offenbar hatte er heute Morgen noch keine Lust, sich zu rasieren, sind seine Wangen und sein Kinn doch von schwarzen Stoppeln bedeckt, die die Biker um ihn herum beinahe wie die netten Jungs von nebenan aussehen lassen.
Ich ziehe bei seinen Worten eine Augenbraue nach oben und stolziere dann zu einem der Tische, um dort meine Tasche abzulegen.
Eine Kaffeetasse wird auf dem Tisch abgestellt, bevor ich mich in Bewegung setzen kann, um selbst zur Quelle des Koffeins zu kommen, und ich sehe verdattert über den Rand meiner Sonnenbrille.
»Du siehst miserabel aus«, erklärt mir da auch schon ungerührt meine Mitfahrgelegenheit, alias der Kerl, den ich gestern beinahe bestiegen hätte und dessen Gegenwart ich heute eigentlich meiden wollte. »Was hast du gestern noch mal alles getrunken?«
Ich gebe ein Seufzen von mir und lasse meine cremefarbene Clutch auf die Tischdecke fallen. »Alles. Zumindest fühlt es sich so an.«
Devons Augen blitzen vergnügt, als er sich auf den Stuhl zu meiner Linken sinken lässt. Offenbar amüsiere ich ihn bestens.
»Hm. Das erklärt zumindest, weshalb du deine Bluse falsch herum anhast.«
Entsetzt sehe ich an mir herunter.
Zu meiner grenzenlosen Schande muss ich feststellen, dass er recht hat. Die Angaben zum Waschen meiner Chiffonbluse hängen an der Seite heraus.
»Das darf doch nicht wahr sein«, entwischt es mir frustriert. Ich setze mich an den Tisch und vergrabe meinen Kopf in den Armen. Kann es noch peinlicher werden?
»Ach, sieh es doch mal so, immerhin hast du weder nackt auf der Theke getanzt, noch hast du mit jemandem geschlafen, den du …«
»Nicht hilfreich«, unterbreche ich seinen Wortschwall und zupfe mit hochrotem Kopf an der Bluse herum. Zum Glück habe ich noch etwas darunter, sodass ich schließlich mit einem Seufzen meine Sonnenbrille abnehme und aus meiner Bluse schlüpfe.
Er starrt mich an. Misstrauisch sehe ich an mir herab, den Chiffon-Stoff noch immer in der Hand. Alles bestens. An dem weißen Top, das in meiner schwarzen Jeans steckt, ist nichts Auffälliges zu sehen, bevor mir klar wird, das Devon nicht auf mich, sondern an mir vorbei in Richtung Tür starrt, wo der Kellner, den ich in Gedanken »den Storch« getauft habe, gerade dabei ist, meine liebste Hotelmitarbeiterin zu feuern.
»Die beiden sind verheiratet, Bea! Ich habe nichts dagegen, wenn du in deiner Freizeit mit wildfremden Männern herummachst. Sogar wenn du mal wieder mit einem unserer Gäste geschlafen hast, war mir das egal! Aber das geht zu weit! Ich bezahle dich doch nicht dafür, dass du mit verheirateten Männern schläfst, während ihre Frauen kurz unter der Dusche sind!« Der lange, ausgemergelte Körper des Storches zittert vor Empörung. Die Haare, die er auch heute mit einem Haarreif zurückgebunden hat, schütteln sich angewidert, und er gestikuliert wild mit den ungelenken Armen, während Bea Kaugummi kauend vor ihm steht und sich keiner Schuld bewusst ist.
Ich erinnere mich an das Gebrüll von vorhin, zähle eins und eins zusammen und spüre meine Wut über Bea, wie sie offenbar heißt, noch ein Stück wachsen. Sie ist also schuld daran, dass ich zu solch früher Stunde geweckt wurde.
»Was für ein Theater«, brummt Devon, dessen Aufmerksamkeit noch immer auf den beiden Streithähnen liegt. Seine Augen verfolgen die Szene scheinbar gespannt, und ich ertappe mich dabei, wie ich ein Stückchen näher rutsche. Ein so dunkles Rot, wie in Devons Iriden habe ich noch nie bei einem Vampir gesehen. Beinahe schwarz. Die meisten Vampire, die nicht mit blauen Augen gesegnet sind, wie ich selbst, haben eine Pupillenfarbe, die sich am besten als verwässertes Hellrot umschreiben lässt. Der einzige Vampir, der aus diesem Farbraster fällt, ist der neue Boss der Dunklen, den man häufiger im Fernsehen zu sehen bekommt, seit sein Vorgänger Abteilungsleiter der 26. wurde. Aber Semjon Coopers Augenfarbe, so der Name unseres neuen obersten Gesetzeshüters, ist eine Fehlfarbe. Ein Fehler der Natur.
Devons Augen hingegen sind einfach nur faszinierend. Sie erinnern mich an das Wolfsherz. Jenen riesigen Rubin, durch den angeblich bei einem Blutritual in grauer Vorzeit, die Magie der Welt verschwunden ist und das jeden Gestaltwandler unsterblich machte. So zumindest behauptet es die Sage.
Ich habe mir das Wolfsherz erst ein einziges Mal in Chicago angesehen. Damals war ich noch in der Schule, aber als jetzt die Sonnenstrahlen über Devons Iriden kriechen, ist es, als würde ich wieder direkt vor ihm im Museum stehen. Leuchtend warm, geschürt von einem inneren Feuer, zieht mich sein Blick in seinen Bann. Die fortwährende Bewegung, die durch das Dickicht aus Rot zu schweben scheint, übt eine beinahe magische Anziehungskraft auf mich aus. Und dann blinzelt er und katapultiert mich zurück in die Realität.
»Ich sollte mir Kaffee holen«, bringe ich raus, bevor Devon merkt, dass ich bei meiner Musterung beinahe vom Stuhl gefallen bin.
Er nickt nur, noch immer abgelenkt von dem Storch und der Ehebrecherin, und ich erhebe mich schnellen Schrittes, wobei ich allerdings am Stuhlbein hängen bleibe und gegen den Tisch stolpere, sodass sich Devons Kaffeetasse dazu entschließt, ihren Inhalt über den gesamten Tisch inklusive Devons Schoß zu verteilen.
Er gibt einen Fluch von sich und springt auf. »Oh verdammt!«, schimpft er und wischt sich über die Jeans.
Das Blut, das sonst in einem gleichmäßigen Fluss durch mein Herz strömt, stockt, und ich spüre meine Souveränität mal wieder von mir abfallen, wie altersschwache Blätter in einem Herbststurm.
Wie peinlich! »Tut mir leid. Ich … das war ein Versehen … du kannst … hier nimm die!« Ich reiche ihm meine Bluse. »Das tut mir so leid, Gott … ich hoffe, du hast dich nicht verbrannt?« Ich will schon mit der Bluse über seinen Schenkel wischen, als er mich am Handgelenk packt. »Es ist nur Kaffee. Kein Grund, dir deine teuren Fetzen zu ruinieren.«
Mir läuft ein Schaudern durch den Körper.
»Aber …«
»Ich bin nicht aus Zucker, keine Sorge, und jetzt nimm deine Sachen und komm einfach mit rüber an einen anderen Tisch. Ich bin mir sicher, dass der Kellner die Tischdecke auswechseln wird, sobald er damit fertig ist, seine Mitarbeiterin zu feuern.«
»Aber der Kaffee war doch heiß.«
Er grinst und lässt mich dann los. »Daran ändert deine Sorge nun auch nichts mehr.«
Ich werfe dem Fleck auf seiner Hose einen kritischen Blick zu, bevor ich unglücklich die Schultern zucke und schließlich nach meinen Sachen greife, um sie einen Tisch weiter zu befördern.
»Ich glaube, du bist noch ganz schön blau«, raunt er mir ins Ohr, als meine Bluse auf den Boden segelt, anstatt auf der Stuhllehne zu landen.
»Bin ich nicht«, protestiere ich. »Ich wollte mir nur einen Kaffee holen.«
Ohne auf seine Antwort zu warten, haste ich zum Kaffeevollautomaten, während der Storch es endlich schafft, Bea in die Lobby zu zerren.
Bei allen Göttern der Nyx, was tue ich denn da? Gestern scheine ich ein paar sehr wichtige Gehirnzellen in meinem Suff vernichtet zu haben. Zuerst besteige ich ihn beinahe in meinem alkoholgeschwängerten Zustand, dann klebe ich ihm heute Morgen zuerst beinahe in seinem Gesicht, und danach kippe ich ihm auch noch eine Ladung Kaffee über den Schoß.
Nachdem ich mich noch ein wenig weiter im Geiste beschimpft habe und der Automat meine Kaffeetasse gefüllt hat, muss ich feststellen, dass Devon sich nicht lange mit meinem Fauxpas beschäftigt hat. Er unterhält sich lauthals mit zwei Bikern über irgendwelche Motorräder und malt mit den Händen Umrisse in die Luft. Sie lachen, und ich sehe Devon zufrieden in seinen Stuhl zurücksinken.
Einer der Typen redet etwas von einer Harley Davidson, die er sich gekauft hat. Ein anderer irgendetwas von einem ganz heißen Teil, und in der Mitte sitzt Devon und erzählt mit einem müden Lächeln von irgendeiner Motorradmesse.
Und so kommt es, dass ich, als ich bepackt mit meinem Getränk an den Tisch zurückkehre, dort einer ganzen Truppe langhaariger Typen Gesellschaft leisten muss, deren knarzende, speckige Lederjacken und Kutten nach zu viel Motorenöl und Schweiß riechen.
Sie begaffen mich mit unverhohlenem Interesse, doch keiner lässt einen blöden Spruch ab oder versucht mich zu betatschen.
Ich rümpfe leicht angewidert die Nase, als mir einer der Männer beinahe seine lange Mähne in meine schwarze, koffeinhaltige Brühe hängt.
Es werden Bilder von irgendwelchen alten Schlitten und großen Maschinen hervorgezogen. Liebevoll erzählt einer von seiner »alten Lady«, die ihn nach dreißig Jahren noch immer nicht im Stich gelassen hat und an der er an jedem Wochenende herumschraubt, und ein anderer erklärt mit flammenden Worten seine Liebe für sein, wie ich sagen muss, hübsches Motorrad. Devon murmelt irgendetwas, das ich aufgrund der Lautstärke hier im Saal nicht verstehe, doch offenbar scheint es witzig gewesen zu sein, denn die Männer um ihn herum lachen auf und klopfen ihm auf die Schulter. »So stelle ich mir das vor! Der Junge weiß, wovon er redet! Oh, ich wette, das tut sie. Das Baby muss ich mir ansehen! Natürlich nur, wenn sie zum Verkauf steht«, blökt der Kerl direkt neben ihm so laut, dass der gesamte Saal zu ihnen sieht. Es scheint sie nicht zu stören.
»Mach das. Aber ich muss dich warnen. Ist nicht gerade billig.«
Sein Nachbar, der auf einem Zahnstocher herumgekaut hat, schenkt ihm ein Grinsen. »Ich denke, das kann ich mir leisten.«
Devon schenkt ihm ein Schulterzucken. »Wir werden sehen.«
»Ich mag deine Einstellung, Mann. Mag ich wirklich. Bist du hier aus der Gegend?«
»Ja. Ich habe eine Werkstatt drüben in Voss und eine in Bergen. Kommt einfach vorbei, wenn ihr in der Gegend seid.« Er kramt eine Visitenkarte aus der Brusttasche seines Hemdes und reicht sie seinem Nachbarn. »Und was die Sache mit dem Mustang angeht, ich kann euch gleich mal mein Baby zeigen. Steht auf dem Parkplatz. Dann können wir meine Begleitung in Ruhe frühstücken lassen.« Sein schelmisches Funkeln in den Augen lässt die anderen sich mit breitem Grinsen verdrücken, nicht ohne ihm noch mal auf die Schulter zu klopfen. »Gutes Material, Alter«, höre ich einen im Gehen mit einem Blick in meine Richtung murmeln, und ich bin kurz versucht, ihm meine Clutch hinterherzuwerfen.
»Deine neuen Freunde sind ja sehr charmant«, stelle ich fest, während er aufsteht.
Devon sieht mich eindringlich an. »Rocker und Biker sind die höflichsten Menschen, die ich kenne.«
»Tatsächlich?«
Er lächelt nachsichtig. »Die meisten schon.«
»Das bezweifle ich.«
In Devons dunkelroten Augen tanzen die Lichtreflexe. »Bin ich etwa nicht der charmanteste und höflichste Kerl, den du seit Langem getroffen hast?«
Er wartet nicht darauf, dass ich ihm eine Antwort gebe, stattdessen schlendert er lässigen Schrittes davon und zieht sich im Gehen seine Mütze vom Kopf. Darunter kommt ein schwarzer Schopf zum Vorschein. Er trägt ihn in einem abgewandelten Irokesenschnitt, die Seiten sind bis auf einen Zentimeter heruntergeschert, der Streifen Haar in der Mitte aber steht dick und glänzend in widerspenstigen Wellen vom Kopf ab. Und das Lächeln, das er mir über die Schulter zuwirft, ist so durchtrieben, dass ich unwillkürlich schlucke.
»Schönen Tag noch, Amy«, formen seine Lippen, und ich hasse mich dafür, dass sich bei seinen Worten ein wohliges Kribbeln in meinem Magen ausbreitet. Kann mein Urlaub noch schlimmer werden?
Wie ich am Montagmorgen feststellen muss, kann er das. Der Storch, der laut Namensschild eigentlich Johann heißt, reicht mir nämlich meine Kreditkarte mit einem »Tut mir leid, die funktioniert nicht«, als ich in der Touristeninformation ein Ticket für die Fähre buchen möchte.
»Das kann nicht sein. Am Freitag hat sie doch noch funktioniert.«
Er zuckt mit den Schultern. »Sorry, aber die geht nicht. Die ist gesperrt.«