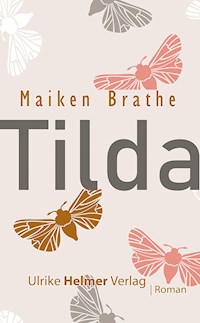Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: adakia Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Die Erkrankung und die darauffolgende Sterbebegleitung eines geliebten Menschen sind die größten emotionalen Herausforderungen innerhalb der Familie. Mit der gebotenen Ernsthaftigkeit, aber auch mit einer viel zu seltenen Leichtigkeit in der Annahme des Lebens mit all seinen Widrigkeiten beschreibt die Tochter Maiken Brathe mit einer wunderbaren Hommage den Verlust, der eigentlich nicht in Worte zu fassen ist. Fragen wie „Warum gerade wir?“, „Ist es normal, was ich fühle?“ und „Was kann ich tun?“ werden in diesem Buch beantwortet. Es gibt Einblicke, wie eine krankheitserprobte Familie die Ausnahmesituation bewältigt und es hilft Betroffenen, vorbereitet zu sein. Zu wissen, dass Angehörige sich Raum und Zeit nehmen, dass sie jederzeit Schwäche zeigen und sich thematisieren dürfen, gibt Kraft. Ganz egal wie alt wir sind: Wenn die Eltern erkranken, braucht das innere Kind Aufmerksamkeit und Trost.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 539
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MAIKEN BRATHE
Leg schon mal die Handtücher auf die schönsten Wolken
Wie man mit Würde den Kampf gegen Krebs verliert
adakia Verlag UG (haftungsbeschränkt)
Richard-Wagner-Platz 1, 04109 Leipzig
Bibliographische Information der Deutschen Bibliothek:
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte Daten sind im Internet über die Homepage http://www.dnb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts ohne Zustimmung des Verlags ist unzulässig.
Gesamtherstellung: adakia Verlag, Leipzig
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH
Coverfoto: Maiken Brathe
1. Auflage, Oktober 2021
ISBN 978-3-941935-93-8
Für meine Eltern und für Peter, der eigentlich R. heißt.
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Feenstaub
»You make me wanna shout!«
Die neue Zeitrechnung – der Kampf beginnt
Frohes Neues Jahr
Ostern. Oder besser gesagt: Oh je, Ostern!
Letzte Diamanten sammeln
Dann feiern wir erst recht!
Neue Wahrheiten finden, die wahrer sind als meine
Wenn das Ich Unmögliches schafft
»Time to go …«
Leg schon mal die Handtücher auf die schönsten Wolken
Mama, du hast es geschafft! Du bist eine Kriegerin!
Feenstaub
Epilog
Feenstaub
Nur die Augen waren zu sehen. Der Rest des Gesichts wurde von einer graugrünen Maske verborgen. Große Hände in Gummihandschuhen entfernten die Bettdecke von meinem Körper, und ich drehte den Kopf zur Seite, weil das Gesicht mit der Maske mich ängstigte. Ich hörte den Atem der Person gedämpft durch das Gewebe, wich einem möglichen Augenkontakt aus und blickte durch die Glasscheibe an der Wand in das benachbarte Krankenzimmer zu den anderen Kindern, von denen ich getrennt wurde. Ich weinte leise, weil einige Krankenschwestern genervt waren, dass ich so viel weinte. Ob diese Frau im Schutzkittel es auch war, erkannte ich nicht. Sie schob wortlos mein Nachthemd hoch und eine Bettpfanne unter meinen Po. Aber ich konnte nicht Pipi machen.
Die Bewegung schmerzte, und die Augen, die mir fremd waren, sahen zur Wanduhr über der Trennscheibe.
»Ich komme später wieder«, sagte eine Stimme, die ich nicht kannte, und die vermummte Gestalt verließ mein Isolationszimmer. Ich schaute auch zur Uhr. Hörte sie ticken, sah den Sekundenzeiger sich mindestens acht Mal um die mittlere Achse drehen, vernahm die Stimmen der anderen Kinder, die nebenan spielten. Meine Hüften schmerzten, untenrum entblößt, wurde mir kalt. Das Nachthemd klemmte zu einem krausen Stoffwulst geformt unter den Achseln. Ansonsten war ich nackt. Ich konnte die Arme nicht bewegen. Sie waren gefangen im Schmerz der Hände, Finger, Ellenbogen und Schultern. Alle Gelenke taten sich zusammen, auch die unteren Extremitäten, und fesselten mich, sodass ich mir vorkam wie ein gefangener Fisch, vorbereitet auf einem Tresen, um seziert zu werden. Ich hörte Stimmen vor der Tür und ein Rascheln. Ich konnte immer noch nicht Pipi machen, obwohl meine gefüllte Blase schmerzte. Sonst wird sie punktiert, hatte eine Schwester am Morgen gesagt, und ich weinte, weil ich Panik vor Spritzen bekam. Die Tür öffnete sich, und ich presste im Unterleib, aber es flossen nur die Tränen. Die Gestalt schaute mich mit den wunderschönsten Augen an, die ich kannte und kenne. Sie waren graublau, ganz anders als meine, die je nach Licht mal braun oder grün aussehen.
»Alles wird gut, mein Spätzchen«, sagte Mama hinter ihrer Maske, und ich wusste, sie lächelte mich an. Sie trug einen ähnlichen Kittel wie die Schwester, und ihre zarten schlanken Finger waren ebenfalls mit Gummi bedeckt. Mama streichelte mir sanft über die Haare und lockerte den Stoffwulst unter meinen Achseln. Ihre behandschuhten Finger strichen zart über meine Hüftknochen.
»Lass einfach los, Muckelchen«, flüsterte sie, und ich sah sie an, weinte vor Erleichterung und konnte endlich Wasser lassen. Mama zog die Bettpfanne vorsichtig unter mir weg, hielt sanft mein Becken, damit ich nicht abrupt auf die Matratze sank und bedeckte behutsam meinen nackten Körper. »Bald haben wir die Ergebnisse, mein Spatz, dann kannst du wieder zu den anderen Kindern.«
»Und wann kann ich nach Hause, Mama?«
Ich wollte mich aufrichten und in ihre Arme legen, aber ich konnte mich nicht bewegen. Mama las meine Gedanken. Sie setzte sich auf die Kante des Bettes, obwohl das streng verboten war, schob vorsichtig ihre Hände hinter meinen Rücken und zog mich an sich. Sie wog mich in ihren Armen, summte eine Melodie und flüsterte leise: »Bald, mein Muckel, sobald wir wissen, was du hast. Bald kannst du nach Hause …«
Und sie hörte auch nicht auf, als die Schwester die Tür aufriss, sich eine Papiermaske vor den Mund hielt und Mama aufforderte, von meinem Bett wegzutreten.
»You make me wanna shout!«
Donnerstag, 11. November – der Monat der Diagnose
Gestern habe ich erfahren, dass meine Mutter bald sterben wird. Sie ist siebzig Jahre alt. Mit siebzig muss man heute nicht mehr sterben. Mama schon. Die letzten zwanzig Jahre hat sie immer damit kokettiert, was für eine flotte Oma sie in diesem Alter sein wird. Und das ist sie auch: Charmant, mit der ganzen Welt im Chat, attraktiv und schick in Mode gehüllt, deren Zielgruppe gerade das Abitur machen sollte. Und mit ihrem rot gefärbten Haarschopf, der verwegen ein Signal in blonder Umgebung setzt, offenbart sie allen: Hier hausen keine alten, sondern wilde Flausen unter dem Pony. Dieser aufregende Mensch wird nun sterben.
Eigentlich wurde mir vor dreißig Jahren bewusst, dass meine Mutter irgendwann einmal gehen wird. Damals war ich zehn Jahre alt und musste mich mit dem Tod beschäftigen. Aber da ging es nur um mich und den abstrakten Gedanken, die Erde vielleicht verlassen zu müssen. Wie alle Menschen. Und damals dachte ich, am meisten wird es mir wehtun, wenn meine Ma nicht mehr sein wird.
Seit ein paar Wochen ging es ihr nicht gut. Sie hatte Schmerzen, bekam schlecht Luft. Ich drängte sie, einen Facharzt aufzusuchen, doch sie wollte einfach abwarten. Es würde schon wieder gut werden.
Schließlich traute sich Mama, konsultierte aber nur ihren Hausarzt. Der horchte sie ab, meinte, die Lunge sei frei, alles okay, sprach von einer Erkältung und verschrieb ein Antibiotikum. Dabei konnten selbst meine unbeholfenen Ohren erahnen, dass Mama Wasser in der Lunge hatte. Erst der anstehende Besuch bei ihrem entsetzten Kardiologen konnte meine Mutter überzeugen, sich ins Krankenhaus einweisen zu lassen.
Und da war sie nun, im Nachbarort, nicht begeistert, von daheim weg zu sein, aber ich im Ausgleich dafür unendlich froh über diese Wendung. Endlich kompetente Hilfe für Mama! Das versprach ein Happy End!
Gestern besuchten Papa und ich sie dort. Die ersten Untersuchungen waren abgeschlossen, und am Telefon klang Mama optimistisch, wie sie es immer ist. Ich brachte ihr einen Plüschhund im Weihnachtsoutfit mit, der sie zum Lachen bringen sollte. Wenn man auf seine Pfote drückte, fing der Hund an, die Hüften zu schwingen und mit den Ohren zu schlackern, während er den Song »You make me wanna shout« sang. Der Plan ging auf, meine Ma lachte genauso, wie ich es mir ausgemalt hatte, knuddelte den Hund, und als die Visite mit Arzt und Schwestern eintrat, alle mit unbewegter Miene, dachten Papa und ich, dass hier nur humorloses Krankenhauspersonal herumlief. Dann erfuhr ich, dass Mama todkrank ist und sterben wird. Ausgesprochen wurde es nicht, aber die Worte »Krebs im fortgeschrittenen Stadium« nadelten auf uns ein.
Meine Mutter – tot. Daran gedacht habe ich schon, wie es sein wird. Wenn sie vielleicht mit neunzig Jahren sich über mich aufregt, weil ich wie immer nicht ihrer Meinung bin. Sie mit der Hand auf der Brust ausruft: »Oh, mein Herz!« und einen letzten aufgebrachten Seufzer ausstoßen wird. Dann, so dachte ich, bin ich sechzig Jahre alt, ärgere mich, weil sie sich vor meinem letzten Gegenargument gedrückt hat und weine, bin auch wütend und werde wie sie selbst über den Tod ihrer Mutter sagen: »Das war okay für sie zu gehen.«
Seit gestern weiß ich, dass ihr krankes Herz sie nicht verraten wird. Ihr Herz, das so groß ist, zu groß für all ihre Gefühle! Was sie aber nicht ausbremsen kann, in all ihrer Lebenslust. Gestern habe ich erfahren, dass ihr die Luft zum Atmen genommen wird. Lungenkrebs.
Und ich sehe den Arzt an, der das sagt, sehe auf den Mund der Krankenschwester, den sie zu einer harten Linie zusammenpresst, sehe auf den Weihnachtshund, der die Ohren hängen lässt. Und ich frage mich, wie kann das sein? Ich verstehe es nicht! Wie kann diese Frau, die die Lebenslust gierig in sich aufsaugt und gedeihen lässt, Krebs in der Lunge haben?
Und ich sehe Mama in ihrem Krankenhausbett sitzen, hübsch wie immer, trotz unfrisierter Haare, mit ihrem unvergleichlichen Mund, dessen untere Lippe sich leicht nach vorne schiebt, wenn sie ihre Mimik nicht kontrolliert. Und ich will diesen Mund atmen sehen! Lachen sehen! Wie vor wenigen Sekunden, als der Weih-Nachtshund »You make me wanna shout« in die Welt grölte!
Und ich möchte eine Knarre nehmen, auf den Stoffhund abfeuern, will ihm seine wiegenden Hüften zerfetzen.
Atme, Mama, atme!
Vor dreißig Jahren, als ich als kleines Kind Rheuma bekam, war meine Mutter mein Mantel der Geborgenheit. Mein Schutzschild gegen Angst und Schmerzen. Verteidigte mich gegen experimentierfreudige Ärzte. Sie vertrieb für mich all die dunklen Nachtgestalten mit Namen Furcht. Für alles hatte sie eine Zauberformel. Ich habe nie wieder in meinem Leben einem Menschen so vertraut wie ihr.
Dann wurde ich älter, und ihr Feenstaub wirkte nicht mehr auf meiner rationalen Seele. Meine Ma und ich entfernten uns voneinander, rieben uns oft aneinander auf. Meine Liebe blieb allerdings immer und auch das ewige Gefühl, von ihr geliebt zu werden. Diesen Menschen verliere ich jetzt.
Ich habe mich sehr erwachsen gefühlt, mit vierzig Jahren, bis gestern. Gestern hat der Krebs nicht nur meiner Mutter die Luft zum Atmen genommen, sondern auch mir einen tonnenschweren Stein auf die Brust gelegt. Empathie nennen das vielleicht kluge Leute. Ich nenne es pure Verzweiflung. Wie soll ich denn ohne meine Mutter sein? Sie saß so ruhig da, auf ihrem ordentlichen Krankenhausbett, die Schultern leicht rund nach vorne gewölbt, die Hände im Schoß, schaute sie ins Nichts vor sich. Ihr gegenüber, rechts und links auf der Bettkante, saßen wir, Papa und ich, und haben geweint und geweint, unsere Gesichter überschwemmt. Sie saß nur da, so ruhig und gefasst, und nahm unsere Hände. Rechts und links umrahmten wir sie, aber in Wahrheit umrahmte und umarmte sie uns und war wieder meine Mama aus Kindheitstagen mit dem Schutzmantel aus Liebe und Geborgenheit. Hüllte uns ein und tröstete uns in unserer Angst, sie zu verlieren.
Heute weiß ich, das kleine Mädchen in mir hatte absolut recht. Es wird mir am meisten wehtun, wenn Mama mich verlassen wird. Ihr Herz wird nicht versagen, aber ihr Tod wird meines zerreißen.
Die neue Zeitrechnung – der Kampf beginnt
Dienstag, 16. November
Ich habe mich in einem Internet-Forum für Krebskranke, Angehörige und Hinterbliebene angemeldet. Meine Eltern sind paralysiert. Ich bin es vermutlich auch. Während Papa rund um die Uhr für Mama sorgt und versucht, ihr Wohlbefinden zu verschaffen, kann ich auf diesem Wege versuchen, Antworten zu finden, Hilfe zu bekommen. Einfach nicht allein zu sein, mit meiner Angst. Marc, mein Freund, ist für mich da, keine Frage. Nur ist es nicht seine Art, mit mir alle Gedanken durchzusprechen. Er ist der pragmatische Typ. Ich brauche hingegen Worte, um Realitäten zu meistern.
Alles Ausgesprochene hat weniger Schrecken. Angst ist für mich das unsichtbare Furchtgespenst. Wenn ich dem Spuk einen Namen gebe, kann ich es bekämpfen. Ich übernehme gerne die Rolle der Recherchierenden. Es ist ein Don Quijote-Gebaren gegen meine Hilflosigkeit. Ich kann nicht einfach nur zusehen, wie meine Ma gegen den Krebs kämpfen und wohl verlieren wird. Sie wird die Ritterin sein, aber nicht von der traurigen Gestalt. Sie ist auch nach der erschütternden Diagnose eher von der schillernden Gestalt. Ich bin nur ihr Knappe. Tatsächlich weise ich wie Sancho Panza meine Eltern auf die Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit hin. Wie schon Don Quijote glaubt auch meine Mutter mir nur begrenzt: Mein Blick sei getrübt – zwar nicht durch bösen Zauber, sondern durch unheilvolle Gedanken. Aber wie sehr darf ich auf der wahrscheinlich tödlichen Wahrheit pochen, ohne ihr den Lebensmut zu nehmen? Mama fordert das Unmögliche von mir: »Als du klein warst und chronisch krank wurdest, da haben wir dir schwören müssen, dir immer die Wahrheit zu sagen, wie es um dich steht. Und das haben wir getan. Jetzt schwöre mir, mir nichts zu verheimlichen. Schwörst du?«
»Ich schwöre, Mama.« Ich, immer der Wahrheit verpflichtet, wie Marc sagt. Für sie bin ich die Absicherung vor der dunklen, unbekannten Variablen. Ich begreife, dass ich ab diesem Zeitpunkt anfangen werde, meine Wertigkeiten neu zu modellieren. Die Wahrheit sagen und gleichzeitig Lebensmut stärken und ihre Angst bezähmen. Das sind gleich drei Wünsche auf einmal. Wo, bitte, kann ich mir ein Stückchen Hoffnung kaufen?
Donnerstag, 18. November
Meine Ma ist aus dem Krankenhaus heimgekehrt. Eigentlich war nach der Bronchoskopie, bei der durch den Mund Gewebe aus der Lunge entnommen und untersucht wird, eine Krebskonferenz geplant gewesen. Dort tun sich Ärzte zusammen, um das weitere Vorgehen zu besprechen: Ist eine Therapie sinnvoll? Sollte es eine Chemotherapie geben und wenn ja, welche?
Wenn ich es richtig verstanden habe, gab es bei der Bronchoskopie Probleme, Proben zu entnehmen. Nun steht die Entscheidung fest, dass Mama in eine Lungenfachklinik gehen wird. Morgen. Und ich habe große Angst, dass jede Sekunde, in der nichts gegen den verdammten Krebs getan wird, ein Diebstahl an meiner Mutter ist.
Die Klinik haben uns Freunde von mir empfohlen, ein Ehepaar, beide Neurologen, und ihnen verdanke ich, eine Ahnung von dem zu erhalten, was auf uns zukommen wird. Sie haben mir geholfen, den Arztbrief zu entschlüsseln. Ich merke, dass sie sich vorsichtig herantasten, mir die Hoffnung zu nehmen.
Sie weisen mich an, ich möge mich um bürokratische Angelegenheiten wie Patientenverfügung und Vollmachtserteilung kümmern. Wenn ich das tue, wenn ich jetzt meine Ma damit konfrontiere, dann wird sie verzweifeln. Oder auf mich schimpfen, ich hätte sie aufgegeben. Ich weiß nicht weiter.
Kann man all diese Sorgen an die Garderobe hängen und erst beim Verlassen der elterlichen Wohnung wieder aufschnallen? Ja, ich kann. Zumindest heute Abend und für den Moment. Es ist so schön, Mama daheim zu haben. Wir saßen gemeinsam an ihrem Bett: Papa, Marc und ich. Mama lehnte aufrecht in ihrer Bettnische, Kissen im Rücken, endlich wieder besser atmend, denn im Krankenhaus wurden ihr eineinhalb Liter Wasser aus der Lunge entfernt. (Zur Erinnerung: Der Hausarzt meinte nach Abhören der Lunge, es sei alles okay …)
Ich bin zu Mama ins Bett gekrabbelt, habe ihren Arm an meinem gespürt, ihre Wärme genossen. Und wir saßen da, Seite an Seite, die Hände berührend. Mama weiß, dass ich ein kompliziertes Wesen bin, das immer einen Sicherheitsabstand zu anderen Menschen benötigt. Ich überraschte sie deshalb mit meiner Nähe. Wir hatten Pizza bestellt, aßen im Bett; Mama nur symbolisch. Sie wird immer dünner. Am Fußende des Bettes saß Papa, Marc auf einem Sessel, Lion, der Yorkshire Terrier meiner Eltern, zu seinen Füßen. Und wir schafften es alle in diesem Moment, das Leben zu genießen. Trotz Angst. Trotz Todesangst.
Freitag, 19. November
Mit der Diagnose Bronchialkarzinom im Gepäck fährt Papa Mama in die Fachklinik, fast zwei Autostunden entfernt. Der Tumor sei nicht operabel und bösartig. Der Krebs hätte gestreut. Lymphknoten seien ebenfalls betroffen und auch das Zwerchfell und das Mittelfell. Die Prognose sei sehr schlecht. Definitive Aussagen wollte man nicht treffen. Ich weiß nicht einmal, was ein Mittelfell ist. Mama ist in einem geräumigen Zweibettzimmer in einem oben gelegenen Stockwerk untergebracht. Man kann auf eine Art Park hinausschauen, der im Novembergrau trostlos erscheint. Fast schon wie ein Totenblick von oben, denke ich. Im angegliederten Badezimmer okkupiert meine Ma dreiviertel der Regale mit ihren Kosmetika. Der Schrank ist zu klein für ihre modischen Klamotten. Sie hat noch alle Besucherstühle mit ihren Wohlfühl-Utensilien beansprucht.
Die Frau, die sich mit Mama das Zimmer teilt, ist nett und in etwa in ihren 60er Lebensjahren. Meine Mutter ist fast zehn Jahre älter, klapperdürr und dennoch neben ihr ein Sonnenschein. Mama ist das sehr wichtig. Sie flüstert mir zu, sie wolle nicht so krank wie diese Frau aussehen und so fürchterlich husten. Sie fände das eklig und sei froh, dass sie selbst vor dreizehn Jahren mit dem Rauchen aufgehört hätte. »Diese Frau raucht heimlich! Das rieche ich!«
Die Lunge meiner Ma wurde heute Vormittag gespiegelt. Mama rief mittags an und sagte, der Stationsarzt meinte, es sei kein Tumor. Er wüsste nicht, was es ist, aber es breitet sich aus. Man müsse die Untersuchung des entnommenen Gewebes abwarten. Eine Entwarnung gäbe es nicht.
Es ist eine Achterbahn der Gefühle. Es tut mir leid, wenn ich dieses Klischee bedienen muss, aber kaum eines beschreibt es besser! Nach diesem Tal aus Angst und Schrecken, dem furchtbaren Tumor-Gespenst, düse ich vorsichtig wieder nach oben und habe Hoffnung. Ich habe heute meinen Optimismus wiedergefunden!
Dienstag, 23. November
Papa verbringt täglich seine ganze Zeit bei Mama. Den kleinen Yorkshire Terrier packt er derweil in den Wagen. Es ist Winter, natürlich kalt, aber Lion hat einen dicken Pullover an, ist eingemummelt in Wolldecken und hält es manchmal über Stunden tapfer im Auto aus, während Papa Mama beisteht. Ich glaube, die kleinen »Ich-muss-mal-nach-dem-Hund-schauen«- Momente sind Augenblicke willkommener Flucht. Einmal heraus aus der Situation kommen, einmal das Gesicht nicht kontrollieren müssen. Mama soll nicht sehen, wie verzweifelt wir sind. Im Krankenhaus, gleich nach der Diagnose, flüsterte er Mama zu, er wolle auch nicht mehr leben, wenn sie nicht mehr sei. Das hat mich überrascht, vielleicht auch ein bisschen verletzt, weil ich doch auch noch da bin. Beim besten Willen kann ich es nicht einschätzen, was die beiden einander bedeuten. Meine Eltern, Erich und Rita, sind seit fast fünfzig Jahren Lebenspartner. Sie haben zwei Kinder, meinen Bruder und mich. Sie haben einen Hund, das heißt, eigentlich ist es Papas. Sie haben das Haus, das endlich abbezahlt ist, und sie haben jede Menge Träume vom Reisen.
Allerdings haben sie auch jede Menge Konflikte. Ein Leben, gespickt mit Disharmonie, Verletzungen, Schuldgefühlen und Missverständnissen. Trotz der gemeinsamen Richtung ist ihr Weg seit einigen Jahren ein Weg mit zwei einzelnen Fahrspuren.
Mamas Anruf erreichte mich heute, als ich gerade beim Hundetraining war. Zuvor sagte ich zu meiner Freundin, die mich begleitete, dass es vermutlich gar nicht so schlimm um meine Mutter stünde, wie es in dem vorherigen Krankenhaus gesagt wurde. Und dann rief Mama an. Ich suchte mir eine ruhige Ecke auf dem Hundeplatz. Es gab einen Unterstand, wo ich mich setzen konnte. Während Mama sprach, brach mir der Schweiß aus. Es war kalt, nass, November halt, und ich glühte und schwitzte. Vielleicht ist das normal, wenn man ohne Sicherheitsgurt in der Achterbahn geradewegs nach unten rast. Die zweite Lungenspiegelung blieb auch erfolglos. Es wurden ihr Proben ihrer Haut entnommen. Mir tut es so leid, was sie alles über sich ergehen lassen muss. Es ist wieder alles offen. Die Aussage »kein Tumor« wurde abermals relativiert. Ich ahne, dass meine Ma etwas falsch verstanden hat. Die Angst hat die Ohren hören lassen, was das Herz beruhigt.
Alles ist wieder möglich, wobei »alles« sich nur in die eine Richtung, in schlimm und schlimmer, orientiert. Wir hatten uns so an diesen Strohhalm geklammert. Jetzt brauche ich mindestens Containerladungen voller Strohhalme, um wieder ein bisschen positiver in die Zukunft zu schauen. Morgen bekommen wir endlich das ersehnte Arztgespräch. Der Arzt wird sicher nicht begeistert sein, wenn wir zu viert auftauchen werden. Mein Bruder ist extra aus dem Ausland gekommen. Wir vier, wir Ur-Familie, wir werden da sein und mit allen Ohren hören, Fragen stellen, auf Antworten pochen und vor allem Mama auffangen, wenn das Schlimmste und das Allerschlimmste eintreten sollten.
Mittwoch, 24. November
Wenn jemand wie ich nach Informationen giert, dann war das Arztgespräch heute wie Kreidequietschen an der Tafel. Der Mediziner hielt sich sehr bedeckt. Jeder Wunsch nach handfesten Diagnosen, positiven Prognosen oder sogar hoffnungslosen Informationen wurde nervenzerreibend vereitelt. Sicherlich geschieht das nicht absichtlich; vielleicht ist es ein Abwehrmechanismus gegenüber verzweifelten Patienten und Angehörigen.
Wir sind (leider) eine sehr krankheitserprobte Familie, allerdings war Krebs zuvor nie ein Thema. Zumindest für mich nicht. Ich merke, wie ich bei den ganzen Fachbegriffen versage und nicht einmal weiß, welche Fragen ich stellen muss. Ich schwimme verzweifelt in dunklen Gewässern, finde keinen Halt, keine Richtung, bin orientierungslos und habe Angst.
Mama ist so tapfer. Blutergüsse von Probenentnahmen sind an ihrem Dekolleté zu sehen, und sie nimmt weiter rapide ab. Trotzdem sitzt sie strahlend auf ihrem Krankenhausbett: die Haare adrett, Schminkutensilien um sich herum verstreut, die allgegenwärtige Handtasche mit ihren Handys, den Nasentropfen, der Handcreme, ihrem Leben davor, zusammengerafft auf ein kleines Volumen Normalität.
Im Krankenhaus erhielten wir durch den Arztbrief die wenigen Anhaltspunkte, in dem Begriffe fielen wie: bösartig, inoperabel und Befall von Zwerch- und Mittelfell. Ich begreife trotz Recherche immer noch nicht, wozu ein Mittelfell da ist. Erklärt wurde von den Ärzten nichts, stattdessen nur mitgeteilt, dass meine Mutter sich noch ein paar schöne Tage machen und »was gönnen« solle. Sollte uns das beruhigen? Welcher Kasper hat sich das so ausgemalt? Es ist unerträglich, so allein gelassen zu werden.
In der Lungenfachklinik haben wir nur einen weiteren kleinen Happen vorgeworfen bekommen. Jetzt heißt es Bronchialkarzinom in der linken Lunge. Der sei bösartig und nicht-kleinzellig. Auf meine Fragen, was das CT erbracht habe, und ob der Krebs schon gestreut hätte, gab es nur den Hinweis, dass man das erst einmal sehen müsse.
Meine Eltern leben in der Annahme, der Tumor ließe sich operieren: Tumor raus, Krebs weg! Nach dem ersten Arztbericht und dem vagen Verhalten des Mediziners, denke ich, dass bereits mehr Bereiche im Körper von Tumoren beziehungsweise Metastasen belagert sind.
Wenn ich in dem Krebsforum recherchiere, verstehe ich nicht, wieso andere Betroffene eine eindeutige Diagnose erhalten und bei Mama weiterhin so herumgedruckst wird. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Ich werde jetzt ein paar Nachtschichten einlegen und über nicht-kleinzellige Bronchialkarzinome im Internet recherchieren.
Heute habe ich Mama in den Arm genommen und gesagt: »Das Schlimmste, was passieren kann, ist nicht eingetroffen. Es gibt noch eine Therapiemöglichkeit. Wir werden dem Krebs jetzt kräftig in den Arsch treten und mit unserem Glauben Berge versetzen.« Und ich habe ihr gesagt, dass ich sie liebe und wir das schaffen. Jetzt hoffe ich inständig, dass ich mein Versprechen halten kann, und ich habe unendliche Angst, dass ich mir etwas vormache. Denn was weiß ich schon?
Freitag, 26. November
Heute bekommt Mama wieder die Lunge punktiert, und das Rippenfell wird freigelegt, um zu schauen, ob es ebenfalls betroffen ist. Was immer das auch heißen mag. Unfreiwillig stelle ich mir vor, wie Mama wie ein Fisch filetiert wird.
Vorhin rief sie mich an und erzählte, die Ergebnisse von den vorherigen Gewebeproben seien da. Da sei was, und es käme von den Drüsen. Chemotherapie beginne demnächst. Und sie fragte mich, was das wohl bedeuten würde, dass man den Tumor nicht mehr operieren könne? … Oh, Mama! Mich darfst du das doch nicht fragen!
Falls sich jemand danach erkundigen möchte, ob ich verzweifelt sei, dann würde ich schreien: »Ja, das bin ich!« Ich brenne auf Antworten, selbst wenn ich meine Fragen nicht formulieren kann. Meine Eltern möchten bei den zuständigen Ärzten nicht nachhaken. Dass Mama nur kleine Nachrichten-Portionen verträgt, das begreife ich. Sie ist so tapfer! Aber auch Papa traut sich nicht, weitere Informationen abzuverlangen.
Montag, 29. November
Vermutlich hat Mama ein Adenokarzinom. Es ist bösartig und entsteht im jeweiligen Drüsengewebe des betroffenen Organs, wie ich im Internet gelesen habe. Bösartiger oder maligner Tumor genannt, das bedeutet, er bildet Metastasen, also weitere Ansiedelungen des Krebses innerhalb des Körpers.
Eine Katastrophe! Bei einem Anruf sprach ich Mama darauf an, den Arzt von der Schweigepflicht zu entbinden. Sie druckste herum, meinte: »Erst mal abwarten«, der Doc sei schon ehrlich und man solle ihn nicht bedrängen.
Papa erzählte mir heute am Telefon, meine Ma hätte geäußert, ihr sei es unangenehm, dass ich alles hinterfrage. Sie selbst möchte es gar nicht so genau wissen. Es werde schon alles gut. Das habe ich mir sehr zu Herzen genommen. Vor allem auch, weil sie es mir nicht direkt gesagt hat. Ich weiß, ich bin extrem wichtig für sie. Deshalb möchte ich, dass sie keine Angst hat, mich zu bremsen, wenn ich ihrer Ansicht nach über das Ziel hinausschieße. Denn ich gestehe mir ein, anstrengend zu sein. Ich habe Journalistik studiert, bin hartnäckig, wenn ich etwas wissen will. Auch meine eigene chronische Erkrankung und der jahrelange Umgang mit Ärzten lassen mich manchmal zum Terrier werden, der sich in eine Sache verbeißt. Aber es macht mich verrückt, keine weiteren Informationen aus erster Hand zu erfahren! Es ist zurzeit ein bisschen wie »Stille Post« spielen:
Der Arzt trifft gegenüber meiner Ma eine Aussage, die sie – selektiert durch einen Filter der Hoffnung – an Papa weitergibt, und der ummantelt sie zusätzlich, sucht weichere, sanfte Worte oder hat sie selbst durch Wunschdenken, Überforderung und Unwissenheit in eine andere Wahrheit verwandelt, bevor ich sie erhalte. Und jetzt komme ich: die Spielverderberin! Ich möchte vorbereitet sein! Will planen können, mich innerlich darauf einstellen, was da kommen wird, damit ich meine Eltern auffangen kann. Ich will ALLES wissen!
Aber hier geht es nicht um mich. Und wenn Mama den Weg gewählt hat, nur mit klein dosierten Nachrichten dem Lungenkrebs den Kampf anzusagen, dann akzeptiere ich das. Ich werde nichts hinter ihrem Rücken tun. Ich werde alles tun, um sie aufzufangen und sie zu stärken. Es wird mir schwer fallen, ihre Scheuklappen aufzusetzen. In meinem stillen Kämmerlein kann ich ja weiter recherchieren, mit den kleinen Info-Brocken, die ich erhalten werde.
Dienstag, 30. November
Heute war ich endlich wieder bei Mama in der Klinik. Sie hat abgenommen, sieht aber zu fesch und gesund für die Diagnose Lungenkrebs aus. Niemand glaubt, dass sie siebzig Jahre alt ist. Sie ist groß und schlank, trägt modische Klamotten, die jede 16-Jährige neidisch machen würden, ohne dabei grotesk auszusehen. Im Gegenteil! Ihre Haare sind kurz und hellblond, der Pony in einem satten Rotton gefärbt.
»Wenn man so alt ist wie ich«, sagt meine Ma, »muss man Signale setzen, um nicht unsichtbar zu bleiben«.
Sie schaut nicht nur sehr attraktiv aus, sondern vor allem sieht sie nach einem Menschen aus, der das Leben liebt. Ich bin so stolz auf sie, wie tapfer und kampfbereit sie ist! Als ich ihr das sagte, nahm sie mich in den Arm und meinte, das habe sie von mir gelernt. Ich hätte als Kind immer gesagt: »Ihr braucht nicht zu weinen, es ist doch meine Krankheit.« Das nehme sie sich nun zu Herzen. Wir bräuchten nicht zu weinen, es sei ihr Krebs. Es ist Quatsch, wenn sie annimmt, ich sei so stark gewesen. Mama hat mir damals die Kraft gegeben, daran zu glauben, gesund zu werden. Und jetzt möge sie bitte diese Kraft für sich aktivieren, und ich würde alles geben, wenn ich ihr dabei helfen kann! Ich bin vierzig Jahre alt, aber ohne Zweifel plötzlich wieder das kleine Mädchen, das Töchterlein, das um ihre Mutter weint.
Jetzt, da ich um Mamas begrenzte Lebenszeit weiß, fallen mir so viele Momente mit ihr ein, die ich wie Diamanten für immer hüten möchte. Wie konnte ich diese Kostbarkeiten die letzten Jahre vergessen? Ist Disharmonie stärker als ein Edelstein? Ein Diamant in meiner Unvergessenheits-Schatulle wird dieser Nachmittag sein:
Ich war acht Jahre alt und radelte mit einer Freundin in die Marsch, um zu picknicken. Ein Gewitter kündigte sich an; auf dem platten Land schon von Weitem zu sehen. Meine Freundin kehrte um, ich wollte hingegen unbedingt mein Picknick haben und fuhr weiter. In der Marsch gab es keinen Schutz, keinen Unterstand, keinen Baum. Vielleicht ist das auch ganz gut, denn Blitze lieben solche Anlaufstellen. Im strömenden Regen gab ich irgendwann auf. Eskortiert von Blitz und Donner, bin ich nach Hause gestrampelt. Geweint hatte ich vor Angst, uferlos, tränenreich, aber ich war ohnehin komplett nass. Daheim zitterte ich, mir war so kalt. Mama trocknete mich ab, ordnete an, die Kleidung zu wechseln. Und als ich wieder zu ihr ins Wohnzimmer kam, schimpfte sie nicht, sondern wies mich an, mich neben sie zu setzen und meine eiskalten Hände auf ihren nackten Bauch unter ihre Bluse zu legen, um die Finger zu wärmen. Ihren Geruch werde ich nie vergessen. Meine Hände brannten, aber meine Ma scheute sich nicht vor meinen eiskalten Pfoten. Sie streichelte sie auf ihrem Bauch. Mein ganzes Leben lang habe ich mich nie wieder so aufgehoben gefühlt. Danach gab es heißen Kakao, und ich wusste: Das ist das Optimum an Geborgenheit.
Eigentlich sollte heute die Chemotherapie beginnen, aber die Ergebnisse von der Rippenfell-Gewebeprobe waren noch nicht da. Man hatte meiner Mutter heute früh die Hoffnung gemacht, man könne ihre Lunge operieren, wenn das Rippenfell nicht betroffen sei. Die einzige Chance auf Heilung. Am Nachmittag kam der Stationsarzt ins Krankenzimmer und erklärte ihr, die Proben würden noch an anderer Stelle untersucht und das bedeutet meist, dass etwas gefunden worden sei …
Abends
Ein kurzes Gespräch, wenige Worte und die Empfindung einer gezündeten Atombombe. Leider hat sich herausgestellt, dass das Rippenfell ebenfalls vom Krebs betroffen ist. Morgen bekommt Mama die erste Chemotherapie und kann dann nach Hause. Wir haben nur am Telefon sprechen können, allerdings war ich positiv überrascht, als sie meinte, sie habe sich alle Informationen genau vom Arzt aufschreiben lassen. Für mich, so habe ich fast das Gefühl. Vielleicht ist nach der rabiaten Durchtrennung aller rettenden Strohhalme doch der Wunsch nach Fakten bei ihr da. Ich bin schon heiß auf den Arztbrief. Endlich wird es mehr Gewissheit geben, der Feind bekommt einen Namen und ich die Möglichkeit, ihm ins Angesicht zu sehen und zu bekämpfen!
Die Tapferkeit meiner Ma beeindruckt mich über alle Maßen. Kein klitzekleines jammerndes Wort wagt sich über ihre Lippen. Und der Situation angepasst, sieht sie die Chemotherapie als ihre Freundin im Auftrag des Lebenswillens an. Sie ist kampfbereit!
Donnerstag, 02. Dezember – erster Monat nach Diagnose
Beim Vorgespräch zur Therapie musste meine Mutter eine Liste mit Fragen beantworten. Eine blutjunge Frau, vermutlich eine Auszubildende, interviewte meine Mutter nach möglichen Vorerkrankungen, Medikamenteneinnahmen und auch, ob sie schwanger sei.
»Ja«, antwortete meine 70-jährige Mama trocken und genoss es, das Mädchen ein bisschen aus der Fassung gebracht zu haben.
Mama hat die erste Chemogabe bekommen und ist guter Dinge, sogar ein bisschen euphorisiert! Sie hat die Krankenschwester gefragt, ob sie Cola beigemischt hätten, das sie vitalisieren würde. Cola ist es nicht, aber Kortison, das eine aufputschende Wirkung hat. Mir hat es gefallen, wie meine Ma lachend meinte, die Chemo sei ihr persönlicher Pac-Man, der, stetig in Bewegung, den Krebs auffressen wird. Morgen kommt sie endlich nach Hause. Was für ein Start in die Adventszeit. Früher freute man sich über Schokoladenüberraschungen hinter Kalendertürchen, heute freue ich mich, ENDLICH den Arztbericht lesen zu können.
Freitag, 03. Dezember
Papa hat mir eben den Arztbericht per E-Mail zugesandt. Wenn ich es richtig herauslese und es mir mit der TNM-Klassifikation, die bei Krebserkrankungen meist angewandt wird, und die zum Glück im Internet erklärt wird, entschlüsseln kann, also wenn ich es einfach richtig verstehe und begreifen kann, dann steht es sehr, sehr schlimm um Mama.
Die offizielle Diagnose ist: »Bronchialkarzinom li. zentral mit UL Atelektase u. Pleurakarzinose; Zytologie: Adenokarzinom; Tumorstadium: T4 N2-3 M1a«.
Die TNM-Klassifikation (Classification of Malignant Tumours) spezifiziert eine Krebserkrankung, die fortgeschritten ist.
»N2-3«, wie im Falle meiner Ma, verrät den zunehmenden Lymphknotenbefall und »M1a«, dass Fernmetastasen vorhanden sind. Nur das kleine »a« lässt sich via Internet nicht entschlüsseln. Steht das »a« für »ausweglos«?
Jemand gab mir den Hinweis, das »a« würde auf einen vorhandenen Pleuraerguss weisen. »Ausweglos« wird sozusagen noch einmal manifestiert.
Da die TNM-Werte meiner Ma sich in jeder Tabelle am maximalen Level bewegen, vermute ich, dass ihre Erkrankung im letzten Stadium ist, im IV., Stadium V gibt es nicht. Die Überlebenswahrscheinlichkeit nach fünf Jahren liegt, je nach Webseite, auf der ich recherchiere, bei einem bis eineinhalb Prozent.
Samstag, 04. Dezember
Das Internet-Krebsforum, in dem ich regelmäßig meine Gedanken aufschreibe, ist mein emotionaler Rettungsanker. Ich fürchte, jede Phase der Krebserkrankung, die wir durchleben, ob als Angehörige oder Betroffene, haben schon Tausende vor uns durchlebt. Alle Ängste darf ich dort thematisieren. Alle Fragen stellen. Und wenn ich ganz, ganz unten bin – so wie jetzt – dann sind Menschen da, die mich auffangen, die keine Angst davor haben, mir über den Weg zu laufen, wenn auch nur virtuell. Sie nehmen sich meiner an, umarmen mich über die Ferne des World Wide Web hinweg. Oft muss ich weinen, wenn ich begreife, dass viele dieser Menschen, die mich da unterstützen, selbst Lungenkrebs haben und doch ihre Kräfte für den eigenen Kampf bräuchten. Es ist ein unglaublicher Kontrast zu der dreidimensionalen Welt da draußen, wo Nachbarn kaum grüßen, Bekannte einen anderen Gang im Supermarkt wählen, um mir nicht zu begegnen.
Es ist ein schwerer Tag. Eigentlich bin ich eine gnadenlose Optimistin, aber im Moment bin ich nur verzweifelt. Der Glaube ist weg.
Heute erzählte Mama, Papa wäre nachts aus dem getrennten Schlafzimmer zu ihr gestürmt, weil er dachte, sie habe ihn gerufen. »Dabei bin ich doch nicht sterbenskrank«, beschwerte sie sich, und ich wusste nichts zu antworten. Unmittelbar nach diesem Vorfall träumte sie jedoch, dass Papa neben ihr ohnmächtig zusammenfiel und sie keine Hilfe holen konnte. Wenn ich mich als Hobbytraumdeuterin verdingen darf, würde ich sagen, meine Ma hat Angst, ihr Zustand überfordere Papa, auch wenn sie – zumindest vermittelt sie den Eindruck – sich selbst nicht als todkrank einschätzt. Vermutlich weiß sie gar nicht, was für einen starken, mitunter selbstlosen Mann sie an ihrer Seite hat.
Mama vertraut darauf, dass nach der Chemo alles gut wird. Der Tumor schrumpft, die Metastasen verschwinden, und sie hat ein paar schöne Jahre vor sich, in denen sie das Leben noch mehr genießen wird als ohnehin schon. Und ich bestärke sie im Glauben, positiv zu denken. Ich kann nicht die Wahrheit beugen, bin nicht in der Lage zu schwindeln, kann nicht behaupten: »Bestimmt wirst du noch ein paar Jahre gut leben.« Weil ich weiß, dass es eine Lüge ist. Stattdessen sage ich ihr: »Wir haben schon so viele Wunder erlebt, und es wird wieder Zeit für ein neues.«
Dem Tod bin ich selbst ab und an von der Schippe gesprungen und auch mein Onkel, der ältere Bruder meiner Mutter, ist ein wirklich zäher Brocken. So oft dachten seine Schwestern, er würde bald zu seinem Boss gerufen – mein Onkel ist Pastor – und immer wieder erholte er sich von schweren Operationen, so als zögerte er, dem eigenen Predigen vom Leben nach dem Tod zu vertrauen.
Aber gerade jetzt zweifle ich an krebsvernichtenden (oder wenigstens aufhaltenden) Wundern. Ich wünsche es mir so sehr, aber unser Wunder-Guthaben scheint aufgebraucht. Der Glaube ist weg, und das ist furchtbar. Ich kann meiner Ma nicht ins Gesicht lügen und »alles wird gut« beschwören. Ich würde mir nie verzeihen, wenn Sie das Vertrauen in mich aufgrund von Floskel-Flüsterei verlieren würde. Ich kann nur versuchen, ihr Halt zu geben, ihr schöne Momente zu ermöglichen und ihr zu sagen, wie sehr ich sie von Herzen liebe.
Sonntag, 05. Dezember
Ich hatte große Panik, dass Mama die ambulante Behandlung ihrem Hausarzt überlassen würde, den ich für einen totalen Idioten halte. Papa habe ich angefleht, mit ihr in eine Fachpraxis zu gehen, die zusammen mit der Klinik arbeitet. Ich habe gesagt, ich würde mir einen Finger abhacken, wenn sie sich von diesem Hausarzt behandeln lässt, und ich habe das wirklich ernst gemeint. Mama ist einverstanden, und morgen wird Papa sie in die onkologische Praxis fahren, um dort alles zu besprechen. Felsbrocken sind von meinem Herzen gerollt! Das muss den ganzen Kontinent erschüttert haben, als die Last von mir abfiel und auf die Erde knallte.
Ich versuche, mich vom Verzweifeln abzuhalten und nicht mehr in diesen Abschnitten zu denken: »Hoffentlich erlebt Mama noch den Frühling«, »Bitte, bitte noch meinen Geburtstag«, »Den Sommer noch, das wäre schön …«
Montag, 06. Dezember
Ein Nikolaustag ohne süße Überraschungen, dafür aber mit jeder Menge Sorgen: Die onkologische Praxis war erst nicht bereit, Mama zu betreuen und mit der Lungenfachklinik zusammenzuarbeiten. Daraufhin hat mein Vater dem Arzt in Aussicht gestellt, dass in der Zukunft die gesamte Behandlung in dieser Praxis erfolgen würde. Das war zwar gelogen, jedoch ohne dem wäre Mama ohne Notfallanlaufstelle vor Ort geblieben.
Wir halten uns alle wacker. Papa umsorgt Mama, und ich bemühe mich, auf ihn aufzupassen, damit er sich selbst nicht aus den Augen verliert und weiter seinen Sport machen kann. Der absolute Retter in der emotionalen Not ist der Yorkie. Lion ist Papas Alibi, das Haus zu verlassen, um Luft zu schöpfen und seine Mimik nicht kontrollieren zu müssen. Mit dem Gedanken beim Hund zu sein bedeutet, im Hier und Jetzt zu sein und die Ängste zu Hause zu lassen.
Die Menschen im Krebsforum erden mich und machen mir bewusst, dass jede Berechnung nur Prognosen sind, wenn in all den Informationen im Internet über das Stadium IV bei Krebserkrankung gesagt wird, die 5-Jahres-Lebenserwartung läge bei einem Prozent. Es sind nur Durchschnittswerte! Und wenn ich recht überlege, unsere Familie ist vielleicht vieles, aber eines waren wir niemals: durchschnittlich!
Freitag, 10. Dezember
Vermutlich ist es Mama ein bisschen unheimlich, wie sehr ich ihre Nähe suche und sie mit Geschenken überhäufe. Vielmehr wünscht sie sich eher Normalität. Deshalb habe ich einen Gang zurückgeschaltet und versuche, mich zu zügeln.
Apropos Besuch: Ein weiterer Diamant in meinem Schatzkästchen der Erinnerungen sind Mamas Besuche bei mir in der Kinderklinik, als ich dreizehn Jahre alt war. Sie musste fast 1000 Kilometer mit der Bahn fahren, um bei mir zu sein. Sie mietete sich in einem kleinen Zimmer gegenüber dem Krankenhaus ein. Die Betreiber des Gästehauses nutzen jeden Winkel ihres Hauses, um Eltern kranker Kinder unterzubringen. Das war keine Nächstenliebe, sondern profitabel. Denn Rheumakinder konnten nicht weit gehen und wenn man dem Klinikalltag entfliehen wollte, folgte man seinem Besuch auf das Gästezimmer. Die Nahegelegenen waren sehr gefragt. Ich schaffte gerade die wenigen Meter zur gegenüberliegenden Straßenseite. Das Haus, in dem Mama während ihres Aufenthaltes wohnte, war von außen attraktiv, mit traditionellen Wandbemalungen, wie sie in Süddeutschland üblich sind. Mamas Zimmer befand sich im Erdgeschoss. Es maß etwa sechs Quadratmeter und war das ehemalige Gästeklo des Hauses. Die Toilette war abgebaut, aber das Waschbecken war hängen geblieben. Das Bett füllte fast den ganzen Raum, und meine Ma und ich lümmelten darauf herum, aßen Bienenstich und Kekse und lästerten über die geizigen Vermieter. Alles wurde verwertet: Das sonntägliche Frühstücksei wurde in alten, ausrangierten Unterhosen gereicht, auf der Toilette befand sich neben dem Einmachglas als Klobürstenhalter auch das Toilettenpapier: in Rechtecke geschnittene alte Zeitungen. Kein Wunder, dass Mama, wenn sie dem Ruf des Darmes folgen musste, lieber im Besucher-WC der Klinik verschwand. Wie zwei Astronauten in einer Zeitmaschine kamen wir uns vor, Mama und ich, die in ihrer Zeitkapsel in der Kindheit meiner Mutter gelandet waren, in der es kein Toilettenpapier mit gedruckten Blumen gab. Sie hat mir stundenlang von damals erzählt.
Das Bett im Raum der ehemaligen Gäste-Toilette war der perfekte Ort dafür. Aus Scheiße kann man Gold machen, und ich aus einer Klo-Erinnerung einen Diamanten.
Sonntag, 12. Dezember
Marc und ich fahren heute Nachmittag zu meinen Eltern. Es ist der zweite Advent. Zuvor hatte ich geplant, die Papiere für die Patientenverfügung mitzunehmen, um das endlich zu regeln. Es ist ein grauenvoller Gedanke, Mama könne plötzlich nicht mehr für sich selber sprechen und wir hätten keine Möglichkeit, in ihrem Sinne für sie zu handeln. Ich habe auch ein Exemplar für uns ausgedruckt, um zu demonstrieren, dass jeder Mensch sich um diese Belange kümmern sollte, egal ob man krank, jung oder alt ist. Ein bisschen habe ich Angst davor, ob sie das Thema herunterziehen wird. Aus dieser Sorge entstand die Idee, ein Familien-Event daraus zu machen, bei dem wir alle die Formulare ausfüllen. Vielleicht gäbe es Anregungen für die Beantwortungen und eine versteckte Hilfestellung für meine Mutter. Ich möchte das unbedingt vor der zweiten Chemo erledigt wissen, weil ich mir große Sorgen um Mama mache. Neben der körperlichen Kräftezehrung wird ihr wahrscheinlich die Therapie besonders psychisch viel Energie abverlangen, und so müsste sie sich emotional nicht mehr mit diesen Formalitäten belasten. Jetzt habe ich jedoch beschlossen, die Aktion zu verschieben. Mir ist gerade nach Leichtigkeit zumute. Heute soll es nur Kaffee und Kekse geben und keine trüben Gedanken. Wir haben das alle vier so bitter nötig.
Montag, 13. Dezember
Mamas Blutuntersuchung ergab, dass ihr Leukozyten-Wert super ist, sprich: Die weißen Blutkörperchen im Blut sind rege vorhanden und verrichten brav ihren Dienst gegen Krankheitserreger und andere Missetäter.
Die Anzahl der roten Blutkörperchen ist allerdings gering. Die sogenannten Erythrozyten transportieren Sauerstoff zu den Organen und Kohlendioxid zurück. Demnächst wird eine weitere Blutuntersuchung anstehen, und dann erhält Mama eventuell eine Blutkonserve, um neue Kraft zu bekommen. Trotz ihrer Erschöpfung sieht Mama frisch aus. In der Tat ist sie eine Meisterin des Vertuschens. Wenn sie vermeiden möchte, jemand könne erkennen, wie schlecht es ihr geht, lächelt sie alles Unbehagen – das auf ihrer oder der anderen Seite – einfach weg.
Mama meint, sie habe kleine Bläschen im Mund, wobei laut Patienteninformationsblatt ihre Schleimhäute durch die Chemo nicht zur Entzündung neigen sollten. Sie hat große Angst vor einer Pilzerkrankung.
Endlich hat Mama wieder etwas zugenommen. Sie gibt sich sehr große Mühe, ordentlich zu essen. Ich bin stolz auf sie! Früher, als sie noch dick war und fast 100 Kilo wog, da hätte sie mich ausgelacht, wenn sie wüsste, ich würde solch einen Satz über sie schreiben. Mama, liebste, tapfere Mama, jedes Gramm unterstützt dich in deinem Kampf.
Mittwoch, 15. Dezember
Gestern war Mama müde und gereizt. Kleinigkeiten haben sie auf die Palme gebracht und sie stritt sich mit Papa über Nichtigkeiten. Vermutlich gehört das auch zu dieser Ausnahmesituation. Und als Außenstehende möchte man am liebsten beide an den Schultern nehmen und sie schütteln und schreien: »Es geht um Leben und Tod! Vergesst diesen banalen Mist! Wir müssen zusammenhalten!«
Nachmittags besuchte ihre beste Freundin meine Mutter. Mama erzählte mir heute am Telefon, wie schön es gewesen sei, sich einfach über alles und nichts unterhalten zu können. Mehrere Stunden sei sie da gewesen, und meine Ma sei mit einem guten Gefühl schlafen gegangen.
Diese Beschwingtheit muss bis heute angehalten haben, denn am Telefon berichtete mir Mama überglücklich, sie sei heute eine Stunde im Weihnachtsgetümmel shoppen gewesen. Allein!
»Endlich mal ohne deinen Vater!«, meinte sie und lachte über meine Bedenken.
Als wir noch einmal zwei Stunden später sprachen, war sie atemlos und erschöpft, aber immer noch euphorisiert angesichts ihrer Einkaufstour.
Das tut mir gut, denn ich war ein bisschen down. Ich schiebe die ganze Zeit die Aufgabe mit der Patientenverfügung vor mir her. Heute habe ich stundenlang darin gelesen und weiß einfach nicht, wie ich Mama die Papiere geben soll, ohne dass sie eine Angstattacke bekommt.
Donnerstag, 16. Dezember
Mamas Einkaufstour am Vortag lief nicht nur bei mir mit gemischten Gefühlen ab. Auch wenn Papa nicht direkt dabei war, so war er doch stets in der Nähe. Die meiste Zeit, so erzählte er mir, verbrachte sie in der Parfümerie und ließ sich beraten und schminken. Ein Produkt nach dem anderen schwatzte man ihr auf, so mein Vater. »Aber was soll’s, wenn es sie glücklich macht?« Sie habe viel Geld ausgegeben, meinte er. Und ich dachte, wenn man Glück kaufen kann, nur für den Moment, dann ist jetzt der Zeitpunkt, um genau das zu tun.
Mama hat neuerdings einen brennenden Ausschlag am ganzen Körper. Kurzzeitig bestand der Verdacht einer Ganzkörper-Gürtelrose (davon habe ich noch nie gehört, oje!), aber heute Nachmittag war sie gleich bei einer Hautärztin, die vermutet, der Ausschlag werde durch ihr Schmerzmedikament Novalgin verursacht. Mein persönlicher Tipp wäre ja, Ursache sei die brutale Chemie, die meine Ma durch die Chemotherapie bekommt. Der Name verrät es doch schon. Sie erhält die Medikamente Carboplatin und Alimta. Ich traue mich gar nicht, deren Nebenwirkungen zu googeln.
Statt Novalgin erhält Mama nun Schmerztropfen und ein Opiat. Ich kann es nur so laienhaft ausdrücken. Die Informationen, die ich von meinen Eltern erhalte, sind häufig so formuliert, meist sogar noch vager, wenn sie von meiner Ma stammen.
Sie scheut sich davor, ein Opiat zu nehmen, aber ich denke, nächste Woche, wenn sie wieder in der Lungenfachklinik sein wird, kann sie all ihre Bedenken mit dem Stationsarzt durchsprechen, dem sie vertraut und, ich würde fast sagen, schöne Augen macht.
Gestern hatte Mama eine Begegnung, die sie mitgenommen hat, aber vielleicht resultiert daraus ihr neuer Energieschub, auch wenn das für Außenstehende makaber klingen mag: Eine Freundin der Familie, die wir lange nicht gesehen haben, besuchte meine Eltern. Der Freundin war nicht bekannt, wie schwer Mama erkrankt ist, und sie war fassungslos, dass sie Lungenkrebs hat. Sie meinte: »Warum denn du auch?«, hob ihre Perücke an und zeigte ihren kahlen Kopf. Seit dem Sommer weiß die Freundin von ihrem Lungenkrebs. Da Deutsch nicht ihre Muttersprache ist, konnte sie nicht genau erklären, welche Form sie hat. Sie bestreitet den Kampf allein. Mama ging aus dieser Situation mit dem Gefühl heraus, sie sei ein Glückskind, nicht einsam zu sein, uns zu haben und vor allem diesen unsagbaren Glauben, es werde alles gut.
Freitag, 17. Dezember
Als meine Ma heute Morgen zur Bluttransfusion gehen sollte, ist sie zusammengeklappt. Sie musste von Papa wieder ins Bett gebracht werden und konnte zum Glück später in die Praxis. Mit ein bisschen Stolz meinte sie, sie wäre die Schnellste beim Bluteinverleiben gewesen. »Ein sehr ambitionierter Vampir bin ich.«
Später ging es ihr leider nicht besser. Durch die lange Autofahrt auf den vereisten und schneebedingt huckeligen Straßen hatte sie starke Schmerzen. Das neue Opiat half nicht, wie sie meinte, und sie fand es furchtbar, benebelt zu sein. Sie will es nicht mehr nehmen und es erst einmal mit Paracetamol-Schmerzmitteln versuchen.
Außerdem hat Mama heute einen vergrößerten Lymphknoten unter ihrer Achsel entdeckt. Das ängstigt sie zu Recht sehr. Ich habe versucht, ihr die Sorge zu nehmen. Momentan habe ich selbst vergrößerte Lymphknoten und wollte ihr damit beweisen, dass das immer mal passieren kann. Aber ich gestehe, auch ich habe Schiss. Nicht nur ihretwegen.
Früher … vor einem Monat ist für mich schon früher! Das Leben ist nun eingeteilt in ein Vor der Diagnose und ein Danach. Früher also hätte ich mir keine Gedanken gemacht. Krebs war für mich nie ein Thema. Jetzt bin ich ein bisschen paranoid.
Samstag, 18. Dezember
Zwei Tage vor Heiligabend wird Mama ihre zweite Chemotherapie bekommen. Deshalb will sie Weihnachten nicht feiern. Aber das ist nicht so wichtig. Oder vielleicht doch, weil es das letzte gemeinsame Weihnachten sein wird und ich mich immer glitzernd daran erinnern will? Ich habe es nicht in meiner Hand.
Heute waren Marc und ich bei meinen Eltern, die Patientenverfügung voller guter Absichten im Gepäck. Ausgefüllt haben wir sie noch immer nicht, aber das heikle Thema angesprochen. Es war ein schöner Nachmittag und Abend, gefüllt mit Waffeln, Eis und innigen Gesprächen. Wir haben viel gelacht und einfach nur eine gute Zeit zusammen gehabt. Die Normalität war nicht gespielt, sondern empfunden. Meine Eltern haben eigentlich keine Angst vor dem Thema Patientenverfügung. Im Gegenteil: Meine Mutter will das spätere Geschehen selbst bestimmen können.
Ihre Schwägerin meinte mal, dass sie sich am liebsten »Nicht reanimieren!« auf die Brust tätowieren lassen würde, damit niemand ihr Herz zwingen könne, erneut zu schlagen. Das fand Mama nicht nur lustig, sondern absolut nachvollziehbar.
Neulich kam eine Sendung mit dem Titel »Das Geheimnis der Heilung« im Fernsehen. Der Bericht stellte dar, wie mittlerweile auch die Schulmedizin die Selbstheilungskräfte der Menschen entdeckt hat und versucht, unkonventionelle oder althergebrachte Methoden zu übernehmen, um die Selbstheilungskräfte bei Patienten zu aktivieren. Ich weiß, dass viele Menschen denken, dies sei nur eine blendende Maßnahme, ein emotionaler Rettungsring, an den man sich klammert. Allerdings habe ich selbst schon solche »Wunder« erlebt. Deshalb verweigere ich, die Angst vor dem Schlimmsten zuzulassen und konzentriere mich darauf, Mama emotional zu unterstützen, damit sie einen Weg findet, ihre Selbstheilungskräfte zu aktivieren.
Die Patientenverfügung wollte sie heute leider nicht ausfüllen.
Montag, 20. Dezember
Heute ist so ein Tag, den ich am liebsten aus dem Kalender streichen und anschließend das Kalenderblatt fressen möchte. Meine Ma habe ich leider nicht gesehen. Wir haben stattdessen telefoniert, und sie erzählte, wie sie beim Friseur gewesen sei. Dieser färbte ihre Haare, zuppelte darin herum und meinte: »Nee, nee, nicht ein Haar locker von der Chemo!« Etwas Schöneres hätte er Mama nicht sagen können.
Ich hingegen durchwanderte heute das Tal der Tränen und konnte einfach nicht aufhören, zu weinen. Natürlich dominiert die Angst um Mama mein gesamtes Leben, zusätzlich geht es mir blöderweise gesundheitlich nicht gut. Das hebt nicht gerade die Stimmung.
Verrückt ist aber, wie meine Ma mich selbst am Telefon durchschaute und anfing, mich zu trösten. Da bin ich plötzlich – bildlich gesprochen – wieder das kleine Mädchen, das mitten in der Nacht in Mamas Bett klettert, damit sie mir die bösen Albträume verscheucht. Fast schäme ich mich für meine Schwäche, aber Mama meinte zu mir: »Wenn du immer nur mit einem lachenden Gesicht vor mich treten würdest, würde ich dir gar nichts mehr glauben. Mir ist es lieber, du zeigst, was du fühlst, dann kann ich dir auch deine Zuversicht glauben.«
Mama und ich sind uns sehr nah. Immer schon. Und vielleicht sind wir uns manchmal auch zu ähnlich, weshalb es in der Vergangenheit oft Streit und Tränen gab. Tränen auf beiden Seiten, und das ist schon verrückt, denn die letzten zehn Jahre hatten wir uns überhaupt nicht mehr verstanden. Aber jetzt, nach der Diagnose, ist es, als hätte jemand einen großen Reset-Knopf gedrückt, alles wurde auf die ursprüngliche Ausgangsposition zurückgestellt, und wir durften noch einmal von vorne anfangen und füreinander da sein.
Mittwoch, 22. Dezember
Heute am Telefon sagte Mama zu mir, sie habe gar nicht im Bewusstsein, dass die Festtage vor der Tür stehen. Und irgendwie sei ihr das auch nicht wichtig. Wichtig sei nur die Familie, und die habe sie ja auch vor und nach Weihnachten. Heiligabend wird Papa sie aus der Klinik abholen. Mein persönliches Weihnachtsgeschenk habe ich schon bekommen: Heute wurde Mama geröntgt, und der Arzt teilte ihr mit, der Tumor sei kleiner geworden! Gibt es ein wunderbareres Geschenk als das Wissen, dass die Chemo wirkt?
Samstag, 25. Dezember
Der Heiligabend fühlte sich nur verkehrt an. Marc und ich waren mit meinen Hunden Tuuli und Liv bei seinem Vater Uwe und dessen Lebensgefährtin Petra. Normalweise wären noch meine Eltern hinzugekommen. Mama ging es schlecht und Papa blieb bei ihr. Ich wollte so gerne bei meinen Eltern sein! Ich empfand es als falsch, woanders zu »feiern«, aber alle wollten es so handhaben. Nur ich nicht. Ich wurde nicht gefragt und musste mich fügen. Ein Jahr zuvor schrieb ich eine bitterböse Glosse über Petras selbstgemachten Schlehenlikör, der unsere Eltern am gemeinsamen Heiligabend in regelrechte Kommunikationszombies verwandelte, mit großem Streitpotenzial, je öfter die kleinen Gläschen Richtung Münder geführt wurden. Selbst mein entspannter Papa ließ sich nicht belehren, nicht mehr Auto zu fahren, auch wenn der Promillewert schon bedenklich war. Noch in der Nacht setzte ich mich hin, um meine Frustration in giftige Wörter zu packen. Anderenfalls wäre ich explodiert. Heute wünsche ich mir solch eine Weihnacht zurück! Und auch, dass mein kleinstes Problem besoffene Eltern sind.
Sonntag, 26. Dezember
Zwei Tage nach der Chemo hat Mama trotz Hilfe versprechender Medikamente starke Übelkeit – fröhliche Weihnachten! Heute ging es ihr endlich wieder besser. Sie hat gegessen, aber alles in allem nochmals vier Kilo abgenommen.
Ein Hautausschlag, den sie seit der ersten Chemo hat, ist dank einer mysteriösen Creme besser geworden. Sie nimmt die Flecken und das Jucken gerne in Kauf, denn sie begreift glücklicherweise die Chemo als eine wichtige Verbündete im Kampf gegen den Krebs. Übelkeit, Juckreiz, Hautausschlag und dünner werdende Haare sind einfach Kollateralschäden, die sie tapfer erträgt. Ich bin so stolz auf sie! Haare, Fassung, Contenance: All das darf sie gerne verlieren – nur nicht ihre Hoffnung und ihren Willen, zu kämpfen!
Mittwoch, 29. Dezember
Die letzten zehn Jahre ist Mama ein Social-Network-Junkie gewesen. Bei so vielen Kaffeebesuchen saßen Marc, Papa und ich allein in der Küche, den Tisch mit Kuchen und Waffeln beladen und warteten auf Mama, die in ihrem Zimmer saß und »nur eben schnell« noch ein paar Freunde am Computer verabschieden wollte, die irgendwo im WWW, meist im Ausland lebten und meine Ma umschwärmten. Sie hat zeitweilig alles um sich herum vergessen. Die virtuellen Freunde waren ihr wichtiger als wir. Auch ihre ganze Kommunikation veränderte sich. Unangenehme Gesprächspartner konnte sie ja im Chat wegklicken, bei ihrer Familie klappte das nicht. Sie war deshalb immer genervt von uns, wenn wir nicht unbedingt ihrer Ansicht waren oder ihr kein »Daumen hoch« gaben.
Diese Leidenschaft ist sicherlich recht ungewöhnlich für eine 70-jährige Frau, vor allem, weil sie sich nicht in irgendwelchen Strickanleitung- oder Gartenpflege-Foren herumtreibt, sondern begeisterte Facebookerin ist und nur Netzwerke besucht, in denen heftig diskutiert und geflirtet wird. Ich habe sie einmal per Google gesucht und fand sie in einem amourös ambitionierten Forum, meine hübsche Ma, mit einem Webcam-Foto von ihr, etwas unscharf, attraktiv und noch nicht von Krankheit gezeichnet. Sie war mit ihrem zweiten Vornamen dort angemeldet – als 44-jährige Nichtraucherin, ohne Kinder und Religion, deren Leitsatz sei: »Lebe den Tag, als wäre es dein Letzter«. Das birgt schon eine gewisse Ironie, wenn man gerade als Tochter seine (durch das Rauchen bedingte) lungenkrebskranke Mutter unterstützt! Geschockt war ich darüber nicht, eher amüsiert. So ist halt meine Ma: lebenshungrig und grenzenlos neugierig. Mögen ihr diese Eigenschaften helfen, den verdammten Krebs zu besiegen! Wird das reichen, damit ich Silvester ins neue Jahr ohne Panik im Herzen wechseln und denken kann, es werde nicht Mamas letzter Jahreswechsel sein?
Frohes Neues Jahr
Samstag, 01. Januar – zweiter Monat nach Diagnose
Ich habe geträumt, ich sei in einer fremden Stadt. Plötzlich überschwemmt eine riesige Flutwelle alle Straßen und Bürgersteige. Menschen und Tiere werden mitgerissen oder flüchten vor den Wassermassen. Ich bin mit meinem Herzenshund dort, und mit Papa, den ich mehr liebe, als ich sagen kann. Aber Papa ist plötzlich nirgends mehr zu sehen. Verzweifelt versuche ich, meinen Hund und mich zu retten, will schneller rennen als die Welle (dabei kann ich seit meinem zehnten Lebensjahr nicht mehr schnell laufen) und tippe tausend Mal die Telefonnummer von Papa in mein Handy, während ich flüchte. Aber vergebens. Er antwortet nicht. Ich bin allein.
Ich habe ein Foto von Papa auf meinem Handy. Ein Bild von unserer ganzen Familie. Ich sitze dort auf seinem Schoß, bin vier Jahre alt. Er schaut mich zärtlich an, hält seinen Arm beschützend um mich. Ich fühlte mich so sicher. Deshalb habe ich das Bild auf meinem Handy als Hintergrundbild. Ich brauche dieses Gefühl im Moment. Das wurde mir jetzt genommen.
Heute, eine Stunde nach Mitternacht, rief Mama weinend an. Sie klang genauso verzweifelt, wie ich mich nach diesem Traum fühlte, in dem ich Papa verloren hatte.
Mama war verzweifelt, weil Papa betrunken war. So kann sie nicht kämpfen, flüsterte sie unter Tränen. Sie weiß, dass er im Keller eine Flasche Ouzo vor ihr versteckt. Ich weiß es jetzt auch. Und ich bin genauso verzweifelt wie sie. Wie soll ich es ertragen, beide zu verlieren?
Ich will alles tun, um beiden zu helfen. Will wie mein Vater auf dem Foto sein und meine Eltern in den Arm nehmen und beschützen. Aber was kann ich tun, wenn mein Papa sich nicht helfen lässt?
Es ist 04.04 Uhr am 01. Januar. Und es ist das traurigste Neujahr in meinem Leben.
Montag, 03. Januar
Mama wusste schon länger von Papas geheimer Alkohol-Reserve im Keller, aber zuvor sei er nie so betrunken gewesen wie an diesem Abend.
»Was will er machen, wenn mit mir etwas geschieht und er müsste mich schnell ins Krankenhaus fahren?« Und sie weinte, als sie mir am Telefon von ihrer Angst berichtete, dem Gefühl, nicht mehr in Sicherheit zu sein. Mir war nur aufgefallen, dass Papa abends, wenn wir zusammensaßen, den Inhalt von zwei Flaschen Bier regelrecht inhalierte.
Alkohol ist ein furchtbares Gespenst in meinem Leben. Mama hatte einige Jahre ein Alkoholproblem. Als ich Rheuma bekam, fing sie an, zu trinken, weil sie es nicht ertragen konnte, mich leiden zu sehen. Dazu muss ich sagen, dass 1980 die Schulmedizin nicht besonders erfahren auf dem Gebiet »juvenile Polyarthritis« war. Vier Jahre wussten wir nicht genau, was für eine Erkrankung ich habe, und es war eine Odyssee von Klinik zu Klinik, von Intensivstationen zu Isolierstationen, von Unihörsaal zu Seminarräumen. Hinzu kamen die Vorwürfe meiner Oma, Mama wäre eine schlechte Mutter, sonst wäre ich, ihr Kind, nicht krank geworden. Mama hat immer noch Schuldgefühle gegenüber meinem älteren Bruder, der oft allein zu Hause war, wenn sie mich in der Klinik besuchte.
Das alles hat Mama nicht ertragen und getrunken. Nach ein paar Jahren absolvierte sie einen erfolgreichen Entzug. Sie wusste, dass sie niemandem betrunken helfen konnte. Sie begann ein neues Leben ohne Droge: schlank, attraktiv und selbstbewusster.
Als meine Ma den Alkohol aus ihrem Leben verbannte, tat das Papa gleich mit, um sie zu unterstützen. Erst vor zwei Jahren hat er mal hier und da ein Bier getrunken, traf sich bei seinem Sportlerstammtisch mit Freunden. Und ich denke, er war dort nie suchtgefährdet, weil er gerne aktiv ist, schwimmt und Inlineskates fährt. In diesem Jahr fuhr mein Paps sogar einen Marathon mit achtundsechzig Jahren. Er fuhr als Letzter durchs Ziel, aber gab niemals auf. Und bekam damit den meisten Beifall. Ich war so stolz auf ihn.
Er ist in kurzer Zeit beunruhigend dick geworden. Erst dachte ich, es käme durch den fehlenden Sport, seit er Mama pflegt. Jetzt weiß ich, es liegt am Alkohol.
Mein Papa war immer der Organisator, der Akteur, der Beschützer der Familie. Man musste ihn stets stoppen, damit er mal Arbeit an andere delegierte, denn er ist kein Jungspund mehr. Das Macher-Dasein hat seine Spuren im körperlichen Verschleiß hinterlassen.
Und meine Ma – so sehr ich sie auch liebe – ist eine Exzentrikerin und ein ängstlicher Mensch. Viele Dinge – sei es die richtige Kosmetik oder das spezielle Vitaminpräparat – geben ihr Sicherheit. Ohne diese Krücken verzweifelt sie, weint, weil der Halt schwindet, oder sie kann sogar ausrasten. Und sie ist herzkrank obendrein, regt sich schnell auf. Die wichtigste Stütze in ihrem Leben, ihr Ehepartner, bricht gerade weg. Ich weiß, wie sehr Papa körperlich und emotional an seine Grenzen stößt. Mama glaubt, sie werde den Krebs besiegen. Wir wissen, dass ein Sieg schon bedeutet, wenn sie den Status quo erhalten kann, und der ist elendig genug.
Das ist ein großes Dilemma und wenn Mama so positiv über die Zukunft berichtet (»wenn ich wieder gesund bin, dann …«), ist es schwer, nicht in Tränen auszubrechen, sie positiv zu bestärken, aber nicht zu belügen. Ein schwieriger Drahtseilakt. Und ich weiß: Ich kann nach dieser Anstrengung nach Hause gehen und mein Kissen vollheulen, oder den Telefonhörer auflegen, wenn ich der Situation nicht gewachsen bin. Mein Vater kann das nicht.
Ich habe Papa letzte Nacht von meinem Traum in einer E-Mail erzählt und wie sehr ich ihn liebe und dass ich Angst um ihn habe. Wir haben uns gesehen und miteinander gesprochen. Gestern habe ich ihm eine weitere Nachricht geschrieben und gesagt, dass ich ihn nicht unter Druck setzen will. Im Gegenteil, ich will alles tragen, was ich tragen kann! Und dass ich mit Mama reden werde. Auch sie muss ihr Verhalten ändern. Nicht alles persönlich nehmen und – nötiger denn je – ein dickeres Fell bekommen! Ich weiß, das ist viel verlangt, denn sie ist so tapfer!