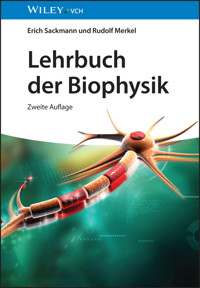
79,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Die Biophysik ist ein sich sehr rasant entwickelndes Wissenschaftsfeld an der Grenze zwischen Physik, Chemie und Biologie. Biophysik behandelt die Kontrolle der Selbstorganisation lebender Materie und deren Funktion durch die Physik. Die Themen reichen von der Steuerung der Struktur und Funktion zellulärer Organellen durch molekulare Kräfte und Zell-Signalsysteme bis zur Physik der Immunologie, Hörphysiologie und Biorhythmen.
Das Lehrbuch der bekannten Biophysiker Erich Sackmann und Rudolf Merkel gibt eine umfassende Einführung in das spannende Gebiet der Biophysik, wie es an Hochschulen und Universitäten im deutschsprachigen Raum gelehrt wird. Die Autoren behandeln ausführlich die Mechanik, Thermodynamik und Elektrodynamik der Bausteine lebendiger Systeme wie Proteine, Zelle, Membranen und Vesikel. Ausgehend von diesen Grundlagen werden fortgeschrittenere Themen beleuchtet wie die Dynamik und Selbstorganisation in biologischen Systemen.
Die vorliegende zweite Auflage wurde vollständig überarbeitet und mit neuen Themen ergänzt: Messung anisotroper Kräfte in Proteinen, Statistische Mechanik der Nichtgleichgewichtszustände in Proteinen, Entdeckung von Mechano-Enzymen, elektrohydrophobe Aktivierung von Membranproteinen, Physik der Zell-Adhäsion, -Migration und -Proliferation, statische und dynamische Struktur des Chromatins.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1901
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Lehrbuch der Biophysik
Zweite Auflage
Erich Sackmann und Rudolf Merkel
Autoren
Prof. Dr. Erich Sackmann†Technische Universität MünchenInstitut für BiophysikJames-Franck-Str. 185748 GarchingDeutschland
Prof. Dr. Rudolf MerkelForschungszentrum JülichIBI – Institut für Biologische Informationsprozesse52425 JülichDeutschland
Titelbild: Unter Verwendung einerAbbildung von© Creations/Shutterstock.
2. Auflage 2025
Alle Bücher von WILEY-VCH werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
© 2025 Wiley-VCH GmbH, Boschstraße 12, 69469 Weinheim, Germany
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
Print ISBN: 978-3-527-41250-1ePDF ISBN: 978-3-527-41283-9ePub ISBN: 978-3-527-41284-6
Umschlaggestaltung: Wiley
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelblatt
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur ersten Auflage
Für unsere Familien und Studenten
Vorwort zur zweiten Auflage
Häufig verwendete Symbole
Abkürzungen
Teil I: Einleitung
Einleitung
Zu diesem Buch
Über den Inhalt
1 Eine Einführung in das Studium der Biophysik
1.1 Woher kommt und wozu treiben wir Biophysik
1.2 Eine kurze Geschichte der Biologischen Physik
1.3 Leben als Zusammenspiel von Genetik und Physik
Literatur
Notes
Teil II: Einführung in die Zellbiophysik
2 Die Zelle
2.1 Die Zelle als dicht gepacktes, kolloidales System aus funktionellen Untereinheiten
2.2 Die funktionellen Kompartimente (Organellen) der Zelle
2.3 Wie neue Zellen entstehen
2.4 Der Zellzyklus
Literatur
Weiterführende Literatur
Note
3 Einführung in die Thermodynamik
3.1 Phänomenologische Thermodynamik
3.2 Ein statistischer Zugang zur Wärmelehre
Anhang 3A: Die Methode der Kreisprozesse zur Herleitung der Entropie
Anhang 3B: Herleitung der Zustandsgleichung eines idealen Gases im Rahmen der statistischen Mechanik
Anhang 3C: Herleitung der Gibbs-Duhem-Beziehung
Literatur
Weiterführende Literatur
Notes
4 Biologisch essentielle physikochemische Reaktionen
4.1 Das Säure-Base-Gleichgewicht
4.2 Reaktionen mit Elektronentransfer (Redoxreaktionen)
Weiterführende Literatur
Notes
5 Wichtige Bausteine lebender Systeme und deren Polymerisation
5.1 Die Aminosäuren und ihre Polymere
5.2 Die Purin- und Pyrimidinbasen
5.3 Zucker als Energiespeicher, Strukturelemente und molekulare Erkennungsgruppen
5.4 Der Träger der biologischen Energie: ATP
5.5 Lipide sind Grundbausteine der Biomembranen und Langzeitspeicher für Energie
Anhang 5A: Chemische Strukturformeln
Literatur
Weiterführende Literatur
Notes
6 Physikalische Eigenschaften von Proteinen
6.1 Grundlegendes zur Struktur der Proteine
6.2 Physikalische Wechselwirkungen in und zwischen Proteinen
6.3 Elektrostatische Wechselwirkungen
6.4 Wasserstoffbrückenbindungen
6.5 Die hydrophobe Wechselwirkung
6.6 Dehydratisierungskräfte
6.7
Depletion forces
: Eine durch Makromoleküle vermittelte Wechselwirkung
6.8 Freie-Volumen-Effekte in Lösungen vieler Komponenten (molecular crowding)
Anhang 6A: Visualisierung von Molekülstrukturen
Anhang 6B: Die Theorie der skalierten Partikel – ein analytisches Modell zur Berechnung des zugänglichen Volumens in gefüllten Lösungen
Literatur
Weiterführende Literatur
Notes
7 Faltung, Konformationsumwandlungen und -fluktuationen von Proteinen
7.1 Proteinfaltung
7.2 Elemente der Sekundärstruktur, Faltung aufgrund lokaler Wechselwirkungen und Konformationsumwandlungen
7.3 Die Dynamik von Biomakromolekülen
Anhang 7A: Eine genauere Betrachtung der Theorie des Übergangszustands
Anhang 7B: Ergänzung zur Kramers-Theorie der Reaktionsrate
Anhang 7C: Der Verlet-Algorithmus zur Integration der Zeitschritte in klassischen Molekulardynamiksimulationen
Literatur
Weiterführende Literatur
Notes
8 Molekulare Erkennung
8.1 Das Konzept der spezifischen Bindung
8.2 Mechanisches Brechen spezifischer Bindungen
8.3 Thermisch fluktuierende Federn: Der Brownsche Oszillator
Literatur
Weiterführende Literatur
Note
Teil III: Biologische Membranen
9 Molekulare Architektur und Funktionen biologischer Membranen
9.1 Weshalb Physiker sich für biologische Membranen interessieren sollten
9.2 Mikroanatomie biologischer Verbundmembranen: Erythrozyten
9.3 Die molekulare Architektur biologischer Membranen
9.4 Der Aufbau elektrischer Potentiale durch molekulare Pumpen und Ionentransporter
9.5 Ein kurzes Intermezzo über die Biosynthese der Membranen
9.6 Intrazellulärer Transport durch Vesikel schafft Ordnung in den Zellen
9.7 Eisenimport durch clathrinummantelte Vesikel
9.8 Signalübertragung und Signalverstärkung an Membranen
9.9 Die Photonenempfänger der Augen funktionieren nach dem Prinzip der Hormonverstärker
9.10 Signalübertragung und Signalverstärkung durch Rezeptor-Tyrosinkinasen
9.11 Die molekularen GTPase-Schalter und ihre Helferproteine (GEF, GDI, GAP)
9.12 Über ein hyperbolisches Gesetz der Hormonwirkung und die Effizienz diffusionsbestimmter Reaktionen in zwei Dimensionen
Literatur
Notes
10 Selbstorganisation, Phasenumwandlungen und Dynamik biologischer Membranen
10.1 Selbstorganisation und lyotroper Polymorphismus von Lipiden in Wasser: Einschalige Vesikel als Nullmodell biologischer Membranen
10.2 Thermisch und elektrisch induzierte strukturelle Phasenumwandlungen von Membranen
10.3 Molekularstatistische Modelle der thermotropen Phasenumwandlung
10.4 Die Hierarchie dynamischer Membranprozesse
10.5 Membranen als Flüssigkeiten zwischen zwei und drei Dimensionen
10.6 Dynamische Schaltung funktioneller Proteine durch elektrostatisch-hydrophobe Rekrutierung an Membranen
10.7 MARCKS: Ein Beispiel für die elektrostatisch- hydrophobe Membranbindung von Proteinen
10.8 Durch selektive Lipidanker vermittelte Membrankopplung und interaktive Kopplung der Enzyme
Anhang 10A: Die Abschätzung von Bindungsenergien aus absoluten Gleichgewichtskonstanten
Literatur
11 Membranen als semiflexible elastische Schalen
11.1 Einführung in die Grundlagen der Elastizität weicher Schalen
11.2 Die Formenvielfalt biologischer Schalen als Minimalflächen der elastischen Energie
11.3 Lokale Modulation und Stabilisierung der Formen durch Kopplung zwischen Zytoskelett und Membran
11.4 Membranen als statistische Flächen, Membranflackern und Ondulationskräfte
11.5 Die aktiv getriebene Oberflächenrauigkeit der Zellen
Literatur
12 Thermomechanische Prinzipien der Strukturierung und Funktion biologischer Membranen
12.1 Einleitung: Warum müssen wir uns mit Phasendiagrammen von Lipidlegierungen befassen?
12.2 Die Thermodynamik von Lipidmischungen
12.3 Die Verteilung von Lipiden und Proteinen durch das Prinzip der hydrophoben Längenadaption
12.4 Membrandefekte als Modulatoren biochemischer Reaktionen
12.5 Materialimport (Endozytose) und intrazelluläre Verteilung durch Transportvesikel (Endosomen)
12.6 Vesikelfission durch Zusammenspiel von Mechanoenzymen mit Regulatoren der lipidgesteuerten Membrandestabilisierung
12.7 Membranfusion als spannungsgetriebene Membraninstabilität
Anhang 12A: Die geometrische Konstruktion von Phasendiagrammen
Anhang 12B: Endozytose und intrazelluläre Sortierung und Umverteilung der Lipide und Proteine
Anhang 12C: Rab-vermittelter Vesikeltransfer zwischen intrazellulären Kompartimenten: Ein Beispiel
Literatur
Notes
13 Zelladhäsion als Wechselspiel spezifischer, universeller und elastischer Kräfte
13.1 Einleitung
13.2 Modellsysteme liefern Einblicke in die Physik der Adhäsion
13.3 Die Zelladhäsion als Benetzungsübergang erster Ordnung
13.4 Modulation der Zelladhäsion durch externe Kräfte
13.5 Zelladhäsion in extrazellulären Polymernetzwerken
13.6 Stimulation der T-Lymphozyten durch Adhäsion auf antigenpräsentierenden Zellen (APZ)
13.7 Adhäsionsdomänen als Reaktionszentren der Lymphozyten-Stimulation
13.8 Über die durch Adhäsion vermittelte globale Polarisierung der T-Zellen
Anhang 13A: Klassifizierung der Zellrezeptoren
Literatur
Note
Teil IV: Biophysik der Nervenleitung
14 Physiologie und Elektrostatik der Nervenleitung
14.1 Das Nervensystem und die Phänomenologie der Nervenleitung
14.2 Elektrostatik der Nervenleitung
14.3 Myelinbildung durch Kontrolle der Zelladhäsion
14.4 Steuerung des gerichteten Wachstums der Axone durch Zell-Zell-Kontakte
Appendix 14A: Adhäsionskontrollierte Wegfindung von Axonen
Literatur
Notes
15 Elektrodynamik der Nervenerregung
15.1 Die Erregung der Nervenmembran: Das Aktionspotential
15.2 Der Äquivalenzschaltkreis erregbarer Membranen
15.3 Fundamentale Experimente der Neurophysik
15.4 Die Huxley-Hodgkin-Gleichungen
15.5 Molekulare Mechanismen des Ionentransports durch Kationenkanäle
15.6 Der molekulare Mechanismus der Signalübertragung an Synapsen und Axonhügeln
15.7 Kinetik und Statistik des Ionentransports durch Membranen
Anhang 15A: Ein thermodynamisches Modell elektrisch und chemisch gesteuerter kooperativer Prozesse
Literatur
Notes
16 Axonmodelle und die Signalfortpflanzung in Axonen
16.1 Nervenleiter als Koaxialkabel mit diffusivem Signaltransport
16.2 Die Huxley-Hodgkin-Gleichung und die Ausbreitung aktiver Aktionspotentiale
16.3 Zur Beschleunigung der Signalfortpflanzung erfand die Natur die Myelinhülle
16.4 Das Fitzhugh-Nagumo-Modell der Nervenerregung
16.5 Die Beziehung der Nervenleitung zum Van-der-Pol-Oszillator
16.6 Realisierung des Fitzhugh-Modells durch Tunneldioden
Literatur
Note
Teil V: Biophysik der Zellen und Makromoleküle
17 Biorhythmik durch Synchronisation selbsterregender Oszillatoren
17.1 Ein lebenswichtiges Beispiel: Die Steuerung der Herzkontraktion
17.2 Abnormale Rhythmen: Herzrhythmusstörung und Herzblock
17.3 Zellkulturen als Herzmodelle
17.4 Mechanische Synchronisation rhythmisch schlagender Muskelzellen
17.5 Periodische Erregung und Synchronisation des Van-der-Pol-Generators
Literatur
Notes
18 Mikroanatomie und Funktion des Zytoskeletts
18.1 Zur Struktur und Biochemie der Grundbausteine
18.2 Aktinbindeproteine regulieren den dynamischen Umbau der Aktinnetzwerke
18.3 Aktinbindeproteine als Regulatoren des aktinbasierten Zytoskeletts
18.4 Regulation der dynamischen Instabilität der Mikrotubuli über die mechanische Verspannung der Protofilamente
18.5 Antrieb der Zellmigration durch sequentielle solitäre Aktin-Polymerisationswellen
18.6 Filopodien und Cilien: Kundschafter und Fangarme der Zellen
Anhang 18A: Kontrolle der Schrittweite der solitären Polymerisationsimpulse: PI-3K als Hauptschalter
Anhang 18B: Die Bewegung von Listeria monocytogenes durch Wirtszellen
Literatur
Notes
19 Molekulare Linearmotoren der Zellen
19.1 Die Motoren der Myosinfamilie
19.2 Der molekulare Mechanismus der Krafterzeugung: Prozessivität und Tastverhältnis
19.3 Mikrotubuliassoziierte Motoren der Kinesin- und Dyneinfamilien
19.4 Kraftspektroskopie der Myosinmotoren mit optischen Pinzetten
19.5 Theoretische Beschreibungen der Linearmotoren
19.6 Myosin X: Ein Motorkomplex, der Aktin und Mikrotubuli koppelt
Literatur
Notes
20 Der Muskel: Anatomie und Phänomenologie der Funktion
20.1 Morphologie des Muskels: Der Muskel als Anordnung parallel geschalteter Linearmotoren
20.2 Das Querbrückenmodell der Muskelkontraktion
20.3 Thermomechanik der Muskelkontraktion: Die Hill-Gleichung
20.4 Zur Energieversorgung der Muskeln
20.5 -Impulse triggern die Muskelkontraktion
20.6 Costamere: Zentren der filaminvermittelten Kraftübertragung zwischen Muskeln und Gewebe
Literatur
21 Protonengetriebene Rotationsmotoren
21.1 Mikroanatomie des Rotationsmotors
21.2 Phänomenologie und Effizienz protonengetriebener Motoren
21.3 Molekulare Modelle des bakteriellen Rotationsmotors
21.4 Bakterien besitzen Sensoren für chemotaktische Gradienten
21.5 Umschlag der Drehrichtung durch Festkörperumwandlung der Flagellen
Literatur
Notes
22 Leben bei kleinen Reynolds-Zahlen: Krafterzeugung durch Flagellen und Cilien
22.1 Das Gleitmodell der Cilienbewegung
22.2 Die Bewegungsmoden der Flagellen und Cilien bestimmen die Funktion der Antriebselemente
22.3 Wie Bakterien und Spermien sich durchs Wasser schrauben und Cilien ihre Bewegung koordinieren
Literatur
Note
23 Makromoleküle des extrazellulären Raums
23.1 Gewebe als Verbundmaterial aus Zellen und Makromolekülen
23.2 Cellulose als Schutzhülle der Pflanzenzellen
23.3 Der Glaskörper des Auges als lebenswichtiges Beispiel einer Gel-Sol-Koexistenz
23.4 Verbindungen zwischen Zellen: Die Grenzen der Organe und die Blut-Hirn-Schranke
23.5 Stabilisierung von Pflanzen und Bäumen durch Faserverstärkung
23.6 Mechanische Stabilität biologischer Nanokomposite: Das Griffith-Kriterium
23.7 Epilog und Perspektiven
Literatur
24 Physik flexibler Makromoleküle: Vom Einzelmolekül zur Lösung
24.1 Von der Gaußschen Kette zu wurmartigen Polymeren oder: Von universellen zu spezifischen Eigenschaften
24.2 Das Flory-Modell des ausgeschlossenen Volumens
24.3 Die Persistenzlänge als Maß für die Kettensteifigkeit semiflexibler Polymere
24.4 Die Struktur makromolekularer Lösungen
24.5 Thermodynamik von makromolekularen Lösungen und Polyelektrolyten
24.6 Phasentrennung in Polymerlösungen
24.7 Der osmotische Druck und der Dampfdruck makromolekularer Lösungen
24.8 Ladungskondensation und Kettenversteifung geladener Polymere
24.9 Der elektro-osmotische Zusatzdruck von geladenen Polymeren
Anhang 24A: Der elektrostatische Beitrag zum Virialkoeffizienten geladener Makromoleküle
Anhang 24B: Häufig benutzte Symbole
Literatur
Notes
25 Molekulare Dynamik und Elastizität semiflexibler Filamente
25.1 Einzelfilamentdynamik und Elastizität semiflexibler Filamente
25.2 Messung der Biegesteifigkeit, der Rauigkeit und der Verhedderungslänge semiflexibler Filamente
25.3 Die anisotrope Federkonstante semiflexibler Filamente
25.4 Relaxationszeiten der thermischen Anregungen
Literatur
Note
26 Viskoelastizität homogener Netzwerke und Gele
26.1 Das Prinzip der Viskoelastizität und was wir daraus lernen können
26.2 Konzepte und Methoden der Nanorheometrie
26.3 Die viskoelastische Impedanz verschlaufter und schwach verknoteter Netzwerke des Aktins
Anhang 26A: Quantifizierung der mechanischen Belastbarkeit biologischer und biotechnischer Materialien
Literatur
Notes
27 Physik und Funktion von Gelen: Zwischen Festkörper und Flüssigkeit
27.1 Homogene Gele: Musterbeispiele für gummielastische Netzwerke
27.2 Die Gummielastizität verknoteter semiflexibler Netzwerke
27.3 Kontrolle der Filamentsteifigkeit durch Bündelbildung
27.4 Die Bildung heterogener Gele als Perkolationsprozess
27.5 Der Perkolationsübergang in Aktinnetzwerken
27.6 Nichtlineare Viskoelastizität – Scherversteifung und Grenzen der Stabilität
27.7 Viskoelastizität und Sol-Gel-Übergänge aktiver Aktin-Myosin-Netzwerke
27.8 Selbstorganisation des Zytoskeletts in Riesenvesikeln: Auf dem Weg zu mechanischen Zellmodellen
Literatur
Note
28 Zellen als Mechanosensoren und chemomechanische Aktuatoren
28.1 Einleitung: Das Schalen-Seil-Modell der Zelle
28.2 Das Endothelium als aktive semipermeable Barriere für weiße Blutzellen
28.3 Hormoninduzierte Steuerung des zellulären Spannungszustands
28.4 Richtungssensitive Spannungssensoren kontrollieren die Adhäsion der Endothelzellen
28.5 Adhäsionsdomänen als biochemische Relaisstationen und Kraftzentren des Zellvorschubs: Logistisch gesteuerte Selbstorganisation
28.6 Lokale und globale Kontrolle der Zellbewegung durch den raumzeitlichen Rac-Rho-Antagonismus
28.7 Zusammenfassung, Schlussfolgerungen und Perspektiven
Anhang 28A: Spannungssensitive Adaptoren und Gerüstproteine
Anhang 28B: Inhibition der RhoA-Aktivität an der Zellfront durch sekundäre Adhäsionsdomänen
Anhang 28C: Die Aktin-Membrankoppler: Ezrin, Moesin, Radixin, Talin, Kindlin, Merlin
Literatur
Notes
29 Mikromechanik und Spannungshomöostase der Zellen
29.1 Mikromechanische Methoden zur Messung elastischer Impedanzen der Zellschalen
29.2 Messung der Wechselwirkung zwischen Zelle und Substrat durch Kraftfeldmikroskopie
29.3 Spannungshomöostase der Zellen und Zelldifferenzierung
29.4 Erkundung des zytoplasmatischen Raums durch Verfolgung artifizieller Endosomen
Anhang 29A: Die Rolle von Vinculin
Literatur
Weiterführende Literatur
Notes
Teil VI: Photosynthese
30 Primärprozesse der Photosynthese
30.1 Bemerkungen zur Evolution der Photosynthese und Bioenergetik
30.2 Zwei fundamentale Prozesse der Photosynthese
30.3 Die molekulare Architektur des Photosyntheseapparats der Pflanzen und Algen
30.4 Das bakterielle Reaktionszentrum: Eine zyklisch arbeitende ATP-produzierende Maschine
30.5 Aufbau von Protonengradienten und Wasserspaltung in Pflanzen und Algen: Ein Beweis der chemo-osmotischen-Hypothese
30.6 Parallelschaltung der Photosysteme und des sukzessiven Elektronentransfers von Wasser auf P680
30.7 Die duale Rolle der F
1
F
0
-ATPase als ATP- Synthesemaschine und Rotationsmotor
Anhang 30A: Erzeugung von NADPH durch Katabolismus
Anhang 30B: Die oxidative Phosphorylierung in der Elektronentransferkette der Mitochondrien
Literatur
31 Physikalische Grundlagen photobiologischer Prozesse
31.1 Die elektronischen Zustände von π-Elektronensystemen
31.2 Quantenmechanische Grundlagen der Photophysik organischer
π
-Elektronensysteme
31.3 Photophysik angeregter Moleküle
31.4 Bandenverschiebung durch Komplexbildung: Die Rotverschiebung des speziellen Paars
31.5 Die Energiewanderung im Photosyntheseapparat
31.6 Mechanismen des Elektronentransfers in bakteriellen Reaktionszentren
31.7 Zusammenfassung
Anhang 31A: Hybridisierung von Atomorbitalen und die Richtungscharakteristik von Bindungen
Literatur
Weiterführende Literatur
Notes
Teil VII: Physik des Hörens
32 Anatomie und Physiologie des Hörsinns
32.1 Stationen der akustischen Informationsverarbeitung
32.2 Struktur und Funktion des Innenohrs
32.3 Die neuronale Verarbeitung akustischer Signale
32.4 Der dynamische Bereich und die Frequenzcharakteristik des Hörsinns
32.5 Optimierung des Hörsinns: Resonanzüberhöhung und zweite Filterung
32.6 Zusammenfassung
Literatur
33 Mechanik und Hydrodynamik der Cochlea-Erregung: Das Wanderwellenmodell von Békésy
33.1 Die Experimente von Békésy und der Weg zur Wanderwellenhypothese
33.2 Zur Theorie der Wellenausbreitung in der Cochlea
33.3 Zusammenfassung und Ausblick
Literatur
34 Haarzellen als akusto-elektrische Signaltransformatoren
34.1 Haarzellen als nichtlineare Verstärker der mechanischen Schwingungen der Basilarmembran
34.2 Innere Haarzellen als passive und aktive mechano-elektrische Transformatoren
34.3 Stereovilli als frequenzselektive nichtlineare Verstärker und aktive mechanische Oszillatoren
34.4 Frequenzselektive Adaption der Empfindlichkeit von IHZ
34.5 Zusammenfassung
Literatur
35 Thermomechanik, Struktur und Funktion von Viren
35.1 Strukturelle Aspekte der Paramyxoviren (Corona und Influenza)
35.2 Transfer des Genoms von Influenzaviren in die Zelle
35.3 Die Biogenese von Coronaviren
35.4 Coronaviren und die Blut-Hirn-Schranke
35.5 Der Weg der Coronaviren über Lysosomen ins Gewebe
35.6 Die Störung der Regulation des Blutdrucks durch Coronaviren
35.7 Die Verteidigung der Zellen gegen den Angriff durch Coronaviren
35.8 Physik und Biologie der von Proteinkapseln (Capsiden) umhüllten Viren
Literatur
Notes
36 Die Physik der Selbstorganisation und Verarbeitung des Genoms
36.1 Die molekularen Organisationsformen des Genoms in Viren und Eukaryoten
36.2 Mechanische und elektrostatische Basis der DNA-Verarbeitung
36.3 Die Regulation der Genexpression in Prokaryoten
36.4 Die DNA-Kondensation in Bakteriophagen erfordert Megapascal-Drücke
36.5 Die territoriale Organisation der Chromosomen in Eukaryoten
Anhang 36A: Replikation und Translation: Eine Zusammenfassung
Anhang 36B: Polymerasen als molekulare Motoren
Anhang 36C: Regulation der Genexpression in Eukaryoten: Die Rolle der Schlaufenbildung
Anhang 36D: Rezeptorvermittelte Aktivierung der Genexpression oder: Wie Haare durch laterale Inhibition entstehen können
Literatur
Notes
37 Experimentelle Methoden der Biophysik
37.1 Wie beobachtet man die Feinstruktur der Zellen?
37.2 Die Abbesche Theorie der Mikroskopie
37.3 Methoden der optischen Mikroskopie
37.4 Untersuchung intrazellulärer biochemischer Prozesse durch Autoradiographie
37.5 Die Ultrazentrifuge: Eine hydrodynamische Methode zur Isolation und Charakterisierung biologischer Makromoleküle
37.6 Grundbegriffe der Hydrodynamik
37.7 Die Fickschen Gesetze der Diffusion
37.8 Beobachtung der molekularen Dynamik durch quasielastische Neutronenstreuung und Fluoreszenzkorrelationsspektroskopie
Literatur
Notes
38 Aufgaben
38.1 Aufgaben zu Kapitel 1
38.2 Aufgaben zu Kapitel 2
38.3 Aufgaben zu Kapitel 3
38.4 Aufgaben zu Kapitel 4
38.5 Aufgaben zu Kapitel 5
38.6 Aufgaben zu Kapitel 6
38.7 Aufgaben zu Kapitel 7
38.8 Aufgaben zu Kapitel 8
38.9 Aufgaben zu Kapitel 9
38.10 Aufgaben zu Kapitel 10
38.11 Aufgaben zu Kapitel 11
38.12 Aufgaben zu Kapitel 12
38.13 Aufgaben zu Kapitel 13
38.14 Aufgaben zu Kapitel 14
38.15 Aufgaben zu Kapitel 15
38.16 Aufgaben zu Kapitel 16
38.17 Aufgaben zu Kapitel 17
38.18 Aufgaben zu Kapitel 18
38.19 Aufgaben zu Kapitel 19
38.20 Aufgaben zu Kapitel 20
38.21 Aufgaben zu Kapitel 21
38.22 Aufgaben zu Kapitel 22
38.23 Aufgaben zu Kapitel 23
38.24 Aufgaben zu Kapitel 24
38.25 Aufgaben zu Kapitel 25
38.26 Aufgaben zu Kapitel 26
38.27 Aufgaben zu Kapitel 27
38.28 Aufgaben zu Kapitel 28
38.29 Aufgaben zu Kapitel 29
38.30 Aufgaben zu Kapitel 30
38.31 Aufgaben zu Kapitel 31
38.32 Aufgaben zu Kapitel 32
38.33 Aufgaben zu Kapitel 33
38.34 Aufgaben zu Kapitel 34
38.35 Aufgaben zu Kapitel 35
38.36 Aufgaben zu Kapitel 36
38.37 Aufgaben zu Kapitel 37
Glossar
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Tabellenverzeichnis
Kapitel 2
Tabelle 2.1 Die wesentlichen Klassen von Substanzen und ihr Anteil am Trocke...
Kapitel 3
Tabelle 3.1 Beispiele für thermodynamische Zustandsvariablen.
Kapitel 4
Tabelle 4.1 Beispiele für Säure-Base-Paare.
Tabelle 4.2 Standardwerte der Redoxpotentiale einiger wichtiger Partner der ...
Kapitel 5
Tabelle 5.1 Biologisch relevante Molekülfamilien und einige ihrer Funktionen...
Tabelle 5.2 Die wichtigsten Fettsäuren.
a)
Kapitel 6
Tabelle 6.1 Eigenschaften ausgewählter kovalenter Bindungen (nach [1]).
Tabelle 6.2 Van-der-Waals-Radien einiger Atome und Atomgruppen (Daten aus [2...
Tabelle 6.3 Van-der-Waals-Radien einiger Ionen (Daten aus [2]).
Tabelle 6.4 Bornsche Selbstenergien für ausgewählte Ionen nach
Gl. (6.2)
.
Tabelle 6.5 Elektrostatische Wechselwirkungen zwischen Ionen in verschiedene...
Kapitel 7
Tabelle 7.1 Anteil hydrophober Aminosäuren in natürlichen Proteinen.
a)
Tabelle 7.2 Elongationsparameter nach
Gl. (7.8)
für die Bildung von α-Heli...
Tabelle 7.3 Relative Häufigkeit von Aminosäuren in α-Helices.
a)
Kapitel 9
Tabelle 9.1 Mittlere Zahlen der Moleküle, die die Struktur des Spektrin-Akti...
Tabelle 9.2 Einige Daten humaner Erythrozyten.
Tabelle 9.3 Lipidzusammensetzung der Plasmamembranen von humanen Erythrozyte...
Tabelle 9.4 Verteilung der häufigsten Kohlenwasserstoffketten (relative Konz...
Kapitel 10
Tabelle 10.1 Auswahl von Diffusionskoeffizienten amphiphiler Moleküle und ...
Tabelle 10.2 Beiträge zur Bindungsenergie für natürliche MARCKS und eine Mut...
Kapitel 11
Tabelle 11.1 Auswahl elastischer Moduln von Lipidschichten.
a)
Tabelle 11.2 Elastische Moduln der Zellhülle von Erythrozyten und einer Scha...
Tabelle 11.3 Geometrische Parameter von Erythrozyten.
Kapitel 14
Tabelle 14.1 Verteilung der wichtigsten Ionen zwischen dem Zytoplasma des Ax...
Tabelle 14.2 Kopplungskoeffizienten für NaCl-Lösungen (in 10
−20
mol N
Tabelle 14.3 Konzentration der das Membranpotential des Tintenfisch-Axons be...
Kapitel 16
Tabelle 16.1 Elektrische Daten des Tintenfisch-Axons (nach [1]).
a)
Tabelle 16.2 Elektrische Daten der myelinierten Nervenfasern des Froschs.
Kapitel 19
Tabelle 19.1 Vergleich der kinetischen Daten einiger Myosinmotoren.
a)
Kapitel 25
Tabelle 25.1
Persistenzlängen
einiger semiflexibler Biopolymere.
Kapitel 31
Tabelle 31.1 Intramolekulare Deaktivierungsprozesse.
a)
Illustrationsverzeichnis
Kapitel 1
Abbildung 1.1 (a) Antoni van Leeuwenhoek. (b) Das von Robert Hooke gezeichne...
Abbildung 1.2 Links: Hermann von Helmholz (1821–1894). Rechts: Thomas Young ...
Abbildung 1.3 Eine Auswahl der Vielfalt von Lebensformen, die sich über neun...
Abbildung 1.4 (a) Bei der Spaltung von Sauerstoff () werden Elektronen frei...
Abbildung 1.5 (a) Wasserstoffbrücke: Prototyp einer richtungsabhängigen zwis...
Abbildung 1.6 Ein Beispiel für den hierarchischen Aufbau lebender Materie. L...
Abbildung 1.7 (a) Abalone und Nanokristalle aus Perlmutt (mit freundlicher G...
Abbildung 1.8 Links: Galileo Galilei. Rechts: Zum Skalengesetz und zu den Gr...
Abbildung 1.9 Vergleich der Setae einer Fliege und eines Geckos. Man beachte...
Abbildung 1.10 (a) Bild eines Sandfischs der Art
Scincus albifasciatus
, nach...
Kapitel 2
Abbildung 2.1 (a) Architektur einer prokaryotischen Zelle mit Zellwand. (b) ...
Abbildung 2.2 Eukaryotische Zellen als modular aufgebaute Maschinen aus funk...
Abbildung 2.3 Übersicht über intrazelluläre Kompartimente und ihre Funktione...
Abbildung 2.4 (a) Aufbau des Zellkerns während der Interphase des Zellzyklus...
Abbildung 2.5 (a) Membransystem des endoplasmatischen Retikulums einer Leber...
Abbildung 2.6 Schematischer Aufbau des Golgi-Apparats aus drei Untersystemen...
Abbildung 2.7 (a) Mikroarchitektur der Zellhüllen. Das Schema unterstreicht ...
Abbildung 2.8 Zur Lebensgeschichte der menschlichen Erythrozyten. Rechts wir...
Abbildung 2.9 (a) Die vier Phasen des Zellzyklus. Man beachte die kurze Daue...
Kapitel 3
Abbildung 3.1 Ein thermodynamisches System kann in seinem Phasenraum auf vie...
Abbildung 3.2 Kompression eines idealen Gases in einem temperierten Kolben. ...
Abbildung 3.3 Ein Kristall im Gleichgewicht mit der gesättigten Lösung seine...
Abbildung 3.4 Ein Lungenbläschen als Beispiel für ein Phasengleichgewicht. D...
Abbildung 3.5 Ein Tropfen einer Flüssigkeit steht innen unter einem höheren ...
Abbildung 3.6 Zur Ableitung der großkanonischen Verteilung betrachten wir ei...
Abbildung 3.7 Schematische Darstellung einer verdünnten Lösung. Der gelöste ...
Abbildung 3.8 Osmose bei Erythrozyten. Die Membran des Erythrozyten ist für ...
Abbildung 3.9 Liegen zwei Phasen vor (hier Öl über Wasser geschichtet), so v...
Abbildung 3.10 Carnotscher Kreisprozess für ein ideales Gas. Der Kreisprozes...
Kapitel 4
Abbildung 4.1 Mögliche Strukturen für die Bindung eines überschüssigen Proto...
Abbildung 4.2 Komplex des hydratisierten Hydroxid-Ions () mit vier Wassermo...
Abbildung 4.3 Titrationskurve (links) und Dissoziationsgrad (rechts) einer P...
Abbildung 4.4 Ein solvatisiertes Elektron. Es liegt in erster Näherung in ei...
Abbildung 4.5 Der Nikotinamidring des NADH- bzw. NADPH-Systems. Links: reduz...
Abbildung 4.6 Elektrochemische Referenzzelle. Die linke Zelle enthält eine u...
Kapitel 5
Abbildung 5.1 Die allgemeine Struktur der Aminosäuren. Die verschiedenen Ami...
Abbildung 5.2 Die apolaren (hydrophoben) Aminosäuren. In Klammern sind die ü...
Abbildung 5.3 Die polaren, aber ungeladenen Aminosäuren.
Abbildung 5.4 Die basischen Aminosäuren. Lysin und Arginin sind bei neutrale...
Abbildung 5.5 Die sauren Aminosäuren.
Abbildung 5.6 Die drei phosphorylierten Aminosäuren Phosphoserin, Phosphothr...
Abbildung 5.7 Die Kondensation zweier Aminosäuren. Die hervorgehobenen Atome...
Abbildung 5.8 Bildung einer Disulfidbrücke durch Oxidation der Sulfhydrylgru...
Abbildung 5.9 Strukturformel von Purin (links) und Pyrimidin (rechts). Aus d...
Abbildung 5.10 Die in den Nukleinsäuren vorkommenden Nukleobasen sowie ihre ...
Abbildung 5.11 Die Bausteine der Ribonukleinsäure (RNA). Von links nach rech...
Abbildung 5.12 Die Bausteine der Desoxyribonukleinsäure (DNA). Von links nac...
Abbildung 5.13 Prinzipieller Aufbau der Polynukleinsäuren. Die Phosphatgrupp...
Abbildung 5.14 Ausschnitt aus einem DNA-Strang. Die skizzierte Sequenz laute...
Abbildung 5.15 Ausschnitt aus einem RNA-Strang. Die gezeigte Sequenz lautet,...
Abbildung 5.16 Die Reaktion eines Ketons (bzw. eines Aldehyds, falls R
1
oder...
Abbildung 5.17 Ringschluss der
D
-Glucose. Die Kohlenstoffatome 2 bis 5 sind ...
Abbildung 5.18 Zwei wichtige Monosaccharide mit sechs Kohlenstoffatomen in d...
Abbildung 5.19 Die beiden wichtigsten Konformationen der ringförmigen Kohlen...
Abbildung 5.20 Bildung einer glykosidischen Bindung zwischen einem Saccharid...
Abbildung 5.21 Zwei häufig vorkommende Disaccharide. Links: Lactose besteht ...
Abbildung 5.22 Glykogen besteht aus einem linearen Polymerrückgrat aus Gluco...
Abbildung 5.23 Struktur von Cellulose. Hier bilden sich Wasserstoffbrückenbi...
Abbildung 5.24 ATP (Adenosintriphosphat) besteht aus einem Grundkörper aus
D
Abbildung 5.25 Einige repräsentative Fettsäuren. Von links nach rechts: Myri...
Abbildung 5.26 Oben: Entstehung eines Triacylglycerols (TAG) durch Kondensat...
Abbildung 5.27 Aufbau der Glycerophospholipide. Links: Die modulare Struktur...
Abbildung 5.28 Plasmalogen. Gezeigt ist das häufigste Plasmalogen mit Ethano...
Abbildung 5.29 Sphingolipide. Von links nach rechts: Sphingosin, der hydroph...
Abbildung 5.30 Chemische Struktur von Cholesterol.
Abbildung 5.31 Die drei wichtigsten Isomere der ringförmigen Hexosen. (a) β-
Abbildung 5.32 Die Richtungen von Bindungen am Beispiel von 2-Desoxyribose. ...
Abbildung 5.33 Implizite Atome am Beispiel von Tyrosin. Links: Darstellung m...
Kapitel 6
Abbildung 6.1 Die Konformation von Myoglobin. (a) Alle Atome raumfüllend gez...
Abbildung 6.2 Größenvergleich einiger biologischer Moleküle. Erste Zeile von...
Abbildung 6.3 RNase A, ein RNA-schneidendes Enzym. (a) Raumfüllende Darstell...
Abbildung 6.4 E-Cadherin, ein Zelladhäsionsprotein, in vier verschiedenen An...
Abbildung 6.5 Die drei grundlegenden Moden der Deformation einer kovalenten ...
Abbildung 6.6 (a) Strukturformeln von Ethan und Formamid. (b) Die Potentiale...
Abbildung 6.7 Ein Peptid. Die Atome, die die Peptidbindung bilden, liegen in...
Abbildung 6.8 Die Struktur der Peptidbindung entspricht einer Überlagerung o...
Abbildung 6.9 Zur Geometrie der Peptidbindung. Die grauen Umrisse kennzeichn...
Abbildung 6.10 Ramachandran-Diagramm von Alanin. Dargestellt ist die Energie...
Abbildung 6.11 Das Wassermolekül: Die Bindungslängen betragen 95,8 pm, die B...
Abbildung 6.12 In einer Salzlösung reichern sich Gegenionen in der Nähe eine...
Abbildung 6.13 Vergleich gemessener (Quadrate) und nach
Gl. (6.7)
berechnete...
Abbildung 6.14 Qualitativer Verlauf des elektrischen Potentials um ein Makro...
Abbildung 6.15 Dipolmomente der Peptidbindung (links) und eines Wassermolekü...
Abbildung 6.16 Konformation einer Wasserstoffbrückenbindung (gestrichelte Li...
Abbildung 6.17 Ein Mehrphasengleichgewicht. Die Substanz liege als Reinsubst...
Abbildung 6.18 Die Freie Enthalpie des Transfers von der wässrigen Phase in ...
Abbildung 6.19 Freie Enthalpie des Transfers von Dimethylpropan in Wasser. D...
Abbildung 6.20 Mögliche Richtungen der Wasserstoffbrückenbindungen in flüssi...
Abbildung 6.21 Der Einfluss von Unordnung auf eine Packung von Kugeln mit ge...
Abbildung 6.22 Mittelgroße Moleküle (graue Plättchen mit Radius ) können si...
Abbildung 6.23 Schematische Darstellung der realistischen Situation von Makr...
Abbildung 6.24 Eine Lösung mit hohem Volumenfüllgrad und das für das Hinzufü...
Abbildung 6.25 Schematische Darstellung einer Chromatographiesäule. Die Gelk...
Abbildung 6.26 Der Aktivitätskoeffizient einzelner Makromoleküle vor einem i...
Abbildung 6.27 Korrekturfaktor gemäß
Gl. (6.13)
für eine Dimerisierungsrea...
Kapitel 7
Abbildung 7.1 Die Konformation von RNase A. (a) Raumfüllende Darstellung. (b...
Abbildung 7.2 Bei der Entfaltung eines Proteins wandelt sich die native Konf...
Abbildung 7.3 Die Freie Enthalpie eines Proteins als Funktion aller internen...
Abbildung 7.4 Die Energiehyperfläche einer hypothetischen chemischen Reaktio...
Abbildung 7.5 In der Kramers-Theorie betrachten wir eine chemische Reaktion ...
Abbildung 7.6 Im Rückgrat eines Proteins liegen jeweils die vier an einer Pe...
Abbildung 7.7 Ein Ausschnitt aus der Struktur von Streptavidin (PDB-Datensat...
Abbildung 7.8 Der „Faltungstrichter“. Die mikroskopische Freie Enthalpie b...
Abbildung 7.9 Links: Mikroskopische Faltungstrajektorien beginnen an beliebi...
Abbildung 7.10 Proteine mit mehreren lokalen Minima der Freien Enthalpie bes...
Abbildung 7.11 Sind zwei Zustände wie hier der intermediäre Zustand I und de...
Abbildung 7.12 Die Struktur eines 28 Aminosäuren langen Fragments aus dem Am...
Abbildung 7.13 β-Faltblattelemente aus der Struktur der RNase A (PDB-Datensa...
Abbildung 7.14 Das Rückgrat eines Tetrapeptids in der α-helikalen Struktur. ...
Abbildung 7.15 Die optische Drehung von Poly(γ-benzyl-
L
-glutamat) (PBG) als ...
Abbildung 7.16 Die Ergebnisse des Reißverschlussmodells. Links: Die Kettenlä...
Abbildung 7.17 Die Struktur von doppelsträngiger DNA (PDB-Datensatz 460D).
Abbildung 7.18 Die Wasserstoffbrückenbindungen (gestrichelte Linien) im Cyto...
Abbildung 7.19 Schmelzen von DNA. Links: Optische Absorption einer DNA-Probe...
Abbildung 7.20 Links: Schmelztemperaturen von verschiedenen natürlichen DNA-...
Abbildung 7.21 Verlauf des Bruchteils der belegten Bindungsstellen in Molekü...
Abbildung 7.22 Die Sauerstoffbindungskurven von isoliertem Hämoglobin (Kreis...
Abbildung 7.23 Vergleich der molekularen Strukturen von sauerstoffgesättigte...
Abbildung 7.24 Die verschiedenen Fehlerquellen bei der numerischen Integrati...
Abbildung 7.25 Myoglobin mit gebundenem Kohlenmonoxid . (a) Die nähere Umge...
Abbildung 7.26 Die Oberfläche der Alkoholdehydrogenase in der offenen Form, ...
Abbildung 7.27 Die Hämgruppe. Links: Strukturformel; rechts: Dreidimensional...
Abbildung 7.28 Messung der Rückbindungskinetik von Kohlenmonoxid an Myoglobi...
Abbildung 7.29 Schematische Darstellung des Myoglobins (grau) mit der Häm-Gr...
Abbildung 7.30 Schematische Darstellung der Potentiallandschaft des Myoglobi...
Abbildung 7.31 Trajektorien, die über den Übergangszustand führen, dürfen na...
Kapitel 8
Abbildung 8.1 Spezifität bedeutet, eine bestimmte Molekülart unter vielen äh...
Abbildung 8.2 Das Prinzip eines Biochips. Die auf dem Biochip gebundenen DNA...
Abbildung 8.3 Eine Bindungsstelle für Biotin im Avidinmolekül. Das Biotinmol...
Abbildung 8.4 Die Bindungstasche von Hexokinase mit dem gebundenen Substrat ...
Abbildung 8.5 Die Bindungstasche von Hexokinase ohne Substrat (helle Struktu...
Abbildung 8.6 Vergleich der Gesamtstrukturen von Hexokinase. Links: ohne Sub...
Abbildung 8.7 Das klassische Schlüssel-Schloss-Modell der spezifischen Bindu...
Abbildung 8.8 Hydrodynamische Kräfte zur Ausübung von Pikonewton-Kräften. Li...
Abbildung 8.9 Biegung eines einseitig eingespannten Balkens durch eine Punkt...
Abbildung 8.10 Messung von Pikonewton-Kräften mit der Mikropipetten-Aspirati...
Abbildung 8.11 Das Prinzip der optischen Falle: Bei Fokussierung eines Laser...
Abbildung 8.12 Verlauf der Freien Enthalpie entlang der Reaktionskoordinate ...
Abbildung 8.13 Bruch einer einzelnen spezifischen Bindung durch Auslenkung e...
Abbildung 8.14 Nach
Gl. (8.4)
simulierte Daten für und . Links: „Überleben...
Abbildung 8.15 Mit der Mikropipetten-Aspirationstechnik gemessene Verteilung...
Abbildung 8.16 Mit der Mikropipetten-Aspirationstechnik gemessene Mediane de...
Abbildung 8.17 Die Struktur von zwei aufeinanderfolgenden Domänen des Riesen...
Abbildung 8.18 Beim mechanischen Entfalten eines Proteins bleibt die Feder (...
Abbildung 8.19 Die Energielandschaft der Entfaltung einer Proteindomäne.
Abbildung 8.20 Simulierte Daten für die kraftinduzierte Entfaltung von Titin...
Abbildung 8.21 Simulierte Daten für die kraftinduzierte Entfaltung von Titin...
Abbildung 8.22 Skizze des Experiments von Essevaz-Roulet et al. zum mechanis...
Abbildung 8.23 Bildung und Bruch einer einzelnen spezifischen Bindung durch ...
Abbildung 8.24 Ein Brownscher Oszillator besteht aus einer Masse, die durch ...
Abbildung 8.25 Das gemessene Leistungsspektrum der Fluktuationen der Spitze ...
Kapitel 9
Abbildung 9.1 (a) Molekulare Architektur der Verbundschale der Erythrozyten....
Abbildung 9.2 (a) Links: Spektrin-Aktin-Netzwerk der Erythrozyten mit Anordn...
Abbildung 9.3 Die wichtigsten Klassen von Membranlipiden. (a) Struktur der G...
Abbildung 9.4 Schematische Ansicht von vier Gruppen von Membranproteinen. (a...
Abbildung 9.5 (a) Charakterisierung der Hydrophobizität der 927 Aminosäuren ...
Abbildung 9.6 (a) Auswahl einiger wichtiger Transportproteine für den Transp...
Abbildung 9.7 Vereinfachtes Schema des molekularen Mechanismus des -Antipor...
Abbildung 9.8 Vergleich der Gleichgewichtskonzentrationen einiger wichtiger ...
Abbildung 9.9 (a) Transfer der neu synthetisierten Proteine durch die Membra...
Abbildung 9.10 Transfer der im ER synthetisierten Proteine (z. B. der Protei...
Abbildung 9.11 Vereinfachtes Modell des Austauschs von Lipiden sowie integra...
Abbildung 9.12 Modell des durch Rezeptoren vermittelten Imports von und de...
Abbildung 9.13 Modell der Signalverstärkung adrenerger Hormone (wie Adrenali...
Abbildung 9.14 (a) Stark vereinfachte Darstellung der Anatomie des Auges (mo...
Abbildung 9.15 (a) Mikroanatomie der Stäbchenzellen. Die Scheiben werden kon...
Abbildung 9.16 (a) Schematische Darstellung der molekularen Struktur des Pho...
Abbildung 9.17 (a) Messung des durch einen Lichtblitz induzierten Abfalls de...
Abbildung 9.18 Adaption der Empfindlichkeit der Sehzellen an die Helligkeit ...
Abbildung 9.19 (a) Aktivierung der Rezeptor-Tyrosinkinasen (RTK) durch gegen...
Abbildung 9.20 Aktivierung der Src-Kinasen. Links: Stabilisierung des inakti...
Abbildung 9.21 Termschema der drei Zustände der Aktivierung der homogenen GT...
Kapitel 10
Abbildung 10.1 Struktur einiger für die biologische Funktion der Membranen w...
Abbildung 10.2 Drei Klassen von Modellen zur Untersuchung der physikalischen...
Abbildung 10.3 Untersuchung der Phasenumwandlung von einschaligen Vesikeln a...
Abbildung 10.4 (a) Molekulare Architektur des fluiden Zustands L
α
und d...
Abbildung 10.5 Variation der Umwandlungstemperaturen der wichtigsten Phospho...
Abbildung 10.6 (a) Zur Elektrostatik der Membranen. Schematische Darstellung...
Abbildung 10.7 Defektmodell der Phasenumwandlungen von Membranen. (a) Ein Fr...
Abbildung 10.8 (a) Lokale Konformation der Ketten in einer planaren Membran ...
Abbildung 10.9 (a) Momentaufnahme einer mittels MD-Rechnung simulierten Memb...
Abbildung 10.10 Hierarchie der Bewegungsprozesse in Membranen. Hierzu gehöre...
Abbildung 10.11 (a) Linke Seite: Schematischer Aufbau der Photobleich- und F...
Abbildung 10.12 Die elektrostatisch-hydrophobe Rekrutierung von Proteinen an...
Abbildung 10.13 (a) Ein hypothetisches integrales Membranprotein, das mit de...
Abbildung 10.14 (a) Durch Enzyme vermittelte Kopplung von vier als spezifisc...
Kapitel 11
Abbildung 11.1 Darstellung der grundlegenden Deformationen dünner Platten un...
Abbildung 11.2 Demonstration des elastischen Verhaltens von Erythrozyten übe...
Abbildung 11.3 (a) Auswahl einiger Grundformen der Erythrozyten (Durchmesser...
Abbildung 11.4 Phasendiagramm der Minimalflächen rotationssymmetrischer Vesi...
Abbildung 11.5 Variation des Oberflächendrucks im Bereich der Stacheln der...
Abbildung 11.6 Zwei durch hydrodynamische Scherkräfte induzierte Formumwandl...
Abbildung 11.7 Phasenkontrastaufnahmen der instantanen Konturen eines frei s...
Abbildung 11.8 (a) Schematische Darstellung der dynamischen Rauigkeit einer ...
Kapitel 12
Abbildung 12.1 (a) Zigarrenförmiges Phasendiagramm einer Mischung aus Lipide...
Abbildung 12.2 (a) Demonstration der Phasenumwandlung L
α
→ L
β
des ...
Abbildung 12.3 Das Prinzip der Längenadaption. (a) Matratzenmodell der Defor...
Abbildung 12.4 Der Mechanismus der selektiven Wechselwirkung aufgrund der Lä...
Abbildung 12.5 Modell der Sortierung der Lipide und Proteine in den Endosome...
Abbildung 12.6 Kontrolle der Aktivität membranständiger Enzyme über die Läng...
Abbildung 12.7 Kontrolle der Enzymaktivität durch Membrandefekte. (a) Links:...
Abbildung 12.8 (a) Universeller Prozess der Bildung von clathrinummantelten ...
Abbildung 12.9 (a) Schematische Darstellung der durch Caveolin induzierten M...
Abbildung 12.10 Modell der durch heptamere COPI-Mantelproteine induzierten K...
Abbildung 12.11 (a) Darstellung der durch Proteinkinase D (PKD) regulierten ...
Abbildung 12.12 (a) Model der Fusion eines synaptischen Vesikels mit der Pla...
Abbildung 12.13 (a) Unterer Teil: Zur Konstruktion des Phasendiagramms einer...
Abbildung 12.14 (a) Vereinfachtes Modell des Austausches von Lipiden, integr...
Abbildung 12.15 Zyklischer durch Vesikel vermittelter Materialtransport zwis...
Kapitel 13
Abbildung 13.1 Demonstration der spezifischen Zell-Zell-Erkennung (nach [1])...
Abbildung 13.2 (a) Schematische Darstellung der Kontaktzone zwischen einem T...
Abbildung 13.3 (a) Modell zur Untersuchung der Physik der Zelladhäsion. Ries...
Abbildung 13.4 (a) Beobachtung der Adhäsionsdomänen mittels Mikrointerferome...
Abbildung 13.5 (a) Illustration der durch Bildung von Rezeptor-Ligand-Paaren...
Abbildung 13.6 (a) Oberes Bild: Domänenstruktur von Fibronektin aus zwei dur...
Abbildung 13.7 Die Interleukin-2-Produktion als Prototyp der Genexpression: ...
Abbildung 13.8 Adhäsionsdomänen als Aktivatoren der Lymphozyten-Proliferatio...
Abbildung 13.9 Adhäsionsinduzierte globale Polarisierung der Lymphozyten dur...
Abbildung 13.10 Fünf wichtige Familien von ZAM in tierischen Zellen. Die Kop...
Abbildung 13.11 Domänenstruktur des Rezeptors CD44. Das extrazelluläre Segme...
Kapitel 14
Abbildung 14.1 Schematische Struktur einer motorischen Nervenzelle (Motoneur...
Abbildung 14.2 (a) Kopplung zwischen sensorischen und motorischen Nervenleit...
Abbildung 14.3 Schematische Darstellung der Signalübertragung an den Synapse...
Abbildung 14.4 (a) Darstellung der Ionenverteilungen in zwei durch eine semi...
Abbildung 14.5 Mit der Goldman-Gleichung berechnete Kennlinie der Membran fü...
Abbildung 14.6 (a) Abhängigkeit des Membranpotentials von der äußeren -Ko...
Abbildung 14.7 Simultane Bildung von Myelinhüllen um mehrere Axone des ZNS d...
Abbildung 14.8 Kontrolle des Axonwachstums durch Ephrine. Rechts oben: Typis...
Abbildung 14.9 (a) Die Steuerung des Vorschubs der Axonkegel durch Rac-1-ind...
Kapitel 15
Abbildung 15.1 Typischer Verlauf der Aktionspotentiale bei unterschwelliger ...
Abbildung 15.2 (a) Die Methode der Spannungsklammer zur Messung der zeitabhä...
Abbildung 15.3 Verlauf des Aktionspotentials (durchgezogene Kurve) und der A...
Abbildung 15.4 Vereinfachte Darstellung des Äquivalenzschaltkreises für eine...
Abbildung 15.5 Zeitlicher Verlauf der Stromdichte durch die Membran des Tint...
Abbildung 15.6 Zwei Methoden zur Trennung der - und -Ströme des Aktionspot...
Abbildung 15.7 Rekonstruktion der Ionenströme durch Einzelkanalmessungen an ...
Abbildung 15.8 Beobachtung des Einschaltstroms (der Index g steht für engl...
Abbildung 15.9 Von Hodgkin und Huxley berechnete zeitliche Verläufe des Memb...
Abbildung 15.10 Spannungsabhängigkeit der Huxley-Hodgkin-Parameter und Relax...
Abbildung 15.11 (a) Zur Struktur der (etwa 100 Mitglieder umfassenden) Famil...
Abbildung 15.12 Modell der spannungsinduzierten Öffnung des -Kanals durch D...
Abbildung 15.13 Struktur und Funktion des Acetylcholinrezeptors. (a) Schemat...
Abbildung 15.14 Die Wirkungsweise einer inhibitorischen (obere Seite der Zel...
Abbildung 15.15 Kopplung der Sehzellen (SZ) und Neuronen in der Retina. Die ...
Abbildung 15.16 Zur Bildung schwarzer Membranen über einem Loch (Durchmesser...
Abbildung 15.17 (a) Schematische Darstellung des Ionentransports über Carrie...
Abbildung 15.18 (a) Beobachtung des statistischen Öffnens und Schließens der...
Abbildung 15.19 Das Zweizustandsmodell allosterischer Prozesse. (a) Jedes Pr...
Abbildung 15.20 Darstellung der beiden Klassen kooperativer Übergänge in ein...
Kapitel 16
Abbildung 16.1 Schematische Darstellung der Ausbreitung eines Aktionspotenti...
Abbildung 16.2 (a) Ersatzschaltbild des Axons. B ist eine Batterie, S ein Sc...
Abbildung 16.3 Stromfluss im Bereich zwischen zwei Schnürringen nach Huxley ...
Abbildung 16.4 Einzelimpuls und Impulsfolge als Lösungen der Fitzhugh-Gleich...
Abbildung 16.5 Darstellung des Verhaltens der Fitzhugh-Gleichungen
16.13
in ...
Abbildung 16.6 (a) Darstellung der Oszillation des Van-der-Pol-Oszillators a...
Abbildung 16.7 (a) Linkes Bild: Experimentelle Realisierung der spannungsabh...
Abbildung 16.8 (a) Schematische Darstellung der Form des Erregungsimpulses
Kapitel 17
Abbildung 17.1 Linkes Bild: Das vereinfachte Schema des Herzens dient der Be...
Abbildung 17.2 Zwei Typen von Herzrhythmusstörungen. (a) Beispiel eines SA- ...
Abbildung 17.3 Zur Störung des Rhythmus erregter Herzmuskelzellen von Hühner...
Abbildung 17.4 Simulation von Herzrhythmusstörungen (Wenckebach-Phänomen). G...
Abbildung 17.5 (a) Koordinierte mechanische Stimulation zweier autonom schla...
Abbildung 17.6 Zur Synchronisierung des Van-der-Pol-Oszillators durch extern...
Kapitel 18
Abbildung 18.1 Die drei verschieden steifen Elemente des Zytoskeletts: Mikro...
Abbildung 18.2 (a) Atomare Struktur des Aktin-Monomers (G-Aktin, 45 kDa). Da...
Abbildung 18.3 Das Wachstumsverhalten der Mikrotubuli. (a) Aufbau der röhren...
Abbildung 18.4 Stufenförmiger Aufbau der Intermediärfilamente (IMF) aus pola...
Abbildung 18.5 (a) Beobachtung der Keimbildungs- und Wachstumsphase von Akti...
Abbildung 18.6 Drei Gruppen von Manipulatoren des Aktinnetzwerks. (a) Der Wa...
Abbildung 18.7 (a) Modell der Konformationsumwandlung der α,β-Dimeren von Tu...
Abbildung 18.8 (a) Oben: Schematische Darstellung zweier Bewegungszustände d...
Abbildung 18.9 (a) Sequenzieller Vorschub der Zellfront durch impulsartige s...
Abbildung 18.10 Oben: Regulation der Zugänglichkeit von Aggregaten von PIP
2
-...
Abbildung 18.11 (a) Domänenstruktur des aus 380 Aminosäuren bestehenden VASP...
Abbildung 18.12 (a) Phasenkontrastaufnahme des Einzugs eines Phantom-Bakteri...
Abbildung 18.13 Kontrolle der Dauer bzw. der Schrittlänge des Vorschubs ...
Abbildung 18.14 Schematische Darstellung der Bewegung von Bakterien der Gatt...
Kapitel 19
Abbildung 19.1 (a) Drei wichtige Motoren der Myosinfamilie. Alle Motoren bes...
Abbildung 19.2 Das molekulare Modell der zyklischen Krafterzeugung in Aktin-...
Abbildung 19.3 (a) Schematische Darstellung der auf MT laufenden Motoren. Ge...
Abbildung 19.4 Modulation der Leistung und Funktion der Dyneinmotoren. (a) R...
Abbildung 19.5 Analyse des biochemischen Zyklus des Motors Myosin V durch zw...
Abbildung 19.6 Energieschema des Brownschen Flügelradmodells der Linearmotor...
Abbildung 19.7 (a) Schematische Struktur der Myosin-X-Motoren, deren Köpfe e...
Kapitel 20
Abbildung 20.1 Anatomie des quergestreiften Skelettmuskels. (a) Oben: Muskel...
Abbildung 20.2 Zur neuronalen Erregung der Muskelzellen. Die Neuronen koppel...
Abbildung 20.3 Feinstruktur der Sarkomere und schematische Darstellung ihrer...
Abbildung 20.4 (a) Messung der Kontraktion einer Muskelspindel oder Muskelfa...
Abbildung 20.5 Der Zusammenhang zwischen Sarkomerlänge und Muskelkraft. Die ...
Abbildung 20.6 Geschwindigkeit der isotonischen Kontraktion einer einzelne...
Abbildung 20.7 Modell der Kontrolle der Muskelaktivität durch Blockade der A...
Abbildung 20.8 Die Mikroanatomie der langgestreckten Muskelzellen. (a) Links...
Abbildung 20.9 Zweizustandsmodell der Filamin-Dimere. Links: Inaktiver Zusta...
Kapitel 21
Abbildung 21.1 Typische Überlagerung der Bewegung eines
E.-coli
-Bakteriums a...
Abbildung 21.2 Schematisches Bild des Rotationsmotors von
E. coli
. Analog zu...
Abbildung 21.3 (a) Die sprunghafte Zunahme der Rotationsgeschwindigkeit eine...
Abbildung 21.4 (a) Ein molekulares Strukturmodell des MotA-MotB-Komplexes. E...
Abbildung 21.5 (a) Das Kontrollsystem der Bakterien
E. coli
und
Salmonella
a...
Abbildung 21.6 (a) Zeitliche Variation des Verhältnisses der Verweilzeiten i...
Abbildung 21.7 Zur Formumwandlung der Flagellen. (a) Drei Zustände I–III der...
Kapitel 22
Abbildung 22.1 Die supramolekulare Organisation der Cilien und Flagellen. (a...
Abbildung 22.2 Zum Gleitmechanismus der aktiven Biegung von Cilien. Links: I...
Abbildung 22.3 Die Bewegung der Flagellen von Spermien des Seeigels durch Er...
Abbildung 22.4 Momentaufnahmen des synchronisierten Schlagens von Cilien zur...
Abbildung 22.5 Momentaufnahme einer oszillierenden Flagelle. Darstellung der...
Abbildung 22.6 (a) Räumliche Ausdehnung der induzierten Geschwindigkeitsfeld...
Kapitel 23
Abbildung 23.1 (a) Schematische Darstellung des durch das Endothelium abgesc...
Abbildung 23.2 Typische Makromoleküle der extrazellulären Matrix. (a) Hyalur...
Abbildung 23.3 Verbundartiger Aufbau der Zellwände von Pflanzen. Fibrillen a...
Abbildung 23.4 Zur Struktur des Glaskörpers der Augen. (a) Aufbau des Glaskö...
Abbildung 23.5 (a) Oben: Schematische Struktur der Verbindungen zwischen den...
Abbildung 23.6 (a) Zusammenhang zwischen dem Neigungswinkel der Cellulosef...
Abbildung 23.7 (a) Mikrostruktur der Knochenlamellen. Die hexagonalen Plättc...
Kapitel 24
Abbildung 24.1 Zur Definition flexibler und semiflexibler Ketten und ihrer p...
Abbildung 24.2 Charakterisierung von Lösungen unterschiedlicher Konzentratio...
Abbildung 24.3 Zur Berechnung der Mischungsenthalpie einer makromolekulare...
Abbildung 24.4 Hypothetisches Phasendiagramm von Polymerlösungen. (a) Freie ...
Abbildung 24.5 Zur Charakterisierung geladener flexibler Makromoleküle. Die ...
Kapitel 25
Abbildung 25.1 Beobachtung der Bewegung von Aktinfilamenten durch Markierung...
Kapitel 26
Abbildung 26.1 Definition der Scherdeformation und mechanischer Äquivalenzmo...
Abbildung 26.2 (a) Frequenzspektrum des Speichermoduls und des Verlustmodu...
Abbildung 26.3 Hierarchischer Aufbau der 50–200 nm dicken Kollagenfibrillen ...
Abbildung 26.4 (a) Spannungs-Dehnungs-Diagramm und Tangentenmoduln der Fib...
Abbildung 26.5 Ein Ashby-Diagramm technischer und biotechnischer Materialien...
Kapitel 27
Abbildung 27.1 (a) Gelbildung durch lokale Selbstassoziation vorgeformter Ma...
Abbildung 27.2 Die Topologie von Gelen. Die Segmente zwischen den Knoten kön...
Abbildung 27.3 Zur Vielfalt der Hetero-Gelzustände der Aktinnetzwerke. Mit z...
Abbildung 27.4 Perkolationsübergang eines Aktinnetzwerks durch zunehmende Ve...
Abbildung 27.5 Spannungs-Dehnungs-Diagramm eines Aktinnetzwerks, das mit HMM...
Abbildung 27.6 (a) Frequenzabhängigkeit eines aktiven Netzwerks aus einem pa...
Abbildung 27.7 Zur Beobachtung des Perkolationsübergangs eines Aktin-HMM-II-...
Abbildung 27.8 Bildung eines Aktin-α-Aktinin-Netzwerks an der Innenseite ein...
Kapitel 28
Abbildung 28.1 (a) Das Schalen-Seil-Modell der Zellen beschreibt die mechani...
Abbildung 28.2 (a) Oben: Zusammenstellung der wichtigsten an der Zelladhäsio...
Abbildung 28.3 Migration einer WBZ durch eine Monoschicht aus EZ. (a) Links ...
Abbildung 28.4 (a) Aktivierung der Endothelzellen durch die Hormone Histamin...
Abbildung 28.5 Bildung und Aktivierung der Aktin-Myosin-Spannungsfasern (Mik...
Abbildung 28.6 (a) Zeitlicher Verlauf der Restrukturierung der Adhäsionsdomä...
Abbildung 28.7 Zwei Zustände des Spannungssensors (ohne VEGFR). Links: Im st...
Abbildung 28.8 Modell der Funktionsweise des anisotropen Spannungssensors. (...
Abbildung 28.9 (a) Modell der Steuerung der Aktingelation an neu gebildeten ...
Abbildung 28.10 (a) Antagonistisches Zusammenspiel von Rac-1 und RhoA durch ...
Abbildung 28.11 Die globale Polarisierung der Zellbewegung. (a) Polarisierun...
Abbildung 28.12 Zur KANK-vermittelten Unterdrückung der Aktivität von RhoA h...
Abbildung 28.13 Links: Struktur und Funktion der FERM-Proteine Talin, Ezrin ...
Kapitel 29
Abbildung 29.1 Mikromechanische Methoden zur Messung lokaler elastischer und...
Abbildung 29.2 Relaxationsspektren der Hülle von Endothelzellen im ruhenden ...
Abbildung 29.3 Die Methode der Kraftfeldmikroskopie. (a) Illustration der Me...
Abbildung 29.4 Zellen in Einheitsformen. (a) Fluoreszenzmikroskopisches Bild...
Abbildung 29.5 Der Lebenslauf von Adhäsionsdomänen in einem Keratinozyten. I...
Abbildung 29.6 (a) Vereinfachtes Federmodell der Stabilisierung einzelner an...
Abbildung 29.7 Verteilung und der aktiven und passiven Geschwindigkeiten...
Kapitel 30
Schema 30.1 Dieser Prozess lieferte gleichzeitig das Reduktionssystem NADH, ...
Schema 30.2 Dieser zyklische Prozess der Milchsäuregärung wird auch heute no...
Abbildung 30.1 Schematische Darstellung der irreversiblen Ladungstrennung an...
Schema 30.3 Die Strukturen von Ubichinon (Mitochondrien) und Plastochinon (C...
Schema 30.4 Die Schwefelgruppen sind über Cysteinreste an das Protein gekopp...
Abbildung 30.2 Feinstruktur der Chloroplasten, der Orte der pflanzlichen Pho...
Abbildung 30.3 (a) Molekulare Architektur des bakteriellen Reaktionszentrums...
Abbildung 30.4 (a) Der zyklische Weg der Elektronen. Sie werden von dem ange...
Abbildung 30.5 Energiekaskade des Elektronentransfers in
R. sphaeroides
. Zur...
Abbildung 30.6 (a) Absorptionsspektrum des bakteriellen Reaktionszentrums vo...
Abbildung 30.7 Modell der Feinstruktur der Elektronentransferkette der Thyla...
Abbildung 30.8 Nachweis der Serienschaltung der Reaktionszentren mithilfe vo...
Abbildung 30.9 Periodizität der -Produktion in Chloroplasten mit der Zahl
Abbildung 30.10 (a) Elektrisch getriebene ATP-Produktion in Thylakoiden. Der...
Abbildung 30.11 (a) Aufbau der ATP-Synthase (500 kDa) aus dem Rotor F
0
und d...
Abbildung 30.12 (a) Flussdiagramm der Freien Enthalpie beim Elektronenfluss ...
Kapitel 31
Abbildung 31.1 Strukturen zweier wichtiger Klassen von Chromophoren des Phot...
Abbildung 31.2 Absorptionsspektren der in Diethylether gelösten Chlorophylle...
Abbildung 31.3 Das Modell des freien Elektronengases für eine linearen Kohle...
Abbildung 31.4 (a) Vergleich gemessener und berechneter Positionen des Absor...
Abbildung 31.5 (a) Absorptions- und Fluoreszenzspektrum von Pyren. Man beoba...
Abbildung 31.6 Jablonski-Termschema zur Diskussion von photophysikalischen P...
Abbildung 31.7 Pfade der intramolekularen Konversion. Für mehratomige Molekü...
Abbildung 31.8 (a) In die Tasche des GFP-Proteins eingebetteter Chromophor u...
Abbildung 31.9 Energetische Verschiebung des angeregten Zustands von Farbsto...
Abbildung 31.10 (a) Darstellung der beiden Mechanismen des Energietransfers....
Abbildung 31.11 (a) Aufbau eines molekularen Schichtsystems zur Untersuchung...
Abbildung 31.12 (a) Ein nichtadiabatischer Übergang zwischen den elektronisc...
Abbildung 31.13 Bildung eines Moleküls mit lokal trigonaler Symmetrie (Proto...
Kapitel 32
Abbildung 32.1 Aufbau des Ohrs aus Außen-, Mittel- und Innenohr. Das Außenro...
Abbildung 32.2 (a) Vorverarbeitung akustischer Signale durch die Topologie d...
Abbildung 32.3 Stimulierte akustische Emission des Innenohrs des Menschen na...
Abbildung 32.4 Die Anatomie des Innenohrs. (a) Schnitt durch das Schneckenge...
Abbildung 32.5 Die neuronale Verarbeitung der akustischen Signale. (a) Aufba...
Abbildung 32.6 Kurven gleicher Empfindung als Funktion der Frequenz für bina...
Abbildung 32.7 (a) Resonanzkurven der Basilarmembran der Cochlea von Chinchi...
Abbildung 32.8 (a) Modell der lateralen Inhibition zur Erzeugung eines neuro...
Kapitel 33
Abbildung 33.1 Die Wanderwellenhypothese der mechanischen Signalübertragung ...
Abbildung 33.2 Modell der Cochlea zur Simulation der Wanderwellen und Berech...
Abbildung 33.3 Vergleich theoretischer und experimenteller Resonanzkurven de...
Kapitel 34
Abbildung 34.1 Untersuchung der Elektromotilität und der Strom-Spannungs-Ken...
Abbildung 34.2 Beobachtung der Beziehung zwischen elektrischer Ladungsversch...
Abbildung 34.3 Modell der Verbundmembran und des molekularen Motors der OHZ-...
Abbildung 34.4 Oben: Schematische Darstellung des Corti-Organs zur Erinnerun...
Abbildung 34.5 Dynamische Struktur der Stereocilien. (a) Schematische Strukt...
Abbildung 34.6 Kriechexperiment zur Untersuchung der nichtlinearen Verstärke...
Abbildung 34.7 (a) Aktiver Kelvin-Körper als mechanisches Ersatzschaltbild d...
Abbildung 34.8 Innere Haarzellen als Quellen der otoakustischen Emission. (a...
Abbildung 34.9 Experimentelle Demonstration der Adaption der IHZ an den Gerä...
Abbildung 34.10 Modell der Adaption durch Zusammenspiel der Triggerfeder und...
Abbildung 34.11 Zur Vermeidung des Rauschens wird das elektrische Potential ...
Kapitel 35
Abbildung 35.1 (a) Schematische Struktur von Influenzaviren. Die leicht kege...
Abbildung 35.2 Darstellung der Fusion der Hülle von Influenzaviren mit der H...
Abbildung 35.3 (a) Die aus einer Multikomponenten-Lipid-Protein-Doppelschich...
Abbildung 35.4 Die Biogenese von Coronaviren in den ERGIC. (a) Bildung ultra...
Abbildung 35.5 (a) Die linke Seite zeigt die mechanische Stabilisierung der ...
Abbildung 35.6 (a) Der grau schattierte Bereich (links) zeigt die Bildung un...
Abbildung 35.7 Das Prähormon Ang2 wird durch Bindung an ACE2 in ACE1-7 umgew...
Abbildung 35.8 Schematische Darstellung zweier Viren mit exotischen Struktur...
Abbildung 35.9 (a) Illustration des Äquivalenzprinzips. Die Abbildung zeigt ...
Abbildung 35.10 (a) Zum Aufbau kristalliner Schalen aus Polyedern mit Ikosae...
Abbildung 35.11 Bildung eines Capsids mit der Triangulationszahl nach der ...
Abbildung 35.12 Auf den Biegemodul normierte gesamte elastische Energie ...
Abbildung 35.13 Dissoziation einer Stufenversetzung in einem 2D-Dreiecksgitt...
Kapitel 36
Abbildung 36.1 Kondensierte Organisationsformen des Genoms in Viren und den ...
Abbildung 36.2 (a) Vereinfachte Struktur der Nukleosomen. Den Kern bildet ei...
Abbildung 36.3 AFM-Aufnahmen der ringförmigen DNA von bei 37 °C kultivierten...
Abbildung 36.4 Druck-Abstands-Diagramm einer nematischen Lösung von DNA euka...
Abbildung 36.5 Multischichten aus Membranen mit positiv geladenen Lipiden un...
Abbildung 36.6 Das Operonmodell der Genexpression nach Jacob und Monod [15]....
Abbildung 36.7 (a) Vereinfachtes Modell der Feinstruktur des Repressor-DNA-K...
Abbildung 36.8 (a) Schematische Darstellung des DNA-Transfers in Bakteriopha...
Abbildung 36.9 Vereinfachtes Schema der Struktur des Zellkerns mit der terri...
Abbildung 36.10 (a) Modell menschlicher Chromosomen in der Zwischenphase des...
Abbildung 36.11 Zeitlicher Verlauf der Verschiebung der Histonloci des Chrom...
Abbildung 36.12 Modell der DNA-Verdopplung an der Replikationsgabel, an der ...
Abbildung 36.13 Die DNA-Polymerase als Linearmotor. (a) Schematische Darstel...
Abbildung 36.14 Vereinfachtes Modell der lokalen Organisation der Chromatinf...
Abbildung 36.15 Laterale Inhibition der Genexpression in der Umgebung einer ...
Kapitel 37
Abbildung 37.1 Vereinfachte Darstellung der mikroskopischen Abbildung. Das O...
Abbildung 37.2 Veranschaulichung der Abbeschen Theorie. Links ist das lichtm...
Abbildung 37.3 Prinzip des Phasenkontrastmikroskops. Das Objekt wird durch d...
Abbildung 37.4 Aufnahme einer Zelle des Schleimpilzes
Dictyostelium discoide
...
Abbildung 37.5 Strahlengang des DIK-Mikroskops mit Wollaston-Prismen W1 und ...
Abbildung 37.6 Reflexions-Interferenzkontrastmikroskopie (RIKM). (a) Entsteh...
Abbildung 37.7 (a) Strahlengang im konfokalen Mikroskop (Beschreibung im Tex...
Abbildung 37.8 Beobachtung intrazellulärer Prozesse (hier der Synthese und d...
Abbildung 37.9 Schema der Gradientenzentrifugation. (a) Röhrchen mit Dichteg...
Abbildung 37.10 (a) Zum Beweis der semikonservativen Verdopplung der DNA bei...
Abbildung 37.11 (a) Illustration der Bedeutung der Hydrodynamik für die Biol...
Abbildung 37.12 Geometrische Darstellung der Streuung einer einfallenden Wel...
Abbildung 37.13 Direkte Messung der Bindungsstärke der elektrostatisch-hydro...
Orientierungspunkte
Cover
Titelblatt
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur ersten Auflage
Vorwort zur zweiten Auflage
Häufig verwendete Symbole
Abkürzungen
Fangen Sie an zu lesen
Glossar
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Seitenliste
iii
iv
xxi
xxii
xxiii
xxv
xxvi
xxvii
xxviii
xxix
1
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
595
596
597
598
599
600
601
602
603
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
735
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
823
824
825
826
827
828
829
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015





























