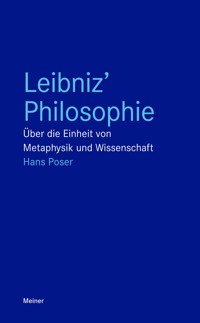
26,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Meiner, F
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Blaue Reihe
- Sprache: Deutsch
Dreihundert Jahre nach Leibniz' Tod ist sein Denken so aktuell wie eh und je. Nicht nur, dass wir in der Infinitesimalrechnung die von ihm eingeführten Symbole verwenden oder uns in allen Computersprachen seiner binären Codierung von Begriffen und Aussagen bedienen – es sind vielmehr die Fragen nach dem Verhältnis von Ich und Welt, von Möglichkeit und Notwendigkeit, von Wissenschaft und Metaphysik, von Sein und Sollen, mit denen wir uns in der wissenschaftlich-technischen Welt von heute in ganz ähnlicher Weise konfrontiert sehen wie Leibniz. In vier Jahrzehnten seiner Forschungs- und Lehrtätigkeit hat sich Hans Poser, einer der gegenwärtig bedeutendsten Leibniz-Forscher, mit beinahe allen Aspekten des Leibniz'schen Denkens befasst und legt mit diesem Band eine systematisch angeordnete Zusammenführung seiner Überlegungen vor, die um das spannungsvolle Verhältnis von Metaphysik und Wissenschaft und deren Voraussetzungen kreisen. Neben einer Einführung in Leben und Werk (I.) enthält der Band umfangreiche Kapitel zu den Themenbereichen Logik, Modalität, Zeichen und Sprache (II.), zur Metaphysik (Monadenlehre, Theodizee, Nouveau Essais – III.), zu Leibniz' Wissenschaftsauffassung (IV.) sowie zu Leibniz als Erfinder, Ingenieur und Wissenschaftsorganisator (V.). Darstellungen zu Leibniz' Unterstützung der jesuitischen China-Mission, zur Rechtsphilosophie und zur Universalharmonie (VI.) schließen den Band ab. Im Leibniz-Jahr 2016 liegt damit eine Gesamtdarstellung des Leibniz'schen Denkens vor, die auf Grund der klaren Gliederung des Bandes und der guten Lesbarkeit der einzelnen Abschnitte auch als Einführung in leibnizisches Philosophieren gelesen werden kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Hans Poser
Leibniz’ Philosophie
Über die Einheit vonMetaphysik und Wissenschaft
Herausgegeben von Wenchao Li
Meiner
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographischeDaten sind im Internet über ‹http://portal.dnb.de› abrufbar.eISBN PDF: 978-3-7873-2860-4eISBN eBook: 978-3-7873-3037-9
www.meiner.de
© Felix Meiner Verlag Hamburg 2016. Alle Rechte vorbehalten. Dies gilt auch für Vervielfältigungen, Übertragungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, soweit es nicht §§ 53 und 54 URG ausdrücklich gestatten. Konvertierung: Bookwire GmbHFür Links mit Verweisen auf Webseiten Dritter übernimmt der Verlag keine inhaltliche Haftung. Zudem behält er sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings (§ 44 b UrhG) vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Inhalt
Vorwort des Herausgebers
I. EINFÜHRUNG – LEBEN UND WERK
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 –1716)
1. Lebensweg
2. Das Werk
3. Wirkung
II. GRUNDLAGEN – LOGIK, MODALITÄT, ZEICHEN UND SPRACHE
Zum logischen und inhaltlichen Zusammenhang der Modalbegriffe bei Leibniz
1. Allgemeine Bemerkungen zur Rolle der Modalbegriffe
2. Die Bestimmung der reinen Modalbegriffe in den Elementa juris naturalis
3. Die Bestimmung der Modalbegriffe in den Generales Inquisitiones
Leibniz’sche Handlungsmodi zwischen Ontologie und Deontologie
1. Die systembildende Kraft von Modalbegriffen
2. Logische als ontische Modalitäten
3. Deontisch-juridische Modalitäten
4. Das Prinzip des Besten, moralische Notwendigkeit und Freiheit
5. Das Problem der Existenz
6. Die Geistmonade als handelndes Wesen
Signum, notio und idea. Elemente der Leibniz’schen Zeichentheorie
1. Die Bedeutung einer Zeichenkunst
2. Die Zeichenträger: signum und character
3. Die Designata: notio, res und idea
4. Die Denotation: expressio und analogia
5. Die vollkommene Charakteristik als imago creationis
6. Bereichsspezifische Charakteristiken
7. Der Ursprung der Denotation und die natürlichen Sprachen
8. Schlussbemerkungen
Der Begriff der Idee bei Leibniz
1. Von Platon zu Leibniz
2. Quid sit Idea
3. Idea vera und Idea falsa
4. Idea, notio und die regio idearum
5. Die Erkenntnis der Ideen
Zeichentheorie und natürliche Sprache bei Leibniz
1. Exprimere in der Monadenlehre
2. Begriffstheorie
3. Erkenntnistheorie und Zeichentheorie
4. Zeichen und Idee
5. Repraesentatio und Analogie
6. Die vollkommene Characteristica als Imago creationis
7. Grammatica Rationis und natürliche Sprachen
8. Sprachphilosophie
9. Sprache und Weltbild
10. Ausblick
III. METAPHYSIK: MONADENLEHRE – THEODICÉE – NOUVEAUX ESSAIS
Entelechie und Monade. Zu einem Kapitel neuzeitlicher Aristoteles-Rezeption
1. Philosophia perennis
2. Aristoteles‘ Entelechiebegriff
3. Die frühneuzeitliche Philosophie als Anti-Aristotelismus
4. Leibniz’ Descartes-Kritik
5. Die Monade als Substanz
6. Philosophia perennis renovata
Ens et unum convertuntur. Zur Leibniz’schen Einheit der Monade
1. Ens et unum in der Tradition
2. Leibnizens Unterscheidung von unum per se und unum per accidens
3. Ontologie und Begriffstheorie
4. Das modale Problem der Einheit
5. Die Unio als principe actif
Perzeptionen und Appetitus: Die inneren Prinzipien der Monaden und ihre ontisch-epistemische Hierarchie
1. Die individuelle Substanz
2. Perzeptionen als nichtbewusste und bewusste Monadenzustände
3. Appetitus: Die innere Dynamik der Substanzen als Strebung
4. Die Grade der Erkenntnis als Grade der Perzeption
5. Die petites perceptions und die Gründe für ihre Existenz
6. Die Repräsentationsfunktion der Perzeptionen
Der Appetitus der Monade: Die Evolution von Werden und Erkennen
1. Denken als Apperzeption der Monade
2. Der vollständige Begriff der individuellen Substanz
3. Vis activa
4. Mens agit
5. Denken und Finalität
6. Schluss
Phaenomenon bene fundatum. Leibnizens Monadologie als Phänomenologie
1. Leibniz und die Phänomenologie
2. Leibnizens Phänomenbegriffe
3. Reale und imaginäre Phänomene
4. Metaphysik der Phänomene
Leibniz’ dreifaches Freiheitsproblem
1. Die Freiheit Gottes
2. Die Freiheit des Individuums
3. Freiheit und durchgängige Kausalität
4. Freiheit und Instinkt
Zwischen Instinkt und Vernunft. Leibniz’ Konzept der Willensfreiheit in den Nouveaux Essais
1. Instinkt und psychische Kausalität
2. Instinkt und Vernunft
3. Freier Wille in den Nouveaux Essais
4. Zusammenstimmung von Freiheit und Instinkt
Von der Zulassung des Übels in der besten Welt. Über Leibniz’ Theodizee
1. Der Spott Voltairs
2. Leibniz und das Theodizeeproblem
3. Der Grundgedanke der Leibniz’schen Theodizee
4. Die Prinzipien und die möglichen Welten
5. Das Reich der Ideen und der möglichen Welten
6. Das Übel in der Welt
7. Das Freiheitsproblem
8. Der Mensch als Richter
Leibniz und der Gedanke einer universellen Harmonie
1. Einheit und Vielheit
2. Die musikalische Harmonie
3. Das Empfinden und Denken der Harmonie
4. Die Einheit der Monade und die prästabilierte Harmonie
5. Die Universalharmonie
6. Die menschliche Schöpfung: Harmonie in der Vervollkommnung der Welt
IV. ZWISCHEN METAPHYSIK UND WISSENSCHAFT
Leibniz’ Metaphysik heute: Die Synthese von Panlogismus und Pandynamismus
1. Der Wandel der Deutungen der Leibniz’schen Metaphysik
2. Die Grundlage der Dynamik
3. Die drei modalen Stufen facultas – dispositio – potentia
4. Die Leibniz’sche Verwendung der Modalia im Lichte der drei Stufen
5. Die dritte Stufe: Potentia oder vis
6. Der Ursprung der Dynamik: Potentia Dei
7. Leibniz heute
Analogia und Expressio bei Leibniz
1. Der Begriff der Analogie
2. Leibniz’ Aussagen zur Analogie
3. Expressio und Analogia
Leibnizens Theorie der Relationalität von Raum und Zeit
1. Newtons Raum- und Zeitmetaphysik
2. Raum und Zeit als Ordnungsstrukturen
3. Die Widerlegung der Absolutheit von Raum und Zeit durch das Prinzip des zureichenden Grundes
4. Gegen die Substantialisierung des Raumes
5. Erkenntnistheoretische und methodologische Kritik
6. Physik und Metaphysik
Die Idee der Unendlichkeit und die Dinge. Infinitum und Immensum bei Leibniz
1. Infinitum, indefinitum und immensum
2. Teil und Einheit
3. Raum und Zeit
4. Dinge und Monaden
5. Die Erkennbarkeit des Unendlichen
Erfinden als Wissenschaft. Leibniz’ Ars inveniendi
1. Projekte einer Ars inveniendi als Ars combinatoria
2. Die Leibniz’sche Ars combinatoria
3. Von der Kombinatorik zur Ars inveniendi
4. Die Infinitesimalrechnung als Paradigma
5. Einbettung und Ausweitung
6. Von den notwendigen Wahrheiten zur Kontingenz
7. Aufnahme und Weiterführung bei Christian Wolff
8. Heutige Bemühungen um eine Entwurfswissenschaft
V. THEORIA CUM PRAXI
Erfindungen für das bonum commune. Leibniz als Ingenieur
1. Die Mehrung des Gemeinwohls
2. Technik als Arbeitserleichterung
3. Technik als Freisetzen für Besseres
4. Technik zur Vergrößerung des Ansehens des Erfinders
5. Technik zur Vergrößerung der Einnahmen des Erfinders und des Landesherren
6. Theoretischer Erkenntnis, Erfindung, Dialog und Transformation in der Praxis
Leibniz und seine Pläne zur Aufrichtung einer Societät der Wissenschaften
1. Akademiepläne der Mainzer Zeit
2. Die Praxis zur Theorie: Die Berliner Societät
3. Die Akademien von Wien und St. Petersburg
Die Schwierigkeit, Theorie und Praxis zu vereinen: Das Akademiekonzept und die Technikwissenschaften
1. Die nützliche Akademie
2. Leibniz als Erfinder
3. Theoretische und praktische Wissenschaft
4. Systematik als Voraussetzung praktischer Wissenschaft
5. Die Maschinenmetapher
6. Die Erfindung des Neuen
7. Die Akademie und die Technikwissenschaften
VI. EPILOG
Propagatio fidei per scientias. Leibniz’ Gründe für die Unterstützung der jesuitischen China-Mission
1. Wissenschaft und Lebenssinn
2. Die jesuitische China-Mission
3. Die Novissima Sinica
4. Die Seinsordnung als Rechtsordnung: Die Justitia universalis
5. Die Grundprinzipien
6. Das Prinzip des Besten und die Universalharmonie
Abkürzungen der Leibniz-Schriften und Ausgaben
Nachweise erster Veröffentlichungen
Anmerkungen
Vorwort des Herausgebers
Dreihundert Jahre nach dem Tod von Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) ist sein Denken so aktuell wie eh und je. Nicht nur, dass wir in der Infinitesimalrechnung die von ihm eingeführten Symbole verwenden oder uns in allen Computersprachen seiner binären Codierung aller Begriffe und Aussagen bedienen – es sind vielmehr die Fragen nach dem Verhältnis von Ich und Welt, von Möglichkeit und Notwendigkeit, von Wissenschaft und Metaphysik, von Sein und Sollen, mit denen wir uns heute in einer wissenschaftlichtechnischen Welt in ganz ähnlicher Weise konfrontiert sehen wie Leibniz.
All dieses veranlasste den Herausgeber, eine Auswahl von Hans Posers deutschsprachigen Leibniz-Aufsätzen, die um das spannungsvolle Verhältnis von Metaphysik und Wissenschaft und seine Voraussetzungen kreisen und bisher zerstreut erschienen sind, systematisch angeordnet in einem Band zusammenzuführen. Ein Résumée des hier Gebotenen erübrigt sich, dessen Reichtum erschließt sich mehr als holzschnittartig bereits aus der Struktur des Inhaltsverzeichnisses. So enthält der Band neben einer Einführung in Leben und Werk (I.) umfangreiche Beiträge zu den Themenbereichen Logik, Modalität, Zeichen und Sprache (II.), zur Metaphysik (III.), zu Leibniz’ Wissenschaftsauffassung (IV.) sowie zu Leibniz als Erfinder, Ingenieur und Wissenschaftsorganisator (V.). Darstellungen zu Leibniz’ Interesse an der jesuitischen China-Mission, zur Rechtsphilosophie und zur Universalharmonie (VI.) schließen den Band ab.
Wegen der guten Zugänglichkeit sind Beiträge zu den Studia Leibnitiana, deren Supplementa und Sonderhefte nicht aufgenommen. Um den geschlossenen Charakter der hier wiedergegebenen Einzelbeiträge zu wahren, wurde darauf verzichtet, Wiederholungen zu tilgen, jedoch wurden die Quellenangaben vereinheitlicht und zumeist ergänzt um Verweise auf die inzwischen erschienenen Bände der Leibniz-Akademie-Ausgabe; zur besseren Übersicht wurden die ursprünglichen Anmerkungen kapitelweise durchnummeriert und als Endnoten angehängt. Eine Abkürzungsliste findet sich am Ende des Bandes. Die jeweiligen deutschen Fassungen der lateinischen oder französischen Leibniz-Zitate sind an die gängigen Übersetzungen angelehnt, ohne diese jeweils zu benennen. Darüber hinaus sind die Texte unter Verwendung neuen Rechtschreibung durchgesehen worden.
Der Herausgeber dankt Hans Poser für die Überlassung der Beiträge; Manfred Meiner und Marcel Simon-Gadhof danken Autor und Herausgeber für die Aufnahme ins Programm des Meiner Verlages und für die gute Betreuung.
Der Druck wurde ermöglicht durch Zuschuss der Leibniz-Stiftungsprofessur der Leibniz Universität Hannover.
Hannover/Berlin, im Mai 2016 W. Li




























