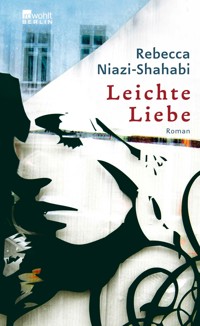
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Er ist ein Lebemann, liebt die Frauen und Musik — und er pflegt von Zeit zu Zeit spurlos zu verschwinden. Einen solchen Vater zu haben hält Yael, Mitte dreißig, Single in Berlin, für einen Fluch. Hat er sich doch nie um sie gekümmert, sie weder finanziell unterstützt noch durch die Wirren des Erwachsenwerdens geleitet. Als aber ihr Vater wieder einmal verschwindet und die Polizei ihn des Mordes an seiner Geliebten beschuldigt, weiß Yael: Das hier ist keine seiner fröhlichen Eskapaden. Sie macht sich auf die Suche nach ihm, reist nach Israel, wo er seine Wurzeln hat. Ihr Vater bleibt spurlos verschwunden. Aber ihre israelische Sippe lehrt Yael, die Dinge im Leben zu nehmen, wie sie sind. Und sie beginnt zu verstehen, dass sie braver, disziplinierter, beherrschter ist als nötig, dass das, was sie für einen Fluch hielt, vielleicht eine Gabe ist: dem Leben immer das Beste abzugewinnen. Verfügt sie auch selbst über diese Gabe und hat sie nur noch nie genutzt? Ein temporeicher Vater-Tochter-Krimi und die berührende Geschichte einer Selbstfindung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Rebecca Niazi-Shahabi
Leichte Liebe
Roman
Für Oliver
Ich weiß nicht, wo er ist», sagt Martha. «Bei mir hat er sich nicht gemeldet. Und falls du ihn sprechen solltest, kannst du ihm von mir ausrichten, dass er sich auch nicht mehr zu melden braucht.»
Beinahe fünf Wochen ist es jetzt her, dass Martha zuletzt etwas von Antoine gehört hat. An einem Mittwochvormittag hat er nach einem Telefonat ihre gemeinsame Wohnung in München-Schwabing verlassen und ist seitdem nicht wieder aufgetaucht. Sie hat keine Ahnung, wohin er wollte und mit wem er kurz vorher gesprochen hat. Und auch sonst scheint niemand zu wissen, wo er ist, denn ständig rufen irgendwelche Leute bei Martha an, die ihn ebenfalls seit dem besagten Mittwoch nicht mehr gesehen haben: Jeden Tag ab elf Uhr klingele ununterbrochen das Telefon, sie gehe ja schon gar nicht mehr ran, klagt Martha, denn in den seltensten Fällen sei es für sie. Es mache ihr nämlich keinen Spaß, beschwert sie sich weiter, nahezu täglich mit Antoines Freunden zu reden. «Wenn er da ist, macht er nur Ärger, und wenn er nicht da ist, auch», sagt sie. Sie komme wirklich nicht zur Ruhe. Und Ruhe sei etwas, was sie nach all den Jahren dringend nötig habe.
Auch ich gehöre zu den Leuten, die ihre Ruhe stören: Seit vier Wochen rufe ich jeden zweiten Morgen bei ihr an, um zu fragen, ob mein Vater sich gemeldet hat, und jedes Mal antwortet sie, dass er das nicht getan hat. Inzwischen brauche ich sie gar nicht mehr zu fragen – schon wenn sie meine Stimme hört, erklärt sie barsch: «Er ist nicht da, du hättest nicht anzurufen brauchen», und dann beklagt sie sich, wie unmöglich es von ihm sei, sich einfach so fortzuschleichen, und was er alles hätte erledigen müssen, aber nicht erledigt habe, bevor er an jenem Mittwoch aus dem Haus ging: das Auto abmelden, das nasse Laub auf der Terrasse aufkehren, einkaufen, die Küche putzen und die Wäsche aufhängen, die er zwei Tage vor seinem Verschwinden gewaschen hat. Nun hat Martha die Wäsche ein zweites Mal gewaschen und selbst aufgehängt, die Küche und das Bad geputzt, das Auto abgemeldet, die Raten für den Kredit eingezahlt und eine neue Glühbirne in die Flurlampe geschraubt. Das Ergebnis dieser Anstrengungen war vorhersehbar: Sie hat wieder Rückenschmerzen. Zwei Nächte habe sie vor Schmerzen nicht schlafen können, und über eine Woche lang habe sie täglich ihre Ärztin aufsuchen müssen, um sich eine Spritze geben zu lassen. Schlecht gehe es ihr, um nicht zu sagen: entsetzlich schlecht. Aber wie es ihr geht, dafür hat sich Antoine ja noch nie interessiert.
«Mir ist egal, wo er ist», höre ich ihre Stimme aus dem Telefonhörer, den ich ein Stück von meinem Ohr entfernt halte, ich verstehe trotzdem jedes Wort. «Am liebsten wäre es mir», sagt sie, «er käme nur noch ein einziges und letztes Mal vorbei und holte den Müll ab, den er hier sechsunddreißig Jahre lang angesammelt hat. Der Schrank in seinem Zimmer ist vollgestopft mit Zeug: Lederjacken, Hemden mit Kugelschreiberflecken auf der Tasche, Hosen und kaputte Schuhe, alte Koffer und wer weiß, was noch alles. Überall im ganzen Haus liegen seine Sachen rum, den Keller kann man gar nicht mehr betreten, das Auto ist ein einziger Aschenbecher, ganz unten im Wäschekorb schimmeln seine Jeans.»
Was ich wissen wollte, weiß ich jetzt, und das, was nun folgt, kenne ich auswendig: Martha hat anderes zu tun, als hinter meinem Vater herzutelefonieren und ihn anzuflehen, doch wieder zu ihr zurückzukommen. Ganz im Gegenteil: Sie wäre froh, wenn er bei irgendeiner anderen untergekommen wäre, auch wenn es ihr leidtäte um diese Frau, die sehr schnell herausfinden werde, wie es sich lebt mit einem Mann wie ihm.
Sorgen scheint Martha sich keine zu machen. Ich halte den Hörer wieder ans Ohr und frage in ihren Redestrom hinein: «Und wenn ihm was passiert ist?» Sie schnaubt halb verächtlich, halb belustigt: «Frag doch eine seiner Freundinnen, wo er steckt.» Und bevor sie weiterreden kann, sage ich: «Das habe ich schon.»
Diese unerwartete Wendung unseres Gesprächs bringt uns beide aus dem Konzept. Sie schweigt mehrere Sekunden, ich wundere mich, wie mir dieser Satz rausrutschen konnte, und überlege, wie ich das wiedergutmachen kann. Viel Zeit habe ich nicht, denn Martha gewinnt natürlich als Erste ihre Fassung zurück und sagt kühl und vollkommen beherrscht: «Du Verräterin. Ich habe dir vertraut, ich habe geglaubt, du bist anders als dein Vater. Ein durchtriebenes Stück bist du, setzt dich an meinen Küchentisch und lachst mir ins Gesicht, obwohl du dich kurz vorher mit ihm und seinen Schlampen getroffen hast, hier um die Ecke in den Schwabinger Cafés, sodass alle sehen können, wie dein Vater mich hintergeht.» Ich zucke zusammen, denn sie hat ja recht: Mein Vater ist so stolz auf jede einzelne seiner Eroberungen, dass er sich nicht verkneifen kann, sie mir vorzustellen, wenn ich in München bin. Oft, wenn er sich angeblich nur mit mir allein zum Mittagessen im Café Atzinger oder im Schellingsalon treffen wollte, war, kaum dass wir uns gesetzt hatten, eine elegant gekleidete Dame an unseren Tisch getreten, die mir verlegen die Hand reichte und beteuerte, wie froh sie sei, endlich Antoines Tochter kennenzulernen. Es war mir tatsächlich schwergefallen, zwei Stunden später vor Martha so zu tun, als ob ich von dieser oder den anderen Frauen nichts wüsste.
Ich antworte ihr lieber nicht, jede Entgegnung würde dieses unangenehme Gespräch verlängern.
Um wie viel spannender als mein eigenes ist das Liebesleben dieser siebzigjährigen Frau. Sie fühlt Eifersucht, Wut und Erleichterung und erlebt Versöhnung. Wenn mein Vater wiederkommt, wird er Blumen und Geschenke mitbringen, sie bekochen und ausführen. Wie dumm und ungeschickt von mir, dass ich ihr offenbart habe, wie viel ich über sie und ihn weiß.
Sie hat fast wieder zu ihrem üblichen Tonfall zurückgefunden. Irgendwie ist es beruhigend: Wenn sie sich nicht sorgt, dann kann ihm auch nichts passiert sein, denke ich. In diesem Moment sagt sie traurig und wie zu sich selbst: «Es ist absurd, dass ausgerechnet ich an einen Menschen wie deinen Vater geraten bin.»
Ich fühle mit ihr. Durch meinen Vater ist sie auch an mich geraten, und ich bin an sie geraten, und fremder können sich zwei Menschen nicht sein. Durch sein Verschwinden sind wir nun gezwungen, jeden zweiten Tag miteinander zu sprechen. Ich hätte nicht anrufen sollen. Ich bin mir aber leider überhaupt nicht sicher, ob sie mich anrufen würde, wenn sie eines Vormittags entdecken würde, dass er im Laufe der Nacht nach Hause gekommen ist und nun in voller Montur schlafend auf der Wohnzimmercouch liegt. Martha sagt nichts mehr, das Telefonat ist zu Ende.
Wie jedes Mal bitte ich sie, sich bei mir zu melden, sollte sie etwas von meinem Vater hören. Doch bevor ich diesen kurzen Satz beendet habe, fällt sie mir mit einem «Mach’s gut» ins Wort und legt auf.
Es ist nicht das erste Mal, dass mein Vater einfach verschwindet. Menschen, die ihn gut kennen, wundern sich eher, wenn er zur vereinbarten Zeit am vereinbarten Ort erscheint. Er kann mitten auf der Straße während eines Spaziergangs oder Einkaufes entscheiden, dass er anderes, Wichtigeres zu tun hat – ein kurzes Wort, und schon rennt er über die Ampel. Ruft man ihn zwei Tage später an, tut er so, als wäre nichts geschehen, was einer Erklärung bedürfe. Einige Begebenheiten dieser Art sind mittlerweile legendär und werden in seiner Familie immer wieder erzählt, sobald das Gespräch auf ihn kommt: In den Siebzigern beispielsweise war er nach Israel gereist, um seine Mutter in Hulon, einem Vorort von Tel Aviv, zu besuchen. Dort war er dann am Vormittag nach seiner Ankunft aufgestanden und hatte seine Mutter gebeten, ihm einen Kaffee zu machen. Währenddessen wollte er sich unten am Kiosk eine Schachtel Zigaretten holen. Zwei Wochen später hat er wieder an ihrer Tür geklingelt. Meine Großmutter soll ihn mit dem knappen Satz «Dein Kaffee ist kalt» empfangen haben. Am nächsten Morgen ging sein Flug zurück nach München.
Ob er für eine halbe Stunde verschwindet, für Wochen oder für ein Jahr − im Grunde erzählen diese Abwesenheiten sein Leben. Bis heute hat er keinen Beruf erlernt und auch sonst nichts zustande gebracht. Wie soll man etwas zustande bringen, wenn man es nirgendwo lange aushalten kann.
Mein Vater war dreizehn, als die Franzosen 1954Marokko in die Unabhängigkeit entließen und die Situation für den jüdischen Teil der Bevölkerung immer schwieriger wurde. Mein Großvater beschloss, die Familie müsse auswandern, und endlich war keine Rede mehr davon, dass mein Vater − außer in Französisch − so schlechte Noten hatte. Während der Vorbereitungen für die Abreise ging er gar nicht mehr zur Schule, drückte sich wie früher schon im Hafen herum, für diese letzten Wochen jedoch ganz ohne schlechtes Gewissen: Das neue Leben in Paris − eine Stadt, von der er träumte, solange er denken konnte − würde er disziplinierter angehen.
Beginnen musste mein Vater die Sache allerdings allein und in Israel: Denn während seine Eltern mit seinen vier jüngeren Geschwistern nach Paris zu ihrem ältesten Sohn Romain reisten, wurde er zu seiner Überraschung auf ein Schiff Richtung Haifa gesetzt. In Haifa empfingen ihn seine Schwester Colette und ihr Mann und nahmen ihn mit in den Kibbuz, in dem sie bereits seit zwei Jahren lebten. Ein Kibbuz in einer heißen und öden Wüste ist kein Ersatz für Europa, für Pariser Cafés, Theater- und Opernaufführungen. Die strengen Regeln aber, die dort herrschten, ließen ihm kaum Zeit, dies zu bedauern.
Wie es weiterging, als Slomo und Alice Hasidim drei Jahre später schließlich in Israel eintrafen, ist ebenfalls Familienlegende: Kaum war Antoine zu seiner Familie in die winzige Dreizimmerwohnung gezogen, die der Staat für die Familie bereitgestellt hatte, verschwand er für mehrere Monate. Niemand hatte Zeit, den Lieblingssohn meiner Großmutter zu suchen. Alle waren mit den Widrigkeiten des neuen Lebens beschäftigt. «Er ist ein Jude unter Juden», soll mein Großvater gesagt haben, «hier wird ihm nichts geschehen.» Meine Großmutter hat die Dinge immer schon weniger romantisch gesehen, doch mehr, als in der neuen Nachbarschaft nach ihrem Kind herumzufragen, hat auch sie nicht tun können.
Niemand weiß, wie viel Angst meine Großmutter um meinen Vater hatte, denn sie sprach nicht darüber. Keins ihrer Kinder hat ihr solche Probleme bereitet wie Antoine – auch in Israel ist er nicht regelmäßig zur Schule gegangen, verbrachte vielmehr die drei Jahre bis zum Militärdienst am Strand von Tel Aviv und in den nahegelegenen Bars, und 1961, mit zwanzig Jahren, verließ er das Land und fuhr als Küchenhilfe zur See.
Ein Einberufungsbescheid rief ihn 1967 aus Deutschland zurück, wo er sich gerade aufhielt: Der Sechstagekrieg hatte begonnen, und tatsächlich tauchte mein Vater am sechsten Juni 1967 im Rekrutierungscamp Tel Hashomia auf und meldete sich beim zuständigen Major Dani Grüner, um von diesem in eine neue Uniform gekleidet und mit einer Uzi ausgerüstet zu werden, dann mit zwölf anderen Soldaten in den Sinai zu fahren, wo er helfen sollte, die Pässe Mitla und Gide zu erobern, dort aber nur fünfzehn Minuten nach der Ankunft sein Gewehr in einem Gebüsch versteckte und floh. Beduinen, die in der Nähe ihr Lager aufgeschlagen hatten, nahmen ihn auf, und vier Tage später wurde er von einem Soldaten seiner Kompanie erkannt, der in der Gegend eine Patrouillenfahrt machte. Mein Vater entging dem Disziplinarverfahren nur, weil er Arabisch sprach und für die ägyptischen Kriegsgefangenen im Gefängnislager Atlit als Übersetzer gebraucht wurde.
Während dieses Aufenthaltes in Israel enttäuschte er aber nicht nur seinen Staat, sondern auch wieder seine Familie, denn gleich nach Kriegsende lieh er sich das Auto seines Bruders Marcel, um nach Eilat ans Rote Meer zu fahren, bevor sein Flug zurück nach Deutschland ging. Es war heiß im Sommer 67, und er hatte vergessen, rechtzeitig Kühlwasser nachzufüllen. Kurz vor dem Ziel streikte der heißgelaufene Motor, mein Vater schob das Auto an den Straßenrand, ließ es dort kurzerhand stehen, ging zu Fuß weiter nach Eilat und reiste von dort, ohne sich bei seinem Bruder auch nur zu melden, wieder nach Deutschland zurück.
Wen er später noch in New York, Marseille, Bremen oder Amsterdam hat stehenlassen, oder wer heute noch in Paris und Granada darauf wartet, dass mein Vater ihm wiedergibt, was er sich einst geliehen hat, weiß nur er selbst, denn zwischen 1967 und 1970 hat niemand etwas von ihm gehört.
Dreieinhalb Jahre nach seinem Verschwinden war er dann plötzlich wieder zurück in Deutschland und schloss knapp zwei Jahre darauf an einem Vormittag im Frühling 1973, kurz nach seiner Heirat mit Martha, den gemeinsamen Antiquitätenladen zu, ging in die Mittagspause und blieb für vier Monate weg. Der Grund für seine Abwesenheit war eine damals legendäre Schwabinger Schönheit, hochgewachsen, blond, stolz und finanziell unabhängig. Er hatte sie an diesem Mittag auf der Leopoldstraße getroffen, man trank einen Kaffee, dann hatte man Lust, in einem Restaurant zu Mittag zu speisen, andere Freunde kamen hinzu, und am Abend ging man in großer Runde zu ihr, in ihre elegante, großzügige Eigentumswohnung. Viele bemühten sich damals um diese schöne Besitzerin zweier gutgehender Boutiquen in der Münchner Innenstadt, und meinem Vater schmeichelte es natürlich unendlich, als sie in den frühen Morgenstunden ihn von allen Anwesenden auserwählte, den Rest der Nacht und den Tag darauf in ihrem Bett zu verbringen. Sechzehn Wochen war mein Vater ihr Geliebter. Saß in den Schwabinger Cafés, besuchte Bars, Diskotheken und teure Clubs, trank exquisite Weine, ging einkaufen und aß in den besseren Restaurants: Sie zahlte alles. Das war doch etwas ganz anderes als die Geschichte mit Martha. Wer von wem genug hatte nach diesen sechzehn Wochen, weiß man nicht, aber noch am selben Tag, als er bei der Boutiquenbesitzerin seine alten und neuen Sachen gepackt hatte, kehrte er zu Martha zurück.
Unzählige Menschen, vor allem Frauen, hat mein Vater im Laufe seines Leben stehen- und im Stich gelassen, betrogen, nicht abgeholt und versetzt. Und je größer die Schuld ist, die er auf sich geladen hat, desto länger dauert es, bis er sich wieder meldet.
Ich habe ihn sieben Jahre lang nicht gesehen, nachdem ich nach einem Umzug ein paar Möbel von mir und meinem Freund bei ihm in München untergestellt und er dann offensichtlich kurzerhand dessen Jugendstilsofa verkauft hatte: Als ich mit ihm absprechen wollte, wann wir vorbeikommen können, um das wertvolle Möbelstück wieder abzuholen, war er telefonisch einfach nicht mehr zu erreichen gewesen.
Meinen Cousin Alon hat er 1998 auf einer Reise mit vier seiner Kommilitonen in Casablanca sitzenlassen. Erst ein knappes Jahr später hat man wieder etwas von ihm gehört.
Geblieben von dieser Reise sind acht Stunden ungeschnittenes Filmmaterial, das Alons Abschlussfilm für die Filmakademie in Tel Aviv hätte werden sollen, es nach dieser unerfreulichen Reise jedoch nicht geworden ist und nun bei meiner Tante Miriam im Küchenschrank liegt. Ich habe mir eine Kopie davon schicken lassen, nachdem ich von dieser Reise gehört hatte.
Eine Kassette zeigt Aufnahmen vom Strand von Casablanca, mein Vater steht in der Sonne und schwärmt davon, wie reich die Hasidims waren, vor 1954.So reich, dass Alice und Schlomo Hasidim jedes Wochenende zwei große weiße Zelte an diesem Strand aufstellen ließen, und in diesen Zelten servierten ihre Diener Tee und Kuchen für die Armen. Im Hintergrund sieht man neugierige Kinder, fast nur Jungen, auf und ab hüpfen. Weil jeder gerne vor die Kamera möchte, drängeln und schubsen sie. Mein Vater lacht und erzählt auf Arabisch weiter, wie es hier an dieser Promenade ausgesehen hat in den Fünfzigern, und plötzlich stehen alle Kinder still und hören zu.
Dann das Gesicht meines Vaters in Nahaufnahme, stumm und sehr deprimiert. Man sieht, er ist entsetzt über den Anblick des Café de Paris, einst eines der elegantesten Cafés von Casablanca, an einem ehemals schönen Platz gelegen, auf dem mein Großvater mit einem der ersten Autos der Stadt eine Runde gedreht haben soll, um die französischen Damen in ihren weißen Kleidern zu beeindrucken. Niemand sagt etwas, man hört nur die leise gemurmelten Anweisungen meines Cousins Alon. Ein Schwenk über das Publikum des Café de Paris, Männer, die Tee trinken und Backgammon spielen, im Hintergrund mein Vater, wie er seine Zigarette wegwirft. Das Café ist voll, die Menschen sitzen auf denselben rotgepolsterten Stühlen von einst, nur sind diese nun vollkommen zerschlissen. Auf einem dieser Stühle hat vielleicht mein Großvater gesessen und hat mit den französischen Damen geplaudert bei einer Tasse Kaffee oder einer echten holländischen Schokolade. Und wieder das Gesicht meines Vaters, angespannt, in seinen nervösen Händen eine Zigarette. Man hört einen Kommilitonen von Alon, der versucht, meinen Vater zum Erzählen zu animieren, doch dieser wendet sich unwillig ab. Die Kamera zeigt, was mein Vater sieht: den Marktplatz, den ungeteerten, schlammigen Boden. Seitenstraßen mit Teerfackeln und den Resten von alten Stromleitungen, den Abfall, die Tiere, den Dreck und die bettelnden Kinder. Plötzlich ist es Nacht, und die Menschen gehen in ihren Djellabas mit Fackeln durch die engen Gassen. Die Szene erinnert an einen Mittelalter-Kostümfilm. Drei Minuten später ist schon wieder Tag, und man erkennt das ehemalige französische Viertel mit den Art-déco-Häusern, wie ausgestorben, kein Mensch ist auf der Straße, aber da war mein Vater schon nicht mehr dabei: Am Abend zuvor hatte er auf dem Parkplatz mit einem Freund von Alon einen Streit angefangen, und die Filmcrew hat die Reise ohne ihn fortgesetzt – mit wenig Erfolg, wie mir Miriam in dem Brief schrieb, den sie den Filmkassetten beigelegt hatte.
Auf unserer vorletzten gemeinsamen Reise nach Israel im Sommer vor zwei Jahren erkannte meine hundertjährige Großmutter ihren Lieblingssohn nicht mehr. Hatten wir nur für kurze Zeit das Wohnzimmer verlassen, um etwas aus der Küche zu holen oder ins Bad zu gehen, fragte sie ihre philippinische Pflegerin, wo all die Besucher hingegangen seien. Einen Abend lang saß ich allein mit ihr und der Pflegerin auf dem Sofa vor dem Fernseher, und meine Großmutter fragte in einem fort nach ihren Kindern: «Wo ist Pierre, wo ist Miriam, wo ist Colette, wo ist Marcel, und wo ist Antoine?» Wie oft wir ihr die Fragen auch beantworteten, nach ein paar Minuten des Schweigens fing die Fragerei von vorn an.
Als mein Vater mich an diesem Abend mit dem Auto aus Hulon abholte und nach Tel Aviv brachte, fiel mir plötzlich wieder die Geschichte seines kurzen Besuches Anfang der Siebziger ein. Ich fragte ihn, ob er sich denn erinnern könne, wo er die berühmten zwei Wochen vor vierunddreißig Jahren gewesen sei. «Welche zwei Wochen?», fragte er zerstreut zurück, denn wir standen gerade an einer Kreuzung. «Na, die mit dem Kaffee», sagte ich. Das Stichwort genügte. Mein Vater bog rechts ab, wechselte die Spur, und nachdem er sich eine neue Zigarette angezündet hatte, vertraute er mir nicht ohne Stolz das fehlende Detail an – den Pointenkiller sozusagen: Er sei hinunter zum Kiosk gegangen, daran könne er sich noch genau erinnern, erzählte er, und gerade als er die Zigaretten habe bezahlen wollen, habe hinter ihm ein Auto gehalten. Eine Frau habe das Fenster heruntergekurbelt und seinen Namen gerufen. Diese Frau hatte er vier Jahre zuvor am Strand von Tel Aviv kennengelernt, eine interessante und sehr anziehende Frau, und seitdem hatte mein Vater sie nicht mehr gesehen. Kurz haben sie miteinander geredet – worüber, wisse er heute nicht mehr–, und dann habe sie ihm gesagt, sie sei auf dem Weg nach Eilat, ob er nicht mitkommen wolle. Ein eindeutiges Angebot, betonte mein Vater und vergewisserte sich mit einem Seitenblick, ob ich auch verstand. Eines, das man sofort annehmen oder ablehnen müsse. Eines, dessen besondere Stimmung man durch den Satz «Ja gerne, aber ich muss mich noch von meiner Mutter verabschieden und saubere Unterwäsche einpacken» nur zerstören könne. «Wenn dir eine Frau» – und er senkte seine Stimme bei dem Wort Frau – «ein solches Angebot macht», sagte mein Vater, «dann gibt es nur eins: Du steigst ein.»
Ich rufe in München an, in Chemnitz, in Israel, in Frankreich, in Ungarn. Niemand hat etwas von meinem Vater gehört. Allerdings hat auch kaum jemand erwartet, von meinem Vater zu hören: Der Unterschied zwischen dem üblichen Nichtmelden meines Vaters und diesem besonderen Nichtmelden meines Vaters erschließt sich den meisten nicht, die ich nach ihm frage. Da mein Vater mir stets stolz die Telefonnummern seiner Eroberungen diktierte und ihnen wiederum meine Nummer zu geben pflegte, habe ich einen guten Überblick über seine weiblichen Bekanntschaften der letzten Jahre. Mit einigen habe ich auch schon lange und ermüdende Telefongespräche über das problematische Zusammensein mit meinem Vater geführt, ohne Erfolg. Es war keineswegs so, dass ihre Namen von da an in den Erzählungen meines Vaters nicht mehr auftauchten. Nur diese Frauen sind empfänglich für Nuancen, was meinen Vater betrifft. Sie sind sehr bemüht, ihre Erleichterung zu verbergen, wenn sie von mir erfahren, dass er nun schon seit Wochen vermisst wird, und enthusiastisch bieten sie an, mir bei meiner Suche zu helfen. Ohne Zweifel wäre es ihnen lieber, man findet ihn erschlagen in einem Waldstück neben einem Autobahnparkplatz, als dass sich herausstellt, dass er sich nicht bei ihnen meldet, weil er eine neue Freundin hat.
Auch die Familie in Israel ist nicht besorgt. «Du kennst doch deinen Vater», sagt mein Onkel Romain am Telefon, Antoines ältester Bruder, der ihn nun schon mehr als ein halbes Jahrhundert hat suchen müssen, seit sage und schreibe 1949, als ihn meine Großmutter in Casablanca regelmäßig auf die Straße geschickt hat, den kleinen Bruder nach Hause zu bringen.
Ich allein bin davon überzeugt, dass es mit seinem Verschwinden dieses Mal etwas anderes auf sich hat. Mein Vater ist nicht mehr jung, und er kann nicht mehr so leicht Geld verdienen unterwegs, für alles, was er zum Leben braucht: Zigaretten, Kaffee und französische Zeitungen. Er ist auch nicht mehr so risikofreudig wie früher. In den letzten Jahren ist es schon zu unangenehmen Engpässen gekommen, so zum Beispiel, als Martha ihn vorigen Winter rausgeworfen hat und Gizella nicht erreichbar gewesen ist. Da hat mein Vater dann eine Nacht im Auto zugebracht, ohne Heizung. Keine vierundzwanzig Stunden hat es gedauert, und er stand wieder in seiner schmutzigen Winterjacke vor Marthas Tür. «Siehst du, was für eine Ehefrau Martha ist», klagte mein Vater, als wir an diesem Abend miteinander telefonierten, nachdem er ein Bad genommen hatte und nun in ihrem Wohnzimmer vor der Heizung hockte. «Umbringen wollte sie mich. Einfach so in die Kälte schickt sie mich hinaus.»
Immer kürzer werden die Abstände zwischen seinen Fluchten und der Rückkehr. Und immer öfter kann man ihn abends bei Martha zu Hause erreichen, wo er liest, kocht oder fernsieht.
Es beunruhigt mich, dass das Auto bei Martha im Hof geparkt ist, die Koffer und Taschen im Schrank stehen und sein Pass in der Schreibtischschublade liegt. Joseph hat schon Dutzende Male angerufen, dabei ist Joseph der beste Freund meines Vaters und weiß meistens, wo er sich gerade aufhält. Er muss etwas Besseres gefunden haben als Martha, die ihn seit sechsunddreißig Jahren mit Unterbrechungen hasst und erträgt. Etwas Besseres als Eva, Renate, Uta und Heidrun, denn auch sie haben seit fünf Wochen nichts von ihm gehört. Dass er in letzter Zeit von keiner neuen Bekanntschaft erzählt hat, muss nichts heißen. Es ist durchaus möglich, dass mein Vater vormittags aus dem Haus geht, um Joseph oder Raoul zu treffen, und nur zwei Stunden später hat eine Schwabinger Lehrerin in den Fünfzigern, die mit einem soliden Rechtsanwalt oder Architekten ermüdende dreißig Jahre verheiratet ist und im Café zufällig mit meinem Vater ins Gespräch kommt, das Gefühl, ihr Leben habe sich verändert.
Mein Vater kann einen Menschen im Kaufhaus, in einem Schnellrestaurant, auf der Straße oder bei einem Arztbesuch kennenlernen. Ihm genügt ein kleiner Anlass – man sucht die Eingangstür, bestellt zufällig das gleiche Gericht, weiß die Uhrzeit, braucht Feuer oder die Zeitung–, um mit Fremden ein Gespräch zu beginnen.
Ich habe keine Lust mehr, ihn zu suchen. Überall, wo er hätte sein können, habe ich nun angerufen. Irgendwann wird er sich schon melden, mein Vater, mit irgendeiner lächerlichen Erklärung für seine Abwesenheit, und es täte einem leid um jede Minute, die man in die Suche nach ihm investiert hat.
Dennoch habe ich kein gutes Gefühl, als ich das Fremdwörterbuch und den Grammatikduden in meine Tasche packe. Wenn ich mich nicht beeile, komme ich zu spät in die Agentur. Das fehlte noch, dass ich wegen meines Vaters einen Kunden verliere.
Wahrscheinlich wäre es das Beste, ich würde eine Vermisstenanzeige bei der Polizei aufgeben. Ich versuche mir das Gespräch vorzustellen, das der diensthabende Beamte mit mir führt:
Polizist: «Sie möchten eine Vermisstenanzeige aufgeben?»
Ich: «Ja, mein Vater ist verschwunden.»
Polizist: «Seit wann vermissen Sie Ihren Vater denn?»
Ich: «Seit ungefähr fünf Wochen.»
Polizist: «Wieso kommen Sie erst jetzt?»
Ich: «Es ist nicht ungewöhnlich, dass mein Vater für längere Zeit verschwindet.»
Polizist: «Wie oft kommt das denn vor?»
Ich: «Ich weiß es nicht. Manchmal.»
Polizist: «Ist Ihr Vater verheiratet?»
Ich: «Ja, er lebt mit seiner zweiten Frau in München.»
Polizist: «Und warum hat sie ihn nicht vermisst gemeldet?»
Ich: «Sie vermisst ihn nicht.»
Polizist: «Sie vermisst ihn nicht?»
Ich: «Nein.»
Ich werde nach der Arbeit trotzdem zur Polizei gehen.
Auf dem Fahrrad konzentriere ich mich auf den Text, den ich heute zu schreiben habe: «Rufen Sie uns an, Ihre Krankenkasse kümmert sich gerne um Sie.» Dieser Satz war der Krankenkasse nicht enthusiastisch genug gewesen, und heute Morgen hatte mich der Kreativdirector angerufen und gebeten, einige Variationen dazu zu verfassen.
«Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Ihre Krankenkasse»– formuliere ich auf der Oranienburger Straße. Am Alexanderplatz: «Wir freuen uns sehr auf Ihren Anruf. Ihre freundliche Krankenkasse.» Das Fahrrad abschließen, warten auf den Fahrstuhl: «Wir würden Ihren Anruf außerordentlich begrüßen. Ihre Ihnen stets verbundene, freundliche Krankenkasse.» Im Fahrstuhl: «Ihr Anruf ist uns Ehre und Verpflichtung zugleich. Ihre Ihnen ergebene Krankenkasse.» Ich steige im zwölften Stock aus, drücke den elektronischen Türöffner, an meinem Platz tippe ich die vier Sätze in den Computer. Dann gehe ich in die Küche und mache mir einen Tee. Auf dem Alexanderplatz weit unten zu meinen Füßen laufen viele Menschen zwischen S-Bahn, der Straßenbahnhaltestelle und dem Kaufhaus hin und her. Wie schnell kann da jemand verlorengehen. Auf jeden Einzelnen von ihnen wartet irgendwo irgendjemand, und dieses Gefühl hat etwas so Schönes und Tröstliches, jeder ist bemüht, an den Ort zu gelangen, an den er gehört, keiner auf dem Platz unter mir hält inne, niemand zögert vor der Straßenbahn, lässt sie abfahren und schlägt plötzlich eine ganz andere Richtung ein. Wie wäre es, wenn mein Vater wieder auftauchen würde, um festzustellen, dass ihn niemand vermisst hat? Würde er mich eigentlich suchen, wenn ich einfach verschwinden würde? Er ist nie allein gewesen. Nie hat ihm jemand zu verstehen gegeben: Jetzt ist es genug. Auch ich habe in der wenigen Zeit, die wir miteinander verbringen, ein Dutzend Dinge erlebt, die ich ihm hätte nicht verzeihen dürfen. Zum Beispiel, dass er in Jerusalem auf einem Ausflug mit meiner Freundin Hannah mitten auf einer Kreuzung kehrtmachte und in der Menge verschwand. Während der zweiten Intifada, wo in der Stadt Dutzende von Bomben hochgingen und über fünfzig Leute getötet wurden, ist er einfach ohne einen Abschiedsgruß davongelaufen. Es war unmöglich, ihn einzuholen, und das war auch der Sinn der Sache, denn er ist, wie sich hinterher herausgestellt hat, mit dem Auto nach Hulon zurückgefahren, mit dem wir gemeinsam gekommen waren. Hannah und ich mussten am Abend den Bus zurück nach Tel Aviv nehmen. Warum er das getan hat, weiß ich bis heute nicht, entschuldigt hat er sich jedenfalls nie, und noch heute werde ich wütend, wenn ich daran denke. Damals habe ich ihm inständig gewünscht, dass er einen Unfall hat oder überfallen wird, und plötzlich war ich sicher, dass genau in diesem Bus, in dem wir uns befanden, der nächste Anschlag stattfinden wird, als Strafe für meine schlechten Gedanken.
«Name, Alter und Wohnort der vermissten Person», fordert mich der Beamte auf.
«Antoine Hasidim, geboren 1941 in Casablanca, Wohnort: Türkenstraße neunzehn in München-Schwabing. Staatsangehörigkeit Israel.» Der Beamte schreibt Namen und Adresse auf den Vordruck für Vermisstenanzeigen. Als er bei der Zeile für die Staatsangehörigkeit ankommt, hält er inne. Er schaut mir ins Gesicht: «Kein Deutscher?» «Nein, Israeli.» «Ihr Freund?» Und obwohl er mir auch die letzte Frage in einem freundlichen Ton stellt, hat sie etwas Ungehöriges, Beleidigendes. «Nein, mein Vater.» «Wie lange schon hier wohnhaft?»
«Mein Vater wohnt seit achtunddreißig Jahren in Deutschland.»
«Aufenthaltserlaubnis?» Seine Hand rutscht weiter zum nächsten Feld.
«Er ist seit siebenunddreißig Jahren mit einer Deutschen verheiratet.»
«Mit Ihrer Mutter?»
«Nein.»
Jede Information komplettiert das Bild über meine Verhältnisse, die mir immer so unendlich kompliziert vorgekommen waren, die sich aber plötzlich problemlos in ein vierseitiges Dokument eintragen lassen. «Gut, nun notieren Sie bitte hier noch eine kurze Beschreibung Ihres Vaters in diesem Feld, Größe, Haarfarbe, Augenfarbe und besondere Kennzeichen.» Der Beamte schiebt das ausgefüllte Formular zu mir herüber. «Haben Sie vielleicht ein Foto von Ihrem Vater?» Während ich schreibe, schüttele ich den Kopf. Ich habe nur ein einziges Foto von ihm, und darauf ist er neunundzwanzig Jahre alt, meine verliebte Mutter hat es gemacht. Der Name meines Vaters und dieses Foto waren das Einzige, was ich als Kind von ihm kannte, und als ich von zu Hause nach Berlin ging, hatte ich es heimlich mitgenommen.
Wie lange ich meinen Vater vermisse, ist bereits eingetragen: sechsunddreißig Tage. Danach haben mich zwei andere Beamte schon vorhin gefragt. Als einer von ihnen meine Geschichte wiederholte, um sicherzugehen, dass er alles richtig verstanden hat, klang sie plausibel: Ich vermisse meinen Vater seit mehreren Wochen. Da er in einer anderen Stadt wohnt und ich ihn nicht täglich spreche, hätte es sein können, dass er geschäftlich oder privat verreist ist und vergessen hat, mir das mitzuteilen. Und Martha, seine Frau, mit der er schon seit Jahren eine schwierige Ehe führt, ist nicht zur Polizei gegangen, weil sie glaubte, ihr Mann habe sie verlassen.
In der Agentur hatte ich mich, nachdem mein Chef beschlossen hatte, die ursprüngliche Abschiedsformel in dem Anschreiben der Krankenkasse zu verwenden, auf den Besuch im Polizeirevier vorbereitet und einen DIN-A2-Bogenerstellt mit den Familien- und Freundschaftsverhältnissen meines Vaters, soweit sie mir bekannt waren: auf der rechten Seite feinsäuberlich untereinander die in Israel lebenden Geschwister: Romain, der Älteste, Miriam und Maurice, die beiden Jüngsten, Pierre, der meinem Vater am ähnlichsten ist, und Shmuel, der noch bei meiner Großmutter wohnt, außerdem Colette, die mit keinem mehr redet. Neben den Namen hatte ich die Adressen und Telefonnummern notiert, außerdem die Ehepartner und die Anzahl der Kinder. Auf der linken Seite stehen dann Martha und Heidrun, die ehemalige Dozentin für Marxismus-Leninismus in Chemnitz, Renate, die Kunstlehrerin aus München, mit der er sich fast jeden Mittag im Café Atzinger trifft, die Französin Uta, die er in Lyon auf der Straße kennengelernt hat und die uns einmal Geld für die Rückreise von Südfrankreich nach München geschenkt hat. Außerdem Gizella, die Ungarin, die sich seit vier Jahren von ihm trennt, Eva, die einen Skinhead zum Sohn hat, alle Frauennamen, die mein Vater je erwähnt hatte, dazu alles, was ich von ihnen wusste, und der Zeitpunkt, an dem sie vermutlich in sein Leben getreten waren. In der Mitte dann seine Freunde in München, viele Araber, die ich nur dem Vornamen nach kenne: Raoul, Joseph, Fahesh, Maarouf und Adil. Dann den emeritierten Physikprofessor, den er jeden Sonntag im Café der Pinakothek der Moderne trifft, um zu philosophieren, und der nun schon fünfmal seinen Kaffee hat alleine trinken müssen. Zwei Stunden hatte ich daran gesessen und die einzelnen Kategorien in verschiedenen Farben gekennzeichnet – die engste Familie in Gelb, angeheiratete und entfernte Verwandte in Orange, Freunde von Antoine in Lila, die gemeinsamen Freunde von ihm und Martha in Grün und die Frauen in Rot. Zufrieden mit meiner Arbeit war ich zum Kopierer gegangen und hatte zwei Farbkopien gemacht. Diese Aufzeichnungen werden der Polizei sehr hilfreich sein bei der Suche nach meinem Vater, hatte ich gedacht. Aber als ich dann vor den beiden Beamten stand, haben mich plötzlich Zweifel befallen. Vielleicht würde dieses Papier den Eindruck erwecken, als sei es bei den vielen Freunden, Verwandten und Frauen praktisch unmöglich, meinen Vater ausfindig zu machen, also habe ich es in meiner Tasche stecken lassen.
Ich reiche dem Beamten das Formular zurück. Es ist gar nicht so einfach gewesen, diese Vermisstenanzeige aufzugeben, jedenfalls nicht so einfach, wie ich dachte. Ich habe hinreichende Gründe dafür anführen müssen, dass meine Sorgen berechtigt sind, Ausschlag hat dann die Tatsache gegeben, dass mein Vater ohne Geld und Auto war, als er am sechzehnten Januar verschwand.
Die Stimme am elektronischen Türöffner hat übrigens viel wärmer und mitfühlender geklungen als die des Beamten, der jetzt vor mir steht. Wahrscheinlich hat er eine junge Mutter erwartet, deren Kind am Abend nicht nach Hause gekommen ist. Ich dagegen suche einen achtundsechzigjährigen Mann – lichtes Haar, schlechte Zähne, nikotingelbe Finger. Einen Menschen, der nie den kleinsten Cent zum Bruttosozialprodukt beigetragen hat. Und der Staat wird, wenn mein Vater lebend gefunden wird, weiterhin seine Miete, die Zigaretten und die Kaffeehausbesuche zahlen müssen, bis an sein Lebensende. Der Beamte seufzt, bevor er fortfährt: «Ist Ihr Vater selbstmordgefährdet, oder vermuten Sie ein Verbrechen?»
Ich verneine, sage, dass ich vielmehr an einen Unfall gedacht habe.
«Natürlich werden wir in allen Krankenhäusern nachfragen», erklärt er mir nun doch mit ein wenig Mitgefühl. «Und falls ihm etwas zugestoßen sein sollte, werden wir es sicher herausbekommen. Aber weitere Nachforschungen werden wir nicht anstellen: Ihr Vater ist ein freier und erwachsener Mann, und solange keine Eigen- oder Fremdgefährdung vorliegt, kann er gehen, wohin er will.»
«Was ist, wenn sie ihn nicht finden?», frage ich.
«Nach zehn Jahren können Sie einen Menschen für tot erklären lassen. Bis dahin werden Konten, Lebensversicherungen oder andere Werte eingefroren.»
«Nach jedem Menschen wird also zehn Jahre gesucht?», frage ich den Beamten.
«Wie ich schon sagte, nicht wirklich», antwortet dieser.
Auf einen kleinen Zettel schreibe ich noch die Telefonnummer meines Onkels Romain, der Beamte heftet ihn an das ausgefüllte Formular, ich bedanke mich, und im nächsten Moment stehe ich im dunklen Flur. Allein und erleichtert. Ich fühle mich wie nach einem Zahnarztbesuch: Etwas Notwendiges ist unternommen worden, und nun kann man die Sache für eine Weile vergessen. Auf dem Weg nach Hause kaufe ich mir zur Belohnung zwei Schokoriegel, doch kaum habe ich sie aufgegessen, wird mir schlecht, und ich bin genauso unruhig und traurig wie vorher.
Am nächsten Nachmittag, gegen drei, ich sortiere gerade meine Rechnungen, klingelt das Telefon: Es ist Martha. Sofort bereue ich, dass ich nicht gewartet habe, bis der Anrufbeantworter angesprungen ist.
Marthas Einstellung mir gegenüber hat sich in den letzten achtundvierzig Stunden nicht verändert: Kühl und voll beherrschten Ärgers teilt sie mir den Grund ihres Anrufes mit: «Du hast eine Anzeige seinetwegen aufgegeben!»
Die Polizei ist bei ihr gewesen und hat nach ihrem Ehemann Antoine Hasidim gefragt. Und man hat ihr auch gesagt, wer sie geschickt hat. «Meinst du nicht, dass ein kurzer Anruf angebracht gewesen wäre, um mich vorzuwarnen? Zwei Beamte sind vor ein paar Stunden in einem Polizeiwagen vorgefahren und haben im Hof geparkt, sodass alle sie sehen konnten», berichtet sie. Sofort sehe ich sie vor mir in ihrem gelben Bademantel, wie sie neugierig aus dem Küchenfenster schaut − wie die meisten ihrer Nachbarn auch − und wie das angenehme Gefühl der Neugierde dann aber nur bei ihr in Schreck umschlägt, als die Beamten sich dem ehemaligen Antiquitätenladen Prössl-Hasidim nähern. Durch das große Fenster versucht einer von ihnen, ins Innere zu spähen, der andere rüttelt an der verschlossenen Holztür mit den hübschen Eisenbeschlägen aus dem achtzehnten Jahrhundert. Sofort denkt Martha: Die sind hier wegen der vielen Ankäufe und Verkäufe ohne Quittung oder sonst einen Beleg. Nie hatte sie meinem Vater die Notwendigkeit einer ordentlichen Buchführung verständlich machen können, und alle Unregelmäßigkeiten haben sich auch nicht ausbügeln lassen über die Jahre. Es ist ein Wunder, dass sie nicht beide im Gefängnis gelandet sind. Und nun ist es doch passiert, ist sie überzeugt. Jetzt, wo sie schon dachte, sie habe diese ewigen Sorgen und den Streit hinter sich; drei Kreuze hat sie gemacht, als sie letztes Jahr den Laden nach dreiunddreißig Jahren endgültig geschlossen hat. Erst als sie die Schritte auf der Treppe hörte, sei ihr plötzlich eingefallen, dass die Polizei vielleicht aus einem anderen Grund kommen könnte: Es ist ihm etwas passiert, sie haben ihn gefunden, irgendwo. Und sie habe geglaubt, das Herz bleibe ihr stehen, als es an ihrer Tür läutete, und sie sei erst beim zweiten Klingeln in der Lage gewesen, die Tür zu öffnen.
All das hätte ich ihr ersparen können mit einem kurzen Anruf. Zu allem Überfluss hat die Polizei das Zimmer von Antoine sehen wollen, und das sei ihr entsetzlich unangenehm gewesen, denn es war noch genau in dem Zustand, in dem er es verlassen hatte: die dreckige Unterwäsche auf dem Stuhl, die benutzten Taschentücher auf dem Nachtschrank, die vollen Aschenbecher neben dem ungemachten Bett. Martha redet sich in Rage, mir bleibt nichts übrig, als zuzuhören. Außenstehende können ja nicht wissen, dass es sinnlos ist, hinter Antoine herzuräumen, schimpft sie, dass sie es sogar versucht hat am Anfang ihrer Ehe, aber ein einzelner Mensch hat ja gar nicht die Kraft dazu, den Status quo der Räumlichkeiten aufrechtzuerhalten, in denen sich dieser Mann aufhält. Weiß denn die Polizei, wie oft sie die Küche geputzt hat, den Fußboden, die Schränke, die Arbeitsflächen, und zwei Stunden später steht er auf, macht sich einen Kaffee, stellt den Kaffeefilter auf eine viel zu kleine Tasse, und naturgemäß läuft die Tasse über, der Kaffee fließt über die Küchenplatte und die geputzte Spülmaschine, dann kommt er noch einmal in die Küche, um sich ein Stück Brot zu holen, tritt mit seinen Hausschuhen in die Kaffeelache, hinterlässt braune Fußstapfen auf dem geputzten Küchenboden und anschließend auf dem ohnehin schon ruinierten Wohnzimmerteppich. Wie viel Arbeit notwendig ist, um die gemeinsamen Räume in einen einigermaßen repräsentablen Zustand zu bringen, könnten sich andere kaum vorstellen, sagt sie. Das hintere Zimmer, in dem mein Vater wohnt, habe sie quasi aus dem Grundriss dieser Wohnung gestrichen, und wenn Besucher kämen, kontrolliere sie, ob die Tür zu diesem unerfreulichen Teil ihres Lebens auch fest verschlossen sei.
Nach der Inspektion des Zimmers setzten sich die Beamten mit ihr an den Wohnzimmertisch und stellten ihr viele Fragen: Wie eine Verbrecherin sei sie sich vorgekommen. Und ob sie den Namen von der Frau wüsste, mit der ihr Mann vielleicht zusammenlebt. «Wenn er diese Wohnung verlassen hätte, um zu einer anderen Frau zu ziehen, dann wäre er schon längst wieder zurück», habe sie gesagt. Da seien die beiden Polizeibeamten erst recht misstrauisch geworden, denn ich, Yael Fischer, habe bei der Polizei angegeben, Antoine Hasidim habe eine Geliebte. Gleichzeitig habe ich mich jedoch als seine Tochter ausgegeben, was aber nicht der Wahrheit entspreche. In einem wenig freundlichen Ton habe man ihr erklärt, dass man nun eine Antwort auf all die Ungereimtheiten haben wolle, der eine Beamte habe ihr sogar gedroht, sie zum Revier mitzunehmen, als sie sich weigerte, mit ihnen die Einzelheiten ihres Ehelebens zu diskutieren. «Dich, seine Tochter, sollten sie aufs Revier nehmen und verhören, habe ich ihnen geantwortet. Du weißt ja anscheinend alles über seine Frauengeschichten.» «Es tut mir leid», sage ich. Und es tut mir wirklich leid: Wie konnte ich wissen, dass die Polizei Martha in München aufsuchen würde, nachdem man mich vorgestern noch darüber aufgeklärt hatte, dass erwachsene Menschen nicht gesucht werden.
Die Beamten haben Martha dann aber doch nicht mitgenommen, dafür das Mobiltelefon meines Vaters, seinen Reisepass, den Führerschein und ein Foto von ihm. Alle Gegenstände, außer dem Foto, hatten sich in seinem Zimmer befunden. Und sie fragten Martha, ob sie mich kenne: «Sie haben vermutet, du bist eine Geliebte von ihm», sagt Martha, «und traust dich nicht, bei mir anzurufen. So ein Quatsch, was die sich immer ausdenken. Aber mach dir keine Sorgen, ich habe ihnen erklärt, dass du seine Tochter bist. Ohne Zweifel.»
Als ich elf Jahre alt war, hatte er uns das erste Mal besucht. Ich war so aufgeregt, dass ich schon Stunden vorher an der Straße vor unserer Einfahrt stand. Hier wird er ankommen, hier wird er langgehen, dachte ich. Als er dann kam, versteckte ich mich im Garten und beobachtete von dort aus, wie er aus seinem Auto ausstieg und zu unserer Haustür ging. Mein Vater war genauso schön und geheimnisvoll, wie ich ihn mir immer vorgestellt hatte.
Nachdem meine Mutter, mein Stiefvater, meine Schwester und ich mit ihm Tee getrunken hatten, ließen sie mich mit meinem Vater allein. Seine Aufmerksamkeit hatte für mich beinahe etwas Obszönes. Er bemühte sich um mich, und das kannte ich nicht. Er hatte mir einen Kassettenrecorder mitgebracht und spielte mir Gedichte von Heinrich Heine vor: «Sie liebten sich beide, doch keiner/Wollt’ es dem andern gestehn;/Sie sahen sich an so feindlich,/und wollten vor Liebe vergehn.» Nach jeder Strophe stoppte er die Kassette und fragte mich, ob mir das denn gefalle und ob ich verstanden habe, was der Dichter damit meine. Ich war jedoch zu klein für Heine und seine Liebesangelegenheiten und schämte mich furchtbar beim Zuhören. Wie erleichtert war ich, als meine Mutter ins Zimmer kam und uns vorschlug, spazieren zu gehen.
Auf diesem Spaziergang haben sich mein Vater und meine Mutter dann gestritten. Sie hatten sich mehr als zehn Jahre nicht gesehen, aber es ist ihnen offensichtlich leichtgefallen, an damals geführte Gespräche anzuknüpfen. Es ging um Politik, daran erinnere ich mich − wenn meine Mutter streitet, geht es meistens um Politik −, mein Stiefvater Burkhardt ging in anklagender Haltung neben ihnen her. «67 habt ihr euch am ägyptischen Volk schuldig gemacht, du bist Bürger eines unterdrückerischen und imperialistischen Staates»,





























