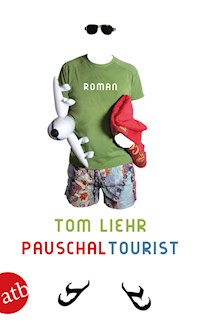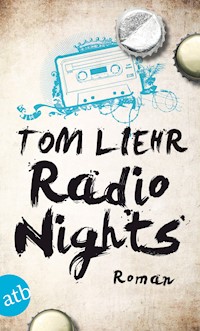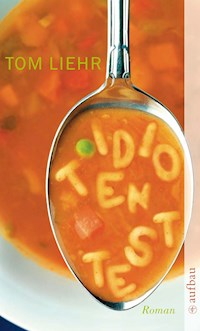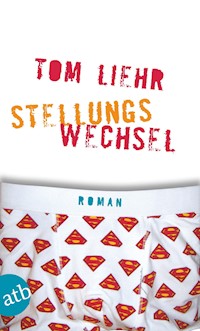12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei humorvolle Romane in einem E-Book Bundle!
Leichtmatrosen
Das Leben ist eine Schleuse.
„Im Flur drückte ich zum x-ten Mal die Wiedergabetaste des Anrufbeantworters. Patrick, ich bin morgen in Düsseldorf, danach im Allgäu. Ich freue mich auf die Pause bei meiner Familie. Hab dich lieb. – Hab dich lieb. Das sagt man zur eigenen Mutter, aber doch nicht zu dem Mann, mit dem man sechzig Stellungen aus dem Kamasutra ausprobiert hat.“
Patrick ist sich sicher, dass Cora ihn betrügt, und ausgerechnet jetzt hat er sich mit drei – sogenannten – Freunden verabredet, mit einem Hausboot die Havel hinaufzuschippern. Eine Idee, die ihm nun so klug vorkommt wie ein Landkauf auf dem Jupiter. Die Chaos-Crew: Henner, ein evangelischer Pfarrer, Mark, ein Verlierer, wie er im Buche steht, und Simon, der gerne die Welt erklärt, unzuverlässig ist und fünfundzwanzig Handys besitzt. Mit dem Schiff „Dahme“ stechen sie in See. Zehn absurde, chaotische und doch wunderschöne Tage auf dem Wasser, die bei den vier Männern etwas zum Vorschein bringen, das sie alle eigentlich längst wissen: So kann es nicht weitergehen ...
Vier Männer und ein Boot – ein Roman, der Lust auf den nächsten Sommer macht und auf ganz viel mehr.
Landeier
Sebastian Kunze ist als Großstadtjournalist gescheitert. Er landet mit Frau und Tochter in der brandenburgischen Provinz, denn Melanie ist Psychotherapeutin, und auf dem Land gibt es, was sie braucht: Einen Kassensitz und therapiebedürftige Menschen. Doch die ländliche Realität zwischen Gurkenständen und Landgaststätten hält für das Paar einige Überraschungen bereit. Melanie traut sich bald kaum mehr auf die Straße - wegen all der «Bescheuerten». Sebastian hingegen lernt die Überschaubarkeit des neuen Lebens zu schätzen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 800
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Leichtmatrosen
Das Leben ist eine Schleuse.
„Im Flur drückte ich zum x-ten Mal die Wiedergabetaste des Anrufbeantworters. Patrick, ich bin morgen in Düsseldorf, danach im Allgäu. Ich freue mich auf die Pause bei meiner Familie. Hab dich lieb. – Hab dich lieb. Das sagt man zur eigenen Mutter, aber doch nicht zu dem Mann, mit dem man sechzig Stellungen aus dem Kamasutra ausprobiert hat.“
Patrick ist sich sicher, dass Cora ihn betrügt, und ausgerechnet jetzt hat er sich mit drei – sogenannten – Freunden verabredet, mit einem Hausboot die Havel hinaufzuschippern. Eine Idee, die ihm nun so klug vorkommt wie ein Landkauf auf dem Jupiter. Die Chaos-Crew: Henner, ein evangelischer Pfarrer, Mark, ein Verlierer, wie er im Buche steht, und Simon, der gerne die Welt erklärt, unzuverlässig ist und fünfundzwanzig Handys besitzt. Mit dem Schiff „Dahme“ stechen sie in See. Zehn absurde, chaotische und doch wunderschöne Tage auf dem Wasser, die bei den vier Männern etwas zum Vorschein bringen, das sie alle eigentlich längst wissen: So kann es nicht weitergehen ...
Vier Männer und ein Boot – ein Roman, der Lust auf den nächsten Sommer macht und auf ganz viel mehr.
Landeier
Sebastian Kunze ist als Großstadtjournalist gescheitert. Er landet mit Frau und Tochter in der brandenburgischen Provinz, denn Melanie ist Psychotherapeutin, und auf dem Land gibt es, was sie braucht: Einen Kassensitz und therapiebedürftige Menschen. Doch die ländliche Realität zwischen Gurkenständen und Landgaststätten hält für das Paar einige Überraschungen bereit. Melanie traut sich bald kaum mehr auf die Straße - wegen all der «Bescheuerten». Sebastian hingegen lernt die Überschaubarkeit des neuen Lebens zu schätzen ...
Über Tom Liehr
Tom Liehr war Redakteur, Rundfunkproduzent und DJ. Seit 1998 Besitzer eines Software-Unternehmens. Er lebt in Berlin.
Im Aufbau Taschenbuch sind seine Romane „Radio Nights“, „Idiotentest“, „Stellungswechsel“, „Geisterfahrer“, „Pauschaltourist“, „Sommerhit“, „Leichtmatrosen“ und "Freitags bei Paolo" lieferbar.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Tom Liehr
Leichtmatrosen & Landeier
Zwei humorvolle Romane in einem E-Book Bundle!
Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Newsletter
Leichtmatrosen
Vorbemerkung
Tag 1: Fieren
Tag 2: Treideln
23 Tage vorher: Lavieren
Tag 3: Kabbeln
Tag 4: Spleißen
Tag 5: Schamfilen
19 Tage vorher: Entern
Tag 6: Schwojen
Tag 7: Staken
Tag 8: Peilen
Tag 9: Kalfatern
Tag 10: Slippen
Ein Jahr später: Ankern
Nachbemerkung
Glossar
Landeier
Prolog: Es tut mir leid, Pocahontas
Teil Eins: Diagnose
1. Tagebuch von Melanie Kunze, Donnerstag, 16. Juni, 15 . 30 Uhr
2. Clubbing
3. Tagebuch von Melanie Kunze, Donnerstag, 16. Juni, 20 . 00 Uhr
4. Unordnung
5. Tagebuch von Melanie Kunze, Freitag, 17. Juni, 15 . 00 Uhr
6. LDS
7. Tagebuch von Melanie Kunze, Freitag, 17. Juni, 19 . 00 Uhr
8. Silikon
9. Tagebuch von Melanie Kunze, Samstag, 18. Juni, 10 . 30 Uhr
10. Erkundungen
11. Tagebuch von Melanie Kunze, Samstag, 18. Juni, 16 . 30 Uhr
12. Freunde
13. Tagebuch von Melanie Kunze, Sonntag, 19. Juni, 01 . 30 Uhr
14. Kleinanzeigen
15. Tagebuch von Melanie Kunze, Sonntag, 19. Juni, 19 . 30 Uhr
16. Nscho-tschi
Teil Zwei: Therapie
1. Arbeitslos
2. Tagebuch von Melanie Kunze, Montag, 20. Juni, 20 . 00 Uhr
3. Autorengruppe
4. Tagebuch von Melanie Kunze, Montag, 20. Juni, 23 . 30 Uhr
5. Warndreieck
6. Schatzsuche
7. Tagebuch von Melanie Kunze, Dienstag, 21. Juni, 17 . 00 Uhr
8. Baumarkt
9. Tagebuch von Melanie Kunze, Mittwoch, 22. Juni, 18 . 30 Uhr
10. Playmobil
11. Tagebuch von Melanie Kunze, Donnerstag, 23. Juni, 13 . 30 Uhr
12. Ausritt
13. Tagebuch von Melanie Kunze, Samstag, 25. Juni, 2 . 30 Uhr
Teil Drei: Konvaleszenz
1. Selfie
2. Missionar
3. Tagebuch von Melanie Kunze, Samstag, 25. Juni, 14 . 00 Uhr
4. Gin Tonic
5. Tagebuch von Melanie Kunze, Samstag, 25. Juni, 22 . 00 Uhr
6. Aufräumarbeiten
7. Tagebuch von Melanie Kunze, Sonntag, 26. Juni, 13 . 30 Uhr
Teil Vier: Rehabilitation
Brunner Gurkenfest (Drei Monate später)
Impressum
Tom Liehr
Leichtmatrosen
Roman
Für die Jungs –Steve, Maddin, Zirni und Frank.Danke!
Auf dem Boot bleibtauf dem Boot.
Vorbemerkung
Beim Entwurf dieser Geschichte stand irgendwann die Entscheidung an, die Originalschauplätze – Flüsse, Seen, Kanäle, Häfen, Orte, Schleusen, Marinas usw. – mit ihren richtigen Namen zu nennen oder diese durch Fantasiebezeichnungen zu ersetzen. Ich habe mich für Ersteres entschieden, denn dieser Text ist – nicht nur am Rande – auch einer über jene wunderbare Landschaft zwischen Schwerin und Berlin.
Dadurch könnte aber der Eindruck entstehen, das Personal an Schleusen, in Charterhäfen usw. wäre ebenfalls authentisch, doch das ist nicht der Fall. Bei meinen eigenen Touren und Recherchereisen sind mir in der Region fast ausschließlich freundliche, zuvorkommende und verantwortungsbewusste Menschen begegnet, die die Hausboottouristen keineswegs als notwendiges Übel oder gar als üble Parasiten betrachten (einige Freizeitskipper allerdings scheinen so zu denken). Auch die Chartereinweisungen, die ich selbst mitgemacht habe, verliefen absolut ordnungsgemäß und gewissenhaft – und vermittelten jene Kenntnisse, die für eine Bootsreise unabdingbar sind. In anderen Worten: Diese Geschichte ist, ihr Personal betreffend, vollständig fiktiv, aber die meisten Schauplätze gibt es wirklich. Nur Restaurants und Kneipen sind frei erfunden, und einige Details wurden aus dramaturgischen Gründen verändert, was mir Kenner des Reviers bitte verzeihen mögen.
Ein »Treffen Evangelischer Freikirchen« im Jahr 2008 gab es meines Wissens ebenfalls nicht.
Fast alle nautischen Begriffserklärungen bei den Kapitelüberschriften stammen aus »Seemannssprache«, Dietmar Bartz, Delius Klasing.
Tag 1:Fieren
Fieren – eine Ketteoder ein Tau nach-, auslassen.
Curt lümmelt sich auf der Rückbank von Lauries Auto, vorn sitzen Laurie und Steve dicht beieinander; der Wagen verfügt dort über eine durchgehende Sitzreihe, und Steve fährt, obwohl das Auto Laurie – Curts Schwester – gehört. Die drei haben sich über das unterhalten, was jetzt kommen wird – nach der Highschool –, inzwischen aber amüsieren sie sich über Wolfman Jacks Radioscherze. Der Song »Why Do Fools Fall In Love« von Frankie Lymon & The Teenagers beginnt. Steve stoppt den Wagen an einer Ampel, Curt schaut aus dem Fenster. Direkt neben ihnen hält ein weißer 1956er Ford Thunderbird Convertible, an dessen Steuer eine hinreißende junge, blonde Frau sitzt. Sie lächelt; Curt lächelt zurück. Dann formt sie mit den Lippen den Satz »I love you«. Die Ampel wird grün, beide Autos fahren an, aber der T-Bird biegt nach rechts ab. Curt reißt das Fenster auf, ruft der Frau hinterher; er ist fassungslos, hingerissen, euphorisiert. Er bittet Steve, anzuhalten, dem weißen Wagen zu folgen, denn er meint, eine Vision gehabt, eine – seine persönliche – Gottheit gesehen zu haben. Aber Steve fährt unbeirrt weiter. Den Rest der Nacht wird Curt damit verbringen, dieser Vision nachzujagen, und mehr als einmal wird er einen kurzen Blick auf den weißen Schlitten erhaschen. Aber die blonde Frau sieht er nicht wieder.
Ich wischte mit dem Rücken des rechten Zeigefingers die Tränen von meinen Wangen. Diese Szene in der elften Minute hatte ich schon viele dutzend Mal gesehen; ich kannte sie auswendig, konnte jede mimische Veränderung in Curts Gesicht – gespielt vom damals noch taufrischen Richard Dreyfuss – antizipieren. Es schmerzte mich dennoch immer wieder, wenn der weiße Thunderbird abbog, und ich hoffte absurderweise darauf, dass Curt irgendwann die weiße Fee träfe, doch der Film endete jedes Mal gleich. Der Moment der Katharsis blieb ein metaphorischer, aber gleichzeitig drückte er all das aus, woran ich glaubte, wenn es um Liebe ging.
Oder, besser: geglaubt hatte.
Ich ging in den Flur und vermied den Abstecher zum Kühlschrank; es wäre zu einfach gewesen, mich jetzt zu besaufen, und auch zu klischeehaft. Männer müssen sich nicht betrinken, wenn in ihrem Leben etwas schiefläuft, aber, zugegeben, meistens tun sie es. Bei mir bewirkte höher dosierter Alkohol lediglich, dass ich noch trübsinniger, noch melancholischer, noch selbstzerstörerischer wurde; das Ungemach wuchs zu einem emotionalen Sauron an, dessen böses, feuriges Auge mich nicht mehr losließ. Kiffen hatte dieselbe Wirkung. Ich beneidete Leute, die der Konsum weicher Drogen in fröhliche Partytiere verwandelte.
Im Flur drückte ich zum x-ten Mal die Wiedergabetaste des Anrufbeantworters.
Patrick, ich bin in Köln und morgen in Düsseldorf, danach dann im Allgäu. Die Tour macht Spaß, aber ich freue mich auf die Pause bei meiner Familie. Wir hören uns. Hab dich lieb.
Hab dich lieb. Das sagt drei Jahre altes Brüllfleisch zum Papa, das sagt man zur eigenen, inzwischen sechzigjährigen Mutter, die altersbedingt für so etwas empfänglich ist. Aber doch nicht zu dem Mann, mit dem man sechzig Stellungen aus dem Kamasutra ausprobiert, dessen Sperma man geschluckt, dessen feuchte, fleckig-dunkelgraue Socken man in die Waschmaschine gesteckt hat. Hab dich lieb. Diese Wendung hatte ich von Cora noch nie gehört. Aber sie war nur ein Symptom. Eines von vielen.
Ein heftiges Symptom, eigentlich ein Indiz, nein, ein Beweis war die Tatsache, dass sie überhaupt nicht ins Allgäu fahren würde. Sie hatte sich mit diesem Alibi ein bisschen zu sicher gefühlt, weil ich ihre Eltern – nichtswürdige Spießer, die mich für einen Verlierer hielten – hasste, aber Cora hatte leider vergessen, ihre Mutter über die Tour und den vermeintlichen Besuch zu informieren, so dass ich Rosa (Rosa!) plötzlich am Telefon hatte, obwohl die nur anrief, wenn sie todsicher war, meine Freundin direkt an den Apparat zu bekommen. In der Regel mied sie das Festnetz und wählte Coras Handynummer. Das Gespräch, das wir führten, war kurz, aber erhellend.
»Patrick. Ach.« Dieses Ach war ein Filtrat aller Achs, eine Beleidigung und Feststellung, ein Urteil, ein zutiefst ablehnendes Geräusch, eine Zusammenfassung all dessen, was sie von mir dachte und hielt – was nicht viel war. Ich interessierte sie weniger als ein Ameisenpopel, und sie hätte gerne mit mir gemacht, was man mit Ameisenpopeln tun würde, wenn man dazu in der Lage wäre.
»Rosa.« Ich versuchte, Neutralität in meine Stimme zu legen, aber das war eigentlich unmöglich, wenn ich mit Coras Mutter sprach – was glücklicherweise äußerst selten geschah.
»Ich würde gerne mit meiner Tochter sprechen.«
»Die ist nicht da.«
»Oh.« Schweigen.
»Ich sehe sie auch erst, nachdem sie bei euch war.«
»Bei uns?« Kurz überrascht, dann erkennbar begreifend, in eine Falle getappt zu sein, die ich ohne Absicht aufgestellt hatte. Ich wurde hellhörig.
»Ach so«, ergänzte sie rasch, aber Rosa war keine gute Schauspielerin. »Stimmt ja.«
»Holt ihr sie vom Bahnhof ab?«, fragte ich, dem Impuls folgend, soeben eine Lüge aufzudecken.
Rosa schwieg für einen Moment. »Sicher«, sagte sie.
Aber Cora würde nicht mit dem Zug kommen. Vom Auftritt in Memmingen wollte sie ein Taxi nehmen; das Kuhkaff, in dem ihre Eltern lebten, war nur eine Ameisenpopellänge davon entfernt.
»So, so.«
»Ja. Äh. Morgen?«, riet Rosa. Ich hätte sie gerne in diesem Augenblick gesehen, zugleich triumphierend – schließlich musste sie auch begriffen haben, dass hier ein Lügengebäude einstürzte, das mich auf unselige Weise betraf – und stark verunsichert, denn ausgerechnet von mir, dem nichtswürdigen Verlierer (»Lektor? Was tun diese Leute? Bücher lesen?«), beim Lügen ertappt zu werden, passte nicht in ihr Wertgefüge. Ich antwortete nicht.
»Oder doch übermorgen? Ich habe meinen Kalender nicht hier.«
»Ich auch nicht«, sagte ich schnippisch, aber ich war am Boden zerstört. In diesem Augenblick wurde mir nämlich klar, was all die kleinen Zeichen bedeuteten, die ich seit jenem verhängnisvollen Nachmittag geflissentlich ignoriert oder heruntergespielt hatte. Cora betrog mich, sie hatte nicht viel Federlesen veranstaltet, sondern einfach die nächstbeste Option gewählt: ein neuer Kerl. Sie würde nicht zu ihren Eltern fahren, sondern etwas anderes tun, mit jemand anderem. Sehr wahrscheinlich mit einem männlichen Jemand. Ich hatte ein oder zwei Typen im Verdacht, ihren Bassisten und diesen glatten Gesellen von der Booking-Agentur, mit der sie zusammenarbeitete, aber diese Verdächtigungen waren ziemlich beliebig, denn Cora hielt mich aus ihrem Musikerdasein weitgehend heraus. Es spielte auch keine Rolle, wer es war. Entscheidend war, dass es jemanden gab.
Ich ging doch zum Kühlschrank, aber nicht, um die Wodkaflasche aus dem Eisfach zu nehmen, die dort seit unserem Einzug lag. Im Gemüsefach lagerte mein Mousse-Vorrat, das gute von »Merl«, nach dem ich süchtig war. Ich nahm fünf Becher.
Vier Stunden später klingelte mein Wecker. Es war kurz nach sieben, ich hatte noch nicht gepackt, und in zwei Stunden würde ich die anderen drei treffen, um sechzig Kilometer ins brandenburgische Fürstenberg an der Havel zu fahren, auf ein Hausboot zu steigen und zehn Tage auf dem Wasser zu verbringen. Die Idee kam mir in diesem Moment so idiotisch vor wie Landkauf auf dem Jupiter, und sie war auch definitiv idiotisch, aber ich hatte sowieso nichts Besseres vor, der Trip war nicht stornierbar, und vielleicht würde es lustig werden, wenigstens interessant – aber daran glaubte ich nicht wirklich. Ich glaubte eigentlich überhaupt nichts mehr, nur an die vorübergehend heilende Kraft von Mousse-au-chocolat aus dem Hause »Merl«, Telefonjoker im Allgäu und die vernichtende Energie des Drei-Worte-Satzes »Hab dich lieb«. Ach ja und an Richard Dreyfuss alias Curt Henderson in »American Graffiti«.
Henner stand neben seinem Discovery wie jemand, der nur neben seinem Auto steht, um zu zeigen, dass es sein Auto ist. Henners linker Ellbogen lag auf dem Dach, was nicht ganz einfach war, denn der teure Geländebockel war nicht nur eine Schrankwand auf Rädern, sondern eine hohe Schrankwand auf Rädern – und obwohl Henner sehr groß gewachsen war, überschritt diese Position seine Körperreichweite. Deshalb befand sich der Ellbogen über seinem eigenen, redlich ausgedünnten Scheitel. Das sah lächerlich aus, und eigentlich passte diese Geste nicht zu ihm. Aber was wusste ich schon? Wenig. Henner, eigentlich Jan-Hendrik, war Pfarrer, ein unglaublicher, zuweilen allerdings kluger Schwätzer und ein mittelmäßig guter Badmintonspieler, der sein oft ungeschicktes Taktieren auf dem Spielfeld und seine bauartbedingte Unsportlichkeit mit Zitaten aus dem Regelwerk zu kaschieren versuchte. Jan-Hendrik alias Henner glaubte – mehr als alles andere, wie ich meinte – an das geschriebene, gedruckte Wort, und seine Allzweckwaffe war diejenige, gedruckte Worte zu zitieren.
»Patrick«, begrüßte er mich lächelnd und hielt mir die linke Hand entgegen, weil die rechte haltungsbedingt (sie gehörte zum Ellbogen auf dem Dach) zu weit von mir entfernt war. »Fehlt nur noch Simon.«
Ich schüttelte nickend die angebotene Hand – Simon war tatsächlich noch nicht da – und ging zum Heck des fetten Bockels, um meinen Rucksack in den gut gefüllten Laderaum zu stopfen. Da stand Mark und musterte die Beladung skeptisch. Mark Rosen. Ich wusste kaum mehr über ihn als über Henner, nicht einmal sein Alter – ich schätzte ihn auf Anfang dreißig; er wirkte in gewisser Weise von innen jugendlich. Kompakt, sogar ziemlich muskulös gebaut, ohne unattraktiv zu sein, etwas kleiner als ich, dunkle, buschige, kurz geschnittene Haare. Gute Rückhand, prinzipiell brauchbares Stellungsspiel, einfallsreicher, origineller Einsatz, ohne jede Rücksicht auf sich selbst, kraftvolle Schläge, aber zu wenig grundsätzliches Interesse am Spiel, das dann auch noch schnell abflaute. Mit Mark spielte man am Anfang Doppel. Während der ersten zwanzig, dreißig Minuten dominierte er auf dem Spielfeld, erreichte fast jeden Ball, überraschende Lobs genauso wie präzise Schmetterbälle, aber danach ging es mit ihm rasant bergab. Da wir die Besetzungen auslosten, war es reine Glückssache, ob man Mark anfangs im Team hatte oder nicht.
Er umarmte mich, was mich ein wenig überraschte, denn diese Form von Intimität hatte es bei den dienstäglichen Badmintonrunden nicht gegeben.
»Urlaub«, sagte er, ein bisschen aufgesetzt-fröhlich, was wahrscheinlich daran lag, dass er die Idee im Moment ihrer Ausführung genauso blöd fand wie ich auch. Ich nickte nur.
Es war warm, die Sonne schien, der Himmel sah eher nach Mittelmeer aus. Gutes Wetter für Urlaub auf dem Wasser. Ich hatte keine Ahnung, was das genau bedeutete. Meine Bootserfahrungen beschränkten sich auf die Dampferfahrten mit meinen Eltern, in einer Zeit, als ich noch nach Kinderschokolade und nicht nach Mousse süchtig war und Mädchen für eine Tierart hielt, und außerdem auf die drei, vier Tretboottouren, die ich später – mit Mädchen, als ich sie nicht mehr für eine Tierart hielt – unternommen hatte.
Drei Leute, die ich seit knapp zwei Jahren einmal pro Woche für anderthalb Stunden traf, würden mit mir zehn Tage auf einem Boot verbringen – auf engem Raum, wie ich annahm –, und in diesem Moment war mir die Sache peinlich. Mir war die Tatsache peinlich, dass ich hier hinter diesem teuren Auto stand. Ich wünschte mich fort, zum Beispiel ins Allgäu, um Rosa zu fragen, wo ihre Tochter ist. Mark sah auf die Uhr und griff dann zum Telefon. Ich überlegte währenddessen, welche Krankheit, die als Hinderungsgrund infrage käme, urplötzliche und von außen unsichtbare, aber gut vorzutäuschende Symptome hatte. Es fiel mir keine ein.
»Simon fehlt«, sagte Mark erklärend, während er die Gesten vollführte, mit denen man heutzutage Telefone bedient. Dann hielt er sich das Teil ans Ohr, Sekunden später zog er die Augenbrauen hoch. »Der Teilnehmer ist vorübergehend nicht erreichbar«, zitierte er.
Henner kam zu uns. »Wo steckt Simon?«
Wir zuckten synchron die Schultern.
Das taten wir auch eine Stunde später noch. Simon kam nicht, Simon war vorübergehend nicht erreichbar.
»Welche Nummer hast du gewählt?«, fragte ich Mark.
»Hä? Die von Simon.«
Ich lächelte. Simme, wie er gerne genannt wurde, hatte mir mal in einer Spielpause das komplizierte System zu erklären versucht, nach dem seine telefonische Kommunikation organisiert war. Er besaß mehr als ein Dutzend billiger Mobiltelefone, die allesamt mit Prepaid-Karten – er nannte das »Praypaid« – ausgestattet waren. Es gab eines für die Familie, eines für »Mädels«, eines für Noch-Freunde, eines für die Freunde, für die er mal gearbeitet hatte, eines für Kumpels, eines für Bekannte, eines für Lieferanten, eines für Lieferanten, die noch Geld von ihm zu bekommen hatten, und insgesamt fünf für die verschiedenen Zustände, in denen sich seine Kunden befanden – die Palette reichte von »früher Begeisterung« bis zu jenem, in dem sie ihn nur noch zur Hölle wünschten, vorzugsweise mit einer Maurerkelle bis zum Anschlag im Schließmuskel. Die Mehrheit, wie er mir lächelnd gestanden hatte.
Wir verglichen die Rufnummern, jeder von uns dreien hatte eine andere, aber keine funktionierte.
Henner sah auf die Uhr. »Die Einweisung ist ab zwölf, wir müssen noch Proviant kaufen, die Bootsübernahme ist um drei. Wenn wir nicht bald losfahren, wird es nichts mit der Tour.«
Wir schickten Simon Kurznachrichten an die diversen Nummern. Der etwas ungeschickte Henner mühte sich redlich damit ab, auf dem Touchscreen seines edlen Smartphones die Wegbeschreibung einzutippen. Und dann fuhren wir los, die Stadtautobahn in Richtung Norden, anschließend auf die A24. Ich saß hinter Mark, Henner hielt das Lenkrad mit beiden Händen umfasst und starrte konzentriert nach vorne. Es gab für ihn nur zwei Arten, Dinge zu tun: mit vollem Engagement – oder überhaupt nicht. Ich betrachtete seine zunehmende Glatze und die seltsamen Flecken auf der Kopfhaut und im Nacken. Ihm würde es leichter fallen, eine Krankheit vorzutäuschen, dachte ich.
»Warst du mit dem Teil schon mal im Gelände?«, fragte Mark.
Henner antwortete nicht.
»Du warst gemeint«, ergänzte Mark und tippte dem Fahrer auf die Schulter.
Henner zuckte zusammen. »Was?«
»Ob du mit dem Ding schon im Gelände warst.«
»Mit welchem Ding?«
»Gott, natürlich mit dem verdammten Auto.«
Henner sah kurz zu Mark. Gott. Verdammt. Ein Pfarrer, wenn auch ein evangelischer (wirklich evangelisch? Nicht einmal dessen war ich mir sicher), hörte das sicher nicht so gerne in dieser Konnotation.
»Nein, warum?«
Mark lachte. »Weil’s ein verdammter Geländewagen ist.«
Henner sah Mark an, dann das Armaturenbrett, die Motorhaube, wieder das Armaturenbrett – als gäbe es da eine Erklärung für die merkwürdige Frage.
»Ich meine«, fuhr Mark fort, »das Teil ist ja ultrabequem und riesig und all das, aber, ehrlich, mit der Leistung zieht er keinen Hering vom Teller. Du fährst Vollgas, und wir werden von Enten überholt. Aber dafür kann er wahrscheinlich Wände hochfahren, oder?«
Henner sah wieder kurz zu ihm, mit einem etwas verwirrten Was-zur-Hölle-willst-du-von-mir-Gesichtsausdruck. Wir fuhren durch waldreiches Gebiet mit knapp 160, und das Geräusch, das vom enormen Windwiderstand des Bockels verursacht wurde, war weitaus lauter als dasjenige des Dieselmotors.
»Ich fahre dieses Auto, weil man Überblick hat. Und weil es sicherer ist. Im NCAP-Test hatte der Discovery fünf Sterne.«
»NCAP-Test«, wiederholte Mark. Das war eine Eigenart, die ich bereits kannte. Mark wiederholte Formulierungen, die er irgendwie interessant fand.
»Ist ein schönes Auto«, sagte Henner etwas kryptisch. Ich konnte nicht umhin zu nicken. Schön. Geräumig. Zwei Schiebedächer. Viel Leder. Geile Instrumente. Riesiger Laderaum. Trotzdem fand ich Marks Frage plausibel.
»Ich verstehe das nicht«, sagte der jetzt, »warum sich alle Geländewagen kaufen und dann nicht ins Gelände fahren. Ich täte das als Erstes. Irgendeine Kiesgrube mit viel Schlamm und so – ab geht er, der Peter. Ich hab irgendwo gelesen, dass es sogar Sprühschlamm für solche Leute gibt, in Dosen.«
»Sprühschlamm?«, fragte der Fahrer konsterniert, offenkundig ohne eine Peilung davon zu haben, wovon Mark sprach.
»Ja, zum Draufsprühen. Damit die Karre nach Gelände aussieht.«
Darauf wusste keiner mehr etwas zu sagen, also schwiegen wir. Wieder überkam mich dieses unangenehme, leicht peinliche Gefühl. Die beiden waren unterm Strich Fremde für mich. Gut, in der Jugendzeit hatte man so etwas häufiger gemacht, Trips mit irgendwelchen Leuten, die man kaum kannte, ein Wochenende in Amsterdam oder wenigstens Köln, zelten in Ungarn oder so. Aber wir waren Erwachsene. Je näher wir dem Ziel kamen, umso bescheuerter fand ich die Idee. Zur Ablenkung versuchte ich, weiter Simon zu erreichen, aber der Teilnehmer … und so weiter.
Die Marina – seltsamerweise trugen Charterhäfen diesen Frauennamen – lag in einem überschaubaren Wohngebiet aus Einfamilienhäusern am Ufer eines nicht sehr großen Sees. Gedrungene, weiß angestrichene Zweckbauten befanden sich unweit einer großen, sich verzweigenden Steganlage, an der etwa zwanzig unterschiedlich große Schiffe sehr ähnlicher Bauart lagen. Wir hoben uns die Begutachtung für später auf und enterten das Verwaltungsgebäude. Eine dickliche, offenbar ziemlich genervte, aber auf fröhlich machende Enddreißigerin begrüßte uns, beglückwünschte uns zur großartigen Entscheidung, diese wundervolle – und nicht eben billige – Art von Urlaub gewählt zu haben, und bat uns, in einer Sitzgruppe Platz zu nehmen, um erst mal, wie sie es nannte, ein Käffchen zu trinken. Wir tranken Käffchen, blätterten durch eine rätselhafte großformatige Gewässerkarte, die sie uns überreicht hatte, und warteten auf die Dinge, die da kämen. Die Dame kehrte nach ein paar Minuten zurück, notierte unsere Namen auf einer Liste.
»Wollen Sie das Ruspi buchen?«, fragte sie feierlich.
»Ruspi?«, echoten wir.
»Unser Rundum-sorglos-Paket. Alles inklusive. Vollkasko ohne Selbstbeteiligung, Endreinigung, Diesel, Leihfahrrad, keine Kaution. Sehr empfehlenswert. Nur das Geschirr müssen Sie spülen, alles andere übernehmen wir.«
»Ruspi«, wiederholte Mark abermals und rollte mit den Augen.
»Klingt vernünftig«, sagte ich. Auch die anderen waren einverstanden, also buchten wir das Ruspi.
»Die Einweisung beginnt in einer halben Stunde, aber Ihr Boot ist schon fertig. Die Dahme. Sie können einladen, wenn sie wollen.«
»Dahme«, sagte Mark, als wir nach draußen schlenderten. »Tusse finde ich irgendwie besser. Wir sollten das Boot Tusse nennen.«
Ich nickte, denn ich hielt das für eine lustige Idee. Henner sagte leise »Das ist ein Nebenfluss der Spree« – vermutlich hatte er das auswendig gelernt –, hielt die Gewässerkarte etwas verkrampft und starrte zum Steg, auf den wir zuhielten. Mark und ich plapperten über die Boote und die Leute, die uns umgaben, Henner blieb stumm. Als wir vor dem Schiff standen, brach der Pfarrer sein Schweigen.
»Das kann nicht sein.«
Die Dahme war riesig. Mit dem breiten Heck am Steg, direkt vor uns, sah das Boot aus, als wäre es mindestens für eine ganze Altenheimbesatzung auf Sonntagsausflug geeignet.
»Ordentlich«, sagte Mark grinsend und pfiff durch die Zähne.
»Und das Ding sollen wir fahren?«, fragte ich.
Henner zog die Papiere aus der Jackentasche und blätterte durch. »Fünfzehn Meter, vier Kabinen, drei Nasszellen, Salon.«
»Fünfzehn Meter sind eine Menge«, erklärte Mark. »Das ist zehnmal Simon übereinander.«
Ich lachte. Simon war vielleicht nicht einsfünfzig, aber auch nicht sehr viel größer.
»Mein Wohnzimmer ist sieben Meter lang, und das kommt mir schon groß vor«, sagte Mark nickend.
Das Heck, das vor uns lag, bestand aus einer Art Terrasse, auf der ein Tisch und vier Stühle standen, dahinter gab es eine verglaste Doppeltür, die in einen sehr, sehr großen Raum führte. Mark kletterte an Bord, ich folgte ihm. Henner blieb auf dem Steg stehen und glotzte, noch immer fassungslos.
Die Dahme hatte die Form eines kleinen Frachters. Der Salon, den man durch die Hecktür betrat, war vielleicht sechs Meter tief, und an seinem bugseitigen Ende führte mittig eine Tür unter Deck, wo sich die Kabinen befanden. Darüber gab es eine neun Meter lange, weiße Fläche und weit, weit entfernt an ihrem Ende den Bug des Schiffes. Der Steuerstand war etwas erhöht am Kopfende des Salons, also ebenfalls neun Meter vom Bug entfernt. Es war, als würde man Henners Bockel von der hinteren Stoßstange aus steuern. Ohne Sicht auf die Straße.
»Feinkörnig«, erklärte Mark. Wenn er damit etwas wie »geil« meinte, hatte er recht. Das hier würde wahrscheinlich keinen Spaß machen, aber dieses Schiff war der Hammer. Ich erinnerte mich kaum an den ouzoseligen Abend, an dem wir diesen seltsamen Beschluss gefasst hatten, und natürlich auch nicht an die kleinen Bilder, die über Henners Tablet gehuscht waren, weshalb ich irgendwie der Meinung gewesen war, wir würden so ein Kajütboot, eine größere Motorjacht oder einen klassischen Hausbootkasten bekommen, irgendwas Tom-Sawyer-Mäßiges, aber nicht das hier. Einen LKW. Das Schiff lag zwischen zwei anderen, die etwas kürzer waren, und es war mir nicht möglich, mir vorzustellen, dass wir es unbeschadet je wieder in diese oder eine ähnliche Position bringen könnten. Ich wusste wenig über das Bootfahren, aber ich wusste, dass Boote träge sind und keine Bremsen haben, dass das Manövrieren nicht gerade präzise geht – und uns Leichtmatrosen mit tödlicher Sicherheit überfordern würde.
»Ist schon ein großes Boot«, sagte jemand hinter uns. Ein Techniker, braungebrannt, Ende vierzig, im blauen Overall. »Aber untergegangen ist noch keiner damit.«
Mark grinste. »Es gibt immer ein erstes Mal.«
Mir lag die Frage auf der Zunge, ob wir ihn als Skipper anheuern könnten, da piepte mein Telefon. Eine Kurznachricht von Simon. »Habe Probleme, komme später nach.« Ich tippte die Nummer an, aber es kam keine Verbindung zustande.
Mark stiefelte in den Gang, der hinterm Steuerstand unter Deck führte, verschwand im Halbdunkel und rief Sekunden später: »Meine Kabine!« Ich schulterte meinen Krempel und folgte ihm. Auf der rechten Seite befanden sich die Nassräume, links kurz hintereinander zwei siebziger-Jahre-mäßig ausgestattete Kabinen mit Doppelbetten, die mir verdammt kurz vorkamen. Im Bug lagen zwei Kabinen mit Etagenbetten nebeneinander, in einer davon drapierte Mark soeben einen Plüschpinguin auf dem unteren Bett. Er grinste, als er mich sah. Ich nickte und belegte anschließend die noch freie Doppelbettkabine; aus der vordersten steckte Henner seinen Kopf und nickte ebenfalls bedächtig. »Wir müssen zur Einweisung«, sagte er dann.
»Einweisung!«, brüllte Mark von vorne.
Im etwas muffigen, aber hellen Schulungsraum saßen vier Paare mit Kindern, eine Art Kegelgruppe – fünf Männer Ende vierzig –, zwei Frauen in den Fünfzigern, die ziemlich aufgeregt oder einfach nur hypernervös dreinschauten, und wir. Der braungebrannte Techniker von vorhin fläzte vorne auf dem Schreibtisch, ließ ein Bein baumeln und betrachtete uns wenig interessiert. Ich nahm an, dass ihm diese Nummer, die er pro Saison wahrscheinlich mehrere Dutzend Male zu absolvieren hatte, ziemlich auf den Zünder ging.
»Wer von Ihnen sind die Schiffsführer?«, fragte er. Bei den Familien gingen synchron die Hände der Väter in die Höhe, die beiden Frauen sahen sich furchtsam an und vermieden eindeutige Signale, die Kegler prusteten los – und in unserer Reihe zeigten drei von drei Leuten an, diesen Posten für sich zu beanspruchen.
»Ich sollte das tun«, zischte der Pfarrer leise, als er unsere gehobenen Hände sah.
»Warum?«, zischte Mark fröhlich zurück.
»Weil die Buchung auf meinen Namen läuft.«
»Wir zahlen alle dasselbe.«
Henner zog die Augenbrauen hoch. »Ich bin am verantwortungsbewusstesten.«
»Verantwortungsbewusstesten«, wiederholte Mark grinsend. »Sagt man das so?«
Der Einweiser-Techniker ignorierte uns. »Die Schiffsführer führen das Kommando und sind verantwortlich, aber Rudergänger kann jeder sein, der über sechzehn ist. Also« – er runzelte kurz die Stirn, als würde er nach dem richtigen Begriff suchen – »das Boot fahren.«
Zwei männliche Jugendliche, die bis dato gelangweilt ihre Füße betrachtet hatten, drückten die Schultern durch. Das Frauenpärchen diskutierte weiterhin leise die Schiffsführerfrage; es machte den Eindruck, als wären beide lieber Passagiere.
Der Vorturner stand auf und schlurfte zur Tafel. »Eigentlich müsste das hier drei Stunden dauern. Ausweichregeln, Befeuerung, Betonnung, Knotenkunde, Maschinenkunde, Verhalten im Notfall.« Er nahm eine Mappe zur Hand, die neben der Tafel lag. »Das steht aber alles im Bordbuch. Also, machen wir’s kurz. Wer von ihnen will zur Müritz?«
Zwei Väter meldeten sich, Mark riss den Arm hoch und schnippte mit den Fingern. Der Einweiser nickte. Mark schnippte weiter, also fragte der andere: »Ja?«
»Was ist das?«
Zusammengezogene Augenbrauen. »Was ist was?«
»Na, Müritz.«
Enger zusammengezogene Augenbrauen. »Das größte Binnengewässer Deutschlands. Nordwestlich von hier. Ein See.«
»Ein See«, wiederholte Mark.
»Die Müritz und den Plauer See dürfen Sie nur am Rand der Betonnung über… – ja?«
»Was ist Betonnung?«, fragte Mark. Henner schnaufte.
»Fahrwassermarkierungen. Am linken …« Der Einweiser unterbrach sich und starrte Mark an, der wie ein Zweitklässler drängte, die nächste Frage zu stellen. »Hören Sie«, sagte er dann langsam. »Ich erkläre das kurz, den Rest lesen Sie im Bordbuch. Wichtig ist das alles nicht; das Revier wird fast ausschließlich von Leuten wie Ihnen befahren.« Er ließ keinen Zweifel daran, was er von Leuten wie uns hielt. »Rufen Sie hier an, bevor Sie auf die Müritz fahren. Und legen Sie Schwimmwesten an, das ist Pflicht. Ansonsten gibt es zwei wirklich wichtige Dinge, die Sie beachten müssen: Manövrieren Sie langsam. Sehr langsam. Und machen Sie nicht in Schleusen fest. Alles andere bekommen Sie dann automatisch mit.«
Mark senkte seine Schnipphand langsam und sah uns grinsend an. »Was passiert, wenn man in Schleusen festmacht?«, fragte er unseren Pfarrer.
»Man kommt nicht mehr los, vermute ich«, antwortete Henner und setzte seinen Namen bei »Schiffsführer« in das Formular, das vor ihm lag.
Die praktische Einweisung verlief ähnlich. Ein junger Mann, der ein bisschen nach Bier roch, worum ich ihn kurz beneidete, kam an Bord und zeigte uns, wo die Gasflaschen, die Badeleiter – Mark jubelte –, der Heckanker und ein paar andere Dinge verstaut waren, wie man eine »Klampe belegt« – Henner nickte dazu und murmelte »Weiß ich« –, wo sich die rätselhafte Bilgepumpe befand und wie man die Duschen und die mechanischen Klos bediente. Er zeigte auf ein Instrument neben dem Steuerrad, ein etwas klobig wirkendes flächiges Teil mit drei farbigen Glühlämpchen, von denen die grüne schwach flackerte. Wie alles hier an Bord wirkte es auf saubere Art betagt, intensiv gebraucht und zugleich gut gepflegt, aber eben anachronistisch. Das Lämpchenflackern schien allerdings auf einen alsbaldigen Abgang des Leuchtmittels hinzuweisen.
»Das ist wirklich wichtig. Die Anzeige für den Fäkalientank. Sie sind zu dritt?«
»Zu viert«, sagte ich. »Einer kommt nach. Vielleicht.«
»Zu viert. Der Tank fasst fünfhundert Liter. Wenn Sie oft auf die Toilette gehen, viel abwaschen oder duschen, wird er sich in zwei, drei Tagen füllen. Sie müssen ihn dann unbedingt abpumpen lassen. Verlassen Sie sich nicht zu sehr auf die Anzeige. Fahren Sie eine Marina an, wenn die gelbe Lampe eine Weile anbleibt. Warten Sie nicht die rote ab.«
Dann startete er den Motor und befahl uns, die Leinen am Heck zu lösen – bitte schön auf der Stegseite, nicht am Boot, denn Mark war bereits dabei, genau das zu tun. Anschließend glitt die Dahme rasant aus ihrer Parklücke, als wäre sie ein verdammtes Mofa und der Mann am Steuer ein Halbwüchsiger, der seit Jahren nichts anderes tat als Mofa fahren.
»Aufstoppen«, sagte er und hantierte am Gashebel. Der Diesel röhrte, kurz darauf stand das Boot wie festgepinnt. »Die Schraube dreht nach links, also zieht das Boot beim Rückwärtsfahren nach rechts. Dran denken beim Anlegen. Rückwärts lässt sich das Boot nicht steuern.«
»Klar«, sagte Mark und drehte mit dem rechten Zeigefinger in der Luft nach links.
»Drehen auf der Stelle. Nach steuerbord einschlagen. Abwechselnd vorwärts und rückwärts Gas geben. Ruder rechts lassen. Langsam machen.« Der Motor gab intensive Geräusche vor sich, der Mann zog und schob am Gashebel, kurz darauf zeigte der Bug in Richtung Hafen. »Und nun Sie.«
Henner übernahm, ohne uns anderen eine Chance zu lassen, ließ den Gashebel nach vorne krachen, der Topf machte zwar keinen Satz, nahm aber rasch Fahrt auf, die Stege kamen schnell näher.
»Aufstoppen!«, befahl der Einweiser.
Der Pfarrer ließ es wieder krachen, kurz darauf waren wir ganz woanders, aber seitlich zum Hafen, fuhren allerdings immer noch – von Stoppen keine Rede. Keine Ahnung, wie wir dahin gekommen waren. Mark lachte. Henner schwitzte. Ich löste die Hebel über den Glasfenstern und zog das mächtige und stark quietschende, etwa vier Quadratmeter große Schiebedach nach hinten, was einiges an Mühe kostete. Der Einweiser übernahm wieder, manövrierte uns in Richtung Hafen, drehte das Boot, als wenn es ein Dreirad wäre. Kurz darauf zogen wir Leinen fest. Der junge Mann lächelte müde. »Kriegen Sie schon hin«, sagte er. Und nach einer kurzen Pause: »Das Boot hat Bugstrahlruder. Hier.« Er drückte einen roten Knopf, irgendwas dröhnte, der vordere Bootsteil bewegte sich. »Kriegen Sie schon hin«, wiederholte er und ging von Bord. »Der grüne Knopf ist für die andere Richtung«, rief er noch.
»Kriegen wir schon hin«, meinte Mark. Henner zog die Stirn kraus und betrachtete den Gashebel. Wir waren nicht viel schlauer als vorher, aber mindestens der Pfarrer hatte jetzt noch mehr Respekt.
Neben uns machte ein deutlich kürzeres Boot fest, das aber immer noch über zehn Meter lang war, der Theorielehrer kletterte von Bord, das Frauenpärchen starrte ihm hinterher, fragende, besorgte Gesichter. Die Damen hatten ihren Proviant schon vorher an Bord gebracht, diskutierten jetzt kurz, schließlich lösten sie die Leinen wieder. Nach vier Fehlversuchen hörten wir das Blubbern ihres Diesels, dann schwankte der Steg. Der Motor ging wieder aus, wieder an, wieder aus und abermals an. Wurde lauter, ohne dass sich das Boot bewegte. Etwas knirschte, dann erklang ein Quietschen, weil ihr Schiff inzwischen dicht an unserem lag und langsam an der Dahme entlang aus dem Hafen herausrutschte. Dort beschleunigte es deutlich, allerdings nicht nach links oder rechts, wo die Ausfahrten aus dem kleinen See lagen, sondern auf die dichte Schilffläche zu, die der Steganlage gegenüber in einiger Entfernung den flachen Bereich des anderen Seeufers markierte. Unbeirrt und sehr zielstrebig zog das Schiff seinen Kurs in Richtung Schilf, vom Steg erklangen erst Rufe, dann Schreie, aber das beeindruckte offensichtlich niemanden.
Zwei Minuten später schob sich das Boot in die Schilfplantage, verschwand zur Hälfte darin, wurde dann ruckartig langsamer, wobei sich der Bug anhob, anschließend neigte sich das Teil etwas zur Seite. Der Motor schrie bis zu uns, gute achtzig Meter entfernt, dann tauchten die beiden Frauen an Deck auf und fuchtelten mit den Händen. Der Chefeinweiser enterte unser Schiff, schob Henner vom Steuer weg, befahl, die Leinen zu lösen, was Mark und ich fröhlich grinsend taten, und kurz darauf lag unser Kahn hinter dem havarierten Schiff der beiden alten Mädels, die an Deck standen, sich aneinander festhielten – und weinten.
»Wir träumen seit Jahren von so einem Urlaub«, schniefte eine, als hätte jemand von uns gefragt.
»Sie müssen langsam machen. Das ist kein Auto.« Der Chefeinweiser zog die Stirn kraus und kletterte von unserem Boot auf das andere, dann hantierte er mit ein paar Seilen und kehrte zurück. Der Motor der Dahme donnerte, aber Sekunden später war der Mädelskahn frei. Der Mann manövrierte ein bisschen – ein bisschen beeindruckend –, und plötzlich lagen die Schiffe nebeneinander. Wieder stieg er um, legte einer Frau den Arm auf die Schulter und redete leise auf sie ein. Uns gab er Zeichen, in den Hafen zurückzukehren. Mark lachte laut.
»Darf ich mal probieren?«, fragte ich so höflich wie möglich, Henner nickte schweigend und starrte zum anderen Boot hinüber.
»Du könntest sie segnen«, schlug Mark vor und sah dabei zum Himmel. Der Pfarrer reagierte nicht.
Ich gab vorsichtig rückwärts Gas, wartete, bis sich der Topf ein wenig bewegte, schlug dann das Ruder kräftig ein und gab vorwärts Schub. Der Kahn drehte, ich lenkte wieder geradeaus und zielte auf den Hafen. Bis dahin ging das ganz gut. Das Ding reagierte sehr gemächlich, man musste ordentlich vorhersehend agieren.
»Ein Fachmann«, lobte Mark.
»Na ja. Wir müssen noch in die Lücke.«
Verblüffenderweise klappte es. Ich stoppte auf, was tatsächlich gelang, weil ich nicht wie ein Irrer – also wie Henner – am Hebel zog und schob, ich schlug das Ruder ein, gab vorsichtig abwechselnd vor- und rückwärts Gas, bis das Heck zur Lücke zeigte.
»Alle Achtung«, murmelte der Pfarrer, aber er sah dabei nicht sehr fröhlich aus.
Der Rest war ein Klacks. Etwas Gas rückwärts, Henner und Mark am Heck, Mark sprang schließlich auf den Steg. Okay, es knirschte und wackelte, aber die Keglertruppe, die gegenüber ihr Boot belud, applaudierte. Mark und ich verneigten uns. Gleichzeitig legte das Damenboot wieder an, natürlich vom Fachmann gesteuert, beide Frauen kletterten von Bord und fielen sich auf dem Steg heulend in die Arme.
»Wir können immer noch Fahrrad fahren. Und nur auf dem Boot übernachten«, sagte eine. Die andere nickte stumm und sah zum Schiff, als wäre das eine Giftschlange.
»Proviant einkaufen«, erklärte Henner, ließ die alten Mädels jedoch nicht aus den Augen.
»Proviant«, wiederholte Mark. Am Ortseingang gab es diese übliche unselige Ansammlung von Großgeschäften – einen Baumarkt, einen Supermarkt, einen Drogeriemarkt, ein Billig-Möbelding und zwei Dönerbuden. Henner zog einen Einkaufswagen hervor, Mark einen weiteren.
»Wozu das?«, fragte Henner.
»Wie viele Kisten Bier willst du mit einem Wagen transportieren?«, fragte Mark zurück.
»Eine?«
»Und was trinken wir morgen?«
»Ein zweites Bier?«
Mark stoppte und legte ein ernstes Gesicht auf. »Hör mal, Freund Evangelium. Das hier ist Urlaub. Du kannst machen, was du willst, du kannst rund um die Uhr beten und meinetwegen Waisenkinder in Schleusen auflesen. Aber ich will meinen Spaß haben. Dazu gehört, dass ich, wenn ich Bock darauf habe, ein gepflegtes Bier in den Hals kippe. Keiner verlangt, dass du das auch machst, aber ich will das, also tue ich es. Comprende?«
Henner öffnete den Mund, um zu einer Replik anzusetzen, nickte aber stattdessen langsam und drückte die Schultern durch. Dann schob er seinen Wagen zum Supermarkt-Eingang. Mein Telefon piepte, eine Kurznachricht von Simon.
Noch zwei Stunden. Wo kann ich aufs Boot kommen?
Ich versuchte gar nicht erst, ihn anzurufen, und schrieb als Antwort: »Keine Ahnung.«
Der Einkauf verlief originell. Henner, ganz der Familienmensch, griff nach Obst, Gemüse, Milch, Tee, Bio-Frühstücksflocken, Vollkornbrot, Vollkornpasta, Mineralwasser, Saft und solchen Sachen – Cora nannte das »Ohne-Produkte«, weil für die Kaufentscheidung relevanter zu sein schien, was sie nicht enthielten –, während Mark, den anderen Einkaufswagen führend, Dinge wie Chips, Spare-Ribs zum Aufbraten, riesige Kochwürste, Tütensuppen, Fertigsoßen, BiFi, massenweise Schokolade und drei Kisten Bier in seinen Wagen lud. Ich fand die Mischung gut und hielt mich zurück. Ich ging ohnehin davon aus, dass wir mindestens abends irgendwo essen gehen würden. Bei den Desserts geriet ich kurz in Panik, entdeckte dann aber doch noch eine schmale Reihe aus zehn Bechern meiner Lieblingsnachspeise, die ich in Henners Wagen lud.
An der Kasse musterte dieser erst den eigenen und dann den anderen Wagen.
»Wie teilen wir das auf?«, fragte er.
»Durch vier?«, schlug Mark vor.
Der Pfarrer zog eine Tüte Buchstabensuppe aus Marks Wagen und hielt sie mit zwei Fingern, als wenn der Antichrist darin wohnen würde.
»Ich werde das nicht essen«, erklärte er.
Mark zog mit genau derselben Geste geschmacklose Bio-Reiswaffeln aus Jan-Hendriks Korb.
»Und ich das nicht«, gab er zurück.
»Mir ist das egal«, sagte ich. »Das ganze Zeug wird vielleicht hundert Euro kosten. Das sind fünfundzwanzig für jeden. Das Mousse zahle ich allein, und das gehört bitte schön auch nur mir.«
Es kostete hundertvierzig.
Eine Stunde später war alles verladen, es gab keinen Grund mehr, nicht abzulegen, der kleine Zeiger der Uhr zeigte kurz hinter die Fünf. Wir versuchten abermals, Simon auf allen möglichen Kanälen zu erreichen, doch das gelang nicht. Also setzten wir uns an den großen Tisch im Salon. Henner schlug die Gewässerkarte auf, blätterte wie wild darin herum, um schließlich triumphierend auf eine ziemlich kleine blaue Fläche zu zeigen.
»Hier sind wir.«
Ich sah nach draußen. »Kann gut sein.«
»Okay. Da ist eine Ausfahrt.« Er wies nach rechts. »Und da ist noch eine.« Nach links. »Wollen wir irgendwo ankern oder anlegen?«
»Ankern!«, verkündete Mark fröhlich.
»Gut. Wir müssten ein Stück Havel fahren, die da Steinhavel heißt, dann durch eine Schleuse. Kurz dahinter kämen zwei Seen, die als gute Ankergebiete markiert sind.«
»Bleibt die Frage, was wir mit Simon machen«, gab ich zu bedenken.
Henner nickte und schob den Zeigefinger über die Karte. »Hier ist eine Brücke, dahinter scheint es einen Anleger zu geben. Steinförde heißt der Ort. Wir müssten in spätestens einer Stunde dort sein.«
»Steinförde«, wiederholte ich und tippte eine Nachricht an Simon.
»Dann los«, erklärte Mark.
Henner stand am Steuer, Mark und ich lösten die Leinen. Der Pfarrer gab erstaunlich vorsichtig Gas, und erst schien es auch, als würden wir uns sauber aus dem Hafen bewegen. Dann gab es seltsame Geräusche, das Boot stoppte, jemand schrie – und es platschte.
»Landstrom«, erklärte Mark grinsend, als er sich nach hinten umgesehen hatte. Ich tat es ihm gleich. Zwischen der Dahme, zehn Meter vom Steg entfernt, und dem Hafen hing ein dickes, blaues Stromkabel, stark schwingend. Ausgerechnet eine der beiden ängstlichen Frauen hatte es erwischt – offenbar hatte sich das Kabel gespannt, just in dem Augenblick, als sie darüber hinwegsteigen wollte. Jetzt paddelte sie ungefähr an der Stelle, wo unser Boot bis eben noch gelegen hatte, im Wasser herum – und heulte schon wieder.
Der Chefeinweiser stand stumm am Rand des Stegs und stemmte die Hände in die Hüfte. Dann schüttelte er langsam den Kopf. Dies nahm Mark zum Anlass, sich aus dem riesigen Kühlschrank ein Bier zu holen, es am Tischrand zu öffnen und dem Mann damit zuzuprosten. Der quittierte das zuerst kurz mit einer drohenden Faust, anschließend verdeutlichte er gestisch, dass wir stante pede zum Anleger zurückkehren sollten. Henner legte den Rückwärtsgang ein, aufwendiges Steuern war nicht nötig, denn das Kabel wies den Weg.
»Es tut uns leid«, nuschelte der Pfarrer in einer Endlosschleife, als wir festgemacht hatten und neben dem Chartertyp standen. Mark nuckelte an der Bierflasche, um sein fröhliches Grinsen zu überdecken. Ich neigte dazu, Marks Fröhlichkeit zu teilen, schaffte es aber – hoffentlich –, relativ ernst dreinzuschauen, was nicht ganz leicht war, denn die pudelnasse Touristin saß direkt vor mir auf dem Steg und plärrte weiter.
»Wenn Sie ungeeignet sind, ein Boot zu führen, kann ich die Charterbescheinigung widerrufen – auf Ihre Kosten«, sagte der Mann leise und sah uns dabei nacheinander an, als wären wir Grundschüler, die mit Pornovideos auf den Handys erwischt worden waren. Henner nickte heftig und wiederholte sein Tut-uns-leid-Mantra.
»Hey, das war ein Versehen«, erklärte Mark. »Ist doch nichts kaputtgegangen.« Er sah kurz zur feuchten Frau und hob die Hände. »Wird nicht wieder vorkommen.«
Der Mann schnaufte. »Immer als Erstes Landstrom trennen. Schreibt euch das hinter die Ohren.«
»Landstrom trennen«, wiederholte Mark und stellte eine Landstromabtrennung pantomimisch dar. »Aye, Sir.«
Der Einweiser setzte zu einer Erwiderung an, ließ es aber.
»Sie können sich auf uns verlassen«, sagte Henner – viel unterwürfiger, als nötig gewesen wäre. Ich verspürte den abgedrehten Wunsch, ihm über den Kopf zu streicheln.
»Ja, das fürchte ich auch«, antwortete der Mann und ging kopfschüttelnd davon.
Also trennten wir den Landstrom ab, vergaßen dieses Mal nur die rechte Heckleine, was aber niemand bemerkte, denn das Schiff an steuerbord, das wir leicht rammten, war nicht bemannt, und alle anderen Bootstouristen waren entweder damit beschäftigt, Vorräte zu verstauen oder der nassen Dame zu helfen. Keine fünf Minuten später hielten wir auf eine Ausfahrt aus dem See zu, die da irgendwo sein musste, die man aber nicht sehen konnte, obwohl das Seeende – oder wie man das in der Schiffersprache nannte – nahte.
»Die grünen Bojen. Links oder rechts?«, fragte Mark, der von Henner das Steuer übernommen hatte, denn der Pfarrer war pinkeln – vermutlich war er einer, dem Stress auf die Blase ging. Dann wies Mark auf die Karte, die über dem Steuer klemmte. »Und was bedeuten diese Zahlen?«
Die Antworten lauteten: rechts. Und: Wassertiefe. Vom Unterdeck kamen Fluchgeräusche, als wir Letzteres feststellten – zum Glück donnerte Mark wieselflink den Rückwärtsgang rein, nachdem ein seltsames Schleifen von vorne zu hören war und das Schiff abrupt stoppte – und Ersteres beantwortete sich dadurch indirekt. Von hinten erklang aufgeregtes Hupen, kurz darauf zog ein kleines Motorboot an uns vorbei, dessen Fahrer sich intensiv gegen die Stirn tippte. Mark grüßte ihn fröhlich und folgte dann seiner Spur. So fanden auch wir die Ausfahrt – beziehungsweise die Einfahrt in ein pittoreskes Stückchen Fluss, ziemlich eng nach meinem Gefühl, bis dicht ans befestigte Ufer von Bäumen umgeben.
»Schön hier«, sagte Mark lachend, während Henner wieder auftauchte und im Oberschenkelbereich an seiner nassen Hose herumwischte, wobei er originellerweise »gottverdammte Scheiße« sagte. Ich dachte mir das »Amen«.
Wir befuhren schweigend das Stück Havel, das hier Steinhavel hieß, und lauschten beeindruckt dem leisen Tuckern des Diesels und dem Gluckern des dunkelgrünen Wassers, auf dem das reflektierte Sonnenlicht glitzerte, wenn es durch den dichten, intensiv duftenden Laubwald beiderseits des Ufers brach.
Das Flüsschen wand sich zweimal und führte uns nach einer knappen, sehr stillen Viertelstunde zur ersten Schleuse unseres Lebens. Sie kündigte sich durch ein Schild an, das der Pfarrer nach einem Blick auf die laminierte Karte, die neben dem Steuerstand hing, als »Anhalten!«-Gebot identifizierte. Kurz darauf tauchte rechts eine Phalanx von dicken Holzpfählen auf, die als »Sportboot-Wartestelle« markiert waren – und wir manövrierten wohl ein Sportboot, wenn es auch eher wie ein Ausflugsdampfer oder leicht verkleinerter Lastkahn aussah. Unglücklicherweise befand sich die Wartestelle ausgerechnet in einer Rechtskurve, und im vorderen Bereich lagen bereits zwei kürzere Jachten, dazwischen außerdem das kleine Motorboot des Vogelzeigers.
»Wir müssen wohl anlegen«, zwitscherte Mark, noch immer am Steuer. »Das Signal ist rot.«
»Ist rot«, wiederholte Henner, der sich das fitzelige Bordfernglas – eher ein Opernglas – vor die Augen hielt und hektisch zu justieren versuchte.
»Ist rot«, erklärte ich dann auch, damit es einstimmig wäre. Die Ampel war schließlich gut und auch ohne jedes Fernglas zu sehen, obwohl ein paar Bäume drum herumstanden.
»Dann halt doch auch an!«, schrie Henner, denn Mark machte keine Anstalten, Fahrt rauszunehmen.
»Aye«, sagte dieser und prügelte den Rückwärtsgang rein. Kurz darauf lag die Dahme quer im Fluss, das Heck wies zur Wartestelle, die wir inzwischen fast vollständig passiert hatten, immerhin war bis zur Schleuse selbst noch reichlich Platz, etwa fünfzig Meter. Da Mark nicht korrekt aufgestoppt hatte, trieben wir heckwärts auf die Pfähle zu. Außerdem heckwärts befanden sich zwei weitere Schiffe, die gerade eintrafen.
»Wenn wir hinten festmachen und ich schlage dann nach rechts ein und gebe Gas – müssten wir dann nicht vorne automatisch anlegen?«, theoretisierte der Rudergänger, wobei er mit einer Hand in der Luft herumfuchtelte.
»Eine andere Möglichkeit haben wir kaum«, antwortete ich und ging nach hinten, nahm mir eine Leine und fixierte den Holzpfahl, der am nächsten war – noch etwa drei Meter entfernt.
»So macht man das nicht!«, brüllte jemand von einem der Nachfolgeboote.
»Schema F kann jeder!«, brüllte Mark zurück. Wir bollerten gegen den Pfahl, der intensiv knirschte, und ich sprang, die Leine in der Hand, ans Ufer, bevor das Schiff vom ächzenden Pfahl zurückgefedert wurde. Dort wickelte ich das Tau mehrfach um das Holzding, hielt das Ende fest und wartete ab, was Mark tun würde.
Aber nicht Mark tat etwas, sondern das Boot. Es schien hier Strömung zu geben, und zwar Gegenströmung. Während der Pott hinten festhing, drehte sich sein Vorderteil frischwärts mit der Strömung, also in die Richtung, aus der wir gekommen waren.
»Bugstrahlruder!«, schrie der Mann, der festgestellt hatte, dass wir eher unüblich manövrierten. Er war von seinem Boot gesprungen, das längst sauber angelegt hatte, und kam am Ufer entlang zu uns gerannt, ordentlich gestikulierend.
»Gute Idee«, kommentierte ich.
»Roter oder grüner Knopf?«, wollte Mark wissen.
Henner griff an ihm vorbei und drückte einen von beiden. Ein Geräusch wie von einer alten elektrischen Kaffeemühle ertönte, und sekundenlang schien nichts zu passieren, bis – Hol’s der Klabautermann! – der Bug der Dahme erst seine Bewegung stoppte und sich dann äußerst langsam, aber ziemlich sicher zum Ufer hin bewegte, und zwar zum Ufer vor uns, in Fahrtrichtung. Leider aber deutlich zu langsam. Inzwischen hatte die Schleuse nämlich ihre wundersame Tätigkeit beendet und diejenigen entlassen, die in die Richtung wollten, aus der wir kamen. Fünf ziemlich große Boote und eine Armada von Kajaks hielten auf unser Schiff zu, das noch immer in voller Schönheit den Flusslauf blockierte.
»Nach steuerbord einschlagen und Vollgas!«, krähte der Ratgebertyp, ein gesetzt wirkender, dicker Glatzkopf Anfang sechzig, der besser keine kurzen Hosen getragen hätte. Er stand inzwischen neben mir, ich konnte die Schweißperlen auf seiner blanken Schädelfläche zählen.
»Steuerbord ist noch mal wo?«, krähte Mark zurück.
»Rechts«, sagte der Mann. »Und bleib auf dem Bugstrahlruder.«
Mark folgte der Anweisung, das Boot beschleunigte seine Bewegung auf das Ufer zu. Es reichte gerade, um die entgegenkommenden Boote gefahrlos passieren zu lassen. Als das letzte an uns vorbei war, wurde die Schleusenampel grün. Der Glatzkopf sprintete zu seinem Dampfer, die beiden vor uns legten elegant ab und hielten auf die Einfahrt zu.
»Jetzt müssen wir nicht mehr anlegen, oder?«, fragte Mark. Ich löste die Leine wieder und sprang an Bord.
»Nein, rein in das Ding.«
»Aber nicht festmachen«, erinnerte Henner, der fast ebenso viel Schweiß auf der Stirn hatte wie der Glatzenkumpel auf seiner haarlosen Kalotte. »Und bitte langsam«, ergänzte der Kirchenmann.
Eine Schleuse ist ein erstaunlicher, allerdings auch etwas bedrohlicher Mechanismus, wenn man ihn von innen erlebt. Tore vorne, Tore hinten, dazwischen eine längliche, stahleingefasste Kammer, die ungefähr vierzig Meter lang und nur etwas breiter als unser Kahn war. Man fährt hinein, legt an, dann wird Wasser hinein- oder abgelassen, und schließlich fährt man auf einem anderen Niveau hinaus. Das wusste sogar ich, der nicht sicher war, ob uns tatsächlich Süßwasser umgab. So weit die Theorie. In der Praxis hörten wir die Bugstrahlruder-Kaffeemühlen der beiden Pötte vor uns, die längst noch nicht das entfernte Ende der Kammer erreicht hatten, während die Dahme, die Boller beiderseits der Einfahrt geräuschvoll touchierend, in die Kammer schlingerte, wahrscheinlich viel zu schnell und ziemlich sicher ohne Plan. Ich sprang an den Steuerstand, schob Mark sanft-bestimmend zur Seite – und stoppte auf. Immerhin ließ die Breite der Schleuse nicht zu, dass wir uns wieder gegen die Fahrtrichtung drehten, doch wir klemmten diagonal fest, waren aber keine Bedrohung mehr für die Schiffe vor uns. Ich drückte den Bugstrahlruderknopf, den ich emotional für den besseren hielt (den roten – ich nahm mir vor, später darüber nachzudenken), unser Vorschiff drehte sich tatsächlich in die richtige Richtung. Dann gab ich ein wenig Gas, und der Pott tuckerte gemächlich auf das Heck des Schiffes vor uns zu. Aufstoppen, Bugstrahl. Wieder leichtes Gas vorwärts.
»Irgendwer sollte mal nach vorne gehen und irgendwas machen«, sinnierte ich laut.
Henner, dessen Shirt stressschweißbedingt die Nässe seiner Hose angenommen hatte, nickte leicht irr, turnte nach hinten raus und tauchte kurz darauf auf dem Vorschiff auf. Dort nahm er ein Stück Leine und betrachtete nachdenklich die Schleusenwand, die selbst ihn überragte – der Hub betrug, wie ich später herausfand, gute anderthalb Meter. Das Heck des Schiffes vor uns kam näher, ich sah kurz nach hinten: Man war uns auf den Fersen. Aufstoppen. Der Pfarrer musterte nach wie vor die Stahlplatten. Bugstrahl, das Vorschiff dümpelte gegen die Schleusenwand.
»Leine um die Stange!«, brüllte jemand von links. An Land, direkt neben unserem Boot, stand ein jüngerer Mann, vermutlich der Schleusenwärter. Henner nickte bedächtig und sichtlich erfreut darüber, keine eigenen Entscheidungen treffen zu müssen, zog das Tau zweimal um eine der gelben Stangen herum und wickelte es dann mehrfach um die Reling. Mark ging nach hinten und zog seine Leine nur um die Stange, behielt das andere Ende aber in den Händen, wie das die Leute hinter uns auch taten, wie ich durch die große, verglaste Doppeltür, die vom Salon auf die kleine Terrasse führte, schön beobachten konnte. Die Dahme lag ruhig. Wir waren in der Schleuse, nicht zu fassen. Und praktisch ohne Schaden.
Die anderen legten an, die Schleusentore schlossen. Und dann erfuhren wir, warum man Schiffe nicht in Schleusen festmacht – und dass festmachen nicht notwendigerweise bedeutet, etwas festzuknoten. Zwei falsche Schlingen in der falschen Richtung gelegt, Zug in die andere – und man kann keine Leine mehr nachgeben. Während der Pegel in der Schleusenkammer recht rasant anstieg, kämpfte Henner mit seiner Leine, die keine Anstalten machte, der veränderten Situation Rechnung zu tragen. Vom Bug kommend, überschlugen sich die – überwiegend ziemlich blasphemischen – Flüche, mit denen der Pfarrer kommentierte, dass die Dahme zu sinken drohte. Schon nach zwanzig Sekunden hatte das Schiff so starke Schlagseite, dass aus den Schränken Geschirrgeklapper zu hören war. Marks halbleere Bierflasche rutschte vom Tisch und bollerte zu Boden, noch nicht einsortierter Proviant folgte, und schließlich musste ich mich sogar abstützen.
»Ich brauche ein Beil! Ein großes Messer! Irgendwas!«, schrie Henner mit sich überschlagender Stimme. Ausgerechnet aus seiner Kabine konnte ich jetzt ein böses Krachen hören.
Und dann stoppte es, während ich schon dabei war, nach einem Werkzeug zu suchen, mit dem man Leinen kappen könnte. Wir hingen immer noch schief, aber die Abwärtsbewegung hatte deutlich spürbar aufgehört.
»Jungs, habt ihr bei der Einweisung gepennt?«, fragte eine Stimme, die mir bekannt vorkam. Ich sah, gerade auf dem Salonboden herumkriechend – hey, unter dem Herd lag tatsächlich ein Beil! –, zum Fenster. Der Schleusenwärter stand neben Henner, die Hände in die Hüfte gestützt, grinsend, aber nicht hämisch.
»Einweisung?«, trällerte Mark, immer noch sehr fröhlich, seine – freie – Leine lässig haltend.
Ich ging nach hinten, turnte an Mark vorbei und hangelte mich an den Kabinen vorbei zum Bug. Der Schleusenwärter, ein rundlicher Endzwanziger, der ein bisschen wie ein ewiger Informatikstudent aussah, sprang behände an Bord. Lässiger Job, Schleusenwärter.
»Ich hätt’s gleich gehabt«, nuschelte Henner.
»Und was wäre dann passiert? Hast du eine Ahnung, was da für Kräfte wirken? Euer Porzellan hättet ihr wegschmeißen können.«
Unser Bugmann schwieg betreten. Sein Shirt war inzwischen patschnass, aber ohne den Einfluss des Havelwassers.
Der Schleusentyp löste vorsichtig beide bootsseitigen Befestigungen der Leine, ließ aber jeweils noch eine Umdrehung übrig, stemmte sich mit den Füßen gegen die Bootswand und gab das Tau dann beidhändig langsam nach. Gemütlich und als wäre nie etwas geschehen, kam der Bug der Dahme auf Niveau, begleitet von merkwürdigen Geräuschen aus dem Innenraum. Auf den Schiffen vor und hinter uns standen die Leute, alle Blicke auf uns gerichtet, und feixten überwiegend, während einige wenige – zumeist Frauen – eine Hoffentlich-passiert-uns-das-niemals-Mimik an den Tag legten. Der Vogelzeiger, der schräg links vor uns lag, zeigte uns selbstverständlich weiterhin ganze Vogelschwärme. Auf einer kleinen Jacht standen ein paar Jugendliche und prosteten uns lachend zu. Ich winkte.
»Einfach an der Stange vorbeiführen und halten. Nirgendwo rumwickeln. Nicht festmachen«, sagte der Schleusenwärter. Henner nickte.
Fünf Minuten später und ohne weitere Havarien steuerte ich den Kahn äußerst langsam aus der Schleuse. Die Boote, die vorher hinter uns gewesen waren, überholten uns, von einem aus wurden wir frenetisch bejubelt. Rechts neben der Schleusenanlage konnte ich das Stauwehr ausmachen, das vermutlich für die Strömung verantwortlich war, die unser Boot vorhin quer gelegt hatte.
»Das war lustig«, befand Mark, der sich eine weitere Flasche Bier nahm und mir eine anbot.
»Irgendwie schon«, sagte ich und nahm das Bier. Henner saß auf dem Vorschiff, mit leicht gebeugtem Rücken, der zu uns wies. Gut möglich, dass er weinte.
»Nur unser Kapitän wird da wohl anders denken«, sagte Mark, auch zu unserem dritten Mann blickend.
»Na ja. Noch einmal wird uns das jedenfalls nicht passieren.«
»Wir werden sehen.« Mark grinste.
In diesem Moment hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass diese Sache durchaus Spaß machen könnte. Ich fühlte mich nicht wirklich wohl, verspürte eher eine diffuse, unangenehme Einsamkeit, die einen überkommt, wenn man unter Leuten ist, von denen man wenig weiß, mit denen man aber dennoch etwas sehr Intimes zu teilen genötigt ist.
Wir passierten die voll besetzte Wartestelle für die andere Richtung, durchfuhren eine gezogene Linkskurve und befanden uns kurz darauf wieder im naturüberfüllten Nichts – die anderen Schiffe waren längst auf und davon. Am rechten Ufer tauchte ein ziemlich großer, weißgrauer Vogel auf, der völlig bewegungslos auf einem Bein stand. So bewegungslos, dass ich ihn zunächst für eine Attrappe hielt. Just, als wir ihn passierten, senkte er das andere Bein in Zeitlupe ab.
»Ein Reiher, vermute ich«, sagte Henner leise, der, von uns unbemerkt, in die Kabine zurückgekehrt war.
»Warum stehen die auf einem Bein?«, fragte Mark.
»Vielleicht entlastet das die Muskeln«, schlug ich vor.
»Reine Angeberei?«, meinte Mark.
»Oder die jeweilige Gehirnhälfte schläft«, kam von Henner.
»Bei Fledermäusen sind die Füße … äh … Greifdinger in der Ruheposition, wenn sie geschlossen sind«, referierte ich, denn ich hatte mal einen Text über Fledermäuse redigiert, aber inzwischen vergessen, wie die Füße von denen genannt wurden – vermutlich Klauen oder so. »Dadurch ist für sie das Festhalten entspannter als das Loslassen, quasi.«
Mark schloss und öffnete die Faust mehrfach, wobei er »Greifdinger« murmelte.
»Mmh«, machte Henner.
Wir drehten synchron die Köpfe, während wir den Vogel passierten. Es war der größte Vogel, den ich jemals in freier Natur zu sehen bekommen hatte.
»Feinkörnig«, sagte Mark, ohne zu erklären, was zur Hölle er damit meinte.
Henner ging unter Deck in seine Kabine, vermutlich um zu prüfen, was da zu Bruch gegangen war. Und sich umzuziehen. Genug Gepäck hatte er ja dabei – vier Koffer und zwei Reisetaschen, weit mehr als Mark und ich zusammen.
Ich steuerte die Dahme durch das legitime Wunder, das uns umgab. Das Wasser war nicht glasklar, aber auch nicht trüb, und ich konnte Fischschwärme sehen. Am Ufer versuchten Blumen und Büsche, sich mit ihren Reizen zu übertreffen. Es zirpte, fiepte, zwitscherte von überall, außerdem war es angenehm warm – und es duftete unfassbar. Ein ähnliches Aroma hatte ich noch nie gerochen. Ich übergab das Ruder an Mark und ging in meine Kabine, um mir kurze Hosen und ein Shirt anzuziehen. Dabei entdeckte ich mein Mobiltelefon, das zwölf Anrufe in Abwesenheit anzeigte – alle von Cora. Erstaunlich, ich hatte heute überhaupt noch nicht an sie gedacht. Und ich beschloss, das auch jetzt nicht zu tun, schnappte mir meine Bierflasche und die obskure Gewässerkarte und ging zu Henner, der am Bug auf der Bank saß und aufs Wasser vor dem Schiff starrte.
»Kann jedem passieren«, sagte ich freundlich.
Er nickte, ohne mich anzusehen, und ich stellte die Frage nicht, die ich hatte stellen wollen – ob er auch Lust auf ein Bier hätte. Vor uns am rechten Ufer kamen verstreut stehende niedrige Gebäude in Sicht, eine Art Kleingartenkolonie. Jedes der akribisch gepflegten Grundstücke hatte einen kleinen Steg, an denen Paddel- und Motorboote befestigt waren. Nach einer Kurve tauchte eine schmucklose Straßenbrücke auf.
»Das muss Steinförde sein«, rief Mark, der inzwischen die mächtigen Scheiben vor dem Steuerstand hochgeklappt hatte und eine Basecap trug, was ihn noch jünger aussehen ließ. Ich blickte auf die Uhr – kurz nach sechs. Nach der Karte zu urteilen, war es nicht mehr weit bis zu den Seen, auf denen wir nach einem Ankerplatz suchen würden.
»Versuchst du noch mal, Simon anzurufen?«, rief ich zurück.
»Aye!«
Hinter der Brücke entdeckte ich den Platz, an dem man möglicherweise – eher mit einem kleineren Schiff – anlegen könnte, um Simon aufzunehmen. Ich sprintete in die Kabine, holte mein Telefon – ein weiterer Anruf in Abwesenheit – und startete Google Maps. Dann kopierte ich die Geodaten unseres Standorts und schickte eine SMS an Simon. Kurz darauf versuchte ich, ihn anzurufen. Ergebnislos.
»Der Teilnehmer ist vorübergehend nicht zu erreichen«, bestätigte Mark vom Steuerstand aus, ein frisches Bier in der linken Hand.
Die Havel wurde etwas breiter, kurviger, noch schöner. Wir passierten seltsame, verlassen wirkende Bootsschuppen, deren Tore mit gewaltigen Spinnennetzen überzogen waren. Schilf. Noch ein Reiher, auch wieder auf einem Bein. Etwas blau Schillerndes, Amselgroßes querte den Fluss in meiner Gesichtshöhe, direkt vor uns, wie ein kurzer Zauber. Dann verbreiterte sich die Havel, und wir fuhren in einen kleinen See ein, der sich links von uns nierenförmig vergrößerte. Rechts war die Ausfahrt markiert, über die es weiterginge. Auf dem See ankerten bereits drei Boote, alle weitaus kleiner als unseres.
Einem Impuls folgend, legte ich Henner die Hand auf die Schulter. »Wir müssen jetzt ankern.«
Er nahm Haltung an, sah zu mir herüber – und versuchte sich tatsächlich an einem Lächeln. Trotzdem wirkte der etwas bullige, aber keineswegs kräftige Zwei-Meter-Mann in diesem Augenblick sehr klein; die Autorität, die er anfangs – keine zwei Stunden war das her – auszustrahlen versucht hatte, war ersatzlos verschwunden. Er stand auf und widmete sich der Ankerwinde am Bug. Es gab einen verchromten, halbmeterlangen Hebel, den man in eine Befestigung stecken musste. Henner tat das auch und zog probeweise am Hebel, woraufhin ein mächtiges Rasseln ertönte.
»Äh«, sagte ich. »Wir fahren noch.«
Er zog abermals am Hebel, kurz darauf stoppte das Rasseln, doch Henners Stirn war schon wieder schweißnass.
»Scheiße.«
»Halb so wild.«