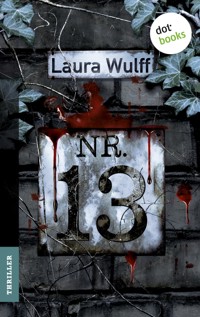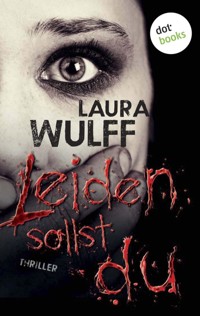
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Willkommen in meinem Spiel. Der Einsatz ist deine Familie." Es fängt an wie ein harmloser Spaß im Internet – und wird zur tödlichen Bedrohung in der Realität: Der junge Ben muss die Aufgaben eines eiskalten Killers erfüllen, koste es, was es wolle. Verzweifelt vertraut der Junge sich seiner Tante Marie Zucker an, die als Gerichtszeichnerin arbeitet und mit einem Hauptkommissar verheiratet ist. Marie willigt ein, ihm zu helfen. Dabei ist sie zunächst auf sich allein gestellt, da ihr Mann Daniel nach einem schweren Unfall gelähmt im Rollstuhl sitzt. Schnell stellt sich heraus, dass der Fall noch größer und erschreckender ist, als Marie zunächst angenommen hat – denn am Rheinufer wird die Leiche einer jungen Frau gefunden, bei der es sich um eine seit Monaten vermisste Freundin von Ben handelt … Eine brutale Verbrechensserie, die niemand stoppen kann, ein Mörder mit einem perfiden Plan und zwei mehr als ungewöhnliche Ermittler: der erste Fall für die Zuckers! "Und der Pseudonym Laura Wulff betritt die vor allem im Erotikgenre sehr erfolgreiche Autorin Sandra Henke ein neues Terrain. Der Kriminalfall ist klug durchdacht und bietet ein außerordentlich spannendes Finale bei diesem mehr als gelungenen Einstieg ins neue Genre." Loveletter Jetzt als eBook: "Leiden sollst du" von Laura Wulff. dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 652
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Es fängt an wie ein harmloser Spaß im Internet – und wird zur tödlichen Bedrohung in der Realität: Der junge Ben muss die Aufgaben eines eiskalten Killers erfüllen, koste es, was es wolle. Verzweifelt vertraut der Junge sich seiner Tante Marie Zucker an, die als Gerichtszeichnerin für die Polizei arbeitet und mit einem Hauptkommissar verheiratet ist. Marie willigt ein, ihm zu helfen. Dabei ist sie zunächst auf sich allein gestellt, da ihr Mann Daniel nach einem schweren Unfall gelähmt im Rollstuhl sitzt. Schnell stellt sich heraus, dass der Fall noch größer und erschreckender ist, als Marie zunächst angenommen hat – denn am Rheinufer wird die Leiche einer jungen Frau gefunden, bei der es sich um eine seit Monaten vermisste Freundin von Ben handelt …
Eine brutale Verbrechensserie, die niemand stoppen kann, ein Mörder mit einem perfiden Plan und zwei mehr als ungewöhnliche Ermittler: der erste Fall für die Zuckers!
Über die Autorin:
Laura Wulff ist das Pseudonym einer bekannten deutschen Autorin, die in der Nähe von Köln lebt. Obwohl sie das Gelübde Bis dass der Tod euch scheidet ernst nimmt, hofft sie, dass ihr Name trotzdem nie in einer Ermittlungsakte auftauchen wird. Sie trinkt gerne ein Glas blutroten Wein, findet, dass Neid die Seele vergiftet, und würde ganz sicher nicht für Schuhe morden, aber durchaus für ein gutes Buch.
Bei dotbooks erscheinen außerdem Nr. 13 und Opfere dich.
Mehr Informationen über Laura Wulff im Internet: www.laurawulff.de
***
eBook-Ausgabe Februar 2013
Copyright © der Print-Originalausgabe Februar 2013 bei MIRA Taschenbuch in der CORA Verlag GmbH & Co. KG
Copyright © der eBook-Ausgabe 2013 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nicola Bernhart Feines Grafikdesign, München
Titelbildabbildung: © dundanim – Fotolia.com
ISBN 978-3-95520-110-4
***
Wenn Ihnen dieses Buch gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weiteren Lesestoff aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Leiden sollst du an: [email protected]
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.twitter.com/dotbooks_verlag
Laura Wulff
Leiden sollst du
Thriller
Sterben ist einfach,
Leben dagegen schwer.
Leid,das
Wortart: Substantiv, Neutrum
Grammatik: das Leid, Genitiv: des Leid(e)s
Bedeutungsübersicht: 1. tiefer seelischer Schmerz als Folge erfahrenen Unglücks; 2. (gehoben) Unrecht, Böses, das jemandem zugefügt wird
Zitternd lag sie langgestreckt mit dem Bauch im Schmutz. Sie glaubte nicht an Gott und dennoch betete sie, dass dieser Psycho ihr nur die Kleider und nicht gleich auch die Haut vom Körper schneiden würde. Ihr Höschen hatte er ihr als Erstes vom Leib gerissen, kaum dass er sie zu Boden gestoßen hatte wie ein Stück Dreck.
Verängstigt hielt sie still, als er ihr Top zerfetzte und lachte, als tickte er nicht ganz sauber. Das tat er ja auch nicht. Von jetzt auf gleich war er explodiert, dieser Psycho!
Plötzlich hörte er auf, wurde merkwürdig still.
Sie bekam eine Gänsehaut.
Bevor sie sich herumdrehen konnte, um zu sehen, was er tat, schabte die Klinge über ihren Rücken.
Augenblicklich verkrampfte sie sich. Sie krallte ihre rosa lackierten Fingernägel ins Erdreich, doch der Schmerz blieb aus. Da begriff sie, dass sie nur die Rückseite der Klinge gespürt hatte, als die Träger ihres BHs durchschnitten worden waren.
Jetzt war sie nackt.
Bis auf den Minirock. Den ließ er ihr. Sie hatte keine Ahnung, warum. Vielleicht machte es ihn an, dass sie etwas anhatte und trotzdem nicht vor seinen Grausamkeiten geschützt war.
Wieso war sie nicht in Jeans zu dieser Party gekommen? Ihr Vater hatte ihr verboten, wie ein Flittchen herumzulaufen, aber sie hatte sich heimlich auf dem Weg nach Porz in einer dunklen Gasse umgezogen. Nur für einen Jungen. Aber der hatte sie gar nicht verdient.
Das hatte sie nun davon! Wäre sie doch nur artig gewesen, ein gutes Mädchen, dann wäre ihr Vater auch nicht so oft böse mit ihr.
Aus dem Augenwinkel heraus sah sie, wie er den Drahtbügel, den er zuvor außerhalb ihrer Reichweite ins Gras geworfen hatte, aufhob.
Sie hätte aufspringen und wegrennen sollen. Aber links von ihr war die Mauer, rechts ein Stapel mit Paletten und vor ihr der Rhein. Außerdem konnte sie sich eh nicht bewegen. Unter anderen Umständen hätte sie es saukomisch gefunden, dass, obwohl ihr Körper vor Furcht bebte, sich ihre Glieder gleichzeitig wie gelähmt anfühlten, etwas, das eigentlich gar nicht möglich war.
Den Bügel hatte er irgendwo im Garten gefunden, hatte ihn aufgebogen und das spitze Ende grob in ihren Unterleib gestochen.
Panisch presste sie jetzt ihre Oberschenkel zusammen.
Doch er spielte ein neues Spiel. Er hieb auf sie ein. Zuerst auf den Po, dann auf die Rückseite ihrer Beine und schließlich auf den Rücken. Wenn sie herumzappelte, knallte er den Draht noch härter auf ihren Körper.
Verzweifelt schützte sie mit den Armen ihren Kopf. Ihre Wangen waren nass. Sie wunderte sich, dass sie überhaupt noch weinen konnte, wo sie doch schon heulte, seit diese Hölle begonnen hatte.
Als ihre Haut an den Schultern das erste Mal aufriss, schrie sie so laut, dass irgendjemand sie hätte hören müssen.
Wäre die Musik auf der Party nicht so laut, dass sie die ganze Nachbarschaft beschallte.
Wäre das Industriegebiet nicht nachts wie leer gefegt.
Und wäre ihr Schrei nicht so heiser gewesen, weil sie schon die ganze Zeit über wimmerte.
Verzweifelt schluchzte sie. Sie verschluckte sich an der eigenen Spucke und begann zu husten.
Als hätte er Mitleid mit ihr, hörte er auf, sie zu schlagen. War dieser Horror endlich vorbei?
Sie erschrak, als er fortfuhr, ihre Kehrseite mit Hieben zu überziehen, die so höllisch schmerzten, dass ihr die Luft wegblieb.
Blut rann zwischen ihren Schulterblättern hinab, als weinte ihr Körper durch die Wunden rote Tränen.
1
Heute war einer dieser Tage, an denen einfach alles schiefging. Er hatte für Benjamin Mannteufel schon bescheiden angefangen. Nach dem Gesetz der Serie konnte er nur in einem Albtraum enden.
Erst war Ben am Morgen der Bus vor der Nase weggefahren. Er hatte auf den nächsten warten müssen und kam zu spät zum Unterricht. Eintrag ins Kursbuch. Wieder einmal.
Dann stand auch noch eine Matheklausur an, die er voll versemmelt hatte. Das wusste er, auch ohne dass er das Ergebnis kannte, denn das Blatt, auf denen die Antworten hätten stehen sollen, hatte ziemlich leer ausgesehen.
Und als er nachmittags von der Schule nach Hause kam, hatte seine Mutter auch noch sein Zimmer aufgeräumt. Wie er das hasste! Er war doch kein Kleinkind mehr. Das Chaos gehörte zu ihm wie das kleine Notizbuch, das er immer bei sich trug, um spontan etwas zu zeichnen. Er fühlte sich wohl zwischen den leeren Cola-Flaschen, den Turnschuhen und getragenen Klamotten, die überall herumlagen, sogar auf der Fensterbank.
Außerdem konnte er es auf den Tod nicht leiden, wenn seine Mutter seine Sachen durchwühlte. Sie spionierte ihm nicht hinterher, aber sie könnte auf Dinge stoßen, die sie nichts angingen, die besser unter den Wäschebergen vergraben blieben. Jeder hat ein Recht auf seine kleinen Geheimnisse, fand Ben, besonders ein Achtzehnjähriger.
Geocaching war eins davon. An sich gab es daran nichts zu verheimlichen. Aber seitdem er gegen GeoGod antrat, trieb er sich illegal auf Privatgrundstücken herum, er brach in Gartenlauben ein und verschaffte sich Zugang zu fremden Kellern.
Er wollte niemandem schaden. Es war nur ein Spaß. Harmlos. Bis man ihn erwischen würde.
Das war ihm bisher nicht passiert. Auch heute Abend würde er ungeschoren davonkommen. Im Schutz der Dunkelheit zum Schatz rennen, mit seinem Smartphone ein Beweisfoto vom Inhalt der Kiste machen, dann noch schnell was immer darin war gegen sein abgewetztes Kölner-Haie-Cap umtauschen, und nichts wie weg.
So wollte es GeoGod, der sich auch „Patron“ nannte. Als Spielleiter diktierte er die Regeln.
Und die waren aufregender als normales Geocaching, bei dem man mithilfe eines Global-Positioning-System-Geräts und Koordinaten einen versteckten sogenannten Cache suchte und den Fund auf einer Internetplattform eintrug – was niemanden einen Furz interessierte. Meistens bekam man kein Feedback, keinen Applaus, nichts.
GeoGod war da anders. Er interessierte sich für Benjamin, er beobachtete ihn genau und lobte ihn. Nach einer Prüfung, durch die er sich qualifizieren musste, hatte er ihn als Spieler akzeptiert. Nur Auserwählte durften gegen ihn antreten. Wer alle dreizehn seiner Schätze fand, wobei der Schwierigkeitsgrad anstieg, den würde er als gleichwertigen Partner akzeptieren. Dieser bekam alle Passwörter der exklusiven Website, die noch ein Geheimtipp war, aber bald, so GeoGod, zu der Anlaufstelle für Cacher werden würde. Und Ben war dabei!
GeoGod gab ihm das Gefühl, wichtig zu sein, jemand Besonderes. Endlich behandelte ihn jemand als Erwachsenen. Außerdem wurde dieses Spiel zur Sucht. Er konnte kaum mehr an etwas anderes denken.
Na und?, dachte er sich. Ist doch alles ungefährlich.
Der mysteriöse Gamemaster würzte die Schnitzeljagd, indem er die Schätze an ungewöhnlichen Orten versteckte. Er verlangte, dass Ben Dinge, die ihm etwas bedeuteten, hinterließ und keinen Müll, wie viele normale Spieler. Zudem hatten sie nicht nur online Kontakt, sondern Ben hatte den letzten Fund in einem Schließfach im Kölner Hauptbahnhof deponieren und den dazugehörigen Schlüssel unter den Abfalleimer, der daneben an der Wand hing, kleben müssen. Den ganzen Tag lang hatte er das Fach beobachtet, um herauszufinden, wie GeoGod aussah. Um elf Uhr nachts hatte er aufgegeben und war heimgegangen, weil er am nächsten Tag zur Schule gemusst hatte. Am darauf folgenden Nachmittag war das Schließfach leer gewesen.
Zu spät fragte er sich, ob nicht nur er die Box beobachtet hatte, sondern GeoGod auch. Vielleicht war er Benjamin gefolgt. Möglicherweise wusste er nun, wo Ben wohnte. Eventuell würde das Spiel in Zukunft noch persönlicher werden, indem er es mehr aus der virtuellen in die reale Welt holte.
Aufgeregt verlagerte Benjamin sein Gewicht von einem Fuß auf den anderen. Die Vorstellung war geil! Etwas Spannenderes hatte er bisher noch nie erlebt.
Ben würde durchhalten, er würde alle Caches finden und den großen Unbekannten schlagen. Die Verstecke sollten angeblich immer kniffeliger zu finden und schwieriger zu erreichen sein, aber das würde er schon packen.
Er nahm einen weiteren tiefen Zug von seinem Blunt und lauschte dabei dem Knistern des Marihuanas, das in dem Zigarrendeckblatt zwischen seinen Fingern eingerollt war und von der Glut aufgefressen wurde.
Ungeduldig trat er näher an den Zaun heran. Seine Jeans rutschte, aber er zog sie nicht hoch. „WK Schrotthandel“ vor ihm hatte längst geschlossen, aber es brannte immer noch Licht im Büro. Der Besitzer Walter Kaspar war also noch da. Aber er war seit einer halben Stunde nicht herausgekommen. Wenn Ben sich im Schutz der Altmetallberge bewegte, konnte der Typ ihn nicht sehen. Warum also warten, bis er endlich Feierabend machte und das Grundstück verließ?
In hohem Bogen warf er den Stummel ins Gebüsch. Er kam einfach nicht vom Gras los. Dabei sollte er es besser wissen, nach dem, was vor einem Jahr passiert war. Aber Maik und Denis kifften auch. Immer, wenn Ben glaubte, stark genug zu sein, um damit aufzuhören, bliesen sie ihm den Rauch ins Gesicht, und schon wurde er wieder schwach.
Daniel, der Ehemann seiner älteren Cousine Marie, hatte das Zeug einmal an ihm gerochen. Dabei merkten Bens Eltern nicht einmal, wenn er in seinem Zimmer bei offenem Fenster rauchte. Aber Daniel Zucker hatte eben einen siebten Sinn für so was. Er war ja auch ein Bulle, zumindest vor seinem Unfall. Mann, hatte der einen Aufstand gemacht. Seitdem passte Ben besser auf.
Er zog die Kapuze seines Hoodies über sein Cap, um sein Gesicht vor Blicken zu schützen. Vielleicht gab es hier Überwachungskameras. Er glaubte es zwar nicht, aber sicher war sicher.
Zum Glück war er schlank. Somit konnte er sich leicht durch das Loch im Maschendrahtzaun quetschen. Geduckt schlich er über das Gelände, dicht an den Autowracks vorbei. Immer wieder schaute er auf sein Smartphone, auf dem die GPS-App ihm den Weg zeigte. Sein Puls stieg. Er kam seinem Ziel immer näher.
Während er umherschlich wie ein Einbrecher, fragte er sich, ob er eines Tages auch auf einem Schrottplatz arbeiten würde.
Seine Ma, wie er sie manchmal nannte, machte sich große Sorgen. Sie meinte, wenn er weiterhin so desinteressiert an allem durchs Leben schlurfte – genau diese Worte hatte sie benutzt und irgendwie passten sie sogar –, würde er keinen gut bezahlten Job finden. Für Heide Mannteufel war das wichtiger als die Tatsache, dass er noch nie eine feste Freundin gehabt hatte. Bis auf Nina, aber das mit ihr war nur während der Zeit im Sommercamp vor drei Jahren gelaufen, und mit ihr zu schlafen war eher enttäuschend gewesen, daher verspürte er keinen Wunsch, das zu wiederholen.
Obwohl er ein Wunschkind gewesen war, hatte seine Mutter nach seiner Geburt an einer Wochenbettdepression gelitten. Sie sprach nie mit ihm darüber, aber Ben hatte mitbekommen, wie sie zu Marie gemeint hatte, dass sie unter einer postnatalen Psychose litt, weil ihre Eltern, die von ihr erwartet hatten, dass sie Karriere machte, von der frühen Niederkunft enttäuscht waren. In den ersten Wochen hatte sie ihn als Säugling nicht einmal in den Arm nehmen können. Ihr schlechtes Gewissen, ihn ausgerechnet in den ersten prägenden Wochen seines jungen Lebens im Stich gelassen zu haben, war so groß, dass sie ihre Stelle als Filialleiterin eines exklusiven Küchenfachgeschäfts aufgab, um sich ausschließlich um ihn zu kümmern.
Seitdem klebte sie an ihm wie eine Klette.
Sie meinte es gut, keine Frage. Aber weil sie ständig hinter ihm her war, reagierte er automatisch trotzig. Er wollte das nicht, es passierte von selbst. Inzwischen arbeitete sie an drei Vormittagen in der Woche in einem Laden für Geschenkartikel auf der Hohen Straße. Pünktlich wenn er aus der Schule kam, war sie wieder daheim.
Sein Vater war ganz anders und nahm ihn in Schutz, sie solle ihn doch einfach machen lassen, er würde schon seinen Weg gehen. Für einen Geschäftsmann war er ein ungewöhnlich gemütlicher Typ. Als Versicherungsmakler für Konzerne war er oft unterwegs. Aber wenn er zu Hause war, legte er die Füße hoch. Er besaß keine Hobbys wie Tennis oder Golfen, nur um Business-Kontakte zu pflegen, sondern sagte, dass seine Freizeit ihm gehöre. Für ihn waren Benjamins Noten völlig okay. Hauptsache, Ben bestand sein Abitur irgendwie.
Zurzeit fiel er allerdings ab. In Englisch hatte er eine Vier geschrieben und in der Matheklausur würde er auch nicht gut abschneiden. Er interessierte sich halt mehr für Geocaching, nein, eigentlich mehr für das Spiel mit dem geheimnisvollen Fremden, der ihn lenkte und Orte in Köln zeigte, die Benjamin sonst nie gesehen hätte.
Dank ihm erlebte er Abenteuer! Er kam sich vor wie ein Spion, wie ein Geheimagent, der einen Auftrag erfüllte, ohne dass jemand es mitbekam. Schlau, gewitzt und lautlos. Das war viel spannender, als zu büffeln oder im Internet zu zocken. Das war real! Echte Mutproben eben.
Illegal, aber er tat ja niemandem weh. Er stahl dort, wo er einstieg, ja nichts, sondern entnahm nur dem Cache eine Trophäe.
Allerdings fragte er sich jetzt, da er die Gegend nach der Schatzkiste absuchte, woher die Dinge, die sich darin befanden, stammten. Es schienen ebenfalls persönliche Sachen zu sein. Etwa von anderen Mitspielern? Oder vom Gamemaster selbst?
Plötzlich hörte er Schritte in seiner Nähe. Er schaute sich aufgeregt um, sah den Besitzer des Schrottplatzes aber nirgends. Angestrengt horchte er.
Walter Kaspar musste sich unmittelbar hinter den Autos befinden. Er war ein Schrank, eine Kante von einem Typ. Ben wollte ihm lieber nicht begegnen.
Sand knirschte unter fremden Schuhsohlen. Kaspar kam näher. Der Schrotthändler konnte jeden Moment um die Ecke kommen und ihn erwischen. Er war bestimmt nicht der Typ, der die Polizei rief, sondern regelte die Dinge sicherlich selbst.
Hektisch sah Benjamin sich um. Er musste sich verstecken, denn um zum Zaun zurückzulaufen, war es zu spät. Ihm fiel nur eine Lösung ein, aber die behagte ihm ganz und gar nicht.
Nachdenklich kaute er auf seiner Unterlippe herum, dann gab er sich einen Ruck und kroch in ein Autowrack hinein, das keine Türen mehr hatte. Es lag auf dem Dach, darüber türmten sich die Überreste anderer Fahrzeuge. Diese wackelten zwar nicht, dennoch hatte Ben Angst, dass der Schrott über ihm zusammenbrechen und ihn begraben könnte.
Würde ihn das Altmetall zerquetschen? Hätte sein Smartphone darunter Netzempfang, um sofort Hilfe zu rufen? Oder bekäme er noch ausreichend Luft, um bis zum Morgen auszuharren?
Aber neben all diesen Fragen beschäftigte ihn eine am meisten. Warum setzte GeoGod ihn diesen Gefahren aus?
Er könnte verhaftet oder in diesem Fall verletzt werden. Gab dieses Risiko dem Patron einen Kick? Oder gehörten die Gartenlaube und der Keller, in die Ben eingestiegen war, Freunden von ihm und er selbst und Kaspar waren ein und dieselbe Person?
Als der Lichtkegel einer Taschenlampe den Weg vor ihm ausleuchtete, zog sich Benjamin noch weiter in das Wrack zurück. Seine Nackenhaare stellten sich auf. Seine Schultern schmerzten, da er den Kopf einziehen und sich zusammenkauern musste, um in diese Altmetallhöhle zu passen. Sein Puls schlug immer schneller. Er spürte, wie er Panik bekam, doch er konnte nicht sagen, ob er sich mehr vor Kaspar fürchtete oder davor, unter dem Altmetall begraben zu werden. Hatte der Händler bemerkt, dass sich ein Eindringling auf seinem Gelände befand? Oder ging er aus reiner Routine nach Feierabend die Gänge ab?
Benjamin wagte erst wieder, durchzuatmen, als sich die Schritte entfernten. Eigentlich hätte er noch einige Minuten warten sollen, doch er hielt es in seinem Unterschlupft nicht länger aus und kroch heraus. Nervös schaute er sich um, konnte aber nur das Licht der Taschenlampe in der Dämmerung ausmachen, es bewegte sich auf das Büro zu.
Du musst den Schatz aufspüren. Streng dich gefälligst mehr an! Wie wild hämmerte Benjamin mit seinem Zeigefinger auf dem Display seines Mobiltelefons herum. Entweder hatte sich die App aufgehängt oder er hatte die Koordinaten des Caches falsch eingegeben, denn er müsste ihn längst gefunden haben. Aber hier war nichts.
Angesäuert startete er das Programm erneut und gab die Daten ein. Es zeigte dennoch denselben Punkt an. Ein weiteres Mal schaute er sich um. Er wurde immer nervöser, schob die Kapuze nun doch vom Kopf und lüftete kurz seine Kappe.
Wo ist das Scheißding? Mit dem Bein holte er aus und hätte beinahe aufgebracht eine Fahrradklingel weggekickt. Im letzten Moment hielt er sich davon ab, um nicht entdeckt zu werden.
Heute war definitiv nicht sein Tag!
Plötzlich bellte ein Hund. Alarmiert machte sich Benjamin so groß wie möglich, um über einen niedrigen Schrotthaufen zu spähen, doch er sah nicht mehr als Kaspars Bürotür, die gerade zufiel. Das Gebell klang schon lauter.
Scheiße, er hat eine Töle! Bens Hände waren schweißnass. Er steckte sein Smartphone in die Hosentasche, um es nicht zu verlieren, denn er wusste, die Zeit war gekommen, um wegzurennen.
„Such! Fang den Kerl, der sich hier herumtreibt. Fass ihn!“, hörte er Kaspar rufen. Seine Stimme klang so aggressiv wie das Knurren seines Köters. Sogleich schabten Hundepfoten über den sandigen Weg.
Benjamin lief los. Sein Herz pochte wild. Er keuchte so laut wie der Hund, der sich auf seine Fährte gesetzt hatte. Zum Glück hatte er lange Beine. Leider fehlte ihm jedoch die Kondition. Rasch bekam er Seitenstiche. Die Angst half ihm, sie zu ignorieren.
Aus dem Augenwinkel heraus sah er den Bullterrier auf sich zukommen, ein massiges schwarzes Tier mit breiten Schultern. Die Glieder seines dicken Halsbandes klirrten bedrohlich. Geifer tropfte aus seinen Mundwinkeln.
Bebend sprintete Ben schneller. Er quetschte sich gerade rechtzeitig durch das Loch im Zaun. Die Kiefer des Hundes schnappten nach seinem Fuß, bekamen ihn aber nicht zu fassen. Der Bullterrier schob bereits seine Schnauze durch die Öffnung, aber er blieb mit seinem Kettenhalsband im Maschendraht hängen. Wütend kläffend versuchte er, sich loszureißen. Er ging rückwärts, schüttelte sich kräftig und sprang plötzlich wieder in Bens Richtung, aber nichts half, er steckte fest. Allerdings wackelten die Stangen, an denen der Draht befestigt war, bedrohlich.
Besorgt, sein Schutzwall könnte brechen, sprintete Benjamin zur Hauptstraße. Er ließ die Bushaltestelle in der Nähe links liegen und hielt erst an der nächsten an, um genügend Abstand zwischen sich und das Monster zu bringen.
Erst jetzt fiel die Angst von ihm ab. Erleichtert lachte er. Er fühlte sich gut, denn er war der Bestie entkommen und Kaspar hatte ihn nicht erwischt. Das Adrenalin kribbelte in seinen Adern. Seine Oberschenkel hatten sich beim Laufen verkrampft und taten weh, deshalb massierte er sie.
Doch der Rausch hielt nur kurz an. Bald kehrte der Frust zurück. Er hatte den Schatz nicht gefunden. Diese verdammte App war nicht präzise genug. Bisher hatte ihm das wenig ausgemacht. Ben war trotzdem immer erfolgreich gewesen. Diesmal sah es anders aus. Vielleicht hatte der Besitzer oder einer seiner Mitarbeiter die Kiste gefunden oder sie hatten ein neues Wrack darauf abgeladen, ohne es zu wissen.
Ben geriet ins Grübeln, verwarf den Gedanken jedoch sofort wieder. Nein, GeoGod hatte bestimmt nicht versäumt, den Schatz zu verstecken. Dazu war er zu genau. Manchmal kam er Benjamin sogar wie ein Kontrollfreak vor, denn er wollte stets über jeden von Bens Schritten informiert sein. GeoGod schien alles, was er tat, genau zu planen, und erwartete von Ben einen ebenso hohen Einsatz. Oder führten die Koordinaten absichtlich zu nichts? Was sollte es dem Spielleiter bringen, ihn hinters Licht zu führen?
Fieberhaft dachte Benjamin nach, ob es einen Trick bei dieser modernen Form der Schnitzeljagd gab, den er nicht kannte, ob der Patron etwas von ihm erwartete, das ihm nicht klar war. Leider fiel ihm nichts ein.
Deprimiert knabberte er an der Innenseite seiner Wange. Er war unzufrieden mit sich selbst. Noch schlimmer war allerdings, seinen Bekannten zu enttäuschen. Der Gamemaster setzte große Stücke auf ihn, hatte er im Chat wortwörtlich so geschrieben, das hatte noch niemand zu ihm gesagt. Er behandelte Ben wie einen Erwachsenen, nicht wie ein Kind oder einen Schüler, sondern gleichwertig. Und nun hatte Benjamin versagt!
Würde der Patron ihn rauswerfen? Was sollte Ben nur ohne den Wettkampf gegen ihn machen? Er wollte weiterspielen, er brauchte den Nervenkitzel, weil GeoGod ihn von der schrecklichen Erinnerung an den Vorfall im letzten Jahr, der ihn quälte und zermürbte, ablenkte.
Heute war wirklich nicht sein Tag.
Mit dem Bus fuhr er von Deutz zurück nach Nippes. Sein Vater hatte versprochen, ihm einen gebrauchten Kleinwagen zu kaufen, sobald er endlich seinen Führerschein gemacht hatte. Aber bisher hatte Benjamin keine einzige Stunde Unterricht genommen. Wozu brauchte man in Köln ein Auto? Irgendwann, sagte er sich, aber nicht jetzt. Genauso wenig wusste er, was er nach der Schule machen sollte. Seine Mitschüler bewarben sich längst. Er dagegen hing lieber mit Maik und Denis rum. Erwachsen war man noch den Rest seines Lebens. Da genoss er doch lieber seine Freiheit, solange er konnte.
Als er nach Hause kam, legte seine Mutter das Buch, das sie gerade las, auf den Wohnzimmertisch und stand von der Couch auf. „Du warst nicht zum Essen da.“
„Ich musste was erledigen.“ Er beeilte sich, an ihr vorbeizukommen.
„Aber du kannst doch nicht ohne Abendbrot ins Bett gehen.“
Er hasste es, wenn sie ihn durch die Wohnung verfolgte. Dann fühlte er sich bedrängt. Über seine Schulter hinweg sagte er: „Ich habe keinen Hunger.“
„Du bist doch schon so dünn.“ Sie blieb vor dem Bad, in dem das Wasser der Dusche rauschte, stehen, als erwartete sie Unterstützung von ihrem Ehemann, aber dieser kam nicht heraus.
Ben wusste ja, dass sie sich um ihn sorgte, aber er war seit einem Monat achtzehn, ging in die zwölfte Klasse des Leonardo-da-Vinci-Gymnasiums in Nippes und konnte auf sich selbst aufpassen. Meistens zumindest. „Ich habe unterwegs etwas gegessen“, log er.
Impulsiv warf er ihr die Zimmertür vor der Nase zu. Sogleich bekam er ein schlechtes Gewissen. Er liebte seine Ma, aber diese Bevormundung ging ihm gehörig auf die Nerven.
Noch während er seinen Pullover abstreifte, fuhr er seinen Computer hoch. Das Cap rutschte beim Ausziehen vom Kopf und flog auf den Boden, er ließ es liegen. Schweiß lief seinen Rücken hinab. Ihm war heiß, aber er hatte auch Angst davor, GeoGod seine Niederlage zu gestehen. Ben fürchtete sich nicht vor ihm, sondern vor seiner Schelte. Sie traten zwar gegeneinander an, aber im Grunde betrachtete er den Gamemaster als Freund. Der Unbekannte war interessant, geheimnisvoll, schien über den Dingen zu stehen und die Fäden stets fest in der Hand zu halten.
Er hatte alles, was Ben nicht hatte. Er war alles, was Ben gerne wäre. Ja, er bewunderte ihn sogar. Aber täte er das auch, wenn der Patron vor ihm stände? Womöglich war er in Wirklichkeit gar nicht so cool, sondern ein Kerl mit Strickpullunder und Hornbrille. Oder ein Bulle wie Daniel. Oder aber einer von den Psychopathen, die Daniel vor seinem schrecklichen Unfall gejagt hatte.
Pulli, Smartphone, Notizheft und den Ausdruck mit den Daten, die er von GeoGod bekommen hatte, warf er auf sein Bett. Als er sich vor seinen PC setzte, drückte sein Portemonnaie in der Gesäßtasche. Er nahm es heraus und knallte es auf den Tisch neben der Tastatur.
Nervös rief er die Website auf und wählte sich mit dem Passwort, das er vom Spielführer exklusiv erhalten hatte, ein. Auf der Plattform benutzte er den Namen „Indy“, weil er sich wie Indiana Jones vorkam, der Schätze aufspürte. Er suchte sofort den Chat auf, machte sich bemerkbar und wartete.
Inzwischen war es vor seinem Fenster so dunkel, dass er die Tischlampe anknipsen musste. Er sah sein Spiegelbild auf dem Bildschirm. Aufgeregt wuschelte er durch seine blonden Haare, die er etwas länger trug, als es seiner Mutter passte. Eigentlich sollte die Skater-Frisur rockig aussehen, doch die Strähnen lagen durch die Kappe platt am Kopf. Er fand sich nicht hübsch, aber er kam auch nicht gerade schlecht bei den Mädchen an. Okay, er war kein Schwarm wie Maik, wurde aber auch nicht völlig ignoriert wie Denis. Sein Aussehen war durchschnittlich, seine Zensuren ebenfalls. Er mochte es nicht, Mittelmaß zu sein, vielleicht entwickelte er deshalb beim Geocaching solch einen Ehrgeiz.
Da erschien endlich eine Nachricht auf dem Display.
GeoGod: Wo bleibt das Foto?
Indy: Hab’s nicht. Die Kiste war nicht da.
GeoGod: Natürlich war sie das. Hast du überprüft, ob du die Koordinaten richtig eingegeben hast?
Indy: Klar. Vielleicht wurde der Cache gestohlen.
GeoGod: Geh noch einmal hin und suche richtig!
Indy: Negativ. Hab morgen Schule.
GeoGod: Zeigst du so wenig Engagement? Ich habe mehr von dir erwartet.
Indy: Meine Eltern würden mich nicht gehen lassen.
GeoGod: Klettere aus dem Fenster.
Indy: Wir wohnen im dritten Stock.
Eine Pause trat ein. Unruhig rutschte Benjamin auf seinem Stuhl hin und her. Immerhin konnte er jetzt sicher sein, dass der Patron ihm nicht gefolgt war. Sonst wüsste dieser, wo er wohnte.
GeoGod: Ich habe die Kiste. Sie war genau dort, wo ich sie versteckt hatte.
So schnell konnte er unmöglich von zu Hause zum Schrottplatz gefahren sein, dämmerte es Ben. In der Nachbarschaft wohnte er jedenfalls nicht, denn der Altmetallhof befand sich in einem Industriegebiet. Viel eher konnte sich Ben vorstellen, dass GeoGod ihn die ganze Zeit beobachtet hatte, mit seinem Smartphone oder einem Laptop online war und längst wusste, dass er unverrichteter Dinge abgezogen war. Warum log er also? Wenn Benjamins Vermutung stimmte, hieß das aber auch, dass dem großen Unbekannten längst bekannt war, wo Ben lebte. Warum tat er dann so, als ob er das nicht wüsste? Am liebsten hätte er sich einen Joint angesteckt, aber er traute seiner Mutter zu, ihm ein Brot zu bringen, daher ließ er es bleiben.
Indy: Ich habe wirklich überall gesucht.
GeoGod: Sie war recht einfach zu finden.
„Fuck!“ Mit der flachen Hand schlug Benjamin auf den Schreibtisch. Er war mal wieder der Loser. Aber er hatte wirklich gründlich geschaut. Beinahe wäre er dabei sogar von einer Bestie zerfleischt worden!
Indy: Da war ein Kampfhund.
GeoGod: Du hättest dich um ihn kümmern müssen.
Indy: Was soll das heißen?
GeoGod blieb ihm die Antwort schuldig. Genau deshalb wurde Benjamin mulmig. Hätte er den Köter etwa ausschalten sollen? Das konnte nicht sein Ernst sein! Oder doch? Dass der Gamemaster einen hohen Einsatz von seinen Spielern erwartete, war Ben klar. Aber nicht, wie hoch.
GeoGod: Dann erachte ich den Auftrag als gescheitert.
Indy: Ja. Leider.
GeoGod: Du weißt, was das bedeutet.
Indy: Es tut mir leid. Ich hab mich echt bemüht.
GeoGod: Du hast die Konsequenzen zu tragen.
Das klang komisch. So ernst. Als befände er sich in einer Erziehungsanstalt. Oder im Krieg.
Indy: Gib mir noch eine Chance, bitte. Beim nächsten Mal mache ich es besser. Heute war ein Scheißtag für mich.
GeoGod: Er wird nicht besser werden.
Indy: Game over?
GeoGod: Habe ich etwa gesagt, dass das Spiel vorbei ist? Doch nicht wegen eines einzigen Fehlers.
Ben fiel ein Stein vom Herzen. Grinsend lehnte er sich zurück. Er atmete tief durch. Das war ja gerade noch einmal gut gegangen. Er würde nicht abserviert werden. Doch dann schrieb sein Freund etwas, das ihn verunsicherte.
GeoGod: Das steht alles im Kleingedruckten.
Indy: Was?
GeoGod: Die Spielbedingungen, meine Art der AGB.
Wovon sprach er? Ben hatte keinen blassen Schimmer. Aber sein Magen ballte sich zusammen, als hätte ihn jemand geboxt. Während er sich durch die Unterseiten klickte, schluckte er mehrmals schwer. Seine Spucke war zäh wie Kleber.
Indy: Ich finde sie nicht.
GeoGod: ASB. Allgemeine Spielbedingungen. Unten links.
Jetzt endlich entdeckte Ben den Link, allerdings nicht im Menü, sondern separat auf der Hauptseite. Aber er war sich sicher, dass die Verlinkung vorher noch nicht da gewesen war! Eventuell hatte er sie aber auch übersehen, denn sie war kaum zu erkennen. Dunkelgraue Schrift auf schwarzem Hintergrund.
2
Etwas stimmte nicht. Marie Zucker ließ ihren Blick über die zahlreichen Trauergäste gleiten, konnte aber nicht sagen, was es war. Doch das ungute Gefühl ließ sie einfach nicht los.
Die Kapelle war so voll, dass Benjamin und sie am Eingang stehen mussten, dicht gedrängt mit anderen Gästen, bis der Trauergottesdienst zu Ende war. Die Anteilnahme war groß, aber das wunderte Marie nicht, denn die Tote war zum einen sehr jung gewesen und zum anderen unter tragischen Umständen verstorben.
Nun flossen die Menschen aus dem Gotteshaus, dem selbst die zahlreichen Blumenkränze, Gestecke und Schleifen mit Abschiedsgrüßen die Kühle nicht nehmen konnten, und folgten den Sargträgern über den Westfriedhof. Marie schaute über ihre Schulter hinweg zurück zu der Kapelle und fragte sich einmal mehr, wie jemand ein solch unansehnliches, graues und kaltes Betongebäude in eine so schöne Parkanlage hatte bauen können.
Endlich fiel ihr ein Detail auf, das nicht recht ins Bild passte. Die Sonne schien an diesem traurigen Vormittag. Marie blickte kurz zum strahlend blauen Himmel auf und dachte, dass der Himmel eigentlich weinen müsste. Stattdessen zeigte sich einer der letzten Septembertage von seiner schönsten Seite. Welch eine Ironie!
Aber ihre innere Unruhe ließ nicht nach. Da war noch etwas, das sie aufwühlte, ohne es bisher genau benennen zu können.
Marie und Ben reihten sich in den Strom der schwarz gekleideten Menschen ein, die sich über den Kirchhof schlängelten wie ein überdimensionales Band aus Trauerflor. Je näher sie der Grabstätte kamen, desto mehr schluchzten die Anteilnehmenden. Auch Maries Magen ballte sich zusammen und der Kloß im Hals ließ sie unentwegt schlucken. Ben dagegen schien immer mehr in sich zusammenzusacken, als wollte er sich in seinem eigenen Körper verkriechen.
Erst hatte ihr Cousin gar nicht zur Beerdigung kommen wollen, vor allen Dingen nicht, als seine Mutter ihm vorschlug, einen Urlaubstag zu nehmen und ihn zu begleiten. Das Verhältnis der beiden war nicht einfach. Aber davon konnte Marie auch ein Lied singen! Ihre Mutter war allerdings keine Helicopter Mom, sondern ihre Differenzen hatten etwas mit Irene Basts Erwartungshaltung und ihren hochgesteckten Zielen zu tun. Marie hatte Ben überredet, mit ihm zu Julias Beisetzung zu gehen und ihn danach zum Gymnasium zu fahren, damit er im Abiturjahr nicht zu viel vom Unterricht versäumte.
Der Kies knirschte unter den Sohlen ihrer kniehohen cognacfarbenen Lederstiefel, als sie vom Hauptgang abbog und zwischen fremden Gräbern hindurch zu dem Loch ging, das frisch ausgehoben worden war. Sie musste Ben mit sich ziehen. Für einen Moment machte es den Anschein, als wollte er geradeaus in Richtung Ausgang weitergehen, doch dann ließ er sich von ihr führen. So blass hatte sie ihn noch nie gesehen. Er zog seinen Kopf noch weiter zwischen seinen Schultern ein.
Trotz der elf Jahre Altersunterschied verband sie eine enge Freundschaft. Da war etwas Besonderes zwischen ihnen, ohne dass sie genau sagen konnte, was es war. Die Chemie stimmte einfach. Vermutlich hatte sie die Geduld, die Heide Mannteufel nicht besaß, und ließ ihm seine Freiheit. Er dagegen inspirierte sie mit seinen jugendlichen Ansichten. Aber da war noch mehr, ein Band, das nicht zu erklären war.
Sie legte einen Arm um seine Schulter und drückte ihn an sich. Obwohl er einen Kopf größer war als sie, wirkte er geradezu fragil. Als bräuchte sie ihn bloß anstoßen und er würde in tausend Stücke zerspringen. Das war nicht seine erste Beerdigung, sein Großvater war an Krebs verstorben, als Ben acht Jahre gewesen war. Aber sein Opa war krank gewesen und er selbst vielleicht noch zu jung, um zu begreifen. Die Situation jetzt war vollkommen anders. Die Tote war in seinem Alter, eine Schülerin wie er, mit Träumen, Hoffnungen und Zukunftsplänen, die sie vermutlich mit ihm geteilt hatte. Nicht nur ihre Eltern trauerten um sie, sondern eine Berufsschulklasse, das Hotel, in dem sie eine Ausbildung zur Köchin absolvierte und eine Tanzschule. Ein junges Leben, das in voller Blüte stand, einfach abgeschnitten.
Obwohl Marie Julia Kranich nur einmal getroffen hatte, traten Tränen in ihre Augen. Ihre Eingeweide krampften sich zusammen und sie hielt Ben fester, nicht nur um ihm Halt zu geben und in diesem schweren Moment beizustehen, sondern auch weil sie selbst fassungslos war.
Die Menschen versammelten sich um das Doppelgrab der Familie Kranich. Die linke Seite war ausgehoben, riesige Gestecke und Kränze bedeckten die rechte. Tannenzweige lagen aufgehäuft davor. Herzzerreißend schluchzte die Frau neben ihr, wodurch Marie eine Gänsehaut bekam.
In dem Sarg vor ihnen lag ein siebzehnjähriges Mädchen. Zumindest war sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens – und vermutlich Todes – in diesem Alter gewesen. Im August des vergangenen Jahres war sie das letzte Mal auf einer Party in Porz, die in einem Haus nahe dem Rheinufer stattfand, gesehen worden. Danach hatte sich ihre Spur verloren. Die Ermittlungen der Polizei waren im Sande verlaufen und man ging davon aus, dass Julia zu viel getrunken hatte und versehentlich in den Fluss gestürzt war. Erst jetzt war ihre Leiche in Chorweiler nahe der Stadtgrenze ans Ufer gespült worden. Sie musste monatelang unter Wasser festgehangen haben. Bei der Vorstellung wurde Marie übel.
Ein Teenager auf der Schwelle zur Frau. Julia würde nie ihre Ausbildung beenden, von zu Hause ausziehen, ihre große Liebe finden, heiraten, Kinder bekommen, Karriere machen, die Welt bereisen oder Großmutter werden. Das Abenteuer Leben begann doch erst richtig, wenn man flügge wurde.
Junge Menschen sollten nicht sterben. Obwohl es Gerüchte gab, dass die Siebzehnjährige freiwillig aus dem Leben geschieden war, glaubte Marie nicht an Suizid. Sie hatte das Mädchen einmal mit Ben in der City getroffen, als die beiden ein Eis essen gegangen waren. Julia hatte ihn angelächelt und verschämt den Blick gesenkt. Ben war knallrot angelaufen. Wenn man verschossen war, brachte man sich nicht um.
Oder gerade deshalb? Hatte sich das Verhältnis zwischen den beiden Jugendlichen geändert?
Zumindest waren sie bis zu ihrem Verschwinden ein Paar in der Tanzschule Dancemania gewesen. Sie hatten sich dort im Salsa-Kurs kennengelernt. Da sie beide ohne Partner gekommen waren, hatte der Lehrer sie zusammengebracht. Sie hatten sich auf Anhieb gut verstanden. Sehr gut sogar.
Eine schicksalhafte Begegnung.
Doch seit Julia verschwunden war, wollte Ben nicht mehr über sie reden. Als hätte sie ihn verlassen und er wäre sauer darüber. Er reagierte geradezu aggressiv, wenn Marie das Thema auf Julia lenkte.
Marie hatte das Mädchen auf den ersten Blick gemocht. Julia war kein Hungerhaken gewesen, sondern ein sportlicher Typ mit langen hellblonden Haaren und Sommersprossen. Sie trat lässig auf und trug damals Jeans und Turnschuhe, aber ihr enges Trägertop brachte ihre Kurven dennoch gut zur Geltung.
Marie hatte sie als strahlend und lebendig empfunden – und nun lag das Mädchen in dem honigfarbenen Kiefernsarg, der vorsichtig in das Loch im Erdboden gelassen wurde. Sie hatte erwartet, dass Ben, der sich bisher krampfhaft tapfer gab, zusammenbräche, aber er war stocksteif in ihren Armen und schaute zu Boden. Hart und weiß wie ein Kalkstein.
Irritiert betrachtete sie zuerst ihn und dann die Umherstehenden.
Alle waren völlig aufgelöst. Der Augenblick, in dem der Sarg hinabgelassen wurde, und man wusste, dass dort unten in der Holzkiste ein Mensch lag, einer, den man liebte, mit dem man schöne Momente geteilt hatte und der nun endgültig weg war, war der emotionalste. Doch Ben hielt weiterhin seinen Kokon aufrecht, während neben ihnen geweint und gewimmert wurde.
Dabei erkannte Marie mit dem geschulten Blick der Gerichtszeichnerin, dass neben dem Sonnenschein an diesem traurigen Tag noch etwas anderes unpassend war. Es waren Menschen anwesend, die nicht zur Trauergesellschaft gehörten.
Zwei Männer schossen Fotos. Sie sahen mit ihren professionellen Kameras und ihren konzentrierten Mienen nicht wie Trauergäste aus. Daher schlussfolgerte Marie, dass sie von der Presse sein mussten. Pietätlos schlich der eine umher, während der zweite sich mehr im Hintergrund hielt und dezent fotografierte. Der dreistere der beiden lichtete auch den Sarg und die Kränze ab.
Der andere jedoch konzentrierte sich auf die Besucher. Er nickte einem Mann und einer Frau zu, die unauffällig in der Menge standen, aber distanziert wirkten. Zudem gingen sie nicht an das Grab, um einen Zweig auf den Sarg zu werfen, wie die anderen Anwesenden, sondern sie blieben stehen und beobachteten die Gäste.
Dieser Scanner-Blick kam Marie äußerst bekannt vor. Ein wenig argwöhnisch, prüfend, forschend und sezierend.
Polizisten in Zivil. Und ein Polizeifotograf.
Marie konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, was sie auf der Beisetzung wollten, aber sie war sich sicher, dass es Ordnungshüter waren, immerhin war sie mit einem verheiratet. Sie hatte Daniel gefragt, ob er mit zur Beisetzung kommen wollte, aber seit er im Rollstuhl saß, mied er Menschenansammlungen.
„Ich komme mir dann wie ein Pinscher zwischen den Füßen eines aufgebrachten Mobs vor“, sagte er in seiner liebenswert bissigen Art.
Noch blieb Marie stehen, statt sich in die Schlange einzureihen, die sich vor dem Grab bildete. Die Trauergäste warfen Zweige auf den Sarg, schüttelten zwei Männern die Hände und sprachen leise mit ihnen. Das mussten Julias Vater Horst und ihr Bruder Markus sein, Marie hatte im Kölner Stadtanzeiger über sie gelesen.
Sie standen nebeneinander, als wären sie Fremde. Niemand stützte sie, nicht einmal sie sich gegenseitig. Die Trauernden sprachen ihnen ihr Beileid aus und gingen rasch weiter, als wollten sie nicht mehr Zeit als nötig mit den beiden Männern verbringen. Aber vielleicht täuschte sich Marie auch und die Menschen wussten nur nicht, wie sie mit der Situation umgehen sollten.
Ihr fiel erneut ein Detail auf, das nicht passte. Als Kostümbildnerin und Gerichtszeichnerin besaß sie ein gutes Auge für Details, die falsch waren. Obwohl Horst Kranichs Blick von Schmerz getrübt war und sein Sohn tränennasse Wangen hatte, schauten sie gleichzeitig so zornig, als wollten sie jeden Moment ein Massaker unter den Trauernden anrichten.
Julias Vater war ein kleiner gedrungener Mann, der leicht nach vorne gebeugt stand, als drückte ihn sein Stiernacken wie eine Last nach unten, mit dicken Lippen und Blumenkohlnase. Sein dunkelblaues kurzärmeliges Hemd spannte sich über seinen medizinballrunden Bauch und der Knopf seiner verwaschenen grauen Jeans fehlte. Er trug nicht einmal Schwarz. Hielt er es nicht für nötig? Oder hatte er kein Geld, um sich neue Kleidung für das Begräbnis zu kaufen?
Hätte sein Sohn ihm nicht unter die Arme greifen können? Markus Kranich, sie schätzte ihn auf Ende zwanzig, sah adrett aus in seiner dunklen Baumwollhose und seinem Button-down-Hemd, aber seine Miene wirkte ebenso feindlich und Marie fragte sich unweigerlich, warum sich die Trauer der beiden Männer in Form von Wut zeigte. Julia starb durch einen selbst verschuldeten Unfall. Sie stürzte betrunken in den Rhein und konnte sich nicht ans Ufer retten. Ihr Tod war eine Tragödie.
Marie versuchte Ben anzuschieben, damit er zum Grab ging und seiner Freundin die letzte Ehre erwies, aber er war wie ein Fels und bewegte sich nicht von der Stelle. „Du solltest dich von ihr verabschieden, indem du einen Zweig hineinwirfst.“
„Ich kann nicht.“
„Tu es für sie. Aber auch für dich.“
„Das macht sie auch nicht wieder lebendig.“
„Es hilft dir, loszulassen.“
Er presste seine blutleeren Lippen aufeinander.
Liebevoll strich sie über seine Haare. „Dann lass uns wenigstens ihrer Familie kondolieren. Es ist unhöflich, zu gehen, ohne ihnen dein Beileid ausgesprochen zu haben.“
„Ich kenne sie nicht einmal.“
„Aber du kanntest ihre Tochter.“
„Wir besuchten nur dieselbe Tanzschule.“
„Nur? Ihr wart Freunde.“
„Nein!“, sagte er barsch und schüttelte ihre Arme ab. Er wandte sich ab, ging in Richtung Parkplatz davon und ließ sie einfach stehen.
Die ganze Zeit hatte sie darüber nachgedacht, was an diesem Vormittag auf dieser Beisetzung nicht stimmte, dabei war die Antwort auf diese Frage direkt neben ihr gewesen.
Es war Benjamin.
Er wirkte verstört. Nicht nur in sich gekehrt, sondern er kapselte sich völlig von seiner Umwelt ab. Er war kalt und abweisend, seine Miene glich einer Maske. Weder ihre tröstenden Worte noch Ermahnungen drangen zu ihm durch.
Er kam ihr fremd vor.
Das war nicht der Ben, den sie seit achtzehn Jahren kannte. Nicht der sensible Jugendliche, der mit sechzehn Jahren einen Sommer lang nachmittags Hunde aus dem Tierheim geholt hatte und mit ihnen spazieren gegangen war, der feuchte Augen bekam, wenn er einen Fernsehbericht über Kindersoldaten in Kriegsgebieten ansah, und der in den Bleistiftzeichnungen, die er in sein kleines Notizheft zeichnete, die Emotionen anderer Menschen so präzise einfing, wie Marie es erst mit viel Übung hatte lernen müssen.
Der Benjamin Mannteufel, der immer schneller von dem Begräbnis wegging, sodass er kurz davor stand, in den Laufschritt zu verfallen, war ein anderer Mensch, einer, der Marie nicht gefiel und der ihr Angst machte.
Aber sie ermahnte sich, verständnisvoll zu bleiben. Einen Freund zu verlieren war ein einschneidendes Erlebnis für einen jungen Menschen.
Merkwürdig war allerdings, dass der Fund von Julias Leiche ihn mehr mitnahm als ihr Verschwinden vor dreizehn Monaten. Er schien regelrecht einen Schock zu haben.
Marie beeilte sich, Horst und Markus Kranich ihr Beileid zu wünschen. Als sie zu ihrem Wagen eilte, damit Ben nicht weglief, ertappte sie sich dabei, wie sie ihre Handfläche an ihrem anthrazitfarbenen Plisseerock abwischte. Sie bekam ein schlechtes Gewissen, obwohl es eine unbewusste Geste gewesen war. Unweigerlich fragte sie sich, ob Frau Kranich ihrem Mann vielleicht weggelaufen war, Marie könnte es verstehen.
Zu ihrer Erleichterung wartete Ben am Auto auf sie. Sonst war er immer in Bewegung, kickte einen Stein weg, zupfte an seinen Haaren herum oder schrieb SMS und prüfte minütlich, ob es neue Einträge in sozialen Netzwerken gab. Doch er stand einfach nur mit dem Rücken an die Beifahrerseite gelehnt und schaute zu Boden. Sein Smartphone hatte er sogar zu Hause liegen lassen. Absichtlich! Das sah ihm gar nicht ähnlich. Normalerweise schien es an seiner Hand festgewachsen zu sein.
Vielleicht sollte Heide mit ihm zum Arzt gehen. Marie machte sich große Sorgen. Sie würde am Abend mit ihrer Tante reden. Statt wie abgemacht zur Schule, fuhr sie ihn nach Hause nach Nippes, denn er schien nicht in der Verfassung zu sein, am Unterricht teilzunehmen.
„Danke“, sagte er immerhin, als er aus dem Fahrzeug stieg. „Das war mir eben einfach zu viel.“
Sie lächelte ihn mitfühlend an. „Die Beerdigung deiner Freundin war bestimmt das Schlimmste, was du bisher erlebt hast.“
„Du hast ja keine Ahnung.“ Er warf die Wagentür zu und ging schnellen Schrittes in das dreistöckige Haus, in dem er mit seinen Eltern in der obersten Etage wohnte.
Was hatte er damit gemeint? Sollte sie ihm hintergehen? Sie entschied sich dagegen, da sie nicht wie seine Mutter sein wollte. Wenn man ihn bedrängte, machte er ohnehin dicht.
Seufzend machte sich Marie auf den Weg zum Hauptbahnhof, wo sie am Musical Dome als Kostümbildnerin fest angestellt war. Als Zeichnerin arbeitete sie nur, wenn sie einen Auftrag bekam, um zum Beispiel für die Polizei ein Phantombild zu erstellen, da manche Befragten mit den künstlichen Bildern der Spezialsoftware nicht zurechtkamen, oder für die Medien, um während einer Gerichtsverhandlung, zu der in Deutschland keine Kameras zugelassen waren, die Atmosphäre und die Reaktionen der Beteiligten einzufangen. Ungerne ließ sie Ben allein, aber sie konnte sich nicht auch noch den Nachmittag freinehmen.
Sie schaltete das Radio ein, um sich abzulenken. Eigentlich hatte sie sich mit Musik berieseln lassen wollen, aber es erklang nur die monotone Stimme eines Sprechers, der lustlos die Elf-Uhr-Nachrichten vorlas. Sie streckte bereits den Arm aus, um auf das CD-Laufwerk umzuschalten, als sie eine Meldung hörte, die sie mitten in der Bewegung stocken ließ.
„... die Anteilnahme auf der Beisetzung, die soeben zu Ende gegangen ist, war groß. Die Gerüchte, dass es bei der Obduktion des Leichnams der Siebzehnjährigen Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden gab, hat die Kriminalpolizei bisher nicht bestätigt ...“
Marie stoppte so abrupt vor einer roten Ampel, dass der Fahrer hinter ihr beinahe auf ihren Wagen auffuhr. Im Rückspiegel sah sie, dass er wütend gestikulierte und mehrfach auf sein Lenkrad schlug. Entschuldigend hob sie ihre Hand und drehte das Radio lauter.
„... und nun die Wettervorhersage ...“
„Mist.“ Die Meldung war bereits vorbei. Hatte der Sprecher wirklich von Julia Kranich gesprochen? Es musste so sein, aber er hatte von möglichem Fremdverschulden gesprochen. Ein weiteres Detail an diesem furchtbaren Morgen, das nicht ins Bild passte, das nicht stimmte und Marie stutzig machte.
Es musste sich nur um Gerede handeln, anders konnte sich Marie das nicht vorstellen.
„Aber Julia Kranich ist doch durch ein Unglück gestorben, oder etwa nicht?“, murmelte Marie nachdenklich.
Der Mann hinter ihr hupte, weil die Ampel auf Grün umgeschaltet hatte. Marie, in Gedanken versunken, biss sich vor Schreck so stark auf die Unterlippe, dass sie Blut schmeckte.
3
Geld war nie ein Problem zwischen Marie und Daniel Zucker gewesen.
Diejenigen von ihren Verwandten und Freunden, die wussten, dass sie getrennte Bankkonten hatten, obwohl sie seit zwei Jahren verheiratet waren, konnten das nicht nachvollziehen. Als Begründung sagten sie lediglich: Das macht man als Ehepaar einfach so. Aber ihre Konten zusammenzulegen war einfach nicht notwendig. Daniel, der mehr verdiente, zahlte die Miete und die Nebenkosten sowie die Hausratversicherung, Marie dagegen übernahm die Gebühren für GEZ, Telefon- und Internetflatrate, jeder kümmerte sich um sein Auto und sein Handy selbst und ging mal einkaufen, sie verdienten beide genug und waren großzügig. Die Maschinerie ihrer Ehe lief wie geschmiert, auch ohne dass sie sich vollkommen verzahnten.
Ihr Problem war anders gelagert. Seit Daniel im März einen Wirbelkörperbruch in einem der unteren Brustwirbel erlitten hatte, hatte er sich verändert.
Der Frühling war ungewöhnlich früh in NRW eingezogen. Bereits im März waren die Temperaturen auf 25 Grad Celsius gestiegen. Daniel, der immer sportlich gewesen war, hatte einen Adrenalinschub gehabt, den er unbedingt abtrainieren musste. Daher hatte er sich dafür entschieden, einen dieser Klettergärten auszuprobieren, die seit einigen Jahren wie Pilze aus dem Boden schossen. Seine Wahl fiel auf eine stillgelegte Talbrücke, an der diverse Parcours angebracht worden waren. Doch an besagtem Tag standen die Zeichen schlecht für ihn. Die feuchte Nacht hatte alles mit Morgentau überzogen, ein neuer Trainer betreute ihn und ließ sich von seinen Frühlingsgefühlen und einer hübschen Kollegin ablenken, sodass er das Sicherungsseil nicht korrekt anbrachte. Eine Weile ging es gut. Mutig und aufgepeitscht vom Kick, den das Spiel mit der kalkulierten Gefahr, dem Kitzel der Höhenangst und der sportlichen Höchstleistung in ihm auslöste, tastete sich Daniel immer weiter über das Tal vor. Plötzlich rutschte er ab, die Leine griff nicht und er fiel schreiend in die Tiefe. Als er rücklings auf dem Boden aufschlug, verlor er das Bewusstsein und wachte erst wieder im Krankenhaus auf.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!