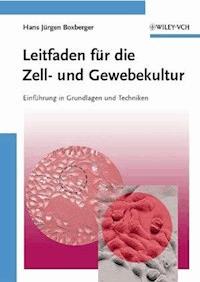
37,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Zellkultur gehört mittlerweile zum Handwerkszeug in allen Bio-Berufen, ob in Forschung, Industrie oder Klinik. Worauf es dabei in erster Linie ankommt erklärt der Autor - im Hauptberuf Geschäftsführer einer Zellkulturfirma - in übersichtlicher und leicht nachvollziehbarer Art und Weise. Eine Übersicht über die wichtigsten Geräte, Materialien und Nährmedien, die Grundregeln beim sterilen Arbeiten, sowie die Beschreibung häufig auftretender Probleme und was man dagegen tun kann machen Auszubildende, Studenten und Fachkräfte in kürzester Zeit (wieder) fit für das Zelllabor. Mit einem Glossar aller wichtigen Fachbegriffe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 356
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1 Geschichte und Bedeutung der Zellkultur
1.1 Das biologische Zeitalter
1.2 Die mühseligen Anfänge
1.3 Die zukünftige Schlüsseltechnologie
2 Das Zellkulturlabor und seine Einrichtung
2.1 Was ist ein Laboratorium?
2.2 Allgemeine Ausstattung eines Zellkulturlabors
2.3 Die Arbeitsbereiche eines Zellkulturlabors
2.4 Die technische Ausstattung im Zellkulturlabor
3 Sicheres Arbeiten im Zellkulturlabor
3.1 Gefährdungen im Zellkulturlabor
3.2 Allgemeine Regeln für das sterile Arbeiten im Zellkulturlabor
3.3 Literatur
3.4 Informationen im Internet
4 Nährmedien für die Zellkultur
4.1 Zusammensetzung von Standardmedien
4.2 Medienzusätze
4.3 Serum
4.4 Zubereitung eines gebrauchsfertigen Zellkulturmediums
4.5 Was man sonst noch beachten sollte
4.6 Literatur
4.7 Informationen im Internet
5 Routinemethoden in der Zellkultur etablierter Zelllinien
5.1 Auftauen tiefgefrorener Zellkonserven
5.2 Optische Kontrolle der Zellkultur
5.3 Mediumwechsel
5.4 Subkultivierung (Passagieren)
5.5 Zellzahlbestimmung
5.6 Vitalitätstest
5.7 Qualitätskontrolle
5.8 Kryokonservierung
5.9 Literatur
5.10 Informationen im Internet
6 Umgang mit kontaminierten Zellkulturen
6.1 Die feindlichen Bataillone: Bakterien, Pilze und Viren
6.2 Bakterien
6.3 Die optische Identifizierung einer bakteriellen Kontamination
6.4 Antibiotika und ihre Wirkungsweise
6.5 Auswahl und Dosierung von Antibiotika in der Zellkultur
6.6 Antibiotika – notwendig oder überflüssig?
6.7 Mycoplasmen
6.8 Gestalt, Funktion und Aufbau der eukaryotischen Mikrobenzelle
6.9 Virale Kontamination
6.10 Prionen
6.11 Kreuzkontaminationen
6.12 Literatur
6.13 Informationen im Internet
7 Spezielle Methoden in der Zellkultur
7.1 Klonierung von Zellen
7.2 Synchronisierung einer Zellkultur
7.3 Zellkultur auf Filtermembranen
7.4 Zellkultur auf biologischen Membranen
7.5 Zellkultur auf extrazellulärer Matrix
7.6 Dreidimensionale Zellkulturen
7.7 Sphäroide
7.8 Perfundierte Zellkultur
7.9 Ein Wort zum Schluss
7.10 Literatur
7.11 Informationen im Internet
Anhänge
I Glossar
II Arbeitsvolumina für Zellkulturgefäße
III MUSTER: Hautschutzplan und Händedesinfektion
IV MUSTER: Hygieneplan Nach BioStoffV § 11
V Hygieneplan, Beispiel 2
VI Nützliche Internetadressen
VII Schlechtes Zellwachstum in der Kultur: Fehlerursachenanalyse und -beseitigung
Sachverzeichnis
200 Jahre Wiley – Wissen für Generationen
John Wiley & Sons feiert 2007 ein außergewöhnliches Jubiläum: Der Verlag wird 200 Jahre alt. Zugleich blicken wir auf das erste Jahrzehnt des erfolgreichen Zusammenschlusses von John Wiley & Sons mit der VCH Verlagsgesellschaft in Deutschland zurück. Seit Generationen vermitteln beide Verlage die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung und technischer Errungenschaften in der jeweils zeitgemäßen medialen Form.
Jede Generation hat besondere Bedürfnisse und Ziele. Als Charles Wiley 1807 eine kleine Druckerei in Manhattan gründete, hatte seine Generation Aufbruchsmöglichkeiten wie keine zuvor. Wiley half, die neue amerikanische Literatur zu etablieren. Etwa ein halbes Jahrhundert später, während der „zweiten industriellen Revolution“ in den Vereinigten Staaten, konzentrierte sich die nächste Generation auf den Aufbau dieser industriellen Zukunft. Wiley bot die notwendigen Fachinformationen für Techniker, Ingenieure und Wissenschaftler. Das ganze 20. Jahrhundert wurde durch die Internationalisierung vieler Beziehungen geprägt – auch Wiley verstärkte seine verlegerischen Aktivitäten und schuf ein internationales Netzwerk, um den Austausch von Ideen, Informationen und Wissen rund um den Globus zu unterstützen.
Wiley begleitete während der vergangenen 200 Jahre jede Generation auf ihrer Reise und fördert heute den weltweit vernetzten Informationsfluss, damit auch die Ansprüche unserer global wirkenden Generation erfüllt werden und sie ihr Ziel erreicht. Immer rascher verändert sich unsere Welt, und es entstehen neue Technologien, die unser Leben und Lernen zum Teil tiefgreifend verändern. Beständig nimmt Wiley diese Herausforderungen an und stellt für Sie das notwendige Wissen bereit, das Sie neue Welten, neue Möglichkeiten und neue Gelegenheiten erschließen lässt.
Generationen kommen und gehen: Aber Sie können sich darauf verlassen, dass Wiley Sie als beständiger und zuverlässiger Partner mit dem notwendigen Wissen versorgt.
William J. PescePresident and Chief Executive Officer
Peter Booth WileyChairman of the Board
Autor
Dr. Hans Jürgen BoxbergerTechnische Universität DresdenInstitut für Mikrobiologie01062 Dresden
Alle Bücher von Wiley-VCH werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
© 2007 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
Gedruckt auf säurefreiem Papier
Satz primustype Robert Hurler GmbH, NotzingenDruck betz-druck GmbH, DarmstadtBindung Litges & Dopf GmbH, HeppenheimUmschlaggestaltung Adam Design, Weinheim
ISBN 978-3-527-31468-3
Für Carl Frederic
Vorwort
Mancher wird sich angesichts dieser Neuerscheinung vielleicht fragen, ob es nötig war, ein weiteres Buch über Zellkultur herauszubringen. Schließlich ist das Angebot an einschlägiger Literatur in den vergangenen Jahren ständig erweitert worden. Die zahlreichen Ermunterungen und Anregungen, die ich über die Jahre hinweg erfahren habe sowie die freundliche Unterstützung durch den Verlag haben mich letztlich bewogen, den Leitfaden für die Zellkultur zusammenzustellen. Einige Vorgaben sollten dabei Berücksichtigung finden:
Der Inhalt des Leitfadens orientiert sich an den Bedürfnissen von Technischen Assistentinnen und Assistenten sowie von Biologielaborantinnen und -laboranten, die in der Ausbildung oder am Beginn ihrer beruflichen Laufbahn stehen, mithin noch nicht über eine mehrjährige Laborpraxis verfügen. Diese Zielgruppe schließt in der Regel auch Studentinnen und Studenten mit ein, die zur Erstellung ihrer Diplom- oder Doktorarbeiten ein Zellkulturlabor nutzen.
Erfreulicherweise sehen nun auch die Lehrpläne der Gymnasien und Berufsschulzentren eine intensive und ernsthafte Beschäftigung mit lebenden Zellen im Zuge der berufsvorbereitenden Ausbildung vor. Es liegt daher nahe, der wachsenden Zahl von interessierten Schülern und Praktikanten sowie Biologielehrern eine Anleitung zur Arbeit mit Zellkulturen an die Hand zu geben.
Im Mittelpunkt stehen vornehmlich die grundlegenden Methoden und Techniken, die man für die Arbeit im Zellkulturlabor unbedingt kennen und beherrschen sollte. Die weitaus meisten Anwender der Zellkulturtechniken wollen nicht einfach nur vom Blatt ablesen, wie ein bestimmtes Ziel im Labor erreicht werden kann. Sie wollen die Zusammenhänge kennen lernen, um zu verstehen, warum sich dieses so und jenes eben anders verhält. Deshalb wird auf eine ausführliche Darstellung des physikalischen, chemischen und physiologischen Hintergrunds der Zellkultur Wert gelegt anstatt auf eine rein beschreibende Sammlung von Arbeitsprotokollen. Nicht zuletzt sollen die Leserinnen und Leser zu einem kritischen, problembewussten, aber auch zu einem phantasievollen Umgang mit lebenden Zellen und Geweben ermuntert werden. Eine Auswahl spezieller und weiterführender Methoden und Techniken wird in Kapitel 7 vorgestellt.
Von einigen der in diesem Buch vorgestellten Methoden existieren in der Literatur mehrere Modifikationen. Ich habe mich stets für jene Varianten entschieden, die sich in der Praxis gut bewährt haben. Dennoch können Abänderungen in Einzelfällen sinnvoll oder notwendig sein.
Es ist leider eine betrübliche Tatsache, dass immer mehr Artikel deutschsprachiger Autoren selbst in deutschen Fachzeitschriften in englischer Sprache veröffentlicht und Vorlesungen für eine überwiegend deutschsprachige Studentenschaft zunehmend in unbeholfenem Englisch gehalten werden. In dieser Entwicklung sieht eine wachsende Zahl von Wissenschaftlern einen schwerwiegenden Nachteil für den Forschungs- und Ausbildungsstandort Deutschland. Ich freue mich deshalb besonders, dass der Wiley-Verlag dem vielfach geäußerten Wunsch nach einer deutschen Ausgabe gefolgt ist und diesen Leitfaden in der vorliegenden Form herausbringt.
Nicht zuletzt ist es mir ein Anliegen, die Lesefreude der Nutzerin und des Nutzers – bei aller gebotenen Sachlichkeit und Genauigkeit des Inhalts – auch nach längerer Lektüre erhalten zu wissen. Da Fremdwörter bekanntlich so heißen, weil sie den meisten Lesern fremd sind, wird auf ihren flächendeckenden Gebrauch verzichtet. Da jedoch auch die Zellbiologie wie jede andere Wissenschaft nicht ohne eine stattliche Anzahl von Fachausdrücken auskommt, werden die unumgänglichen Fachbegriffe im Text „übersetzt” oder im Glossar erläutert. Auf weiterführende Literatur wird am Ende eines jeden Kapitels hingewiesen.
Herzlich danken möchte ich meiner Frau für ihre Geduld und Nachsicht während der Erstellung des Manuskripts. Den Mitarbeitern des Wiley-Verlags, Frau Nussbeck und Herrn Dr. Sendtko sowie allen ungenannten Personen, gilt mein besonderer Dank für die freundliche Unterstützung und verständnisvolle Zusammenarbeit. Herzlichen Dank auch an alle Firmen und Personen, die durch Überlassung von Bildmaterial zum Gelingen des Leitfadens beigetragen haben. Allen Leserinnen und Lesern bin ich für Verbesserungsvorschläge und kritische Hinweise dankbar.
Dresden, im September 2006
Hans Jürgen Boxberger
1
Geschichte und Bedeutung der Zellkultur
1.1 Das biologische Zeitalter
Leben wir im Zeitalter der Biologie? In seiner Neigung zum Ordnen und Klassifizieren hat der Mensch vergangene Epochen stets unter dem Gesichtspunkt herausragender gesellschaftlicher und kultureller Errungenschaften betrachtet. Begriffe wie „Eisenzeit“ oder „Neuzeit“ sind jedermann geläufig. Die fortschreitende Entwicklung der modernen Wissenschaften hat die letzten zwei Jahrhunderte vornehmlich geprägt. Stand das 19. Jahrhundert allgemein im Zeichen aufblühender Technik, bahnbrechender medizinischer Entdeckungen und der Emanzipierung der Naturwissenschaften, gehen wir kaum fehl, wenn wir das 20. Jahrhundert als das Atom- und Computerzeitalter bezeichnen.
Trotz der ungeheuren Leistungen, die auf den Gebieten der Physik und der Chemie vollbracht wurden, hat sich die Biologie in den Jahrzehnten seit 1953, als James Watson, Francis Crick und Maurice Wilkins die Desoxyribonukleinsäure (DNS) als Träger der genetischen Information entdeckten, unaufhaltsam eine Schlüsselposition erobert. Dass dem nicht immer so war, demonstriert die Tatsache, dass ein Nobelpreis für Biologie vom Stifter nicht vorgesehen war und merkwürdigerweise bis heute nicht ausgelobt wird. Dennoch konnte die „klassische“ Biologie dank ihrer engen Bindung an die Medizin und die zunehmende gegenseitige Durchdringung mit den anderen naturwissenschaftlichen Disziplinen zu dem avancieren, was man heute in Ermangelung klarer Abgrenzungskriterien als Biowissenschaften bezeichnet. Nicht wenige sehen deshalb mit dem 21. Jahrhundert das Zeitalter der Biotechnologie anbrechen.
Ob sich diese Vision bewahrheitet, soll dahingestellt bleiben. Kaum zu bestreiten ist hingegen die Tatsache, dass insbesondere der Zellbiologie in dem neuen wissenschaftlichen Gebäude mit seinen zahlreichen Räumlichkeiten eine fundamentale Bedeutung zukommt. Betrachten wir die zahlreichen biowissenschaftlichen Teildisziplinen genauer, stellen wir fest, dass die Beschäftigung mit Zellen darin eine mehr oder weniger zentrale Rolle spielt. Die Zell- und Gewebekultur bildet gewissermaßen die Basis, auf der die gesamte Biotechnologie aufbaut.
In der Tat sind in den letzten Jahrzehnten Zellkulturen zu einem der wichtigsten Werkzeuge in der zellbiologischen, virologischen und immunologischen Forschung sowie in der Tumorforschung geworden. Die enormen Fortschritte in der Grundlagenforschung, der Medizin und der Pharmazeutik wären ohne die Verwendung von Zellkulturen nicht möglich gewesen.
1.2 Die mühseligen Anfänge
Obwohl uns die Zellkultur als eine sehr moderne und mit großem technischen Aufwand betriebene Methode erscheint, reichen ihre Wurzeln weit zurück. Man macht sich kaum noch eine Vorstellung von den nahezu unüberwindlichen Schwierigkeiten und Hindernissen, mit denen sich die Pioniere seinerzeit konfrontiert sahen. Es dürfte nicht übertrieben sein, wenn man aufgrund der äußerst unzureichenden Voraussetzungen von einer Erfolgsquote von höchstens 1% ausgeht. Die großen Probleme bei dem Versuch Zellen lebend in Kultur zu halten, ließen ahnen wie komplex die Lebensvorgänge auf der mikroskopischen und auf der molekularen Ebene tatsächlich sind. Heute wissen wir um die Vielschichtigkeit der Ursachen, die im Laufe eines langwierigen Erkenntnisprozesses nach und nach mühsam und von zahlreichen Rückschlägen begleitet aufgedeckt wurden.
Jedes komplex organisierte Lebewesen – ob Mensch, Tier oder Pflanze – entsteht aus einer einzelnen Zelle, der befruchteten Keimzelle. Durch kontinuierliche Teilung und Differenzierung entwickelt sich ein komplizierter Organismus aus zahlreichen, miteinander in wechselseitiger Beziehung stehender Zellen. Ärzte und Wissenschaftler waren von Anfang an bestrebt, diesen Vorgang auch künstlich im Labor („in vitro“) durchführen und studieren zu können. Zum einen wollte man die Mechanismen der Krankheitsentstehung, zum anderen die entwicklungsbiologischen Vorgänge aufdecken und untersuchen. Die ersten „Zellkulturen“ beschaffte man sich mit dem Kescher aus einem Tümpel. Amphibienlaich – das weiß jeder, den der Forscherdrang in jungen Jahren mit dem Marmeladenglas voller Froscheier nach Hause trieb – verlangt außer genügend Wasser keine besonderen Vorkehrungen. Unendlich schwieriger erwiesen sich hingegen die lebenserhaltenden Maßnahmen bei frisch isolierten Zellen oder Gewebeproben! Selbst Krebszellen, deren Teilungsaktivität ungehemmt vonstatten geht, konnten in einer Kulturschale kaum am Leben erhalten werden.
Man muss sich vergegenwärtigen, dass nahezu alle heute bekannten Parameter der Zellphysiologie damals unbekannt waren. Über die Nährstoffe, die ein Mensch zum Leben braucht, lagen gesicherte Erkenntnisse vor. Welche Ansprüche jedoch eine Zelle hinsichtlich der Versorgung und der Darreichungsform stellen mochte, darüber herrschte größte Unsicherheit. Da einer Zelle kaum feste Kost zugemutet werden konnte und eine Kultur in wasserloser Umgebung in kurzer Zeit vertrocknet, versuchte man es zunächst mit so kuriosen Flüssigkeiten wie Boullion aus Rindfleisch. Die Rinderbrühe konnte sich in der Zellkultur jedoch nicht durchsetzen. In erstaunlicher Vorausahnung der tatsächlichen Gegebenheiten experimentierte man nun mit Blutflüssigkeit und Lymphe, um die Kulturbedingungen für Säugerzellen soweit wie möglich der natürlichen Situation anzupassen.
Während die Nährstofffrage zumindest vorläufig gelöst schien, sah man sich mit einem anderen, kaum weniger bedeutenden Problem konfrontiert: den allgegenwärtigen Mikroorganismen, die sich als lästige Kommensalen („Mitesser“) in fast allen Zellkulturen trotz sorgsamster Abschirmung erfolgreich einnisten konnten. Da eine schlagkräftige Abwehrstrategie in Form von Antibiotika noch nicht zur Verfügung stand, muss die Verlustrate außergewöhnlich hoch gewesen sein.
Verglichen mit den Schwierigkeiten bei der Bereitstellung von Nährstoffen und der Aufrechterhaltung steriler Bedingungen war die Versorgung der Kulturen mit Wärme in geeigneten Behältern eine durchaus lösbare Aufgabe. Die Temperatur wurde mittels Thermometer und Raumheizung auf dem erforderlichen Niveau gehalten. Ein einfacher Kasten, ausgestattet mit einer Schale Wasser und einer Kerze kann als Urahn aller Brutschränke betrachtet werden.
1.3 Die zukünftige Schlüsseltechnologie
Versuch und Irrtum bestimmten noch bis weit in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts die meisten Experimente mit Zellen. Erst die Entwicklung spezieller Kulturmedien und die Entdeckung der Antibiotika erlaubten den Zellforschern eine adäquate Nährstoffversorgung ihrer Zellkulturen sowie eine gezielte Bekämpfung mikrobieller Infektionen bzw. deren Vorbeugung. Die Zahl der erfolgreich in Kultur genommenen Zellen konnte ständig gesteigert werden. Infolge der rasanten Entwicklung auf dem Gebiet der Labortechnik und der immens verfeinerten Analysemethoden hat die Zellkultur mittlerweile einen Stand erreicht, der es erlaubt, komplexe Primär- und Gewebekulturen in vitro zu etablieren.
Besonders durch die stürmische Entwicklung der Biotechnologie gewann die Zellkultur, auch die pflanzliche Zell- und Gewebekultur, in der letzten Dekade des 20. Jahrhunderts ständig an Bedeutung. Konzentrierte sich das Interesse der Zellbiologen und Mediziner ursprünglich nur auf die Vorgänge in der einzelnen Zelle, untersucht man heute auch komplizierte Zusammenhänge in Zellverbänden und Geweben. Diese lassen sich meist nur in mehrschichtigen Cokulturen studieren, in denen z. B. sowohl Epithelzellen als auch Bestandteile ihrer natürlichen Umgebung (Basallamina, extrazelluläre Matrix, Fibroblasten) vorhanden sein müssen.
Schließlich sei noch darauf hingewiesen, dass die Zellkultur das Leiden von Tieren verringern hilft, indem sie Tierversuche überflüssig macht. Laut einer Statistik des Bundeslandwirtschaftsministeriums konnte die Zahl der Tierversuche in Deutschland von 1989 bis 1997 um mehr als 40% reduziert werden. Im Jahr 1996 wurden knapp 1,5 Mio Wirbeltiere in der Arzneimittelforschung „verbraucht“. Diese Zahl erscheint riesig, im Vergleich zur Situation vor 20 Jahren ist das jedoch eine Reduzierung um ca. 3 Mio Tiere pro Jahr. Es darf dennoch nicht verschwiegen werden, dass aufgrund der neuen EU-Chemikalienpolitik, die für Tausende von Stoffen neue toxikologische Untersuchungen vorsieht, seit Anfang der 1990 er Jahre die Zahl der Versuchstiere wieder auf mehr als 2 Mio pro Jahr angewachsen ist. Die Bedeutung der Zellkultur als Alternative zu Tierversuchen wächst dennoch ständig. So stellte die EU-Kommission im Jahr 2003 neue Arzneimitteltests auf der Basis von Zellkulturen vor, die preiswerter und genauer sein sollen als der herkömmliche Test an Kaninchen.
Die moderne Zellkultur hat die Kinderkrankheiten ihrer Anfangsphase weit hinter sich gelassen und ist zu einem unverzichtbaren Werkzeug nicht nur für die Biologie und Medizin geworden. Zellkulturen werden zunehmend auch für technische Fragestellungen, z. B. in der Biotechnologie, Gentherapie oder in der Materialforschung eingesetzt. Sie werden sich auch in Zukunft weiterentwickeln und ein spannendes Betätigungsfeld nicht nur für Zellbiologen bleiben.
2
Das Zellkulturlabor und seine Einrichtung
2.1 Was ist ein Laboratorium?
Wie jedes andere Gewerbe benötigt auch die praktische wissenschaftliche Tätigkeit einen geeigneten Arbeitsraum, ein Laboratorium oder Labor.
Unter einem Labor im Allgemeinen verstehen wir einen Raum, in dem von Fachleuten oder unterwiesenen Personen Arbeiten zur Erforschung und Nutzung medizinischer, naturwissenschaftlicher oder technischer Vorgänge durchgeführt werden.
Nicht selten wird das Labor auch zu Ausbildungszwecken genutzt. Den für den Umgang mit lebenden Zellen geeigneten Arbeitsbereich bezeichnen wir als Zellkulturlabor.
Als die Wissenschaftler ihr Labor noch im Straßenanzug mit Zylinder und Monokel betraten, gab es kaum Vorschriften darüber, wie ein Labor einzurichten sei. Inzwischen hat die Bürokratie eine Vielzahl an Normen, Rechtsvorschriften, technischen Regeln, Verordnungen, nationalen Gesetzen und EU-Richtlinien produziert, mit denen sich die Betreiber von Forschungsstätten bei der Ausstattung von Laboratorien befassen müssen. Die überwiegende Mehrheit des Laborpersonals wird kaum mit der Neueinrichtung eines Zellkulturlabors beauftragt werden und die rechtlichen Grundlagen in ihrem vollen Umfang würdigen können. Meist sind die Arbeitsbedingungen, unter denen Zellkultur betrieben werden soll, bereits vorgegeben. Dennoch sollten wir uns die wichtigsten Grundanforderungen an die Einrichtung eines Zellkulturlabors vergegenwärtigen, um gegebenenfalls Mängel erkennen und beseitigen zu können.
2.2 Allgemeine Ausstattung eines Zellkulturlabors
Wie wir noch sehen werden, erfordert die Arbeit mit Zellen zum Teil sehr unterschiedliche Laborstandards. Schon wenn wir uns in einer Forschungseinrichtung nach der Lage des Zellkulturlabors erkundigen, fällt auf, dass dieser Arbeitsbereich gewöhnlich nicht in ein molekularbiologisches oder genetisches Labor integriert ist. Meist werden wir einen separaten Raum vorfinden, der einen etwas abgeschotteten Eindruck auf den Besucher macht. Dieser Umstand ist kein Zeichen dafür, dass es sich bei den Zellbiologen um ausgesprochen eigenbrötlerische Naturen handelt. Die Gründe für die Lage des Zellkulturlabors, abseits der anderen Laborräume, liegen vielmehr in den besonderen Ansprüchen und Notwendigkeiten, die sich zwangsweise aus dem Umgang mit lebenden Zellen ergeben.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























