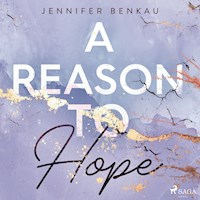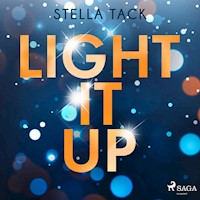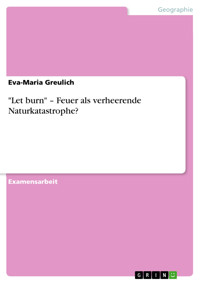
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Examensarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Didaktik - Geographie, Note: 1,0, Ludwig-Maximilians-Universität München (Department für Geo- und Naturwissenschaften), Sprache: Deutsch, Abstract: Schon seit 1,5 Millionen Jahren versucht der Mensch die Naturkraft Feuer zu zähmen und nutzt ihre Eigenschaften – ihr Licht, ihre Wärme und ihre Brennkraft. Jedoch brachten die Flammen auch oft Unheil, wenn sie die Zivilisation gefährdeten oder schädigten. Ein negativer und bedrohlicher Aspekt haftet der Naturkraft noch heute an – sie wird als zerstörerisch empfunden und muss unter allen Umständen kontrolliert werden. Doch ist Feuer tatsächlich eine derart gefährliche und destruktive Kraft, die Mensch und Natur schadet? In der vorliegenden Arbeit soll dies untersucht werden. Negative sowie positive Aspekte dieser vermeintlichen Naturkatastrophe sollen dargestellt und erläutert werden, um ein differenziertes Bild des Faktors „Feuer“ im Zusammenhang mit natürlichen und anthropogenen Einflüssen zu schaffen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Page 1
zur Zulassung zur ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Grundschulen in
Page 1
Einleitung
So dichtete Friedrich von Schiller in der „Glocke“. Schon seit 1,5 Millionen Jahren versucht der Mensch diese Naturkraft zu zähmen und nutzt die Eigenschaften des Feuers - sein Licht, seine Wärme und seine Brennkraft. Jedoch brachten die Flammen auch oft Unheil, wenn sie die Zivilisation gefährdeten oder schädigten. Ein negativer und bedrohlicher Aspekt haftet der Naturkraft noch heute an - sie wird als zerstörerisch empfunden und muss unter allen Umständen kontrolliert werden.
Doch ist Feuer tatsächlich eine derart gefährliche und destruktive Kraft, die Mensch und Natur schadet?
In der vorliegenden Arbeit soll dies untersucht werden. Negative sowie positive Aspekte dieser vermeintlichen Naturkatastrophe sollen dargestellt und erläutert werden, um ein differenziertes Bild des Faktors „Feuer“ im Zusammenhang mit natürlichen und anthropogenen Einflüssen zu schaffen.
Page 2
1. Begriffsklärung
Der Begriff Feuer, bzw. Brand beschreibt einen „ökologischen Faktor, der einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf Böden, Vegetation, Tierwelt und nicht zuletzt den Menschen in seinem Lebensraum ausübt.“ (MEUSBURGER 2002b, 378)
Tritt ein Schadfeuer in einem Trockengebiet auf, wird der BegriffBuschfeuerverwendet (BROCKHAUS 2006, 360).
Es können folgende Brandformen in der Natur unterschieden werden (vgl. KÖNIG 2007b, 50ff u. BAY. LANDESAMTFÜRBRAND-U.KATASTROPHENSCHUTZ 1988, 5f):
•Boden- und Lauffeuer (Abbildung 1):
Unmittelbar im Bodenbelag oder -bewuchs entzündet, dehnt sich ein Boden- oder Lauffeuer zunächst auf alle Seiten hin aus, um sich schließlich zu der dem Wind hingewandten Seite, der Luv, elliptisch auszubreiten, da dort die Sauerstoffzufuhr am höchsten ist. In Hanglagen bewegt sich das Feuer hangaufwärts rascher fort, in steilen Bereichen ist eine Ausbreitung auch bergab durch Steinschlag möglich.
Abbildung 1: Bodenfeuer
Die Flammen bleiben aufgrund der geringen Brandlast der Bodenvegetation verhältnismäßig niedrig (selten übersteigen sie die 2 m-Grenze) und auch der Feuersaum erreicht mit 70 - 200 cm keine große
Page 3
Tiefe. Die Laufgeschwindigkeiten können 10 - 1 200 m/h betragen, üblicherweise liegen sie allerdings nicht über 500 m/h. Das Brennmaterial bedingt eine helle Rauchfärbung, was die Identifikation eines Bodenbrandes auch aus der Ferne erlaubt. In Deutschland sind durchschnittlich 75% aller Waldbrände Bodenfeuer.
•Vollfeuer/Totalfeuer (Abbildung 2):
Ein Bodenfeuer kann sich im Wald zu einem Vollfeuer entwickeln. Entzünden die am Boden brennenden Flammen die Borke und die unteren, trockenen Äste der Bäume, können sie sich bis in den Kronenbereich ausbreiten, wo das Brennmaterial grüner und harzreicher ist. Dies zieht eine Veränderung des Rauches nach sich: er färbt sich dunkelgrau bis schwarz - ein eindeutiges Erkennungsmerkmal eines Totalbrandes.
Durch den enormen Sauerstoffverbrauch entwickelt ein Vollbrand eine eigene Thermik: ein vertikal und nach allen Seiten hin wirkender Luftsog. Dieser ist derart stark, dass Windgeschwindigkeiten unter 10 m/s die Laufrichtung des Brandes nicht beeinflussen.
Abbildung 2: Vollfeuer in Russland
Ist die Windstärke höher, besteht die Möglichkeit, dass sich das Feuer in den Wipfeln der Bäume schneller ausbreitet als das darunter brennende Bodenfeuer. Solche Wipfel-, Kronen- oder Flugfeuer können durch
Page 4
herabfallende Glut- oder brennende Ast- bzw. Borkenstücke selbst neue Brände entzünden.
Totalbrände können stark qualmende, lange Feuerfronten bilden, die ab einer Größe von über 50 ha Laufgeschwindigkeiten von 100 ha/h oder annähernd 2 ha/min erreichen können. Vollbrände werden in Deutschland immer seltener, da die Früherkennung und Bekämpfung von Bränden ständig weiterentwickelt wurde und wird (siehe 4.1 bis 4.6).
•Erdfeuer (Abbildung 3):
Diese eher selten auftretende Brandform tritt überwiegend in Moorgebieten auf. Material unter der Bodendecke glimmt meist nur mit schwacher Rauchentwicklung vor sich hin; zudem tritt der Rauch und Wasserdampf meist nicht senkrecht über dem Brandherd aus, so dass sich eine präzise Ortung dessen äußerst schwierig gestalten kann. Teilweise bestehen derartige Brände sogar unbemerkt über Monate hinweg. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit
von Erdfeuern ist sehr gering: 100 m bis 1 000 m/24h können erreicht werden.
Die Bekämpfung gestaltet sich durch den hohen Energie- und Kostenaufwand problematisch; ein konzentrierter und intensiver Einsatz von großen Mengen Löschwasser ist nur selten durchführbar. Zudem ist ein Löscheinsatz über Erdfeuern lebensgefährlich: ausgebrannte Hohlräume bergen die Gefahr beim Betreten einzustürzen. Aus diesen Gründen erfordern diese Brände lang anhaltende und kontinuierliche Kontrolle - auch nach ihrem Erlöschen.
Page 5
•Stammfeuer:
Auch diese Brandform tritt sehr selten auf. Auslöser ist Blitzschlag, betroffen sind einzelne, meist alte Bäume. Wird ein hohler Baumstamm entzündet, brennt er im Inneren und ist zumeist einfach zu löschen. Besonders Kiefern mit alten Harzungslachen brennen aufgrund ihres hohen Kiengehaltes nach einem Blitzeinschlag lichterloh. Stammfeuer können sich zu Bodenfeuern weiterentwickeln.
Da der Anteil der anthropogen verursachten Wald- und Vegetationsbrände weltweit bei über 90% liegt (GOLDAMMER 2001, 211) und diese erst durch die Verknüpfung mit der gesellschaftlichen Verfassung eines Raumes zur Katastrophe werden, können Brandereignisse zumeist als „man-made hazards“ bezeichnet werden (GEIPEL 1992, 186).
2. Ursachen für das Auftreten von Wald- und Vegetationsbränden
2.1. Natürliche Ursachen
Blitzschlag wird häufig als einziger natürlicher Auslöser für Waldbrände betrachtet. Die Schätzungen über dessen Beitrag als Brandursache schwanken zwischen 10% (GOLDAMMER 2001, 211) und 15% (NIEDEK u. FRATER 2003, 165). Laut PLATE (2001, 220) ist Blitzschlag in den Industrieländern der Nordhemisphäre zu 2-3% und in den Mittelmeerländer gar nur zu 1% Brandauslöser.
In borealen Wäldern dagegen kann der Anteil an Blitzschlag als Auslöser von Waldbränden die 80%-Marke übersteigen, was durch die geringe Besiedlungsdichte zu erklären ist (MEUSBURGER 2002a, 378). Blitzschlag war wohl auch in vergangenen erdgeschichtlichen Zeiträumen Auslöser großer Brände, wie fossile Baumstämme z.B. aus dem Miozän (23-5,5 Millionen Jahre vor heute) vermuten lassen, in denen Blitzschlagrinnen nachweisbar sind.
Page 6
Weitere natürliche Zündquellen können ferner aktive Vulkane sein, die mit ihren heißen Auswurfprodukten (siehe Abbildung 4) die Vegetation in Brand setzen, wie es 1991 auf Sulawesi geschah. In der Folge von starken Eruptionen und der dadurch begünstigte Gewitterbildung wiederum Blitzschlägen kommen.
Auch Funkenschlag von Feuersteinen, der unter Umständen bei Steinschlagereignissen auftritt, kann Auslöser eines Vegetationsbrandes sein. Durch Hangrutschungen, leichte Erdstöße gelöste oder durch Tiere losgetretene Steine, die beim Herabfallen Funken bildeten, wurden im südlichen Afrika und im indischen Himalaya beobachtet. In der südafrikanischen Cedarberg-Region konnte in einer Untersuchung zwischen 1958 und 1974 bei über 25% der Brände Funkenbildung bei Steinschlag als Auslöser ausgemacht werden.