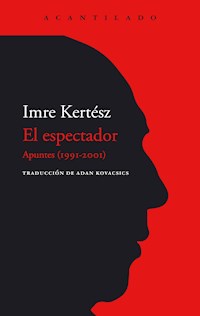14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Handelte es sich bei Imre Kertész' berühmtem «Galeerentagebuch» um eine bewußte Komposition seiner jahrzehntelangen Aufzeichnungen, bilden die Tagebücher 2001–2009 ein unbearbeitetes, ursprünglich nicht für die Öffentlichkeit gedachtes «journal intime» von überraschender, oft verstörender Offenheit. Es umfaßt die Jahre seiner «äußeren» Emigration – die Loslösung von Ungarn, dessen postsozialistische Entwicklung ihn immer stärker an präfaschistische Zeiten erinnert, und die Niederlassung in der Wahlheimat Berlin, wo ihn 2002 die «Glückskatastrophe» des Nobelpreises ereilt. Zwar weiß er das damit verbundene «rare Geschenk guten Lebens» durchaus zu genießen, doch die Klage über die Anforderungen des Ruhms grundiert von nun an die Aufzeichnungen, verbindet sich mit der Klage über den «Terror des Alters» und das Nachlassen der Schaffenskraft. «Trivialitäten-Tagebuch» nennt er das Diarium schließlich. Von der gewohnten Schärfe seiner zeitdiagnostischen und ästhetischen Reflexionen, der Prägnanz der Momentaufnahmen verliert es freilich nichts. Leitmotiv bleibt das Schreiben, das Ringen um die Gestaltung der in diesen Jahren entstehenden Prosawerke «Liquidation» und «Dossier K.» sowie des geplanten Sonderberg-Romans. Schreiben ist für Kertész die Legitimation seines Lebens. Als Krankheit und Schmerzen dominieren, macht er sich mit unerhörter Kühnheit zum Chronisten des eigenen Verfalls «im Vorzimmer des Todes».
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 557
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Imre Kertész
Letzte Einkehr
Tagebücher 2001–2009 Mit einem Prosafragment
Aus dem Ungarischen von Kristin Schwamm
Rowohlt E-Book
Inhaltsübersicht
Editorische Vorbemerkung
Genau ein Jahr nachdem er zum Nobelpreisträger gekürt worden war, am 13. Oktober 2003, schreibt Imre Kertész in sein Tagebuch: «Eine ganze Weile schon kann ich meinem Leben nicht mehr folgen, das sich mit kometenhafter Geschwindigkeit von mir entfernt, während ich verwundert hinterherstarre, wie es immer kleiner und kleiner wird; bald wird es kaum noch wahrnehmbar sein am Horizont, dann drehe ich mich auf dem Absatz um und mache mich mit verzagten Schritten auf den Weg nach Hause.» Unmittelbar darauf spricht er zum ersten Mal von einem neuen Projekt: «Ein radikal persönliches Buch, bis schließlich nichts mehr übrig bleibt (Die letzte Einkehr). Den Weg zu Ende gehen, im wortwörtlichen Sinn. Die Figur zerrütten, zermalmen, zernichten. Aber möglichst ohne jede Erklärung, vor allem ohne jede sogenannte Philosophie.»
Was sich hier formuliert, ist der Plan, seine Aufzeichnungen als Grundlage für ein Prosawerk zu verwenden, ähnlich, wie er es schon in Ich – ein anderer gemacht hatte, nur ungleich radikaler und stärker fiktionalisiert. In dieser Absicht beginnt er noch im Dezember 2003 ein Trivialitäten-Tagebuch, um die Stationen seiner durch den Ruhm hervorgerufenen Selbstentfremdung und des eigenen, durch Krankheit und Alter bedingten Verfalls als Rohmaterial festzuhalten. Im März 2004 sind bereits 30 Seiten der fiktionalisierten Fassung fertig. Dann aber geht die Arbeit nur stockend weiter. Bei Kertész stellen sich Skrupel ein, ob er noch ein weiteres Werk publizieren könne, das auf seinen persönlichen Aufzeichnungen basiert. Hinzu kommt die Befürchtung, daß ihm mit einem so «gnadenlosen» persönlichen Buch nur die Wahl der posthumen Veröffentlichung bliebe.
«Ich weiß nicht, wie ich die schwierigen Probleme der Letzten Einkehr lösen soll», notiert er am 6. August 2004. «Ich gelange nicht zu der nackten Wahrheit. Ich weiß nicht, was die nackte Wahrheit der Letzten Einkehr ist. Vielleicht die Ironie, wie mich der Literarische Hauptgewinn erreicht und vernichtet. Aber dazu ist es nötig, den lächerlichen Gegensatz zwischen meinem Leben und diesem Hauptgewinn klar zu umreißen. Ich müßte meine Umgebung dann als das abbilden, was sie ist: eine mörderische Welt wohlmeinender Verschwörer. Und mich selbst gleicherweise: als eine lächerliche, hilflos im Honig ertrinkende Fliege, eine zugrunde gehende Figur, die sich ohnmächtig ihren sie liebenden Mördern ergibt.»
Beinahe erlöst wendet er sich im folgenden der Arbeit an Dossier K. und dem Drehbuch zum Roman eines Schicksallosen zu. Das «Trivial»-Tagebuch aber, ursprünglich als Materialsammlung angelegt, gestaltet sich unterdessen selbst zu einem erschütternden Werk der letzten Einkehr und erfüllt am Ende die Prämisse, die sich Kertész für sein «opus magnum ultimum» gesetzt hatte – «ein radikal persönliches Buch, bis nichts mehr übrig bleibt». Exit-Tagebuch nennt er das Diarium zum Schluß, bevor er es 2009, im 80. Lebensjahr, krank und zutiefst desillusioniert, ganz beendet. Berechtigterweise sind nun die späten Tagebücher mit dem Titel Letzte Einkehr versehen.
Am Plan des parallelen Prosawerks aber hat Kertész stets festgehalten. «Ich arbeite an der Letzten Einkehr, wie Beethoven an seinen letzten Streichquartetten gearbeitet haben mag», schreibt er im März 2006. Es schwebe ihm ein Werk «in der Manier Turners» vor, ergänzte er im Gespräch. Wir haben in diese Ausgabe ein Fragment aufgenommen, das zeigt, wie stimmig diese Vergleiche sind.
Ingrid Krüger
Geheimdatei
2001
1. Januar 2001 Neujahr. Das alte war schwer und ziemlich unproduktiv, mit garstigen Krankheiten gescheckt, von denen eine lebenslänglich bedeutet (Parkinson) und diese bezaubernde Handschrift zur Folge hat; aber sie mahnt mich, daß der Tod nahe ist und also das Leben, das heißt die Arbeit pressiert. – Vor zwei Tagen habe ich mir eine elektronische Schreibmaschine (Laptop) angesehen und beschlossen, mir diese technische Errungenschaft zu eigen zu machen; ich sehe dem mit Aufregung entgegen, denn eine andere Lösung gibt es ohnehin nicht – und wie gut, daß es diese gibt. Der langweiligen Kaste der Erfinder Dank und Respekt!
2. Januar 2001 Wer bei gesundem Verstand bleibt und Glück hat, stirbt so, wie das Kind gezwungenermaßen sein Spielzeug liegen läßt, wenn es am Abend ins Bett geschickt wird; sich einerseits beklagend, andererseits kaum noch imstande, die Augen offen zu halten. Zwar tröstet man es, daß es sein Spielzeug am nächsten Tag wiederfinden werde, aber das Kind glaubt so wenig an morgen wie der Sterbende.
8. Januar 2001 Gestern und vorgestern in Wien, am Sonnabend Besuch bei Ligeti, Gespräche bis tief in die Nacht. Die immer noch wie neu empfundene Freude, mich in den Zug setzen und nach Wien oder sonst wohin fahren zu können, um einen Freund zu besuchen. Ligetis Bitte, ihm zu erzählen, worum es in meinem Roman geht, konnte ich natürlich nicht erfüllen; unmöglich, diese Geschichte in einer Sprache, die Hand und Fuß hat, vorzutragen. Aber heute im Morgengrauen, schlaflos, habe ich mir die ganze vielschichtige Geschichte selbst erzählt. Wieder wurde mir bewußt, wie wichtig der Einbau des Stückes – ein scheinbar zufälliger Einfall – ist und wie sehr es sich verbietet, die Geschichte mit dem Gestus einer «wahren» Geschichte vorzutragen: Sie verlöre völlig ihre Glaubwürdigkeit.
10. Januar 2001 Gestern eingeladen; ein jüdisches Ehepaar, etwa Mitte Fünfzig; die Frau (von stark semitischem Aussehen) mit der stereotypen Verwunderung über den «heutigen», den «sogenannten Antisemitismus»; sie sagt, «früher» (sie meint, während des Kádár-Sozialismus) habe sie so etwas (wie die sogenannte «Judenfrage») überhaupt nicht erfahren. Dann sprach sie von ihrem Vater, der Arzt war, er war nach Auschwitz deportiert und in Dachau befreit worden, habe jedoch zu Hause, im Kreis der Familie, nie ein Wort über das Konzentrationslager verloren. Wenn Gott, so zitierte sie den Vater, Auschwitz zugelassen habe, dann habe er mit diesem Gott abgeschlossen, ein für allemal. Mehr habe er über all das nicht gesprochen: Damit war die Angelegenheit für ihn erledigt. – Vermutlich war er Kommunist, zumindest Parteimitglied geworden. Was für eine banale Denkweise. Seine Kinder wurden natürlich nicht im jüdischen Geist erzogen – sofern wir nicht in der skizzierten Denkweise jenen typisch jüdischen Geist erkennen, den der angepaßte jüdische Kleinbürger sich als unklare und unzulängliche Verteidigung ausbildet. Was aus alldem klar hervorgeht, ist die geistige Hilf- und Wehrlosigkeit des Menschen gegenüber jeder Art von Macht. Die grenzenlose Dummheit, die das hiesige Leben – das Leben in einer antisemitischen, haßerfüllten und zerstörerischen Umgebung – dem potentiellen Opfer abverlangt, ist die erste Voraussetzung, der erste Schritt auf dem Weg zu seiner Vernichtung. Doch warum sollte es leichter sein, dumm zu sein, als die Dinge zu erkennen und sich, um einige Fußnoten reicher, auf den Tod vorzubereiten.
11. Januar 2001 Alles ist auf der Strecke geblieben – das ist das Grundgefühl, das mich begleitet. Was eigentlich ist auf der Strecke geblieben? Die Möglichkeit der Revolution, jeder neuen geistigen Bewegung überhaupt. Die Zukunft, die geistige Zukunft ist auf der Strecke geblieben – zumindest scheint es so. Darum verfasse auch ich entweder Nekrologe oder eben sprachliche Konstrukte, die von der geistigen Stagnation handeln. – Aber wieso ist es schlimm, daß die Revolution auf der Strecke geblieben ist? Wohin hat Revolution denn letzten Endes geführt? Zu den Nazis und zum Gulag. Die Lehre der Französischen Revolution, daß die Situation des Menschen in der Gesellschaft ungerecht ist und die Gesellschaft deswegen verändert werden muß, hat zu Haß, zu verstärkter Ungerechtigkeit geführt, schließlich zu Völkermord: Die Macht, jede Macht, ist auch heute (trotz demokratischer Wahlen) illegitim. Aus dem Bankrott der europäischen Kultur ist kein Ausweg zu sehen; wo es Dynamik gibt, sind Hybris der Macht, dann Völkermord die Folge, wo es keine Dynamik gibt, drohen Stagnation und durch Stagnation bedingte Verkalkung. Gibt es noch irgendein Ziel, das des Menschen würdig und noch nicht diskreditiert worden wäre? Ist Erneuerung, rinascimento noch möglich? Was ist meine Aufgabe, als Mensch, als Künstler? Einsehen, daß ich auch nur von Bankrott sprechen kann? Und deshalb lieber aufhören, aufgeben? «Ich weiß es nicht, auf Ehre und Gewissen, ich weiß es nicht», wie es bei Tschechow heißt.
12. Januar 2001 Gestern Nora. In einer – zumindest gesellschaftlich – starren Welt übernehmen Psychologie und Charaktere die führende Stimme. Womöglich kehren wir allmählich genau dahin zurück. Dann würden meine Romane allerdings unverständlich werden. (Falls sie es nicht jetzt schon sind.)
14. Januar 2001 Das Tagebuch von 1982: Was für ein reicher, was für ein strömender, mäandernder Text. Im Galeerentagebuch habe ich das Ganze kastriert, vor allem – um A. nicht zu verletzen – die Teile über das Liebesleben. Dadurch kam im Galeerentagebuch ein reiner und lichter Text zustande, aber das Licht ist nur intellektuell, es mangelt ihm schmerzlich an sinnlichem Glanz.
15. Januar 2001 In letzter Zeit stoße ich öfter auf den Wittgenstein-Satz (in Zitaten, denn in den Büchern des Autors blättere ich ja heute kaum noch), wer sich selbst nicht kenne, könne kein «großer Mensch» sein. Ich kann nicht umhin, mich über diesen apodiktisch formulierten Satz zu wundern, denn wer kann sich schon selbst kennen? Das läßt sich selbst von Wittgenstein, diesem klugen Kopf, nicht sagen. Mein Ideal ist lediglich eine gewisse Unabhängigkeit von den Urteilen anderer und ein Sich-Abfinden mit den eigenen kläglichen Möglichkeiten; innerhalb dieser Möglichkeiten aber bis an die äußerste Grenze gehen – das ist alles, soweit es mich, ausschließlich mich betrifft.
Heute wurde ich nach einem Anfall von Tachykardie von der tiefen Traurigkeit der Verurteilten erfaßt; immer mehr Indizien, immer weniger Aufschub, du stirbst und hast deine Sache noch nicht zu Ende gebracht; und vielleicht wurdest du deswegen zum Tode verurteilt, wegen dieser Sünde, zu glauben (solange es sich glauben ließ), daß du ewig lebst.
16. Januar 2001 Ich kann wie die großen Romantiker sagen, mein Herz schlägt wild; nur schade, daß der Grund bei mir die Tachykardie ist. – Doch ein Blick auf meinen Arbeitstisch und den verödeten Garten im Hintergrund – und plötzlich ergreift mich Freude: Solange du lebst, sei glücklich, einzig das Glück ist dem Leben würdig, sonst vegetiertest du würdelos … Auch die Freude ist ein Hüpfen des Herzens, nicht nur die Tachykardie.
17. Januar 2001 Erkennen zu müssen, daß mein Tagebuch zu einer Wüste persönlicher Klagen geworden ist. Trotzdem muß ich es führen, damit man sieht, was aus einem wird, wenn Geist, Lust und Begabung schwinden. Irgendwann, vor Jahrzehnten, habe ich mir nach dem Vorbild Camus’ selbst den Befehl zur «offenen Kreation» gegeben. Und dazu gehört auch der Kollaps. (Obgleich ich annehmen möchte, daß ich noch imstande bin, den begonnenen «letzten Roman» zu schreiben.)
19. Januar 2001 Ein reizvoller Gedanke, bei einer eventuellen nächsten Tagebuch-Publikation den Text nicht in einer aphoristischen oder sonstwie bruchstückhaften Form zu bringen, sondern «ohne Pause», als einen einzigen, ungebrochenen Monolog, als Redeschwall, wenn man so will.
20. Januar 2001 Meine literarische Reputation in Ungarn entspricht der eines Porno-Autors: In der guterzogenen, vornehmen literarischen Gesellschaft schickt es sich nicht, meinen Namen auszusprechen, tut man es doch, dann dient ein spezieller Anlaß dazu, ein gewisses Ritual in der Art schwarzer Messen, oder die schreckliche Farce, wenn man dem Holocaust genannten traurigen Ereignis opfert, von dem im übrigen weder die Anwesenden noch die Nichtanwesenden wissen, was es ist; nur darüber, wie schmachvoll diese Feier ist, sind sich alle im klaren.
23. Januar 2001 Warum schreibt man? Die Welt als zu lösendes und unlösbares Problem. Das Leben als unüberwindliches Trauma. Nie können wir zu einem Ende kommen, der Tod ist nur das Siegel auf dem, was ständig hinausgeschoben wird. Alles ist in liquidem Zustand, fließt (man müßte das griechische Zitat kennen): panta rhei … Die größte Lüge der Marxisten (von den vielen großen) ist, daß es nichts «ewig Menschliches» gebe. Es gibt es. Gerade dadurch ist der Mensch Mensch. – Zum Roman. Das Neue daran: die kontrapunktische Konstruktion. Ich glaube, so etwas hat noch niemand gemacht. Die Form hat sich allmählich herausgebildet, unter sanften Qualen, ohne daß ich von vornherein auf eine neue Form aus gewesen wäre. Aber Kunst ist immer neue Kunst, wie Schönberg sagt, und dieses Erleben der Welt, die völlige Auslöschung des Schicksals, der Wirklichkeit, ist nur auf ungewöhnliche Art zu beschreiben, so ungewöhnlich, wie diese Welt selbst ist, das heißt, wie sie so noch nie gewesen ist.
25. Januar 2001 In Ungarn läßt sich gut studieren, was dort geschieht, wo nichts geschieht. Dieses Land ist schon lange aus der Geschichte ausgeschlossen; es ist nicht in der Position, die Geschichte, die Weltläufe in irgendeiner Weise zu beeinflussen – also versteht es sie auch nicht. Es gibt ausschließlich negative Erfahrungen, die zwangsläufige Passivität wirkt kastrierend auf das ganze Land, und damit stirbt langsam die Kreativität, die eine Nation am Leben und nicht bloß in einem vegetierenden Überlebenszustand hält. Immer deutlicher zeigen sich die Konsequenzen, die sich daraus für mein Schaffen wie auch für meine bloße Existenz ergeben. Ich arbeite in einer verständnislosen Umgebung, in einer Sprache, die diejenigen, die mich sonst verstünden, nicht verstehen.
30. Januar 2001 Am Wochenende Salzburg. András Schiff. Nächtlicher Spaziergang durch die engen Gassen Salzburgs. Sein wundervolles Mozart-Konzert. Abends die Landesmanns. Noch ein Konzert im Festspielhaus (Periaha). Nachts Übelkeit (verdorbener Magen, wie in meiner Kindheit, vom Tscholent-Abendessen zwei Tage zuvor). Wie schon gesagt, so muß man leben – wenn ein Freund ein Konzert in Salzburg gibt, setzt man sich in den Zug und fährt hin; Schiff gestand, daß es für ihn, obgleich er – zumindest als Erwachsener – nur einige Jahre von der «sanften» Diktatur miterlebt hat, auch heute noch wie ein Wunder ist, sich frei in der Welt bewegen zu können. Das gleiche sagen auch Ligetis: Sie leben seit 1956 in freien, zivilisierten westlichen Verhältnissen, können das aber auch heute noch nicht als ganz natürlich betrachten. – Sowohl im Zug als auch in Salzburg langweilte ich Magda mit meinen üblichen Klagen: über die Schande, in Ungarn zu leben und den Antisemitismus der Öffentlichkeit zu ertragen. Und das ist noch das kleinere Übel: Mein wirkliches geistiges Elend in diesem Land rührt daher, daß es hier für mich keine Aufgabe, keine Arbeit im geistigen Sinne gibt. Ich sagte, daß ich gern jetzt noch, im Alter von 72 Jahren, die deutsche Staatsbürgerschaft annähme. Ich habe das Gefühl, in Deutschland eine Aufgabe zu haben; wie gering die Wirkung auch ist, die ein Schriftsteller haben kann, dort habe ich sie, was ich schreibe, fällt auf fruchtbaren Boden, man braucht mein Werk, das eine geistige Brücke bildet und doch so vieles umfaßt; ich gehöre zur westlichen Zivilisation, und das wird mich immer von der Region, dem Volk, der «Kultur» trennen, in deren Sprache ich schreibe. – Weg von hier: das ist eine strategische Frage, solange ich für meine kurz bemessene Zeit überhaupt noch strategische Pläne schmieden kann.
5. Februar 2001 Kampf mit dem Roman. Früh aufgestanden, gebadet, dann ans Manuskript. Das Wahrheitsverlangen der – von mir – dargestellten Welt. In Wirklichkeit ist der Grund für das Gefühl des Werteverlusts nicht geklärt, es ist nicht geklärt, was die Menschen, vor allem die sogenannten Intellektuellen, verloren haben. Wahrscheinlich die Hoffnung, die Hoffnung auf einen Wandel. Es hat zwar ein Wandel stattgefunden, aber dabei ist das Gefühl der Erneuerung, die Katharsis, ausgeblieben. Im Seelenzustand der westlichen Welt ist dieses Gefühl, wenn auch irgendwo in der Tiefe, so doch gegenwärtig, weil die Revolutionen ausgefochten, Gesellschaftsverträge im großen und ganzen geschlossen worden sind.
8. Februar 2001 Die «Volks»-Motive, so, wie Schostakowitsch sie verwendet, zum Beispiel im ersten und – vor allem – im letzten Satz des 1. Klavierkonzerts, als Dummheit vorgeführt; und allein so ist er glaubwürdig. – Aber wie lange hat es gedauert, bis man endlich darauf kam, daß er, Schostakowitsch, nicht mit diesen Idiotismen identisch ist, die lediglich den künstlichen und alles um sich niedertrampelnden Optimismus einer scheußlichen, mörderischen Maschinerie darstellen; nebenbei sind in diesem dummen Gepfeife sogar die Fehler, Aussetzer und Stockungen der Maschinerie enthalten.
17. Februar 2001 Schreiben, mit besonderem Genuß, mit dem Gefühl: «mein letzter Roman». – Ansonsten: viel zuviel gesellschaftliches Leben, überflüssige Abendessen und Zusammenkünfte; die Nähe von Freunden in dieser unfreundlichen, dieser faschistischen Umgebung dennoch erwärmend. – Eine interessante Frage: Wenn ich meine Spielkarten herausnehme, wieso ist Pik-As dann immer (fast immer) die unterste Karte? Es scheint, als hätte das Pik-As ein eigenes Gewicht, irgendeine sonderbare Gravitationskraft. Mysteriös.
8. März 2001 Letztes Wochenende in Madrid. Die Eleganz dieser Stadt. Die südlichen Gesichter; noch menschlich, es ist ihnen noch nicht jene roboterhafte Starrheit eingegraben – oder auch der Alkoholismus –, wie nordeuropäischen Gesichtern. Jede Menge Interviews – interessiere ich die Leute tatsächlich, oder handelt es sich um etwas anderes? Aber um was? Auf dem Umschlag des Romans eines Schicksallosen das Gesicht eines halbwüchsigen Jungen; ich erinnere mich an die langen Jahre einsamer Arbeit und das Gefühl, als ich den Roman beendet hatte: Ich bildete mir ein, eine edle literarische Figur geschaffen zu haben, die das Publikum lieben würde. Dann Jahrzehnte, fast zwei Jahrzehnte Stille. Und siehe da, jetzt ist er zum Leben erwacht; ich staune darüber noch nicht einmal genug, ich schlage mich mit den unangenehmen Symptomen des Alterns herum und einer Krankheit, die mich nunmehr immer begleiten wird, bis ich sterbe.
10. März 2001 Eigentlich gebe ich ein unverantwortliches Interview nach dem anderen. Ich rede über Auschwitz wie ein Großaktionär, der sich seine Rechte vorbehält; es möge zu meiner Entschuldigung dienen, daß mir diese Tonart gewissermaßen abgenötigt wird und ich nur dem «allseitigen Wunsch» nachgebe. Aber warum gebe ich nach? Keineswegs aus Gefallsucht, ausschließlich aus jener Schwäche, vielleicht sollte ich sie richtiger Feigheit nennen, die mich ständig zwingt, den Leuten gefällig zu sein. Was ich in solchen Situationen sage, verstehe ich selbst nicht; und ich ertappe mich ununterbrochen dabei, nicht aus einer Position der Souveränität zu sprechen, sondern mich gleichsam zu verteidigen. Ich fürchte, schließlich mich selbst enorm satt zu haben und das, was ich zu sagen habe, das in solchen Interviews in denkbar banaler Form erscheint. Wenn ich noch lange lebe, werde ich am Ende noch zur Kultfigur, obwohl ich nicht zum Segenspenden unter die Menschen gegangen bin, sondern um ihnen von meinen Erfahrungen zu berichten und das nach Möglichkeit mit den Mitteln der gehobenen Unterhaltung, das heißt der Kunst, zu tun. Warum muß ich darüber hinaus noch weise sein?
Ich lese eine detailreiche Biographie Primo Levis. Was kann man wissen – oder in Erfahrung bringen – von einem Menschen, der aus Auschwitz zurückgekehrt ist, dann Jahrzehnte später (und offensichtlich in Zusammenhang mit dem KZ-Erlebnis) Selbstmord begeht? Ich habe das Gefühl, daß meine Romanfigur geisterhaft und ihre innere Welt nicht darstellbar ist. Der Selbstmord folgt keiner Logik, nur der Dramaturgie, das aber bedeutet eine lange, sich dem Selbstmord entgegenstellende Lebensführung. (Nicht Ciorans von Celan übernommenen Satz vergessen: Er habe alle Möglichkeiten ausgeschöpft, die Zerstörung zu vermeiden – so ungefähr …)
11. März 2001 Nach schlafloser Nacht ein frisch gewaschener, blasser Morgen vom Schreibtisch aus; das Auftauchen eines frühen Passanten auf der Straße hinter dem Garten weckt ferne Erinnerungen, ich weiß nicht genau, was für Erinnerungen – an morgendliche Düfte, Kaffee, Eile, an morgendliche Lichter und Farben … Bin in einer Celan-Biographie auf der Suche nach einer vorstellbaren B.-Figur, so wie ich gestern nacht schon Primo Levi studierte; aber ich weiß, daß meine Figur schließlich aus dem spezifischen Gewebe der Handlung hervorgehen muß … In den letzten Tagen sträubt sich etwas in mir stark gegen das ganze habituelle Judentum, Kafka, Celan, Levi – gegen alle; ich bin gegen die Auschwitz-Mystik, die Problematisierung der verschiedenartigen Identitäten. Warum muß, wer als Jude nach Auschwitz gebracht worden ist, Jude sein? Aus Trotz? Aus Empörung? Mir graut vor dem jüdischen Glauben genau wie vor jedem anderen Glauben; aber ich finde Brüderlichkeit in den Gesichtern, der Intonation, einem Lächeln. Das schöne Gesicht meiner Magda ist kein jüdisches Gesicht, und in ihm finde ich Brüderlichkeit. Auch in den Gesichtern von Levi und Celan erkenne ich Verwandtes – aber das bezieht sich nicht auf die Mystik von den Juden; ich kann mir vorstellen, einen Nachmittag lang mit Celan im Gábor-Internat Fußball zu spielen oder der Banknachbar von Levi im Madách-Gymnasium zu sein. Wovon rede ich? Davon, daß mich ein Klischee erwürgt, ich will mich nicht mehr in eine der Varianten einreihen, die im Rollenbuch vorgesehen sind; ich möchte ich sein – auch wenn ich nicht wissen kann, wer ich bin; aber mir ist, als würde mir das Schreiben langsam nicht mehr helfen, etwas über mich selbst zu erfahren, mich eher daran hindern; der Zwang der Sprache, einer mich befremdenden, mir fremden Sprache steuert mich. Und ich bin unleugbar glücklich. Ist das schlimm?
Der Selbstmord rührt vielleicht aus der Erkenntnis einer großen Lüge; die Erkenntnis einer großen Wahrheit spornt, so glaube ich, eher zur Fortsetzung des Lebens an. (Was ist der Unterschied zwischen einer großen Lüge und einer großen Wahrheit? Vielleicht ist es nur ein moralischer Unterschied und berührt eben die Frage von am Leben bleiben oder Selbstmord begehen.)
14. März 2001 Dieser Roman ist voller Rätsel. Daß ich die Figur (den Selbstmörder) sozusagen «kalt» erfinde, davon kann keine Rede sein. Ich muß meinen eigenen Fähigkeiten vertrauen, meiner Inspiration, meinem «Unterbewußtsein», meiner plastischen Begabung.
16. März 2001 Der chaotische, diffuse Charakter dieser letzten Tage. Noch vor drei Tagen in großer Romanstimmung, noch gesteigert durch die Lektüre des jetzt fertiggestellten und des schon lange vorhandenen (und auf Einarbeitung wartenden) Materials. Dann warf vorgestern der Kauf eines Laptops mit einem Mal alles wieder um. Gestern von morgens bis abends vergeblich an dem Apparat herumgearbeitet – ich komme nicht mit ihm zurecht. Aber diese zwei Tage haben mir wieder gezeigt, was ich bin, wenn ich nicht schreibe: nichts und niemand.
18. März 2001 Angeblich kann es nun mit dem Tippen auf diesem Gerät losgehen. Ich möchte die Datei unter dem Stichwort «Geheimdatei» eröffnen.
Gestern im Konzert (Rostropowitsch). Ein paar Worte mit dem Minister, einem im Grunde genommen gar nicht unsympathischen jungen Mann. Mir wurde ein wesentliches Moment dieses Prozesses klar, der sich untergründig vollzieht. Worum geht es? Kurz gesagt – eine merkwürdige Machtübernahme hat eingesetzt. Wenn ich hier das Wort «Jude» gebrauche, meine ich das eher symbolisch. Eine Generation von Intellektuellen übernimmt die Macht von den «Juden». Ein merkwürdiger Vorgang, den es mit leichter Trauer und großer Hellsicht zu beobachten und dem es sich schleunigst zu entziehen gilt. Auch literarisch. Ja, vor allem literarisch.
Morgendämmerung. Das Geisterhafte der Welt. Als würden keine Menschen, nur Gespenster existieren. Auch ich bin geisterhaft, ich weiß nicht, wessen Geist ich bin, beziehungsweise welche Art von Gesetzen bestimmt, was mein Geisterdasein auf dieser Erde antreibt, was es lenkt.
19. März 2001 Aber was symbolisiert «der Jude»? Offenkundig das «Weite», Weltläufige, den Gegenpol, die Kritik. In Wahrheit ist der «Jude» aber auch Symbol seiner selbst. Zumindest der europäische Jude. Der europäische Jude ist ein Überbleibsel, kein Anachronismus wie das orthodoxe Judentum, bei dem es immer noch um eine Art Befindlichkeit geht. Nein, der europäische Jude ist tatsächlich ein von den anderen definierter Menschentyp, der zu dem ihm aufgezwungenen Judenstatus keinerlei innere Beziehung mehr entwickeln kann. Als Religion mag es vielleicht noch funktionieren, aber dann stellt sich die berechtigte Frage, warum nicht orthodox? Und was bedeutet das «Auf Wiedersehen in Jerusalem» – da doch Jerusalem tatsächlich existiert und die Juden dort leben?
20. März 2001 14 Uhr 26: Nachdem sie lange, lange verschwunden war – so als sei ein musikalisches Thema ausgeblieben –, ist es mir genau in diesem Augenblick gelungen, die sogenannte «Datei» wiederzufinden, und daß mich das mit einem solchen Glücksgefühl erfüllt, macht deutlich, wie tief man sinken kann, wenn man sich der Technik ausliefert. Und damit gehe ich nun zum ersten Mal, seit ich am Computer arbeite, nach einer Seite Text auf die nächste Seite über und habe nicht die leiseste Ahnung, was passieren wird.
Am selben Tag: Diese Zeilen sind ein Dokument meines Ringens mit dem Computer: Als solches erfüllen sie keinen anderen Zweck als den, daß irgend etwas auf der Seite steht. Soviel ist sicher: Der Computer ist eine Denkweise, und nicht eben die erhabenste. Sogar, wenn man so will, eine Sprache, und nicht eben die poetischste.
21. März 2001 Wieder Morgendämmerung, dunkle, regnerische Frühe. Während ich mit Leidenschaft auf dem Laptop lerne, begleitet mich ein Gefühl von Verrat – als würde ich meine geistige Welt verlassen. Wie? Soll es bald von der Elektrizität, von der Stromversorgung und dem Zustand dieses Apparats abhängen, ob ich schreiben, überhaupt denken kann? Er führt mich weit aus der Welt der stillen Meditation heraus, und es wäre gut, mir in dieser Hinsicht Beruhigung zu verschaffen – denn andererseits könnte ich ja mit meiner Parkinson-Hand bald überhaupt nicht mehr schreiben. Man stelle sich vor, Shelley würde seine Gedichte auf dem Computer verfassen: Ist das vorstellbar? Ich denke hier einfach an die Technik, ob einem, wenn man am Computer sitzt und auf seine Tasten hämmert, überhaupt ein guter Vergleich einfallen kann. Doch warum schließlich auch nicht? Man muß den Computer liebhaben, wie Rilke sagen würde. Und wenn ein plötzlicher Stromausfall alles zunichte macht, was ich geschrieben habe? Und wenn ein Schlaganfall es zunichte macht? Das Beispiel ist nicht gut, denn gegen einen Schlaganfall ist man am Computer ja auch nicht gefeit, und der geschriebene Text bliebe erhalten (bloß nicht mehr mir). – Hätte sich Gyula Krúdy über den Computer gefreut? Darüber ließe sich nachdenken. Es ist nicht auszuschließen …
24. März 2001 Ich habe keine großen Träume, keine großen Gedanken. Aber mein Stil ist gut, und was ich begonnen habe – der Roman – strebt nach Vollendung.
26. März 2001 Ich erinnere mich, welche Vorwürfe man mir vor vier Jahren, als Ich – ein anderer erschien, wegen des «düsteren» Bildes machte, das ich von Ungarn gezeichnet hätte; und heute tritt das Gesindel, das den braven Ungarn ein Herdendasein, den Zigeunern die Ausrottung und den Juden die Ausplünderung verspricht, als drittgrößte politische Partei auf, und ihre Führer-Persönlichkeiten sind eine sichere Garantie dafür, daß diese Versprechen eingehalten werden.
27. März 2001 In der Nacht Kunderas geschwätziger Essay über den Roman. All die bekannten Gemeinplätze, aber mit französischer Eloquenz, was das Ganze ein wenig mildert. Unter anderem resümiert Kundera, daß der Roman seit Kafka den von außen beherrschten Menschen darstelle, der keine Chance mehr gegenüber der alles in Besitz nehmenden Macht hat – vertraute Gedanken aus der Zeit des Romans eines Schicksallosen; doch die Frage bleibt: Wenn die Macht totalitär und die Anpassung an sie total ist, für wen stellen wir dann den totalitär beherrschten Menschen dar – genauer, warum stellen wir den totalitär beherrschten Menschen negativ dar, für was für eine rätselhafte Entität, die demnach außerhalb der Totalität bliebe und urteilte, ja – da es um den Roman geht –, sich an dem Werk vergnügen und daraus lernen könnte, mehr noch, die Arbeit des Kritikers verrichten und ästhetische Schußfolgerungen für künftige Werke daraus ziehen sollte? Das Absurde daran ist, daß es, seit Gott tot ist, keinen objektiven Blick gibt, daß wir uns in einem Zustand des panta rhei befinden, daß es keinen Halt mehr gibt und wir dennoch so schreiben, als gebe es ihn, das heißt, als existiere trotz allem ein sub specie aeternitatis, ein göttlicher Standpunkt oder das ewig Menschliche. Wie ist dieses Paradoxon aufzulösen?
28. März 2001 Ich wäre wirklich eine provinzielle und jämmerlich Figur, sollten die Anstrengungen, den Computer zu beherrschen, mich vom Schreiben abhalten.
Im Hinblick darauf, daß es keine Geschlechter unterscheidet, ist das Ungarische wirklich eine unmögliche Sprache. Es wäre interessant, die Gründe zu analysieren – es ist, als sollte dabei irgendein undurchdringliches Geheimnis gewahrt werden. «Ich fragte ihn, ob er sie/ihn/es liebe; nach einigem Nachdenken antwortete er, daß er sie/ihn/es gern lieben würde, aber keine Zeit dazu habe.» Sind zum Beispiel Frauen die Objekte dieses Dialogs und Männer führen ihn, klingt er ganz anders, als wenn von Männern die Rede ist und das Gespräch unter Männern stattfindet.
29. März 2001 Damit du dich nicht täuschst: der Kampf mit dem Computer ist kein luxuriöses Spiel, sondern eine existentielle Frage (wegen meiner rechten Parkinson-Hand); und die bisherige Erfahrung zeigt, daß es kein größeres Vergnügen gibt, als mit der Hand zu schreiben.
30. März 2001 In der Nacht endlich ein Traum – ich erinnere ihn nicht, aber das Auftauchen eines Traums nach langer, langer Zeit, in der ich überhaupt nicht träumte, verspricht vielleicht die Rückkehr zu echter Kreativität. – Zugleich hat sich in dieser Nacht mit merkwürdiger Eindringlichkeit der Einsame von Sodom wieder gemeldet, die erste große Idee oder das erste Thema meiner jungen Jahre – das dionysische Erlebnis, die Selbstaufgabe des freien Individuums im Rausch des Massenrituals; dieses Motiv hat meine ganze spätere Arbeit bestimmt (wenn ich in der Eile so sagen darf), also die Handlung all meiner späteren Romane. Ich entsinne mich noch, wie ich mit einem jungen Mann namens Péter (wir waren beide vielleicht 23 Jahre alt) über die Zivatar-Straße spazierte und ihm, der ebenfalls Schriftsteller werden wollte (es wurde ein schlechter Schriftsteller aus ihm, und er ist jung gestorben), von meiner Idee erzählte, die auf einem alles entscheidenden Grunderlebnis basierte: ein Erlebnis, genauer, eine Erfahrung, die ich während des Militärdienstes gemacht hatte, so, wie ich es Jahrzehnte später in Fiasko beschrieben habe. Die Geschichte des Sodomers Lot aber, wie ich sie mir damals ausgedacht habe, wartet noch immer darauf, geschrieben zu werden. (Zu erwähnen ist, daß mir dieses Motiv in der Zeit meiner Nietzsche-Übertragung von neuem begegnet ist, bei der Beschreibung des apollinischen bzw. dionysischen Griechen; und da mein damaliges Erlebnis einen sehr déjà-vu-artigen Charakter hatte, frage ich mich, ob ich Die Geburt der Tragödie in meinen jungen Jahren nicht schon einmal gelesen habe, natürlich in der archaischen, ungeheuer prägnanten Übersetzung von Lajos Fülep; nun, ich kann mich nicht entsinnen, ob es so gewesen ist, andererseits hat der Text, wie auch Stimmung und Welterleben, die darin eingefangen sind, in mir ein ungewöhnlich heftiges und nostalgisches Gefühl von «Vertrautheit» ausgelöst, als ich die Tragödie übersetzte.)
1. April 2001 Weiter Lektüre des Kundera-Essays; er ist doch sehr inspirierend, es fragt sich bloß, warum die Bücher des Autors so mittelmäßig sind, wenn er doch so klug ist und alles über den Roman weiß. Was mich betrifft: Sobald ich über Romantheorie sprechen soll, aber auch, wenn ich etwas darüber lese, wird mir der Mund so trocken wie ein Schwamm. Das alles ist so überflüssig, alles hängt schließlich ganz entschieden von der Begabung zur plastischen Darstellung ab, davon, ob jemand seine Welt zum Leben erwecken kann oder nicht. Und doch habe auch ich mich in der Zeit des Romans eines Schicksallosen unheimlich viel mit theoretischen Dingen beschäftigt, damals tat mir das irgendwie gut und war für den Roman auch nötig. Jetzt hat sich das alles verändert: Auch für Liquidation ist enorm viel Theorie nötig, sind immense Probleme aufzurollen und zu lösen, aber ich arbeite fast verschämt daran, im stillen, damit es bloß niemand mitkriegt; denn um die Probleme des Romans heute zu erkennen, genügt es wohl kaum zu wissen, daß «der Roman die Erforschung des Seins mit den Mitteln des Romans ist», dazu gehört auch das Wissen, wie obsolet das Erforschen von Seinsfragen heute ist; wie obsolet damit auch der Roman und noch obsoleter der Romancier heute ist.
Das wichtigste Merkmal des «schicksallosen Zustands» ist schließlich das völlige Fehlen einer Beziehung zwischen Existenz und wirklichem Leben. Das existenzlose Dasein, oder eher: das Dasein ohne Existenz – das ist das große Novum der Epoche.
Ich gehöre zu einer Minderheit, die schon immer beschimpft und verfolgt, und schließlich, 1944, zum Tode verurteilt worden ist, und dieses Urteil ist bis heute nicht aufgehoben. Wie interessant, daß ich diesen Satz so viel leichter auf Deutsch als auf Ungarisch niederschreibe. Ich gehöre also zu jener Minderheit, die man zufällig die jüdische oder die Judenheit nennt, was aber nichts mit meinem Judentum zu tun hat, meiner eigenen, persönlichen Bindung an das Judentum – ob ich also darin eingebunden oder herausgelöst aus ihm bin –, und letztlich auch nichts mit dem eigentlichen Judentum selbst, falls es so etwas überhaupt gibt. – Andererseits, wenn ich die Entwicklungen der letzten zehn Jahre in Betracht ziehe, seit Ungarn ein freier und sogenannter demokratischer Staat ist, und daß im Lauf dieser zehn Jahre das «Judentum» nicht nur noch mehr ausgegrenzt, sondern daß auch noch offenkundiger geworden ist, daß die «Nation» keinen Anspruch auf meine Erfahrungen, meine schriftstellerischen Erzeugnisse erhebt: angesichts dieser Entwicklung kann ich keinerlei nationale Solidarität mit dem sogenannten «Ungarntum» entwickeln, das heißt, ich habe keine ungarische Identität, ich fühle und denke nicht im Einklang mit der desperaten ungarischen Ideologie. Und das ist auch deshalb traurig, weil es letztlich das antisemitische Vorurteil bestätigt, daß die sogenannten Juden sich für die sogenannten Ungarn nicht interessieren. Alles ist Lüge und Betrug auf diesem semantischen Feld, kein Wort, kein einziger Begriff hat einen realen, klar artikulierbaren Sinn. Auf diesem Gebiet existiert überhaupt kein Sinn, nur Affekt, Romantik und Sentimentalität, lauter subjektive Empfindlichkeiten: Ist es nicht seltsam, daß eine Nation die Einschätzung ihrer Situation und ihrer Realität, ihr nationales und geschichtliches Bewußtsein auf diese Irrealitäten gründet?
7. April 2001 Ich kann meine von Gott verliehene Einsamkeit nicht schützen. Vielleicht ist damit das Debakel benannt, das mich in kritischen Momenten so quält.
9. April 2001 Heute nacht hatte ich folgenden Wunschtraum: Ich erwachte im Traum (während ich weiterschlief) von einer Leibesvisitation in meiner Lendengegend, die irgendeine angenehme Überraschung verhieß. Einen Moment später wurde ich gewahr, daß ich eine Erektion hatte und mein Penis (wie ich feststellte) seine ursprüngliche Größe und Härte vollständig wiedererlangt zu haben schien; das so lange vermißte Glied, mein einstiger Besitz, reckte sich jetzt wieder triumphierend auf, war größer und härter als je, und ich streichelte es zufrieden (aber nicht so, wie man zu masturbieren beginnt, eher mit der berechtigten Freude des Besitzers); so viel war passiert, als ich in Wirklichkeit erwachte. – Je mehr ich darüber nachdenke, um so klarer scheint mir das ein im Grunde symbolischer Traum zu sein; M. und ich hatten am Vormittag über Mozart gesprochen, M. hatte darauf hingewiesen, wieviel Erotik in seiner Musik stecke, und wir kamen darauf, daß jedes große Werk letztlich erotisch sei; ich fügte noch an, daß es, wenn einem bei einem gelungenen Kunstwerk endgültig die Worte ausgehen, üblich sei, «geil!» zu sagen – und das sage viel mehr aus als das viele ästhetische Geplapper, ja, es sage sogar alles. – Vielleicht ist mein verheißungsvoller Traum eine Ermutigung für den Roman und bedeutet, daß der Roman «geil» wird.
11. April 2001 Wie und für wen soll man schreiben? «Monsieur Leuwen senior, einer der Teilhaber des berühmten Hauses Van Peters, Leuwen & Co., fürchtete auf der Welt nur zwei Dinge: langweilige Leute und feuchtes Wetter» – Stendhal. Das Vorwort, in dem er sein Buch wie gewohnt der Aufmerksamkeit «seiner kleinen Leserschar» empfiehlt, mündet mit einer überraschenden Volte in den Satz: «Sei darauf bedacht, dein Leben nicht in Haß und Furcht zu verbringen.» (Das könntest du dir als Motto über dein Leben schreiben.)
«Die Mehrheit liebt ganz augenscheinlich dieses süßliche Gemisch aus Heuchelei und Lüge, das man eine parlamentarische Regierung nennt» – Lucien Leuwen. – Übrigens hat Ligeti mir Stendhal empfohlen. Eine Zeitlang habe ich diesen Autor sehr geliebt; später glaubte ich, die Modernen seien interessanter. – Nicht sicher, ob ich recht hatte. Von wem habe ich am meisten gelernt? Ich glaube, von Thomas Mann (Entschlossenheit und schriftstellerische Haltung, Fleiß und Würde, und nicht zu vergessen: Bildung) sowie von Camus (die unerbittliche Treue zu einem bestimmten Stoff als dem einzig möglichen). Seither habe ich kaum noch einen von ihnen gelesen. – Nebenbei gesagt war Stendhal modern. «Jede Kunst ist neue Kunst.»
12. April 2001 Unmutig warte ich auf den Augenblick, da sich zweifelsfrei herausstellen wird, wie verdorben mein Stil und wie heruntergekommen mein Geist ist, seit ich auf dem Computer schreibe. Und wieviel geschwätziger ich geworden bin.
Dem letzten Tagebuchroman sollte ich den Titel «Endspiel in der Bar Zum sicheren Verlierer» geben.
16. April 2001 Jeden Tag den schon vorhandenen Text des Romans wieder lesen, um abzusehen, was ich noch vor mir habe. – Der Perspektivwechsel bei ein und demselben Stoff: anscheinend ist es das, was mich am meisten interessiert. Oder bin ich vielleicht so phantasielos, daß ich keinen neuen Stoff habe? Über dergleichen zerbreche ich mir nie den Kopf, ich arbeite immer mit dem, was ich habe. Dies nun wird ein Satyrspiel zu Kaddisch (das Wort Satyrspiel dabei von Thomas Mann entliehen). Darüber hinaus aber ist es hauptsächlich (auch) etwas anders: ein großer Roman (in kleiner Form) über den Bankrott dieses Landes. – Ich muß gestehen, daß ich daraus meinen Stoff schöpfe, aus dieser Brühe, diesem Sumpf, diesem Land, in dem ich lebe – wobei der Stoff nicht soziologischer oder ähnlicher Natur ist, vielmehr dem Charakter nach eine geistige Projektion seiner Gesetze (meinetwegen: seiner Existenzgesetze). Andererseits aber auch der Geschichte dieses Landes. Ein Tagebuch-Schreiben über dieses Land, was sich sehr von Geschichtsschreibung unterscheidet – ein Wort Kafkas, von dem sich stets herausstellt, daß er nicht nur «kafkaesk» ist; er wußte auch eine ganz andere Sprache zu sprechen, hätte man ihn nur erhört.
Diese Aufzeichnungen unterscheiden sich ganz und gar von meinen früheren Tagebüchern. Ich würde gern herausfinden, warum ich heute so viel platter schreibe. Möglich, daß die Welt, in der ich lebe, einfach nüchterner ist, es gibt nichts Metaphysisches mehr in ihr oder – um den Bedürfnissen dieser Welt Genüge zu tun – keinen metaphysischen Anspruch. Es gibt keine Rätsel mehr, nur einfaches materielles und geistiges Elend, historische Rückständigkeit, Herdendasein, politische Selbstaufgabe. All das ist nicht mehr das Werk äußerer Umstände, sondern Faktum, Ergebnis des eigenen, selbständigen und unabhängigen Handelns der ungarischen Gesellschaft. Und auf die Frage, was ich damit zu tun habe, muß ich die Antwort als Citoyen suchen, denn dem Anschein nach bin ich Bürger eines freien und unabhängigen Landes, während meine Erfahrungen von etwas ganz anderem Zeugnis geben. Eine schwierige Frage, auf die einzig die Emigration eine relevante und eindeutige Antwort wäre. – Aber auch Emigrieren ist platt.
17. April 2001 Es wäre endlich an der Zeit zu definieren, was für ein Schriftsteller ich eigentlich bin, direkt ausgedrückt, für wen ich eigentlich schreibe. Noch vor zwei, drei Jahrzehnten hätte ich die Fragestellung für grundverkehrt gehalten. Für wen ich schreibe? Natürlich für mich selbst – hätte die Antwort gelautet und lautet sie im wesentlichen auch heute noch. Doch neige ich heute eher zu der Einsicht, daß bei diesem «Selbst» – seinem Zustandekommen – die gesellschaftlichen Verhältnisse wohl doch eine gewisse Rolle gespielt haben. Zumindest zum Teil bin ich Gefangener dieser Lebensumstände, und das bezieht sich auch auf meine geistigen Äußerungen. Wenn ich sage, ich bin ein jüdischer Schriftsteller (denn diese Tatsache drückt meinen Lebensumständen doch am ehesten ihren Stempel auf), dann sage ich damit nicht, daß ich Jude bin – denn das kann ich meiner Kultur, meinen Überzeugungen nach leider nicht sagen. Doch ich kann sagen, daß ich Schriftsteller einer anachronistischen jüdischen Lebensform bin, des Galut, der Lebensform der assimilierten Juden, Träger und Darsteller dieser Lebensform, Chronist ihrer Liquidation, Bote ihres unabwendbaren Untergangs. In dieser Hinsicht spielt die «Endlösung» eine entscheidende Rolle: Jemand, dem sich jüdische Identität allein durch den Versuch der Judenvernichtung, also Auschwitz herstellt, läßt sich in gewissem Sinn doch nicht als Jude bezeichnen. Er ist der «nichtjüdische Jude», von dem Deutscher spricht, dessen entwurzelte europäische Variante; er erfüllt eine große – und vielleicht wichtige – Rolle in der europäischen Kultur (sofern es eine solche noch gibt), in der neueren Epoche der Geschichte des Judentums aber, bei der Erneuerung des Judentums überhaupt – und hier muß ich wieder hinzusetzen: sofern es eine solche gibt, beziehungsweise falls es sie geben wird – spielt er überhaupt keine Rolle.
«Jude» ist nur für den Antisemiten eine eindeutige Kategorie.
18. April 2001 Stillstand beim Roman. Zum Teil wegen des Lernprozesses am Laptop; damit war zu rechnen. Hauptsächlich aber: Ich habe den Faden verloren. Nun ist von neuem zu klären, wovon genau der Roman handelt. Vorsicht: nicht von Keserű. Der versteckte Erzähler des Romans ist B., der Stückeschreiber; der Selbstmord und alles, was in dessen Folge geschieht, ist seine Konstruktion, so wie auch Keserű, der Katalysator, seine Konstruktion (bzw. Fiktion) ist: Also kann Keserű niemals eine reale, eigengesetzliche Figur sein!
19. April 2001 Mein Roman als ein spätes Kind, verwöhnt und fragil; er erweckt in seinem alten Vater ungeheure Ängste. Macht sämtliche Kinderkrankheiten durch, und die ständige Sorge ist, wieviel hält seine Vitalität aus. Es würde mich nicht wundern, wenn ich ihn eines Morgens tot auffände. Aber ich wäre untröstlich …
Koestler zähle ich in einem gewissen Sinne zu meinen geistigen Verwandten, wie all jene, die ihr Verantwortungsgefühl für die Welt verführt, auf Irrwege geleitet und heimatlos gemacht hat, bis sie schließlich in der Heimatlosigkeit ihre Ruhe, sogar ihre Berufung fanden. Der Zusammenbruch Europas in den dreißiger Jahren war ein Schauspiel, an das die Welt noch lange denken wird, und wenn ich Koestler lese, schlage ich nicht seine Romane auf, sondern jene erschütternden Dokumente, die er als Zeuge des Jahrhunderts über den Zerfall der bürgerlichen Existenz, sein Enttäuschung von der kommunistischen Bewegung, seine Flucht und seine Internierung in Frankreich geschrieben hat.
20. April 2001 Abgrundtiefe Müdigkeit. Seit Wochen bin ich nicht in jenen Moment des Schöpferischen eingetreten, in jenen plötzlichen (und wundervollen) Rausch von Glück, der mich vordem so häufig heimgesucht hat. Depressionen. Schlaflosigkeit. Jüdische Mystik von György Tatár; das einzige, was momentan mein Interesse weckt: Ich gerate beinahe wieder ins Denken, was derzeit eine ungewöhnliche Tätigkeit bei mir ist.
21. April 2001 Heute, am Samstagvormittag, bin ich zu der keineswegs erheiternden Feststellung gekommen, daß ich alles, was ich bis jetzt von dem Roman geschrieben habe, den Roman überhaupt, so, wie er ist, wegwerfen muß. Damit mache ich meiner seit elf Jahren gehegten Illusion ein Ende. Vielleicht noch nicht endgültig. Aber was soll ich tun, wenn dieser Stoff weder als Theaterstück noch als Roman noch sonst irgendwie zulassen will, daß ich ihn schreibe?
22. April 2001 Ich muß entscheiden, ist der Roman notwendig? Ist es ein Beweis seiner Notwendigkeit, daß ich mich schon fast elf Jahre damit beschäftige? Ist es ein Beweis seiner Notwendigkeit, daß ich diese Arbeit als Abschluß meiner gesamten Arbeit, als ihre Krönung betrachte? Könnte es nicht sein, daß ich eine Geschichte erzählen will, die nicht zu erzählen ist oder die ich nicht erzählen kann? Wie sieht diese Geschichte aus, und warum will ich sie erzählen? Etwa aus Eitelkeit, also nur, um noch einen Roman zu schreiben, egal was für einen? Die Frage ist falsch, denn der Ehrgeiz, noch einen Roman zu schreiben, ist nicht falsch, es ist der absolut legitime Ehrgeiz eines jeden Schriftstellers, eines jeden Künstlers, der noch nicht den Wunsch hat, in den Ruhestand zu treten.
Wie also sieht die Geschichte aus?
1) B., der Schriftsteller, Medium von Auschwitz, zerstört im Zeichen von Auschwitz sein eigenes Leben und das Leben seiner Frau; er erkennt, was er getan hat, und schreibt ihrer beider Geschichte nieder, um gewissermaßen Buße zu tun und Läuterung zu bewirken; das Geschriebene – nehmen wir an, einen Roman mit dem Titel Kaddisch – übergibt er seiner früheren Frau, als Erklärung und zu ihrer Aufklärung, und fordert sie auf, das Manuskript zu verbrennen, gleichsam als Brandopfer und als Lossprechung und Befreiung der Frau von Auschwitz; zugleich als Zeichen der Liebe, seiner Liebe zu ihr; er selbst begeht Selbstmord – nicht deswegen, sondern wegen des vollkommenen Scheiterns seines eigenen Lebens und seiner Zukunftslosigkeit. – Soweit die Geschichte, die sich nicht linear und ohne Perspektivwechsel darstellen läßt.
2) Also haben wir Keserű, eine Vermittlerfigur erfunden, B.s früherer Freund, Verlagslektor und einstiger Liebhaber von B.s ehemaliger Frau – ein Mensch der Papiere, der B.s Nachlaß herausgeben will. Aus im Nachlaß (und anderswo) entdeckten Hinweisen schließt Keserű, daß in diesem Nachlaß ein Roman fehlt; seine Nachforschungen führen ihn zu B.s früherer Frau, Judit, von der er – mittels Erpressung und anderer feinsinniger Methoden – die Geschichte erfährt; überdies gehört dieser Keserű zu den typischen intellektuellen Verlierern der «neuen Zeit», ausgebrannt, jenseits aller Leidenschaft, allen Ehrgeizes – überhaupt aller Zukunft; die Geschichte, die ja gleichzeitig auch seine Geschichte ist, ja, deren Abschluß gleichzeitig auch der Abschluß seiner Lebensgeschichte ist, ist für Keserű unbegreiflich. Seine Darstellung kann daher a) tragisch und b) komisch sein – naturgemäß ziehen wir letzteres vor.
3) Um die Komik seines Charakters noch stärker zu betonen, haben wir uns ein im Nachlaß gefundenes Theaterstück ausgedacht. Dieses Stück hatte der Erzähler in der spielerischen Absicht verfaßt, zu prüfen, wie es wäre, wenn sich die Geschichte wirklich so zugetragen hätte, d.h. wenn es eine wahre Geschichte wäre.
4) Nun also: die ganze Geschichte ist keine wahre Geschichte, die Figur des Keserű ist eine vom Erzähler, B., erdachte Figur; die Geschichte und sämtliche handelnden Personen sind Fiktion, der allein wirkliche B., der Erzähler, hat die Geschichte erdacht und erfunden und stellt sie sich in der Gattung der Komödie vor.
So sollte die Geschichte aussehen, das wäre der Roman, der gar nicht so kompliziert ist, wie es hier erscheint, man brauchte nur ein bißchen Begabung, um sie niederzuschreiben. Verfüge ich noch über diese Begabung, besitze ich die Begabung zur plastischen Darstellung noch, oder habe ich sie völlig ausgeschöpft? Oder kann es sein, daß ich tatsächlich nur zu autobiographischen Schreibereien fähig bin, die Gabe für Fiktion mir fehlt? Das ist deshalb nicht sehr wahrscheinlich, weil ja sowohl die Detektivgeschichte als auch Kaddisch reine Fiktion sind. – Soweit genug für heute.
23. April 2001 Gestern Lesung auf einer jüdischen Veranstaltung (den Namen der Organisation habe ich nicht behalten). Das letzte Kapitel aus dem Roman eines Schicksallosen. Die Kraft und (wie es scheint) ewige Aktualität des Textes packten mich. – Danach ein «Podiumsgespräch» vor Publikum. Ich war sehr scharf (politisch), was sonst nicht meine Art ist. Doch ich bin inzwischen so angewidert, daß es guttat, mich zu erleichtern. M. war ein bißchen erschrocken. Nun, wenn Spitzel im Saal waren – und warum sollten sie wohl nicht da gewesen sein –, fanden sie reichlich zu berichten. – Ein paar (nicht) paranoide Bemerkungen: Man zieht (zöge am liebsten) eine Mauer um mich. Die sogenannten Listen (schon darüber zu sprechen ist eine Schande: Man übergeht mich auf der Autorenliste zum französisch-ungarischen Kulturjahr, nach französischem Protest wird mein Name aufgenommen – genau nach dem üblichen Verfahrensmuster der Kádar-Zeit; letztlich denke ich natürlich nicht im Traum daran, ein staatliches Flugticket anzunehmen, lieber fahre ich nicht). – Ich könnte noch eine Reihe staatlich inspirierter Beschimpfungen in verschiedenen staatlich inspirierten Presseorganen und Radioprogrammen aufzählen. Zwar interessieren sie mich nicht sonderlich, aber ein «Connaisseur» der Diktaturen, wie ich einer bin, weiß genau, wie derartige Phänomene einzuschätzen sind (vor allem so, daß wieder eine Diktatur im Anzug ist). In dieser Hinsicht muß man das Schreiben mit dem Computer beinahe fürchten, weil das Gerät eher Bestand hat als zerreißbares Papier; und wer wollte wegen etwas wie einer ungewissen Lebensgefahr schon seinen Computer zu Boden schmettern. Übrigens eine interessante Feststellung, daß es noch keine veritable Diktatur gegeben hat, zumindest nicht in Europa, seit Computer im allgemeinen und privaten Gebrauch sind. Aber wie für alles würde man sicher auch dafür eine radikale Lösung finden, zum Beispiel die Computer verbieten – sie wären in den Läden einfach nicht mehr zu kriegen.
24. April 2001 «Aus den Aufzeichnungen eines katholischen Ungarn» … Aber lieber Freund! Sollte Ihnen noch nicht zu Ohren gekommen sein, daß das Judentum und alle seine ketzerischen Abspaltungen (so das Christentum, vom Katholizismus ganz zu schweigen) vergangen, aufgelöst, absorbiert sind und man uns, die einstigen Gläubigen, hier allein gelassen hat?! Sollten Sie, mein lieber katholischer ungarischer Freund, der Sie sich von Ihrer katholischen Kirche wünschten, daß sie die Zigeuner als unsere Brüder und Schwestern betrachtet und das von der Kanzel verkündet: sollten Sie die Geschichte der Kirche, Ihrer katholischen Kirche nicht kennen? Sollten Sie die lange Reihe von Penitenzen, Ausgrenzungen, Verfolgungen, der physischen und geistigen Inquisitionen nicht kennen, deren Endergebnis die Vernichtung der europäischen Juden war? Sollten Sie nicht wissen, daß die Nazi-Behörden jede einzelne Etappe, alle Gesetze und sämtliche Verordnungen dieses Prozesses, vom gelben Stern bis hin zur institutionalisierten gesellschaftlichen Ausgrenzung und Absonderung (sie nannten es Ghetto, mein Freund), von der katholischen Kirche übernommen haben und ihre Neuerung (an Stelle von Scheiterhaufen und Pogrom) «lediglich» die Gaskammer von Auschwitz war? Sollten Sie nicht wissen, daß die Bischöfe Ihrer Kirche im ungarischen Parlament für die ungarischen Judengesetze stimmten? Sollten Sie sich nicht im klaren darüber sein, daß die katholische Kirche (wie im übrigen auch die Juden und alle anderen) vierzig Jahre lang total mit den kommunistischen Behörden kollaboriert hat und diejenigen katholischen Priester, die ihre Berufung womöglich ernst nahmen und im Sinne ihrer Weihe handelten, der Polizei auslieferte? Sollten Sie nicht wissen, daß dieser «hinfällige Mensch», dieser Astralleib, Ihr Papst, sozusagen um Verzeihung «für den Holocaust» gebeten hat, daß das Lamm Gottes aber die Schuld nicht auf sich nahm?
Da geschah die Entgleisung, mein lieber katholischer Freund; da war die große Gelegenheit, die die Möglichkeit zu Erneuerung und Läuterung barg, wozu die Kirche aber, einfach aus politischen Gründen, nicht imstande war. Damit war sie auch nicht imstande, Ihre Kirche und das Christentum zu retten. Was bedeutet Christentum heute? Wenn wir bei Ungarn bleiben: eine leere, politische Formel. Wenn wir weiter schauen: die zerstörte europäische Kultur. Täuschen wir uns nicht: die offiziellen, institutionalisierten Glaubensformeln sind ausgehöhlt – das betrifft jeden Glauben, alle Kirchen und religiösen Gemeinden gleichermaßen. Es könnte ja sein, es wird noch einmal eine heilige Teresa von Ávila, einen heiligen Johannes der Täufer usw. geben, die mit ihrem Glauben den Glauben erneuern; aber darauf sollten wir nicht allzusehr hoffen. Sicher aber können wir sein, daß vom Herrn Kardinal Paskai die Auferstehung nicht zu erwarten ist. Und ein Katholik, der die Auferstehung seiner Kirche wünscht, kommt nicht weit, wenn er seine schönen Wünsche nur zum Ausdruck bringt: Er muß sein Leben daransetzen, durch eine minder glaubwürdige Tat ist gar nichts zu erreichen, es wäre nur ein Rufen in der Wüste, ein gutgemeinter pädagogischer Artikel in Élet és Irodalom, zu dem die Besseren kräftig nicken, die Bösen die Zähne fletschen und den am nächsten Tag alle vergessen haben.
Langsam entfaltet sich doch die ganze Größe der Geschichte (Liquidation). Das Erzählen der Geschichte ist zugleich die Zurücknahme der Geschichte. Irgendwo am Ende wird wiederholt: «Nennen wir unseren Mann, den Helden dieser Geschichte, Kerserű …» usw. – Kerserű revoltiert gegen seine Geschichte.
27. April 2001 Seit Wochen anhaltende Depressionen. Ich lebe außerhalb des Romans. Jeden Tag Abendessen in Gesellschaft, mit Fremden. Der größere Teil meines Lebens ist eine tief empfundene sinnlose Zeitvergeudung. Ich bin unfähig, mich dem zu erwehren. Meine Schwäche M. gegenüber. Die physischen Demütigungen des Alters. Das Alter – das hätte ich nie gedacht – setzt schlagartig ein. Von einem Tag, fast von einem Moment auf den anderen. Plötzlich verändert sich deine Körperhaltung, und du kannst nichts dagegen tun. Plötzlich überkommt dich anfallartiger Harndrang, dem du innerhalb von Sekunden nachgeben mußt, sonst beschmutzt du dir in demütigender Weise die Wäsche. Der größte Schlag aber ist die Impotenz, wenn du das Interesse an Frauen noch keineswegs verloren hast. Der andere Schlag ist die Schlaflosigkeit. Im Moment ist es drei Uhr zweiundvierzig, und ich habe noch kein Auge zugetan. Morgen früh muß ich vor «großem Publikum» spanische Schriftsteller vorstellen, die ich nicht kenne, und Spanisch spreche ich nicht, ich werde mich durch totale Inkompetenz auszeichnen; macht nichts, die ganze Epoche, in der wir leben, ist inkompetent.
Etwas anderes: Warum kann ich die erste Ohrfeige, die ich von meinem Vater zur Strafe erhielt, nicht vergessen? Es passierte an einem Mittag im Internat, im Schlafsaal der Anstalt, in dem sich außer uns beiden niemand aufhielt. Mein Vater hatte irgendwann gesagt, wenn ich hungrig sei, solle ich beim Lebensmittelhändler an der Ecke – er hieß Ács, sein Laden lag in der Szondi-Straße/Ecke Mihály-Munkácsi-Straße, ein Kellergeschäft – anschreiben lassen und mir auf Kredit etwas zusätzlich kaufen. Ich aß die ganze Woche Buttersemmeln mit Salami. Es ist denkbar, daß mein Vater einen Haufen Geld dafür bezahlen mußte (wieviel kann es schon gewesen sein?). Aber egal, mein Vater war nun einmal arm und betrachtete meine Salami-Esserei offenbar als eine Art Exzeß.
Aber er machte nicht viele Worte zur Rechtfertigung. Er hatte sich offensichtlich für eine demonstrative Tat entschieden, eine schallende Ohrfeige. Die abseitige Ecke, wo der Akt geschah, und die körperliche Überlegenheit, der ich ausgeliefert war, zwangen mich zu lautem Gebrüll. Psychisch war es ein vernichtendes Ereignis. Ich war vielleicht neun Jahre alt. Erst mit großem Zeitabstand, wenn ich das Ereignis lange genug betrachte, verspüre ich so etwas wie einen befreienden Zug. So, wie Flaubert Maupassant einmal riet, einen Baum so lange anzuschauen, bis er ihn anders sähe als die übrigen und seine unvergleichliche Einzigartigkeit erkenne.
27. April 2001 Die Spanier. Geschafft; vier Schriftsteller, drei von ihnen sehr sympathisch, besonders Señor Mendoza. Anschließend Thunfischsalat auf der Terrasse des Cafés Belváros. Strahlender Frühling. Ich genieße es, mir jetzt leisten zu können, was ich mir vor vielen Jahrzehnten, als ich mit meinen Freunden noch auf der Terrasse des Bristol saß, nicht leisten konnte. Damals waren die sogenannten «überbackenen Makkaroni» die große Verlockung, der ich nie nachgeben konnte, weil ich kein Geld hatte. Tröstet es mich, daß ich wenigstens jung war? Als wirklichen Trost empfinde ich es nicht. Ich bin lieber alt und habe ein bißchen Geld in der Tasche. Aber das nur nebenbei. Gegen vier kam ich nach Hause, ziemlich erschöpft, und mit einem Mal, hoppla-hopp, war plötzlich die Fortsetzung des Romans da, dort, wo ich steckengeblieben war. Ich setzte mich an den Computer und arbeitete bis abends um acht; ich glaube, der Zusammenhang ist wiederhergestellt, der Roman ist gerettet. Und – komisch, das hätte ich nie geglaubt – es tat gut, auf dem Computer zu schreiben. Intim und elegant. Zumindest auf meinem schönen kleinen schwarzen Laptop, der wie ein schlankes, fügsames Mädchen ist.
28. April 2001 Gestern abend Strindberg. Ich würde so gern seine Prosa haben, aber sie ist nicht zugänglich, jedenfalls nicht auf Ungarisch. Frauen und Männer; böse Einsichten in die Psyche – Einsichten sind überhaupt immer böse. Aber was wollen wir, Takt ist das Höchste, was wir in der Beziehung von Mensch zu Mensch erreichen können. Und die Liebe, könntest du fragen. Ja, aber auch die Liebe ist mit Takt zu behandeln. – Das wiederum ist nicht immer und nicht jedem möglich.
29. April 2001 Wegen des neuen Romans in Kaddisch lesend, verblüfft mich die Aufrichtigkeit der Todessehnsucht, die der Urgrund, der Spiritus rector dieses kleinen Romans war. Und auf einmal erinnerte ich mich auch wieder an die triste Stimmung jener Jahre, in der aber doch soviel Spannung steckte, daß es für das Zustandekommen eines Romans wie Kaddisch reichte.
Seit neuestem gewöhne ich mich an Schlaftabletten. Fast habe ich deswegen Gewissensbisse: Um des guten Schlafes willen, könnte man sagen, arbeite ich nicht richtig. Ich nehme sie auf Pump. Heute morgen erzählte M., mein linker Arm habe eine halbe Stunde lang gezuckt, nachdem ich nachts eingeschlafen war. Ich habe keinerlei Erinnerung daran und habe auch nichts geträumt. Vielleicht wird mein Tod von Symptomen des Veitstanzes begleitet sein: das wird amüsant – aber nicht für die anderen. Ich hingegen werde kaum mehr in der Lage sein, mitten im Todeskampf noch zu lachen.
1. Mai 2001 Eheleben und Schreiben: ein Paradebeispiel für zwei nicht miteinander zu vereinbarende Lebensformen. Eine ewige Quelle von Gewissensbissen (falls man noch nicht völlig blind vor dem eigenen Egoismus ist).
2. Mai 2001 Wenn es den allwissenden Erzähler nun einmal nicht mehr gibt. Und wir es dennoch mit Allwissenheit zu tun haben, weil wir uns in der dritten Person bewegen … Vielleicht ist es mir doch gelungen, wenn auch nicht die, so doch wenigstens eine Lösung zu finden: Existenzgrundlage für den Roman ist ein Theaterstück. Die Wirklichkeit des Werkes ist ein anderes Werk. Hinzu kommt, daß wir dieses andere Werk – das Theaterstück – nicht in Gänze kennen. Es ist für uns genauso dunkel wie die Schöpfung, die uns umgebende Wirklichkeit, dunkel für uns ist. Und genauso fragmentarisch; in gewissem Maße aber dennoch durchschaubar, da wir ja nach einer uns gemäßen Logik leben.
5. Mai 2001 Die erste Sequenz des Romans steht. Verrückte Tage. Erregtheit, Schlaflosigkeit bis hin zu Herzbeschwerden; Schlaftabletten. Computer-Freuden. Computer-Aufregungen. Der manchmal halbe Tage beanspruchende Kampf mit den Seiten; andererseits, wenn ich das gleiche mit der Maschine tippen müßte, würde es Tage dauern. Letzten Endes mag ich den Computer («habe ich ihn lieb»?!) – wer hätte das wohl gedacht? Den erniedrigenden Kampf mit der Technik als Freude aufzufassen, weil ich ihn schließlich noch gewinne – wie beschämend. Aber noch beschämender wäre es, mit meiner Parkinson-Hand zu kämpfen und den Kampf, ob ich meine eigene Schrift lesen kann, schließlich aufzugeben, denn da kann ich nur verlieren, und diese Niederlage wäre – weil ich ja letztlich mit dem Tod kämpfe, wenn ich mit der Parkinson-Krankheit kämpfe – eine tödliche Niederlage.
7. Mai 2001 Eine Aussage ist nur deshalb, weil sie für dich vorteilhaft sein kann, noch nicht wahr. Wenn du gerecht sein willst, mußt du also alle Aussagen, die nachteilig, eventuell sogar schädlich für dich sind, gründlich prüfen. – Fragen kommen auf, etwa: Ist zum Beispiel die Krankheit eine Aussage? Und wenn ja, wer sagt damit was aus? (Und so weiter bis zur Absurdität, oder vielleicht: ins Absurde.)
Gestern eine Dame (auf Deutsch): «Ich lese Ihr Galeerentagebuch. Es ist wie ein Gebetbuch.» – Bis jetzt das schönste Kompliment, das mir für dieses Buch gemacht worden ist. Die Dame war übrigens katholisch (und, denke ich, gläubig). – Dann das Konzert (in der Musikakademie); ein ungewöhnlicher Dirigent, Davies, ein Amerikaner: Er hatte die Musik einfach auf die Spitze seines Stäbchen gesteckt. Sowie er es ein wenig hob, senkte oder schwingen ließ, hob oder senkte sich oder schwang die Musik – nie bewegte dieser Stab sich leer, ohne Bedeutung.
11. Mai 2001 Ungarn: Antisemitismus als einziger Konsens des herrschenden rechten Lagers. Das Ganze ähnelt auf lachhafte Weise den dreißiger Jahren. Da hatte sich der Antisemitismus mit Irredentismus assoziiert, der zwar auch jetzt noch vorhanden ist, aber – mit Rücksicht auf das westliche Ausland – immer unterschwelliger. Es ist nicht ausgeschlossen, daß es schließlich mit dem Antisemitismus genauso gehen wird. Warum erfüllt mich diese Möglichkeit nicht mit dem gleichen beispiellosen Optimismus, wie er für die hiesigen Assimilierten charakteristisch ist? In erster Linie, weil bis dahin irreparable Schäden im Sprachgebrauch, also in der Denkweise und der Mentalität angerichtet sein werden; außerdem hat man mir die Solidarität mit diesem Land so weit ausgetrieben, daß mich jede Gefahr und jede Chance, die hier bestehen, gleichermaßen mit Ekel erfüllen.
M.s morgendliche Berichte darüber, was ich unter dem Einfluß der Schlaftabletten anstelle. Heute bin ich bei Tagesanbruch aus dem Bett gefallen (ich hatte am Rand des Bettes geschlafen und mich nach außen gedreht – daran erinnere ich mich noch irgendwie). Die Ärmste mußte sich dann lange plagen, um mich wieder hochzukriegen und ins Bett zu packen. Dabei soll ich Dinge gesagt haben wie: Gyula Krúdy – auf solche Autoren stürzen sich die ausländischen Verlage. Und M., beschwichtigend: «Das werde ich schon machen!» Dann bekam ich einen Niesanfall, zerriß Taschentücher, streckte den Arm in die Höhe und so weiter. Und während meine Frau mir fürchterliche Dinge in Aussicht stellte und vollkommen verzweifelt war, wurde ich von einem unbezwingbaren Lachkrampf gepackt. Es scheint, die Schlaftabletten rufen bei mir Symptome von Trunkenheit hervor, und betrunken bin ich anscheinend ein lustiger Bursche; zumindest tritt in diesen Berichten nie ein latent schlechter Charakter oder ein unangenehmer Wesenszug hervor. Das ist jedenfalls eine bessere Nachricht, als es das Gegenteil wäre; es scheint, ich bin nur nüchtern mürrisch und des öfteren unannehmbar.
13. Mai 2001 Nietzsche: Ein verheirateter Philosoph gehört in die Komödie. Das philosophische Dilemma: Dann stellen wir also das Denken am Wochenende ein?
15. Mai 2001 Die «Geheimdatei» gelesen: Fürwahr, hier gibt es keinerlei Geheimnisse. Wo ist mein Radikalismus geblieben? Ich würde verzweifeln, wenn ich nicht wüßte, daß er im Roman noch vorhanden ist.
Einem dummen, verleumderischen Artikel zufolge soll ich einer holländischen Zeitung gesagt haben, «ich lebe nicht aus Überzeugung hier, mein Koffer ist immer gepackt». Daß ich nicht «aus Überzeugung hier lebe»? Einen solchen Unsinn habe ich mit Sicherheit nicht gesagt. Man lebt nur an sehr wenigen Orten gewissermaßen aus Überzeugung. Sagen wir, unter den Israelis leben viele wirklich aus Überzeugung in Israel. Aber in Ungarn? Hier wird man zufällig geboren und bleibt dann entweder am Leben oder nicht. Von Überzeugung kann keine Rede sein.
16. Mai 2001 Gestern abend Zusammenbruch (beim Lesen des fertigen Romanteils). Nach meinem Empfinden ist alles verfehlt, der Text rattert so leer dahin wie eine kaputte Dreschmaschine, die man erst gar nicht mehr mit Getreide füllt. – Andererseits die Erleichterung, die stets mit einem solchen Urteil einhergeht; diesmal ist in dieser Erleichterung aber auch etwas davon zu spüren, daß das Urteil vielleicht noch nicht endgültig ist.