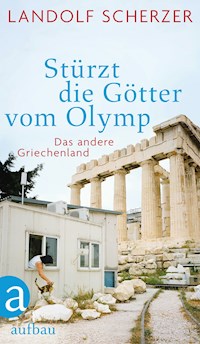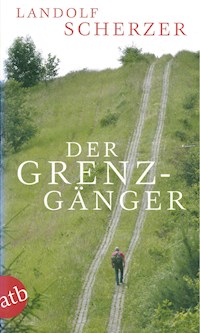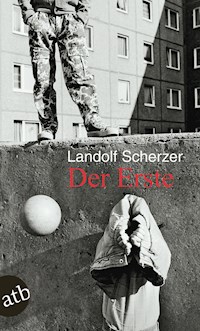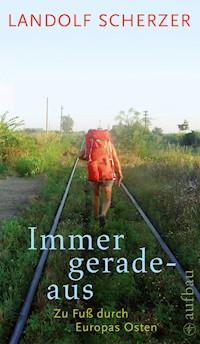8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Das Abenteuer Realität
Mit diesen drei Reportagen beweist Landolf Scherzer erneut sein Gespür für brisante Themen: Zweimal versuchte er, in die gesperrte Zone um Tschernobyl zu kommen. In einer „Tafel“ für Bedürftige erfuhr er, wie rasch man im Kreislauf von Arbeitslosigkeit, Hartz IV und sozialer Ausgrenzung landet, und zwanzig Jahre nach der Wende spürte er einstige „Helden der Arbeit“ auf.
„Der Meister der literarischen Reportage.“ NEUE PRESSE COBURG
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Landolf Scherzer
Letzte Helden
Reportagen
Impressum
Die Recherche für die Reportage »Die Tafel oder ›Jesus‹ und die Speisung der Armen« wurde durch ein Stipendium der Kulturstiftung des Freistaates Thüringen gefördert.
ISBN 978-3-8412-0034-1
Aufbau Digital,veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, Oktober 2010© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2010
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Umschlaggestaltung morgen, Kai Dieterichunter Verwendung eines Fotos von Lothar Hornbogen, das Landolf Scherzer vor dem Berliner Bauarbeiterdenkmal zeigt
E-Book Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, www.le-tex.de
www.aufbau-verlag.de
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Impressum
Inhaltsübersicht
Die Tafel ODER »Jesus« und die Speisung der Armen
Der erste Tafeltag
Die erste Lebensgeschichte einer Abholerin
Zahlen und Zitate (1)
Der zweite Tafeltag
Die zweite Lebensgeschichte einer Abholerin
Zahlen und Zitate (2)
Der dritte Tafeltag
Zahlen und Zitate (3)
Der vierte Tafeltag
Die dritte Lebensgeschichte einer Abholerfamilie
Zwei Versuche, mich Tschernobyl zu nähern
Erster Versuch
Zweiter Versuch
Letzte Helden
Die gesunkene Elbschute
Das Beständige
Das Wand-an-Wand-Gespräch
Die Geschichtsbewahrer
Der Irrweg
Der Kuhhandel
Die Diätassistentin
»Helden«-Nekrolog
Die Tafel
ODER
»Jesus« und die Speisung der Armen
Der weißhaarige Mann, der mitten in seiner Rede wie ein Gehetzter aufsteht und in der kleinen Plattenbauwohnung im Eisenacher Norden umherläuft, hat sich eine taudicke Kordel durch die Schlaufen der Jeans gezogen und fest verknotet. Trotzdem rutscht ihm die Hose unter den Bauch. Immer wieder zieht er sie hoch und stopft das viel zu enge rot-schwarz karierte Flanellhemd in den Hosenbund. Statt des Hemdes sollte er einen weiten Pullover tragen, aber ich sage nichts. Ich versuche lediglich, die Bruchstücke seiner Lebensgeschichte, die er mir erzählt, kommentarlos zusammenzusetzen.
Wolfgang Ehme1 hat 11 Jahre als Konstrukteur im Fahrzeug- und Jagdwaffenkombinat Suhl (Fajas) gearbeitet. Als das damals größte europäische Mopedwerk nach der Wende dichtgemacht wurde, qualifizierte das Arbeitsamt den Diplom-Ingenieur mit Steuergeldern erst zum Lagerarbeiter und später zum Grünanlagenpfleger. Doch die Lager der Betriebe waren schon ausgelagert, und die Grünanlagen wurden von ABM-Leuten gepflegt. Der Dipl.-Ing. musste sich notgedrungen bei einem sechswöchigen »Wie-bewerbe-ich-mich-richtig«-Lehrgang und anschließend ein Jahr lang mit Kreuzworträtseln und Fernsehkochkursen weiterbilden.
In seinem linken Ohrläppchen steckt ein grüner herzförmiger Kristall. »Damit ich nicht kneifen konnte, ging meine Freundin mit zum Ohrstechen. Danach kaufte sie mir diesen Hoffnungsstein. Er sollte uns Glück in der Fremde bringen.«
Die Fremde lag nur 75 Kilometer von Suhl entfernt: Eisenach.
Aus Suhl war er, wie er sagt, »geflohen«. 8000 hatten dort im Fajas gearbeitet. Die meisten von ihnen wohnten in Suhl. Und jeder kannte jeden. »Nach einem Jahr ohne Job reichte das Geld nicht mehr für den Stammtischabend. Meine Freunde gingen ohne mich in den ›Gambrinus‹. Und manche Kollegen, nicht gerade die Klügsten, grinsten, wenn sie mich am Tag in der Stadt sahen: ›Na, der Herr Dipl.-Ing., heute wieder vor der Arbeit gedrückt?‹«
In Eisenach kannte niemand den Ingenieur Wolfgang Ehme. Dort wurde er zum Fliesenleger umgeschult. Eine Firma beschäftigte ihn sechs Monate, so lange, wie das Arbeitsamt seinen Lohn zahlte. Danach entließ man ihn und nahm einen neuen Umgeschulten.
Seine Freundin ist inzwischen nach Suhl zurückgegangen. Manchmal, wenn er im nahe gelegenen »Marktkauf« in den Regalen mit den billigen Lebensmitteln, deren Verfallsdatum fast abgelaufen ist, sucht, hört er Volkes Meinung: »Was heißt hier arme Hartz-IV-Leute? Die sind nur zu faul, ihren Arsch zu heben. Die kriegen doch alles umsonst. Sollten wenigstens den Wald aufräumen oder die Straßen kehren. So ne Art Arbeitsdienst …«
»Ich bewegte meinen Arsch, ich wollte nie Stütze vom Staat und habe es sogar geschafft, einen festen Job in einem Zulieferbetrieb zu erhalten. Als ich mich dort vorstellte und sagte, dass knapp 5 Euro brutto in der Stunde wenig sind, belehrte mich der Chef: ›Einem gesunden, intelligenten Arbeitslosen wie Ihnen wird zu Hause doch die Decke auf den Kopf fallen! Da ist man froh, endlich wieder unter Leute zu kommen. Und das können Sie hier, oder?‹ Ich nickte.«
Zwei Monate später musste er Stütze bei der ARGE beantragen, weil ihm, wenn er die Miete und die Stromkosten vom Lohn abgezogen hatte, im Monat nicht einmal mehr 300 Euro für Essen, Klamotten, Schuhe, Bücher, Seife, Busfahrscheine und so weiter blieben. Obwohl er acht Stunden arbeitete, musste er vom Amt bis zum Hartz-IV-Niveau von 351 Euro »aufgestockt« werden.
Er kocht selbst. Er geht in keine Kneipe und kein Erlebnisbad. Er abonniert keine Zeitung mehr. Er fährt nicht mehr in den Urlaub. So kommt der Diplom-Ingenieur Wolfgang Ehme aus.
Nur einmal hat er in einem Tobsuchtsanfall mit der Faust seinen wackligen Küchentisch zertrümmert. »Ich war schon in der DDR ein Fan von Neil Young. Weil ich mir keine Zeitung mehr leisten kann, erfuhr ich erst eine Woche vor dem Konzert, dass Neil Young in der Erfurter Messehalle auftritt. Eine Karte kostete um die 50 Euro. Dazu das Fahrgeld. So eine Summe kann ich nicht von heute auf morgen lockermachen. Die hätte ich drei Monate lang ansparen müssen.«
Ob er sich gespendete Lebensmittel aus der Eisenacher Tafel holt?, frage ich. Da lacht der Mann, der gerade noch geflucht hat, auf. Zur Tafel gehen? Er wird mir erzählen, weshalb er das erste und einzige Mal zur Tafel gegangen ist. »Solch eine kitschige Geschichte kann kein Autor erfinden. Doch vielleicht sind nicht nur Fettleibigkeit und Armut, sondern auch Kitsch und Armut Geschwister.«
Am Tag des Konzerts hatte er sich in einem Musikladen die neuesten CDs von Neil Young angehört. Neben ihm stand eine schöne langhaarige blonde Frau mit schwarzen Jeans und engem dunkelblauem Shirt.
»Sie gab mir ihren Bob Dylan, und ich gab ihr meinen Neil Young. Wir hörten über eine Stunde lang gemeinsam Musik, danach verabredeten wir uns. Eine Woche später, ich bekomme die Stütze am Monatsanfang, trafen wir uns in einem Restaurant, das sie vorgeschlagen hatte. Blumen auf dem Tisch, Kerzen und so. Ich bin weiß Gott kein Angeber, aber mit dieser Frau, sie war 43, ich bin 55, das hätte etwas werden können. Also bestellte ich Wein und Essen. Das Essen bezahlte sie Gott sei Dank selbst. Für mich blieben noch 30 Euro. Das nächste Mal trafen wir uns in einem Café. Dort war es billiger, nur 15 Euro. Doch am Monatsende hatte ich wegen meines ›ausschweifenden‹ Lebens nicht mal mehr Geld, um Brot zu kaufen. Da bin ich zum ersten Mal in die Tafel gegangen. Für 1,50 Euro erhielt ich Brot, Joghurt, Tomaten, Apfelsinen, ein wenig Wurst und Kartoffeln. Ich packe also alles in einen Bananenkarton, und als ich mit meinen Schätzen von der Tafel die Friedensstraße am Bahndamm entlanglaufe, fährt sie zufällig mit dem Auto vorbei, hält und fragt, ob sie mich mitnehmen kann. Ich sage: ›Nein, danke, es geht schon!‹ Sie schaut erst auf den Bananenkarton, dann auf die Lebensmittel darin und schließlich mich fragend an. Seitdem habe ich sie nicht wieder gesehen.«
Er kocht Kaffee und wickelt einen Rührkuchen mit Schokoguss aus der Folie. »Das Verfallsdatum war schon gestern«, sagt er. »Aber greifen Sie zu, der schmeckt noch.«
Nach dem ersten Stück meint er, dass es in Deutschland keine Menschen gebe, die verhungern müssen, weil sie arm sind. Schlimmer sei das Minderwertigkeitsgefühl der Menschen, die als Hartz-IV-Empfänger, arme Rentner oder »Aufstocker« aus der »normalen Welt« ausgegrenzt werden und in der »Welt der unnützen Bedürftigen« durch staatliche und private Almosen versorgt werden.
»In manchen Supermärkten stehen Container, in die Gut-Menschen zusätzlich gekaufte Konserven einwerfen können.«
»Ich weiß«, sage ich, »Spenden für Tiere, die im Winter im Zirkus oder im Zoo hungern.«
»Ja. Aber diese Spenden sind nicht für Tiere, sondern für Menschen, für sogenannte Hartzis, gedacht, die sich Lebensmittel aus der Tafel holen müssen.«
Der erste Tafeltag
Als mein Anorak, den ich in der hundekalten Tafelhalle nicht ausgezogen habe, beim Aussortieren von verschimmelten Orangen, verfaulten Bananen und zerquetschten Tomaten nach zwei Stunden bekleckert ist, gibt mir »Jesus« einen Pullover aus der Kleiderkammer. Der hagere, großgewachsene Mittfünfziger leitet die Eisenacher Caritas-Tafel. Mit seinem verwilderten grauen Vollbart und den langen, bis auf die Schultern hängenden Haaren ähnelt er zwar dem Bild des Gekreuzigten, hat aber sonst wenig von einem Heiligen an sich. Mit sieben Helfern sitzt er frühmorgens um 8 Uhr in der Wärmestube der Tafel, stellt mich als Schreiber vor, der eine Woche bei ihnen arbeiten wird, und schenkt, sobald ich ausgetrunken habe, in einer halben Stunde viermal Kaffee nach.
Punkt 8.30 Uhr erheben sich alle. Arbeitsbeginn in einer der 800 ehrenamtlich betreuten Lebensmitteltafeln der Bundesrepublik. Heute ist Montag. Am Montag und am Donnerstag werden in Eisenach nachmittags die Waren an die bedürftigen »Abholer« ausgegeben. Zuvor müssen die mit einem Transporter aus Supermärkten und kleinen Geschäften geholten und dadurch vor den Müllcontainern geretteten Lebensmittel sortiert, ausgelesen und in Stiegen gelegt werden.
Mit Richard und Jochen schneide ich Kartoffelsäcke auf und fülle die Knollen portionsweise in Plastikbeutel. Die beiden arbeiten im Akkordtempo. Richard, mit Zahnlücken, roter Nase und sechs oder sieben Silberkettchen an Hals und Handgelenken, ermahnt mich, nicht zu reichlich Kartoffeln in die Beutel zu packen. Sie müssten heute bestimmt für 250 Leute reichen.
Die ersten zwei »Kunden« – in dicke Mäntel und wollene Kopftücher gehüllte Frauen – stehen schon gegen 9 Uhr im Hof vor dem Ausgaberaum, der um 14 Uhr geöffnet wird. Um 10 Uhr kommt das Auto mit Obst, Gemüse, Keksen, Käse, abgepacktem Brot und weißen Rosensträußen. Die Blumen legt »Silberkettchen« auf den Hof.
»Irgendjemand wird sie mitnehmen.«
Aus teilweise schon durchgesuppten Pappkartons klaube ich die schlechten Tomaten, suche die guten Orangen aus den Netzen, sortiere Rosenkohl, werfe matschige Möhren und Rote Bete in die Biotonne, staple noch brauchbare Bananen in Plastestiegen und will angefaulte Auberginen und Gurken sorgsam ausschneiden. Aber Jochen erklärt, dass sie Ausgeschnittenes nicht ausgeben. Zusammen mit Töpfen von verdorrtem Basilikum, verwelktem Salat und vergammelten Litschis landet alles in der Tonne.
Noch drei Stunden bis zur Ausgabe, aber die Schlange der Wartenden ist schon 20 Meter lang. Im hungernden, vom Bürgerkrieg heimgesuchten moçambiquanischen Tete sah ich 1978, wie auf Brot wartende Frauen vor dem noch geschlossenen Bäckerladen »Wartesteine« in eine Reihe legten und wieder gingen. Nachdem sie zwei oder drei Stunden auf dem Feld gearbeitet hatten, kamen sie zu ihrem Stein in der Schlange zurück. Sie hatten keine Zeit, um zu warten. Sie mussten inzwischen arbeiten, um zu überleben.
Ich nehme jede Mandarine einzeln in die Hand, prüfe, ob sie noch fest ist, schneide welkes Laub von Kohlrabi, Sellerie und Radieschen, sammele im Dezember (!) schlechte Kulturheidelbeeren aus den Schälchen. Die draußen warten, sollen mit den Lebensmitteln zufrieden sein. Und sie werden dankbar lächeln, wenn sie sich mit ihren gefüllten Kartons verabschieden. Denke ich.
Als Jochen die Stiegen mit den Bananen nun schon an die drei Meter hoch stapelt und »Silberkettchen« nicht mehr hinaufreicht, faucht er ihn an, ob er nicht sehen kann, dass er kein Riese ist. Früher haben beide im VEB Fahrzeugelektrik Eisenach gearbeitet. Der heute 53-jährige Richard zuletzt im Warenlager und Jochen an der 150 Tonnen Tiefziehpresse. 1990, als die Kollegen fürchteten, dass ihr Betrieb, in dem sie unter anderem Scheinwerfer für den Wartburg und den Volvo herstellten, bald geschlossen werden würde, wechselte Richard zu Neckermann. »Dort verdiente ich fast das Doppelte – ich wollte unser Fachwerkhaus, das meine Frau schon zu DDR-Zeiten gekauft hatte, endlich ordentlich ausbauen.« 10 Jahre lang wurde er mit anderen Eisenachern nach Frankfurt zum Neckermann-Lager gefahren. 10 Jahre lang um halb zwölf zur Arbeit und nachts um zwei oder drei zurück.
»Nach 10 Jahren waren die Ehe und die Gesundheit im Arsch. Meine Frau ließ sich scheiden, und das Arbeitsamt hatte einen neuen Kunden.«
Seitdem ist Richard arbeitslos und hangelt sich von einer Maßnahme zur nächsten. Jetzt bekommt er Hartz IV und arbeitet in der Tafel als Ein-Euro-Jobber.
Jochen, sein früherer Arbeitskollege, ist 1951 in Saalfeld geboren. Der Vater ging am 17. Juni 1953 nach Westdeutschland. Jochen glaubt nicht, dass es eine politisch motivierte Flucht war. »Dann hätte er sich wenigstens wegen mir noch einmal von drüben gemeldet.«
Seine Mutter war Kindergärtnerin. Als Jochen in Ruhla eine Lehre als Elektromechaniker begann, weigerte er sich, in die FDJ einzutreten. »Ich, der Sohn einer Kindergärtnerin, die sozialistische Kinder erziehen sollte … Sie durfte jedoch weiter als Kindergärtnerin arbeiten.«
An die 20 Jahre hat er in drei Schichten im Werk für Fahrzeugelektrik gearbeitet. Als der Betrieb 1993 geschlossen und ein modernerer, mit weniger Arbeitskräften auskommender in Stockhausen eröffnet wurde, hatte er Pech. »Ich war 1989 geschieden worden. Und weil alleinstehend, fiel ich, durch das soziale Punktesystem bedingt, in die Arbeitslosigkeit. Ein Jahr als Monteur in Frankfurt. Arbeitslosigkeit. Zwei Jahre Zeitarbeiter als Schweißer ohne Schweißerpass. Arbeitslosigkeit. Sechs Monate ›Idiotenlehrgang‹ für Lager und Logistik. Arbeitslosigkeit. Ein-Euro-Jobber im Wald. Arbeitslosigkeit. Umschulung zum Metallbauer. Keine Arbeit. Und nun in der Tafel im Ehrenamt.«
»Auch Hartz-IV-Empfänger?«
»Natürlich. Alle, die in der Tafel helfen, außer ›Jesus‹, unserem Chef, und Sandro, der für die Obdachlosen sorgt, bekommen Hartz IV.«
»Wenn ihr nicht als Helfer bei der Tafel wärt, würdet ihr jetzt mit den anderen draußen in der Schlange stehen?«
Er nickt.
Die vor der Tafel warten und die hinter der Tafel stehen, gehören zur selben Klientel. Aber die hier sammeln und sortieren und Lebensmittel ausgeben, könnten einem guten Bekannten ein Stück Butter oder einen Joghurt zusätzlich in den Korb legen. Und einem Unsympathischen vielleicht den Beutel mit den wenigsten Kartoffeln und keinen Kuchen. (Wie seinerzeit die Verkäuferin im DDR-Konsum, die für gute Kunden Mangelwaren unter dem Ladentisch reservierte und deshalb bei allen Bekannten und Verwandten beliebt war.)
»Jesus« sagt, dass ich die Pappkartons, die wir aus dem Obst- und Gemüseputzraum auf den Hof geworfen haben, plattdrücken, zerreißen oder zerschneiden und auf den Transporter stapeln soll. Ich mühe mich redlich, aber es dauert. Udo, der schweigsamste der Tafelhelfer, der nicht raucht und frühmorgens als Einziger in Stadtkleidung erscheint und sich erst hier umzieht, der keinen Kaffee trinkt, sondern sich Tee in der Thermoskanne mitbringt, hilft mir. Doch der Haufen wird nicht kleiner, weil Jochen und »Silberkettchen« immer neue Kartons herauswerfen.
Im Innenhof stehen schon 30 Abholer. Sie stehen, warten und schweigen. Einige beobachten uns, wie wir die sperrigen Supermarktkartons, in denen die Lebensmittelspenden für sie geholt wurden, mühsam zerreißen. Die Übrigen schauen zur Erde oder gucken Löcher in die Häuserwände. Nur eine alte Frau kommt herüber und hilft, die Kartons auf das Auto zu laden. Sie macht es wortlos. Ich lächele sie dankbar an und nehme mir vor, ihr bei der Ausgabe eine Tafel Schokolade und eine größere Wurst in den Korb zu legen. Aber als wir die Kartonagen gestapelt haben, sagt »Jesus«, dass ich heute erst einmal nur die Regale nachfüllen soll. Verteilen darf ich übermorgen.
Manche Abholer sind zu zweit und wechseln sich beim Warten ab. Wenn der eine friert, wärmt sich der andere in Dieters Tagesraum. Dort gibt es Kaffee und Tee und Saft für 30 Cent und Suppe für 80 Cent. Eine Mutter holt ihren 3- und 6-jährigen Söhnen Gemüsesuppe. Der »Große« soll aufpassen, dass der »Kleine« nicht matzt, sagt sie und geht wieder hinaus. »Wir haben heute einen guten Platz in der Schlange, vielleicht gibt es da noch was extra.«
Ich fülle das Extra ab: Sauerkraut. Weil die Torflügel zum Gemüse- und Obstputzraum offen stehen, friere ich und habe klamme Hände. Herr Neumann und Micha bringen die letzten Spenden, die wir noch putzen, sortieren und in den genauso kalten (»damit sich alles frisch hält«, sagt »Jesus«) Ausgabeladen bringen müssen. Es sind – und ich bin deshalb nicht traurig – nur sehr wenige Kartons. Wir greifen zu den Messern, schneiden die Netze auf, werfen vergammelten Salat, Kohl, Melonen, verschimmelte Champignons und gelben Blumenkohl in den Biomüll.
Kurz vor 14 Uhr sind wir fertig, und Lagerchef Bernhard weist uns ein: »Entweder einen Käse oder einmal Saure Sahne. Entweder Soßenpulver oder Tomatenketchup. Entweder Müsli oder Milchpulver. Bananen und Orangen könnt ihr unbegrenzt ausgeben.« Endlich heißer Kaffee. Dann zünden sich alle außer dem Teetrinker wie an der Front vor dem Sturmangriff noch eine Zigarette an. Ich gehe auf den Hof. Die Wartenden draußen frieren wie wir drin. Die meisten schweigen, einige murren.
»Wir (!!!) machen jetzt gleich auf!«, erkläre ich und mustere die Abholer möglichst unauffällig. Auf der Straße würde ich sie an ihrer Kleidung nicht erkennen. Ich hatte mir vorgenommen, einige zu fragen, ob sie mir ihre Lebensgeschichte erzählen würden. Doch nun scheue ich davor zurück. Später schreibe ich diese Bitte in einem Brief auf, den ich bei der Ausgabe an 50 Abholer verteile. Vier von ihnen erklären sich bereit, mit mir zu sprechen.
Die erste Lebensgeschichte einer Abholerin
Sie hat einen christlich-deutschen Vornamen und seit 1982 einen italienischen Nachnamen: Elisabeth Venturelli. Geboren wurde Elisabeth Schmidt 1947 als einziges Nachkriegskind von fünf Geschwistern in Haldensleben. Erlernt hat sie den in der DDR begehrten Beruf einer Säuglingsschwester. Doch wegen einer Anämie konnte sie keine Nachtschichten machen und wurde Schaffnerin. Sie fuhr noch mit langsamen Dampfzügen – »in denen ich während der Fahrt schon mal stricken oder lesen konnte« – zwischen Stendal, Berlin und Schwerin hin und her.
Aber ihr Leben war ein Schnellzug. Fernschreiberin bei der Bahn. Sekretärin im Optischen Werk in Rathenow. Das kannte sie schon als Schülerin vom Unterricht in der Produktion. Damals sollte sie winzige Löcher in Brillengestelle bohren, aber weil sie der Maschinenlärm konfus machte, drehten sich die Bügel jedes Mal wie Propeller unter dem Bohrer. Deshalb durfte sie in der Betriebsbibliothek Bücher sortieren. »Ich hatte immer Glück im Leben«, sagt sie. Auch bei den Männern. Sie war, wie sie heute verschämt gesteht, nicht nur für DDR-Männer »ein verdammt schönes blondes Weib«. Ein sowjetischer Offizier verliebte sich in sie. Man traf sich, und sie lud Serjosha zu ihrer Geburtstagsfeier ein. Danach sah sie ihn nicht wieder. Er wurde bestraft und abkommandiert. Sie wurde nicht bestraft, aber in den VEB Ofen- und Herdbau Rathenow versetzt. Später arbeitete sie als Sekretärin im Kreisvorstand des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes (FDGB). Und wieder verliebte sich ein Ausländer in die schöne Elisabeth. Allerdings kein Genosse aus dem Bruderland, sondern ein »Kapitalist« aus Italien. Die Italiener bauten damals in Brandenburg ein modernes Stahlwerk und gingen nach Rathenow zum Tanz.
»Es waren zwar, wie man damals sagte, Klassenfeinde, aber sehr hübsche schwarzhaarige Klassenfeinde.«
Nachdem das Stahlwerk den Probelauf bestanden hatte, fuhren die Italiener wieder nach Hause. Weil Elisabeth ein Kind von ihrem Silvano bekam, wurde sie aus der SED ausgeschlossen und vom FDGB in das Dienstleistungskombinat versetzt, in dem schon andere Frauen arbeiteten, die sich mit den »italienischen Klassenfeinden« eingelassen hatten.
Elisabeth nannte den Sohn nach dessen Vater. »Wenn du dem Sohn seinen Namen gibst, hast du immer eine Erinnerung an ihn, dachte ich.«
Doch der Vater wollte das Kind und Elisabeth. Im Januar 1983 heiratete er sie in der DDR und nahm sie im März mit nach Italien in das Haus seiner Eltern in Udine.
»In Kreuzworträtseln kommt das Wort oft vor. Italienische Stadt in Norditalien.«
Die DDR-Bürgerin Elisabeth Venturelli wusste 1983 weder genau, wo Udine liegt, noch etwas von der kapitalistischen, geschweige denn der italienischen Lebensweise. Sie verstand nicht, dass die zum Kindergeburtstag eingeladenen Schulkameraden ihres Sohnes nicht die mit Wurst und Käse belegten deutschen Brötchen mochten, dass Weihnachten kein Baum aufgestellt und alles im Haus nur von »Signora Mamma«, ihrer Schwiegermutter, bestimmt wurde.
Elisabeth lernte Italienisch. Sie arbeitete schwarz als Reinemachfrau. Als ihr Mann, inzwischen Rentner, nach 15 Jahren Ehe zu saufen begann, ging sie nach Deutschland zurück. Ihr Sohn, damals noch in der Lehre als Kfz-Schlosser, blieb beim Vater. Weil in München Bekannte lebten, versuchte sie dort Arbeit zu finden. Doch auf dem Amt hieß es nach den ersten »Maßnahmen«, dass sie als ehemalige DDR-Bürgerin ihr Glück im Osten versuchen sollte.
»Also wohin? Ich hatte in München einen Prospekt über Eisenach und die heilige Elisabeth gelesen. Und weil es dort auch Berge gibt, dachte ich: Versuche es bei deiner heiligen Namensvetterin. Ich war vor 16 Jahren aus der DDR weggegangen und kam nun in die ostdeutsche BRD zurück. Zuerst in ein Frauenhaus, dann spendete man mir Möbel und Küchengeräte. Schließlich schenkte man mir Kleider und Lebensmittel. Mir, der Namensvetterin der heiligen Elisabeth.«
Es folgten Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen in Eisenach. Im Winter fegte sie die Wege zum Kirchenamt, später arbeitete sie auf dem Friedhof. Nach drei Fußoperationen wurde sie wieder arbeitslos, ehe sie eine Beschäftigung bei der kommunalen Verkehrsgesellschaft fand: Sie musste Schwarzfahrer bestrafen. Als der Job von einer privaten »Wach- und Schließgesellschaft« übernommen wurde, kündigte man ihr. Arbeitslosigkeit. 2003 war ihr Sohn, der ausgelernte Kfz-Schlosser, nach Deutschland gekommen und wollte sich hier seinen Traum, Busfahrer zu sein, erfüllen. Stattdessen Umschulungsmaßnahmen. Zeitarbeit. Hartz IV. Bis zum Sommer macht er noch einen Gabelstapler-Lehrgang.
»Wenn er danach keine Arbeit bekommt, gehen wir wieder nach Italien.«
Ich frage, weshalb sie nicht in Deutschland bleiben will, wo sie für sich und den Sohn monatlich 350 Euro erhält. Dazu Kleiderkammer, Suppenküche, Lebensmitteltafel …
»Wissen Sie, in Italien leben wahrscheinlich mehr ärmere Menschen als in Deutschland. Die haben dort weniger Euro als hier und keine Lebensmitteltafeln und keine Sozialkaufhäuser. Aber trotzdem sind sie reicher!«
Diese Logik begreife ich nicht.
Das sei einfach. »In Italien gehören die Armen noch zum normalen Leben. Niemand stempelt sie als Außenseiter ab. Sie sitzen mit den anderen in den Cafés und bekommen ein Bier spendiert. Die italienischen Armen müssen sich nicht bürokratisch ausweisen, um Almosen zu erhalten. Sie werden nicht wie hier die Hartz-IV-Empfänger als bedauernswerte Außenstehende und Überflüssige durch die Medien und Talkshows gezerrt, bis die anderen mit Fingern auf sie zeigen. Es wird nicht staatlich kontrolliert, ob sie eine vielleicht 1,53m2 zu große Wohnstube haben. Sie gehören zur Normalität des alltäglichen Lebens.«
Noch hofft Elisabeth Venturelli, dass ihr Sohn eine Anstellung als Gabelstaplerfahrer erhält.
»Wir sind doch ordentliche Leute, und ich habe ihn gut erzogen.«
Neben der Tür ihrer Neubauwohnung im Eisenacher Norden hängt am Regal ein von ihr geschriebener Zettel: »Schuhe ausziehen und in den Schrank stellen!«
Der Laden ist nicht geräumig, und die Wände sind vollgestellt mit Regalen und Kartons. Rechts vom Eingang das Regal mit Milchprodukten, Fertigsalaten und abgepackter Wurst. In der Mitte die Fächer für Obst und Gemüse, auf deren oberster Ablage auch Frostschutzspray, Peeling-Handschuhe zur Körperpflege, Müsli, Zwieback und Slipeinlagen (einmal bekamen sie sogar eine Kiste Kondome). Davor steht eine Kühlbox, in der, weil es heute keine Tiefkühlware gibt, Soßenpulver, Ketchup und Brokkolisuppen liegen. Neben dem Durchgang zum Gemüse- und Obstputzraum stehen die längsten Regale mit Brot, Süßigkeiten, Brötchen, Kartoffeln und Weißkraut, Sellerie und Salatköpfen.
Die ersten acht bis zehn Hineindrängelnden – mehr haben nicht Platz – bringen in ihren Mänteln und Haaren zusätzlich Kälte mit. Doch schon bald erwärmt sich der Raum von unserem Atem. Wir Austeiler und Regalauffüller frieren ohnehin nicht, wir arbeiten im Laufschritt. Nur Herr Neumann sitzt am Eingang und kontrolliert die Ausweise, auf denen die Anzahl der im Haushalt lebenden Personen und die Tafelbedürftigkeitsberechtigung bestätigt sind. Er kassiert pro Person 1,50 Euro, treibt Schulden ein und mahnt beim letzten Mal ausgegebene Milch-Pfandflaschen an. Schon nach kurzer Zeit sind die zwei Stiegen Blumenkohl verteilt, die nächsten Abholer bekommen Radieschen, als die zu Ende gehen, bringen wir Gurken aus dem Lager …
Micha, Jochen und Theo verteilen so schnell, dass Udo, »Silberkettchen« und ich beim Auffüllen kaum nachkommen. Im Lager stehen fast 200 Paletten mit Obst und Gemüse. Wir werden vier Stunden ohne Pause hin- und herlaufen müssen.
Die Abholer drängen, wie ich es aus der DDR vom Anstehen nach frischem Bäckerbrot und Brötchen kenne, schon zur Tür herein, bevor die Abgefertigten wieder draußen sind. Ich komme nicht dazu, mir die Leute genau anzusehen. Ich höre nur, wie sie »Das!«, »Das!«, »Das!« sagen oder auf die Frage der Ausgeber »Ja!«, »Ja!«, »Ja!«. Selten heißt es »Ja, bitte das!« und noch seltener beim Gehen auch »Danke!«.
Nur das Gesicht einer jungen Frau mit ungepflegten fettigen Haaren fällt mir auf. Es ist rot und blau geschlagen. »Jesus« sagt, dass die Frau, weil sie von ihrem Freund ständig misshandelt worden ist, von Mönchengladbach nach Eisenach gezogen ist und er ihr eine Lehrstelle besorgt hat. Doch nun ist der Freund hinterhergekommen und schlägt sie wieder. Dieser Mann steht mit einem extrem großen Einkaufskorb drei Positionen hinter ihr. Ich bin froh, dass ich heute noch keine Lebensmittel ausgeben muss!
Am schnellsten, aber auch am schweigsamsten bedient Micha. Manchmal gibt er flinker aus, als die Leute fragen oder zeigen können. Und diskutiert auch nicht, wenn sich einer beschwert, dass der Joghurt heute schon verfällt, eine Tomate zerdrückt ist oder bei ihm fünf Kartoffeln weniger als beim Nachbarn im Beutel sind. Micha arbeitet wortlos.
Micha sei froh, dass er hier als Ein-Euro-Jobber noch etwas zuverdienen könne. Er habe es bitter nötig, sagt »Jesus«. Der gelernte Baumaschinist hatte im Eichsfeld für die Familie, Frau und zwei Kinder, ein Haus gebaut. Das gehöre in der Zwischenzeit der Bank, und Micha lebe allein mit den zwei Kindern in einer kleinen Wohnung in Eisenach. Die Frau sei mit einem Schwarzen, von dem sie ein Kind bekommen habe, durchgebrannt. Einem Schwarzen! Und nun müsse er in der Tafel auch an Schwarze Lebensmittel verteilen.
«Und an Wolgadeutsche.«
»Aber die haben doch nicht seine Frau …?«
»Nein, aber in seinem Garten geklaut.«
Erst kurz vor 18 Uhr legt sich der Sturm der Abholer auf das »kalte Buffet«. Der Lagerchef holt Konserven aus dem Lager, damit auch die Letzten noch etwas bekommen. Bis auf ein paar Zwiebeln, Möhren und Krautköpfe ist alles Gemüse ausgegeben.
»Wenn wir morgen in Eisenach wieder Waren einsammeln, kannst du mitfahren«, verspricht »Jesus«.
»Geben alle Supermärkte etwas?«
»Nein, bei manchen werden gute, brauchbare Lebensmittel gleich in die Mülltonnen geschmissen.«
Zahlen und Zitate (1)
1993 wurde in Berlin die erste deutsche Tafel eröffnet. Fünf Jahre später waren es 100. Im Jahr 2000 schon 270, und heute gibt es 872 Tafeln, die an rund eine Million Bedürftige Lebensmittel verteilen.
Nach Angaben der Investmentgesellschaft Merrill Lynch-Capgemini besitzen 798000 Wohlhabende in der BRD ein reines Finanzvermögen von mehr als je einer Million Dollar. Und für 2004 wies der »World Wealth Report« 55 »Nettovermögensmilliardäre« aus, von denen die 24 Reichsten über ein Nettovermögen von insgesamt 180,3 Milliarden Euro verfügen.
»Wir sorgen mit Suppenküchen, Sozialkaufhäusern und Lebensmitteltafeln dafür, dass der soziale Frieden in der Gesellschaft gewahrt wird. Wir verhindern Kleinkriminalität und halten die Gesellschaft stabil, damit es nicht irgendwann einmal einen Aufruhr gibt. Anders gesagt: Wir sind Revolutionsverhinderer.« (G. S., Tafelverantwortlicher)
Für ein Jahr Hartz IV werden für die spätere Rente 2,19 Euro angerechnet. In 10 Jahren sind das 21,80 Euro Rente.
»Ähnlich wie das Sexualleben der öffentlichen Kontrolle entzogen ist, beansprucht auch der Reichtum einen Intimschutz.« (Jürgen Espenhorst, Reichtumsforscher)
»Die Bettler, die an der Straße sitzen, oder die Alkis, die auf der Straße liegen, kommen im Osten sehr selten zur Tafel, um sich Lebensmittel abzuholen. Unsere ›Kunden‹ sind vor allem Menschen wie du und ich. Für die Probleme der Menschen ganz unten, also die Obdachlosen, Drogensüchtigen und anderen, gibt es Spezialisten, Sozialhelfer, die sich mit ihnen beschäftigen.« (G. S., Tafelverantwortlicher)
Fast 100000 Hartz-IV-Empfänger klagten 2007 gegen die von der ARGE erstellten Zuwendungsbescheide. Über 50 Prozent klagten erfolgreich.
»Es gibt entwürdigende Dankbarkeitsrituale bei den Tafeln.« (Peter Storck, Pfarrer der Heilig-Kreuz-Gemeinde Berlin-Lichtenberg)
»Ich habe vier Prozesse führen müssen, um 60 Euro Unterstützung für den Kauf der Schulsachen meines Sohnes zu erhalten. Die 60 Euro muss ich in 20-Euro-Raten monatlich zurückzahlen.« (M. G., Tafelkundin)
Bundesweit wachsen zur Zeit über 2 Millionen Kinder in Armut auf.
Mehr als 50 Prozent der deutschen Unternehmen sind Einmann-Betriebe. Davon verdient jeder Dritte weniger als 1000 Euro. 108000 der nicht mehr zur Arbeitslosenstatistik zählenden Ich-AGs (52000 im Osten, 56000 im Westen) sind auf Hartz-IV-Zuschüsse angewiesen.
Der zweite Tafeltag
Auf meinem Weg vom Bahnhof zur Tafel komme ich an einem der zwei Eisenacher Aldi-Supermärkte vorbei. Davor diskutiert ein Schlipsträger mit einem in Arbeitsklamotten, wie er das Aldi-Schild, das auf einem Mast am Straßenrand steht, werbewirksamer anbringen soll.
Ich vermute, dass er der Chef ist, erkläre, dass ich Mitarbeiter der Tafel bin, und frage, weshalb Aldi die Lebensmittelreste lieber in die Tonne kippt, als sie der Tafel zu geben. Der Mann stottert, er wisse davon nichts. Aber es gäbe einen zentralen Aldi-Beschluss, die Tafeln in Deutschland zu unterstützen.
Er werde das selbstverständlich sofort regeln. Wir könnten schon heute Lebensmittel im Aldi abholen.
»Dann kommen wir gegen Mittag?« Er nickt.
Noch während ich zur Begrüßung der morgendlichen Kaffeerunde im Tagesraum der Tafel auf den Tisch klopfe, verkünde ich triumphierend, dass wir heute auch bei Aldi Lebensmittel holen können.
»Jesus« guckt nicht begeistert. »So was muss man von oben regeln, das kannst du nicht auf der Straße aushandeln. Aber fahrt mal vorbei.«
Damit ist das Thema beendet, und Dieter, der Chef des Tagesraumes, erzählt weiter, was er nachts gegen 3 Uhr im Fernsehen gesehen hat. »Also der hatte Witze drauf: ›Wenn’s zwei Schirme miteinander treiben, was kommt dabei raus? Knirpse! Und bei Kugelschreibern? Nichts, die haben ne Spirale drin!‹«
Dieter erzählt jeden Morgen vom Fernsehprogramm nach Mitternacht. Er trägt eine starke Brille, und ich bilde mir ein, dass er sehr oft mit den Augen zuckt. Er lebt in einer kleinen Eisenacher Wohnung.
»Allein?«
»Nein, mit dem Fernseher.«
Erneut Themenwechsel. Benzin ist billiger geworden. Spott über Ministerpräsident Althaus, der mit der Schöpfkelle Suppe für Arme in Erfurt austeilt. »Alle Politiker sind Heuchler.« Streit, ob es sinnvoll ist, Millionen dafür auszugeben, dass der Zug aus Erfurt zehn Minuten früher in Würzburg ankommt.
»Zeit ist Geld«, sagt Theo.
»Wozu? Die in der Welt der Bedürftigen leben, haben doch alle Zeit der Welt«, entgegnet Dieter. »Die zehn Minuten sind nur für die in der anderen Welt wichtig. Aber ob die ihre zehn zusätzlichen Minuten dann auch sinnvoll nutzen?«
Udo kommt herein und zieht sich um. Wir Tafelhelfer gehen pünktlich vom Kaffeetisch an die Arbeit.
»Wird es heute ruhiger?«, frage ich. »Ausgabe ist erst übermorgen.«
Theo, der mit 34 Jahren jüngste Tafelhelfer, schaut mich entgeistert an. »Ruhiger? Saubermachen! Das muss heute alles blitzblank werden. Und dann neue Waren einsammeln! Sortieren! Schneiden! Danach wieder ausgeben! Und dann alle Räume saubermachen! Das ist der Rhythmus der Tafel. Und den muss man einhalten, solange es bei uns Armut gibt.«
Ich meine, dass es besser wäre, die gesellschaftlichen Ursachen für die Armut zu beseitigen, als immer und ewig Lebensmittel zu sammeln und an Bedürftige zu verteilen.
»Silberkettchen« mault: »Du Idiot! Wo sollen wir Ein-Euro-Jobber arbeiten, wenn es keine Tafeln und keine Armen mehr gibt?«
In der Nacht hat der Frost die weißen Rosensträuße auf dem Hof entblättert. Ihre Blüten liegen im Dreck. Theo wirft sie in die Tonne. Er ist der Ordentlichste von uns. Theo hat gleich nach der Wende den ehrbaren Beruf eines Maurers erlernt. Als er ausgelernt hatte, wurde zwar noch viel gebaut, aber meist mit Subunternehmen und Billigarbeitern aus Osteuropa. Entlassung. Und Umschulungsmaßnahmen. Dann Hartz IV. Zusätzlich poliert er manchmal die Wagen in einem Opel-Autosalon. »Die schwarzen Mercedes sind bös, auf denen siehst du den kleinsten Fussel.«
Theo ist beim Saubermachen der Chef. Er zeigt uns jedes welke Blatt, jeden Papprest und jede Folie, die noch in einer Ecke der Putzhalle liegen. Er lässt uns die Gemüsestiegen auswaschen und den Fußboden schrubben. Mich schickt er in den Laden, damit ich die Regale putze. Ich mühe mich, die Spuren von umgeschüttetem Rotkrautsalat und ausgelaufenem Joghurt zu beseitigen. Als Theo kontrolliert, ob ich auch alle Brotkrümel aus den Ecken gepolkt habe, und er zu nörgeln beginnt, weil er auf dem Ausgabetisch noch Schlieren sieht, schreie ich: »Du bist nicht meine Mutter und ich nicht deine Putze, und du hast Maurer und nicht Raumpfleger gelernt!«
Das hätte ich nicht sagen sollen.
»Weißt du«, blafft er zurück, »meine Mutter war brutal. Brutal wie Hitler! Wir wohnten unten. Und wenn ich meine Sachen im Zimmer nicht ordentlich aufgeräumt hatte, egal ob Hosen, Schuhe oder Bücher, schmiss sie alles auf die Straße. Und später in dem kleinen Bauwagen konnte ich auch nicht herumschlampen wie du hier.«
An der Tür steht ein alter, sehr gepflegt aussehender Mann im langen wollenen Wintermantel. Er bringt uns zwei Stiegen mit Äpfeln. Es sind sehr große und sehr schöne Äpfel. Obwohl er sie selbst in seinem Garten gepflückt hat, kennt er die Sorten nicht. In seiner Gegend würden zwar keine Notleidenden wohnen, aber er sei als Christ zur Nächstenliebe erzogen worden.
Er ist 71 Jahre alt und hat im Eisenacher Automobilwerk als junger Ingenieur das Rechenzentrum mit aufgebaut. Später wurde er ein Leiter der unter höchster Geheimhaltung stehenden Datenverarbeitung des Betriebes.
»Und SED-Genosse?«, frage ich.
»Nein«, sagt er, »kein Genosse, nur gläubiger Katholik.«
»Das war möglich in der DDR?«, frage ich.
Heinz Altenberger nickt und erklärt, dass wir die Äpfel nicht gleich ausgeben sollten. Sie müssten noch ein paar Wochen lagern.
Gewöhnlich gehen Herr Neumann und Micha allein auf Sammeltour. Wir haben allerdings in dem Renault-Transporter auch zu dritt Platz. Dass es ein Renault ist, sehe ich nicht auf den ersten Blick, denn auf allen freien Flächen des ockerfarbenen Autos – Motorhaube, Türen, Seitenwänden und den hinteren Ladetüren – sind Werbetexte von Firmen und Institutionen angebracht. Ich nehme an, dass die Tafel mit den Einnahmen für die Werbung das Auto finanzieren konnte. »Nein«, sagt »Jesus«. Eine Werbefirma hat den Transporter gekauft und den Werbekunden für Reklame zur Verfügung gestellt. Und weil die Tafel ein »Etwas-Gutes-tun«-Image hat, meldeten sich viele Interessenten für die freien Flächen. Die Werbeagentur nahm rund 40000 Euro ein und stellte den Transporter, der rund 20000 Euro gekostet hatte, der Tafel fünf Jahre kostenlos zur Verfügung …
Herr Neumann kurvt fast blind durch Eisenach. Er war früher Schichtmeister in der Plastverarbeitung, die Kleinteile für die Uhren aus Ruhla herstellte. »Als der Betrieb nach der Wende in einen anderen Ort umgezogen ist, haben sie den Schichtmeister nicht mitgenommen. Inzwischen werden sie es bestimmt bereut haben«, sagt er und lacht.
Am ersten Supermarkt stehen vor der durch ein Gitter verschlossenen Warenannahme drei Kartons mit Tomaten, Paprika, Weintrauben und abgepacktem Brot. Obst und Gemüse sind vergammelt und werden auf diese Weise für den Supermarkt billig entsorgt!
An der nächsten Kreuzung steht ein mannsgroßer Aufsteller mit dem Bild der heiligen Elisabeth, die im 13. Jahrhundert Brot und Speisen aus ihrer reichen Welt oben auf der Wartburg an die Bedürftigen unten in der armen Welt von Eisenach verteilt hat. Reklame für ein Elisabeth-Musical, das im Sommer wieder in der Wartburg-Stadt aufgeführt wird.
Wir halten am Hintereingang eines großen Kaufmarktes, der die Restaurants in der Umgebung versorgt. Die Leiterin des Lagers hat ein Dutzend Paletten mit Haferflocken, Kakaopulver, Paprika, Erdbeeren, Vanillepudding und anderen Lebensmitteln bereitgestellt. An einer Tankstelle sammeln wir die übriggebliebenen Baguettes ein. Danach noch ein Supermarkt. Brauchbares und schon arg Angefaultes liegen beieinander. Micha notiert: »Zwei Paletten mit Blumenkohl, zehn Kilo Nudeln, Joghurt, Butter.« Und unterschreibt den Empfang. Die Bescheinigung erhalten die Discounter als Beleg.
Vor einem Supermarkt wirft ein Lagerarbeiter Säcke mit Möhren in große Abfallcontainer. Ich schaue nach. Die Möhren haben noch nicht einmal braune Flecken. Als ich einen Sack herausheben will, hält mich Herr Neumann zurück. »Wir dürfen nur mitnehmen, was sie uns hinstellen. Holst du was aus den Tonnen – auch wenn es abgepackte Nudeln sind –, ist das Diebstahl.« Drinnen stehen für uns nur eine Palette mit Zwiebeln und ein Karton Zwieback. Keine Möhren. Im letzten Jahr, sagt Herr Neumann, sind die Supermarkt-Spenden für die Tafel spärlicher geworden. »Oft verramschen sie – um auch die Hartz-IV-Leute in ihren Supermarkt zu locken – die fast abgelaufenen Waren zu Billigpreisen. Und die Leute kaufen dann nicht nur das Billigzeug, sondern vielleicht auch eine teure Wurst, die sie sich sonst nicht leisten würden.«
Am Schluss der Tour fahren wir zu Aldi. Ich gehe siegessicher hinein und frage die Frau an der Kasse nach dem Geschäftsleiter.
»Ich bin die Geschäftsleiterin«, entgegnet sie.
»Kassiererin und gleichzeitig die Chefin?«
»Warum nicht?« Der Mann mit Schlips und Anzug sei lediglich der Thüringer Bereichsleiter für Technik und Investitionen gewesen.
Ich erkläre unsicher, dass wir nach seiner Ankündigung Lebensmittelreste für die Tafel abholen sollen. Sie staunt, weil nur der Chef für die zwei Aldi-Supermärkte in Eisenach solch eine Weisung erteilen könnte. Der aber sitzt im anderen Aldi. Sie telefoniert. Es dauert. Ich hole mir einen Kaffee und frage die Mitarbeiterin, die inzwischen die Kasse übernommen hat, ob ich ihr einen Kaffee mitbringen soll.
»Einen Kaffee? Nee! Vom Kaffee musste nur viel pinkeln. Und dazu haben wir hier keine Zeit. Überfällige Lebensmittel extra für die Tafel zur Seite stellen? Wer soll das machen, wenn nicht einmal Zeit zum Pinkeln bleibt? Schneller geht es, wenn wir alles in die Tonne schmeißen.«
Die freundliche Leiterin hat umsonst telefoniert. Der Chef ist nicht zu erreichen.
»Aber morgen rufen wir gleich zurück.«
Mit unserem Lebensmittelschatz fahren wir rückwärts an das Tor der Gemüseputzhalle. Sesam, öffne dich! Doch weder »Silberkettchen« noch Jochen oder Theo schauen neugierig, was und wie viel wir eingesammelt haben, geschweige denn, dass sie uns loben, weil der Laderaum zu einem Dreiviertel gefüllt ist. Wortlos tragen sie die Kisten aus dem Transporter und stapeln sie vor dem Tisch mit den Messern, die »Silberkettchen« zu Hause alle geschärft hat.
Als ich in den Laden gehen will, um meine restlichen Regale auszuwischen, schlägt »Jesus« vor, in die Caritas-Zentrale zu fahren. »Ich möchte dir meinen Chef, Gerd Buder, vorstellen. Der hat mich Atheisten vor sieben Jahren hier in der katholischen Hilfsorganisation eingestellt.«
»Jesus« hat von 1972 bis 76 in Ilmenau Elektrotechnik studiert. Er war kein linientreuer Student. »Davon hatten wir wenige. In unserer 20 Mann zählenden Seminargruppe gab es nur zwei Studenten mit SED-Parteibuch. Einen von ihnen hat man später exmatrikuliert, weil damals gnadenlos gefeuert wurde, wer keine gute fachliche Leistung brachte. Aber als wir uns fünf Jahren nach dem Studium zum ersten Mal wiedertrafen, waren nur noch zwei ohne Parteibuch.«
Einer davon war der spätere »Jesus« (damals trug er noch keinen Vollbart). Er arbeitete als Konstrukteur für elektronische Steuerungssysteme im Eisenacher Automobilwerk. Später in der PGH Elektroanlagen. Als sich 1982 in der DDR eine Bürgerinitiative zur Rettung der Creuzburg bildete, wurde er Bauleiter der Feierabendbrigaden, die jährlich 10000 Stunden (für 5 DDR-Mark pro Stunde) auf der Burg mauerten, zimmerten und malerten. Nach der Wende arbeitete er zuletzt in einem Steinmetzbetrieb, und als der pleiteging, war »Jesus« (damals schon mit Rauschebart) ein Jahr zu Hause. Auf dem Arbeitsamt fragte sein Vermittler, ob er etwas gegen Asoziale und Obdachlose hätte. Wenn nicht, könnte er sich bei Herrn Buder in der Caritas melden.
»Und der nahm mich Partei- und Gottlosen auf.«
Gerd Buder, wie »Jesus« im »guten Weinjahr 1954« geboren, hat Buchdrucker gelernt und in der DDR (er sagt »Zone« dazu) katholische Fürsorge studiert. Jetzt leitet er die Caritas in Südthüringen. Er redet – »ich habe früher den Mund nicht gehalten und mache es heute auch nicht« – sehr laut und sehr leidenschaftlich und sehr gestenreich.
»Wissen Sie, es gab in der Zone keine Hungersnot und keine Existenzängste. Aber es gab beispielsweise die Frau, die, bevor sie den Ausreiseantrag stellte, einen Brief in meinem Tresor hinterlegte. Darin stand, was mit ihren Kindern geschehen soll, wenn sie verhaftet würde … Und Rentner kamen zu mir, um sich auf die lange Warteliste für einen Platz im Altersheim setzen zu lassen.«
Heute gibt es genügend schöne, moderne Altersheime.
»Man muss nur das dafür nötige Geld aufbringen.« Der Gottesmann flucht zwar nicht gotteslästerlich, aber beim Wort Geld redet er sich derart in Rage, dass er bei dem Versuch, gleichzeitig zu trinken und zu sprechen, den Kaffee verschüttet. Nie könnten »Geld haben müssen« und christliche Hilfe zusammengehören. »Man kann nicht gleichzeitig Gott und dem Mammon dienen. Wir sollten wieder auf die Armen zugehen, wir sollten Moral und Nächstenliebe vorleben. Stattdessen ahmen wir das Geschäftsgebaren von Konzernen nach. Unsere Oberen beraten, wie sie die Caritas-Kliniken noch effektiver betreiben, wie sie die Arbeiten im Pflegeheim rationalisieren und kontrollieren und mit weniger Arbeitskräften auskommen können … Gott lebt aber nicht bei den Managern oben, sondern bei den Armen unten.«
Ich erzähle ihm von Heinz Altenburger, der heute zwei Stiegen Äpfel aus seinem Garten zur Tafel gebracht hat.
Gerd Buder kennt den Mann. »Herr Altenburger war schon früher in unserem Kirchenvorstand aktiv. Nur wenn Kirchendelegationen aus dem Westen kamen, entschuldigte sich der Leiter der Datenverarbeitung: ›Die darf ich nicht begrüßen.‹«
Bevor wir gehen, schenkt mir Gerd Buder einen Abzug seines Lieblingsgedichtes, das er im Aktenordner ganz vorn, sozusagen als Leitmotiv, abgeheftet hat.
Erich Kästner
Dem Revolutionär Jesus zum Geburtstag
[…] Du gabst den Armen ihren Gott.
Du littest durch der Reichen Spott.
Du tatest es vergebens! […]
Du warst ein Revolutionär
und machtest dir das Leben schwer
mit Schiebern und Gelehrten. [ …]
Du kämpftest tapfer gegen sie
und gegen Staat und Industrie
und die gesamte Meute. [ …]
Die Menschen wurden nicht gescheit.
Am wenigstens die Christenheit,
trotz allem Händefalten.
Du hattest sie vergeblich lieb.
Du starbst umsonst. Und alles blieb
beim alten.
Ich sage dem Caritas-Chef, dass er mich an die lateinamerikanischen Priester erinnert, die den Armen die »revolutionäre Theologie der Befreiung« gegen Armut und Ausbeutung predigen. Und die deswegen im Vatikan nicht beliebt sind.
»Mich muss keiner lieben«, sagt der Revolutionär Gerd Buder.
Auf dem Rückweg zur Tafel frage ich den Atheisten Georg Schulz, wann seine äußerliche Verwandlung zu »Jesus« begonnen hat.
»Als mein Bebo-sher-Trockenrasierer 1990 seinen Geist aufgab und ich keinen neuen teuren Westrasierer kaufen wollte.«
Dank der revolutionären Theologie der Befreiung bin ich in der Zwischenzeit vom Saubermachen befreit worden. Der Laden und das Lager sind so blitzblank, dass nicht einmal Theo noch einen Krümel findet.
Micha arbeitet allein im Tagesraum. Links von ihm steht ein Gummibaum und rechts am Fernseher der Weihnachtsbaum. Dazwischen hängt das Bild eines Segelschiffes vor norddeutschen reetgedeckten kleinen Häusern und ein Bild, auf dem wohl irgendwo in Norddeutschland die Heide blüht. Und ein Spruch der Caritas: »Wenn es allen Arbeitslosen viel zu gut geht, warum wollen dann nicht alle arbeitslos sein?«