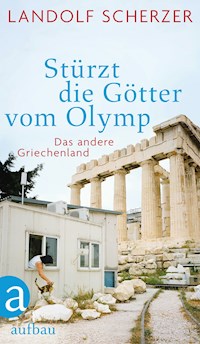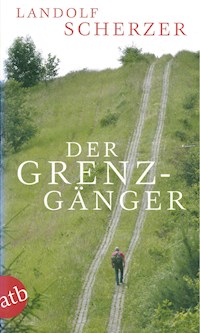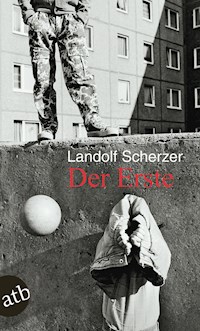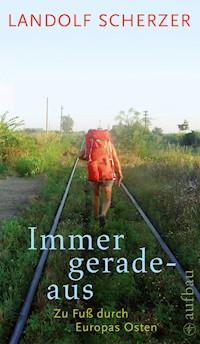16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Er ist einer der großen Reporter des Landes. In diesem Buch spricht er über sein Werden und über sein Werk. Es erzählt den deutschen und europäischen Osten packend, prägnant und präzis. Landolf Scherzer ist einer der großen Reporter des deutschen Ostens, dessen Leben und Werk gewissermaßen Straßenstaub und Grassamen an den Schuhen haben. Er berichtete aus China und Kuba, aus der lebendigen wie der sterbenden Sowjetunion, aus Tschernobyl und Griechenland. Er wanderte am ehemaligen deutschen Todesstreifen entlang, porträtierte Menschen auf beiden Seiten und ging zu Fuß durch Europas Südosten. Ein störrischer Querfeldeinläufer, der auf einer Unmittelbarkeit seiner Wahrnehmungen besteht, ein sturer Romantiker, der zwischen Thüringen und Taschkent, Petersburg und Peking, Maputo und Havanna die Welt durchwanderte, ein Reisender im Weltall der Provinzen, die er seinen Leserinnen und Lesern nahebrachte wie kein anderer. Nun stellt er sich dem Journalisten Hans-Dieter Schütt für ein großes autobiographisches Gespräch. „Scherzers Reportagen verfahren wie die Chroniken der alteuropäischen Geschichtsschreibung, die Wetter und Schlachten gleichberechtigt nebeneinanderstellten und zeigten, wie die Menschen damit recht und schlecht fertig wurden.“ Gustav Seibt, Berliner Zeitung. „Landolf Scherzer interessiert weniger das faszinierende Lichtspiel des Brandes als vielmehr das, was sich nach dem Verglimmen des Feuers regt. In der Asche und am Rande.“ Siggi Seuss, Süddeutsche Zeitung. „Endlich hat sich jemand gebückt und den Stoff aufgegriffen, wie Steine, über die man nicht nur in den neuen Bundesländern täglich stolpert. Scherzer wertet und urteilt nicht, sondern zeigt: Neureich und Neuarm wohnen dicht beieinander. Er hebt seine Steine auf, wendet sie und fügt sie in sein Mosaik.“ Erich Loest.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 398
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
Er ist einer der großen Reporter des Landes. In diesem Buch spricht er über sein Werden und über sein Werk. Es erzählt den deutschen und europäischen Osten packend, prägnant und präzis.
Landolf Scherzer ist einer der großen Reporter des deutschen Ostens, dessen Leben und Werk gewissermaßen Straßenstaub und Grassamen an den Schuhen haben. Er berichtete aus China und Kuba, aus der lebendigen wie der sterbenden Sowjetunion, aus Tschernobyl und Griechenland. Er wanderte am ehemaligen deutschen Todesstreifen entlang, porträtierte Menschen auf beiden Seiten und ging zu Fuß durch Europas Südosten. Ein störrischer Querfeldeinläufer, der auf einer Unmittelbarkeit seiner Wahrnehmungen besteht, ein sturer Romantiker, der zwischen Thüringen und Taschkent, Petersburg und Peking, Maputo und Havanna die Welt durchwanderte, ein Reisender im Weltall der Provinzen, die er seinen Leserinnen und Lesern nahebrachte wie kein anderer. Nun stellt er sich dem Journalisten Hans-Dieter Schütt für ein großes autobiographisches Gespräch.
»Scherzers Reportagen verfahren wie die Chroniken der alteuropäischen Geschichtsschreibung, die Wetter und Schlachten gleichberechtigt nebeneinanderstellten und zeigten, wie die Menschen damit recht und schlecht fertig wurden.« Gustav Seibt, Berliner Zeitung.
»Landolf Scherzer interessiert weniger das faszinierende Lichtspiel des Brandes als vielmehr das, was sich nach dem Verglimmen des Feuers regt. In der Asche und am Rande.« Siggi Seuss, Süddeutsche Zeitung.
»Endlich hat sich jemand gebückt und den Stoff aufgegriffen, wie Steine, über die man nicht nur in den neuen Bundesländern täglich stolpert. Scherzer wertet und urteilt nicht, sondern zeigt: Neureich und Neuarm wohnen dicht beieinander. Er hebt seine Steine auf, wendet sie und fügt sie in sein Mosaik.« Erich Loest
Über Landolf Scherzer
Landolf Scherzer, 1941 in Dresden geboren, lebt als freier Schriftsteller in Thüringen. Er wurde durch Reportagen wie »Der Erste«, »Der Zweite« und »Der Letzte« bekannt.
Im Aufbau Taschenbuch sind ebenfalls seine Bücher »Der Grenzgänger«, »Immer geradeaus. Zu Fuß durch Europas Osten«, »Urlaub für rote Engel. Reportagen«, »Fänger & Gefangene. 2386 Stunden vor Labrador und anderswo«, »Madame Zhou und der Fahrradfriseur. Auf den Spuren des chinesischen Wunders«, »Stürzt die Götter vom Olymp. Das andere Griechenland«, »Der Rote. Macht und Ohnmacht des Regierens« und »Buenos días, Kuba. Reise durch ein Land im Umbruch« lieferbar.
Hans-Dieter Schütt, 1948 in Ohrdruf geboren, Studium der Theaterwissenschaften in Leipzig, war in der DDR Redakteur und Chefredakteur der Tageszeitung »Junge Welt«. 1992 bis 2012 Redakteur der Tageszeitung »neues deutschland«. Veröffentlichte Essays, Biographien und zahlreiche Interviewbücher.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Landolf Scherzer
im Gespräch mit Hans-Dieter Schütt
Weltraum der Provinzen
Ein Reporterleben
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Hans-Dieter Schütt: Das Nahe fern, die Ferne nah
Frank Quilitzsch: »Ja, aber …« – »Aber ja!«
I. »Wer nichts von Irrwegen weiß, erfährt auch nichts von Wegen«
II. »Freiheit? Die riecht bei mir daheim nach selbstgezogenen Zwiebeln«
III. »Gern zähle ich die Grashalme: Wie viele wachsen durch Beton?«
IV. »Geben wir dem unbekannten Serben unseren Wohnungsschlüssel?«
V. »Sorgen loswerden? Auf dem Schiff? Da musst du schon springen«
Landolf Scherzer: Mit Visum auf die Krim – trotzdem ein »Illegaler«?
Anhang
Landolf Scherzer
Bücher
Im Aufbau Verlag erschienen
Bildteil
Bildnachweis
Impressum
Ich habe mich schon oft gefragt,
was die Menschen eigentlich meinen,
wenn sie von Erlebnis reden.
Max Frisch
Wir haben eine Geschichte von Völkern.
Die der Leute ist noch immer nicht geschrieben.
Hans Magnus Enzensberger
Unsere Hoffnung ist das Wirkliche.
Volker Braun
Hans-Dieter Schütt Das Nahe fern, die Ferne nah
Wir dampfen nach Hause. In der Nordsee fängt Odysseus auf dem Peildeck einen kleinen, entkräfteten Vogel. Ein Spatz? Ein Fink? Ein kleiner Eichelhäher? Wir füttern ihn mit Brot, Erdnüssen und Haferflocken. Im Sund, fast wieder auf Tuchfühlung mit dem Land, will ihn Odysseus wieder fliegen lassen … Auf der Backbordseite liegt Schweden. Auf der Steuerbordseite Dänemark, Helsingør, wo Hamlet lebte. »Sonst kann man die grünen Dächer erkennen«, sagt Odysseus. Ich würde sie gern sehen. Heimkehrend habe ich Fernweh. Im Trawlbrückenraum holt Odysseus den Spatz-Fink-Eichelhäher aus der Kiste, aufgeregt flattert der Vogel hin und her, stößt gegen die Scheiben. Wahrscheinlich hat Odysseus schon miterlebt, wie sich eingesperrte Vögel an den vermeintlichen Fenstern zur Freiheit totstießen, er steckt ihn vorsorglich noch einmal in den löchrigen Pappkarton. Dann gehen wir hinaus in die Kälte und lassen den Vogel fliegen. Schauen ihm lange schweigend hinterher. Ob er auf Schloss Helsingør Rast macht? In den Nebel hinein sage ich: »Wir können zwar neugierig sein auf die Welt, aber wer kann sie schon sehen?«
Landolf Scherzer, aus »Fänger & Gefangene«, 1983
Dietzhausen ist Bedarfshalt. Das Dorf, das zu Suhl gehört, liegt auf der regionalen Zugstrecke zwischen Erfurt und Meiningen. Ich bediene rechtzeitig den – wie es in der Lautsprecheransage heißt – »Haltewunschtaster«. Nicht alltäglich, dass man eine Maschinerie stoppen darf, obwohl man der Einzige ist, der aussteigen möchte.
Am Rande von Dietzhausen steht Landolf Scherzers Schreibhaus, umgrünt: Wald und nochmals Wald. Hecken und Gestrüpp. Beete und Holzlager. Ein Strauchbogen bildet die Eingangspforte. Trittst du unter der Wölbung hindurch, leuchten Lämpchen. Mit solcher Signalgebung beginnen verwunschene Anwesen; so blinkt spielerischer Geist. An einem kleinen Baum hängen Eier, in Silberpapier eingewickelt. Der Rest vom Osterschmuck? Ja. Jede handbemalte Eihülle, die es schafft, übers Jahr standhaft Wind und Wetter zu trotzen, also nicht herunterzufallen, und somit das nächste Osterfest zu »erleben«, erhält ein silbernes Mäntelchen. Eier, die es gar ein weiteres Jahr durchhalten, werden golden umhüllt. Ein Schicksalsspiel.
Rundum ist Mittelgebirge, aber gedacht werden darf hier ans Meer. Freilich nicht ans gesetzte Segel. Nicht an den Wind, der hineinfährt. Nicht ans hinausdrängende Herz, nicht an Nietzsches »Auf die Schiffe, ihr Philosophen!«. Nein, hier schrieb der Reporter Landolf Scherzer, lange Zeit nach Nietzsche, einen eher niederdrückenden Satz: Die Schiffe im Rostocker Hafen seien zwar größer, aber eben auch »rostiger und verbeulter«, als er dachte. Rost und Beulen: heruntergebrochene Romantik; enttäuschte Erwartung; ein gar schäbiger Beginn für Abenteuer.
Mit dem zitierten Satz beginnt »Fänger & Gefangene. 2386 Stunden vor Labrador und anderswo«. Die Reportage erschien 1983 im Greifenverlag zu Rudolstadt. Für mich Scherzers bestes, sein rauestes und existenziell härtestes Buch. Und jenseits der beschriebenen Tristesse an den Kais dann doch: eine atemberaubende Ausfahrt.
Der Satz mit Rost und Beulen porträtierte die DDR, aber zugleich war damit jenes irdische Grundgesetz benannt, das sehr oft hinter sozialen, ideologischen Wunschbildern obwaltet: Da wird etwas möglichst prachtvoll ersehnt – am Ende jedoch ist alles weit ramponierter, als es das freudig erregte Bewusstsein sich zuvor ausmalte.
Das Buch »Fänger & Gefangene« – der Autor als Arbeiter auf einer schwimmenden Fischfabrik – erfasste den Staat außerhalb seiner Hoheitsgewässer und also jenseits der geläufigen publizistischen Beschönigungswellen, die das Land fortwährend durcheilten. Der Reporter ist weit draußen. Und bleibt doch drinnen. Das Schiff, auf dem er sich befindet, beherbergt nicht nur Menschen, es transportiert ein gesellschaftliches Verhältnis; konserviert werden nicht bloß Fische, sondern auch eine Struktur: in der Nussschale die zerbeulte sozialistische Welt, wie sie sich quält und müht. Ein Anklang von B.Traven gespenstert durch jene raue Tonlage, die Scherzer anschlägt. Achtzig Männer und zwei Frauen, eisige Kälte und täglich zweimal sechs Stunden Schicht. Die Existenzhärte der Ausnahmesituation als Blick in eine Alltäglichkeit, die Ozean und Festland erhellend verbindet: nirgends sicherer Boden, es schwankt das Sein, es schlingert das Bewusstsein.
Im »neuen deutschland« schrieb Essayist Gunnar Decker: »Allein den eingemauerten Staat mit dem grenzenlosen Ozean in Verbindung zu bringen ist bei aller Nüchternheit des Geschilderten eine Anmutung. Deren surreale Tiefenströmungen, wie bei Joseph Conrad, einen schwer zu beschreibenden Rausch erzeugen. Ein schwimmendes DDR-Kombinat, in der Welt ausgesetzt, das ist wie ein LPG-Bauer als Cowboy im Wilden Westen. Was passiert da? Der realsozialistische Bauer wird kein Cowboy, und der Wilde Westen bleibt der Wilde Westen, aber etwas ist danach doch anders, wenn so fremde Welten aufeinanderstoßen. Was genau es ist, das zu benennen, braucht es die Präzisionsinstrumente eines Landolf Scherzer. Aufschreiben, was ist. Diese Erzählhaltung verbindet Scherzer mit Truman Capote, mit dem ihn sonst wohl eher wenig eint.«
Wenn ich gute Reportagen aus unwirtlichen Gegenden lese, also aus ausbruchtrotzigen Seelensteinbrüchen, und dann aufschaue und mich umschaue in der Realität, so sehe ich rundum keine Abenteuer mehr und keine Abenteurer, sondern Menschen im erschütternden Gleichmaß ihres Lebens. Ich gehöre zu ihnen. Einen wie Scherzer sehe ich mit Notizbuch und Ausdauer loslaufen ins Unwegsame und Unbekannte – und weiß mich selber doch unter den vielen anderen, die nicht weggehen. Die sich nur festgezurrt erleben. Das macht uns nervös, arbeitsam, rücksichtslos und traurig. Als habe man einen Körper, aber kein Organ fürs Leben. Man lebt zwar, aber man kann es nicht wirklich.
Ein Romancier erfindet Leben. Der Reporter findet es. Warum interessiert uns gefundenes Leben? Weil wir selber suchen – und zwar erfolglos? Man kann nicht im Leben und gleichzeitig darüber stehen. Du siehst ihn nicht, jenen Fluss der Geschichte, der dich umherwirbelt – aber dieses Dilemma vermittelt uns jeder gute Reporter als kitzelnde Erfahrung. Seume, Bechstein, Dumas, Reed, Kisch, Troller, Fučík, Granin, Hemingway, Chatwin, Kapuściński, Nooteboom, Gauß, Stasiuk, Koeppen, Kaufmann, Büscher, Villain.
Auch Scherzer.
Abenteuer? Heutzutage? Wie nehmen wir Welt denn noch wahr? Per Flugzeug überqueren wir eilig und teilnahmslos Kriegsfelder, Katastrophengebiete, Hungersavannen. Der fliegende Passagier weit droben sorgt sich höchstens ums Serviceniveau und bangt um den Anschlussflug. Die Verzwergung der Reise zum Transport – sie hat sämtliche Ufer und Fernen einander nähergebracht. Wozu überhaupt noch hinaus? Und wenn, dann nur im industrialisierten Ansturm: Für den Weg zum Mount Everest gibt es inzwischen Wartelisten. Auf Wegen zum Gipfel Stauzonen, als seien die Berge eine vertikale Autobahn. Immer mehr Menschen verfallen der Besessenheit, Abenteuer sei als Sonntagstourismus nachahmbar. Aber wer eine Grenze überschreitet und nicht erschauert, hat keine Grenze überschritten.
Der Reporter will die Herrschaft über die Horizonte. So viel Eitelkeit muss sein. Jede Reportage gemahnt: Immer nur in eigenen Wänden zu bleiben – das wäre Villa Verfolgungswahn … Nach der Lektüre weißt du etwas mehr von der Wohltat, in Abständen dahin zu fahren, wo man nicht hingehört. Also: Ganz ohne Entfernung geht Dasein nicht.
Am schönsten ist wohl: fort zu sein, ohne reisen zu müssen. Man nennt das: lesen. Scherzer etwa – es reizt, seine Bücher zu lesen. Wegen seiner Art, zu reisen. Wegen seiner besonderen spröden, schmuckfreien Art, zu schreiben. Wegen der Art, wie Leben und Schreiben einander zusprechen. Das kommt bei ihm ohne Prunk daher. Ohne jeden Stildrang, so scheint es.
Das Reden über das Ungewohnte, das Gespräch mit Unbekannten, und sei es in unmittelbarer Nachbarschaft – auch für diesen Autor ist es vorrangig ein Versuch, mit sich selber zu sprechen. Obwohl seine Texte dieses Selbstgespräch partout nicht eingestehen. Aber jeder Mensch schreibt, weil er ein Problem mit sich hat. Erst mit sich und dann erst mit der Welt. Ja, diese Reihenfolge!, auch wenn Schriftsteller oft das Gegenteil behaupten. Ehrliches Schreiben ist Selbsthilfe. Ist Hoffnung, es fände sich im Austausch eine offene Stelle, an der die Welt lächelt und sagt: Nichts wird besser, aber du bist nicht allein.
Landolf Scherzer wurde Wahlthüringer. Thüringen ist kaum eine Gegend der Elementarkräfte. Kein erloschener Vulkan, kein hoher Gipfel. Ein Landstrich ohne dämonische Spannung. Hier weiß jeder zu erzählen von den Schönheiten des Gemäßigtseins.
Ein störrischer Querfeldeinläufer ist Scherzer, er besteht auf einer Unmittelbarkeit der Wahrnehmungen, die sich schnurrender Moderne verweigert. Zwischen Thüringen und Thessaloniki, Petersburg und Peking, Maputo und Máriagyűd, Samarkand und Suhl, Kaluga und Kamyschin, Banat und Bad Salzungen. Reportagen aus Tschernobyl und Temeswar. Er wanderte am ehemaligen deutschen Todesstreifen entlang, porträtierte Menschen auf beiden Seiten der einstigen Grenze. Das Reisen betreibt er nicht, um sich zu zerstreuen, sondern um sich zu verlieren. In anderen Existenzen, anderen Fragen, anderen Anschauungen. Sich reicher wähnen durch aufkommende Unsicherheit im Urteil, worüber auch immer.
Scherzer, 1941 in Dresden geboren. Es ist das Jahr, in dem auch Faye Dunaway und Senta Berger, Jutta Hoffmann und Bruno Ganz, Joan Baez und Bob Dylan und Regine Hildebrandt geboren werden, Neil Diamond und Plácido Domingo. Rapid Wien ist im »heimgekehrten« Österreich deutscher Fußballmeister, Joe Louis Boxweltmeister. In der Damenmode sind weite Röcke, Fledermausärmel, Raffungen und kleine Dekolletés beliebt. Die Herrenoberbekleidungsindustrie ist mit der Produktion von Uniformen ausgelastet. Ingenieur Konrad Zuse entwickelt den elektrischen Rechner »Zuse Z3«. Die Nazis besetzen Jugoslawien, Kreta, Griechenland, führen Krieg in Nordafrika, greifen die Sowjetunion an. Die Briten versenken das Schlachtschiff »Bismarck«. In Pearl Harbour beginnt der Krieg zwischen den USA und Japan. In Deutschland wird der Befehl zur »Endlösung der Judenfrage« erteilt. In deutschen Kinos laufen die Filme »… reitet für Deutschland« mit Willy Birgel, »Ohm Krüger« mit Emil Jannings, »Quax, der Bruchpilot« mit Heinz Rühmann. Die beliebtesten Schlager des Jahres: »Lili Marleen«, »Sing, Nachtigall, sing«, »So schön wie heut, so müsst’ es bleiben«. Beginn der Kinderlandverschickung.
In Leipzig studiert Scherzer ab 1961 Journalistik – bis zur Exmatrikulation vier Jahre später. In seiner Diplomarbeit hatte er unliebsame Gedanken zur geltenden Medienpolitik geäußert. Es war 1965, die SED hatte mit dem 11.Plenum des ZK der SED, breschnewbeflissen, ihre soeben erst gelockerten ideologischen Fesseln wieder enger gezogen. Für Scherzer bedeutete das: Strafversetzung – zur SED-Tageszeitung »Freies Wort« in Suhl. Praxis als Strafe? Thüringen als Testgelände für Freiräume.
»Südthüringer Panorama. Merk-Würdiges zwischen Rennsteig und Rhön« hieß sein erstes Buch, es folgten »Spreewaldfahrten«. Bald erweiterte sich der Radius der Beobachtung: »Nahaufnahmen. Aus Sibirien und dem sowjetischen Orient«. Dafür gab es eine Parteistrafe in der Suhler Redaktion: Scherzer hatte im Vorabdruck im »Freien Wort« beim Schildern der sowjetischen Realität das freie Wort zu wörtlich genommen. Bis 1975 blieb er Tageszeitungsjournalist, seitdem lebt er als freier Autor. Er ist halb freiwillig, halb gedrängt in ein Abseits getreten. Befreit von Karrierezwängen. Entschlossen, den Opportunismus zu begrenzen, dem jeder ausgesetzt war, der sich in der DDR ins Medienwesen begab.
Vor dem Ausstieg freilich: Einsatz und Enthusiasmus. Ein Blick in die damaligen Wochenendbeilagen des »Freien Wortes«, die den Namen »Neues Leben« trugen: Scherzer ist leicht erkennbar als das, was man heute »Edelfeder« nennt. Die Texte groß aufgemacht, ihm gehören die Aufschlagseiten, das Layout prunkt. Die Themen: der Alltag als Exotik. Und als Einsatzgebiet für Ehrlichkeit. Ein Bericht über den »Meiler im Langenbachtal«. Klare Luft dort? »›Wenn der Meiler brennt‹, berichtet einer der Anwohner, ›mache ich meine Fenster lieber zu.‹ Romantik der Natur? Des Meilerwärters Schwiegervater, der vor zwanzig Jahren hierherkam und seinerzeit die Meiler übernahm, starb an einem Lungentumor.«
Bemerkenswerter Satz eines 28-Jährigen: »Der Mensch muss sich vor allem gegen jenen Tod wehren, der ihm von anderen Menschen auf den Buckel gesetzt wurde.« (»Sülzfelder Turmuhrgeschichten«) In einem der Texte ist der Reporter Blutspender. Der Lohn: ein Spenderfrühstück in der nahe gelegenen Gaststätte. »Vor mir auf dem Tisch steht ein Teller mit Leber und Räucheraal. Ich dachte: Das darf doch nicht wahr sein!« Doch: Bürger, spende Blut, »und die DDR ist plötzlich ein Füllhorn!«. Erstaunlich, die Offenheit.
Weniger erstaunlich der Ton der zeitungsbedingten Pflichtteile. Etwa das Porträt eines Lehrers in Suhl: »Wie aus einem Steinbrucharbeiter ein Oberstudienrat wurde«. Der Mann ist Genosse, er gibt zu Protokoll: »Es ist sehr wichtig, dass jeder Pädagoge bei uns einen festen Klassenstandpunkt hat, denn nur dann können wir alle Schüler zu bewussten Staatsbürgern erziehen.« Pathos, inzwischen auch dem Autor peinlich. Aber: im »Don Carlos« schreibt Schiller: »Sagen Sie ihm, dass er für die Träume seiner Jugend soll Achtung tragen, wenn er Mann sein wird.«
Ja, rechtzeitig hat sich der Reporter in die Büsche geschlagen. Ins lebensfrische Gelände neben der genormten Spur. In die belebte Gegend abseits vom Beton der Vorgaben. Wer sich in Büsche schlägt, flieht nicht nur, er wagt sich auch dorthin, wo es sticht und kratzt. In den Büschen ist das Verbergen immer auch ein Sammeln, ein geschütztes Anspannen der Sprungmuskeln.
Auf einem Kolloquium zur literarischen Publizistik, im September 1986 in Halle, notiert der Reporter in sein Tagebuch: »Leben setzt sich aus kleinen Steinen zusammen, die kleinen Steine – ich bin ständig auf der Suche nach ihnen – können dennoch schwer wie Felsblöcke sein … Jede Information, die in die Welt eintritt, neigt zur Selbstverzerrung. Jede zweite Information, die in die Welt eintritt, ist veraltet oder tritt in Widerspruch zur vergangenen. Jeder dritte Information, die in die Welt eintritt, ist eine falsche … Was furchtbar ist: diese Ikonenmalerei bei Beschreibungen von Großbetrieben, dieser Jubiläumsvirus beim Blick auf Städte, Betriebe und sonst was, diese Reiseskizzen, die nur noch ›aus dem Fenster‹ gemacht werden …«
Sein Hauptwerk: eine Art politische Thüringen-Tetralogie. Vier Bücher einer ungeschminkten Umschau. Ende der achtziger Jahre porträtiert Scherzer einen 1.Kreissekretär der SED in Südthüringen: Hans-Dieter Fritschler – »Der Erste«. Nach 1990 dann: »Der Zweite« – so heißt das Buch, in dem er jenen CDU-Landrat Stefan Baldus bei der Arbeit beobachtet, der in Bad Salzungen die Nachfolge von Fritschler angetreten hatte. Scherzer begleitet den ehemaligen Bundeswehroffizier im November 1992, es ist eine skeptische Annäherung. Das Buch offenbart den Gleichlauf der Mechanismen, mit denen der Mensch des umgewälzten Ostens und der weggewälzten Strukturen versucht, sinnvoll zu leben oder wenigstens gut zu leben oder wenigstens zu leben oder wenigstens zu überleben. »… der Kulturhausleiter, der nun einen Erotikshop betreibt; der Stasi-Major, der Versicherungen verkauft; der SED-Bürgermeister, der nun ein Asylantenheim leitet; der Arbeiter ohne Arbeit und der Sachbearbeiter, der die Leute aus dem Westen als ›vollgefressene Kuckucksvögel‹ bezeichnet«, wie Scherzer in einer Reportage schreibt.
Es folgte das Buch »Der Letzte«. Dies klang wie Abgesang und stimmte in gewisser Weise. Zwar bezog sich der Titel diesmal auf Scherzer selbst (er ließ sich als letzter Journalist für die Thüringer Landtagswahl 1999 akkreditieren), aber was er monatelang an Beobachtungen des parlamentarischen Ablaufs notierte, offenbarte am praktischen Beispiel durchaus ein Ende – jenes Mythos nämlich, die repräsentative westliche Demokratie sei der gesicherte Garant einer (selbst)kritischen, aufgeklärten Selbstfindung der Gesellschaft. Eine Idee, ein großer Text – viele Jahre bevor Roger Willemsen 2013 ein Jahr lang die Plenarsitzungen des Bundestags für sein Buch »Das Hohe Haus« verfolgte. Zwölf Monate Protokoll einer Empfindung, wie sie auch bei Scherzer spürbar geworden war: die Einsamkeit dessen, der gleichsam einer Reptilisierung des parlamentarischen Gebarens ausgesetzt ist. So zahlreiche Schutzpanzer, so große Zuschnappgier, so häufige Krokodilstränen, so elende Echsengeduld beim Desinteresse, so variantenreiche Lauerstellungen im trüben Wasser der Selbstgewissheit und Fraktionskumpaneien.
Schließlich erschien »Der Rote« – Beobachtungen an der Seite des ersten linken Ministerpräsidenten in Thüringen, Bodo Ramelow. Ein Buch über wohltuende, unideologische Wege linker Politik – hin zur praktizierenden Mitte. Mitte, wo ist das? Wo jenseits einer weltbildfesten Oppositionsbeharrung natürlicher Abrieb stattfindet und Wahrheitenaustausch.
Anfang 1988 hatte sich Scherzer Schreibblöcke im DIN-A4-Format gekauft, unliniert, jeder Block eine Woche; er schreibt zwei Jahre lang Tagebuch, klebt DDR-Zeitungsausschnitte hinein, kommentiert sie, ein privat bleibender Kummerkasten, ein Spiegel der ablaufenden Tage, aber was da abläuft, er ahnt es, sind mehr als Tage, hier läuft auch eine apathische Zeit ab.
»25.Januar 1988: Ich lese in der Zeitung, was im moçambiquanischen Dorf Monhica geschah: elf Menschen von Banditen ermordet, 28 Menschen schwer verletzt, die Apotheke des Krankenhauses zerstört … In diesem Krankenhaus wurde ich 1982 nach einem Autounfall verarztet. Vielleicht lebt, wer mir damals geholfen hat, nicht mehr. Ein kleines Hospital in einem schattigen Park. Eine lange Wartebank vor dem Behandlungsraum. Vielleicht zwanzig Menschen saßen, etwa vierzig standen. Ich erinnere mich an die Höflichkeit, die mir peinlich war. Eine Frau, deren Kleinkind von Eiter verklebte Augen hatte, bot mir ihren Platz an, auch ein Mann, dessen Arme verbrannt waren. Die Freundlichkeit anzunehmen war mir so unangenehm, wie sie abzulehnen. Ich setzte mich und kam lange vor denen dran, die schon lange ausharrten. Wieder dieses beklemmende Gefühl. Ich saß im Behandlungszimmer auf einem zerschlissenen Ledersofa. Ein Glasschrank fast ohne Instrumente, ein Arzneischränkchen fast ohne Medizin. Über einem gusseisernen Küchenabflussbecken wuschen mir zwei Frauen das Blut von Kopf und Arm. Zusammen mit dem Gesundheitshelfer versuchten sie, meinen Kopf zu scheren. Ich müsse entschuldigen, sagte der Helfer, solche dünnen weichen Haare hätten sie noch nie geschnitten, ihre afrikanischen seien härter. Die Glassplitter zog er mit einer großen Zahnarztzange heraus, eine der Schwestern hielt meinen Kopf, aber so leicht, dass es wirklich nur psychologische Bedeutung hatte. Das Desinfektionsmittel brannte, Binden gab es nicht. Verbunden wurde ich mit Watte und viel Pflaster als Befestigung. Mir schien, meine Helfer schämten sich ein wenig für das Primitive der Ausrüstungen, aber ich spürte auch den Stolz, ausgebildet worden zu sein, uns also überhaupt helfen zu können … Und jetzt diese Nachricht des Überfalls. Wie ein tiefer Sturz, ein Ideensturz: Ein paar Banditen genügen, um in mir die Frage wühlen zu lassen, ob das Gute wirklich siegreich ist.
26.Januar 1988: Ich sollte bei den ›Tagen der Landjugend‹ in Frauenwald lesen. Ich kam mir dort vor wie ein Kellner, der um Trinkgeld bittet. Man schickte und schubste mich rum, bis mir ein FDJ-Funktionär sagte, leider seien keine Leute für die Lesung organisiert worden. Ich stehe rum. Eine Stunde Fahrt durch den Nebel zurück. Die Arroganz und Unkultur der FDJ-Vertreter ist System: Wer am Hebel sitzt, tut allmächtig und erlaubt sich jede Willkür. Der Mensch im Mittelpunkt? Der Funktionär! Walter Werner war in Österreich, hat einen Text darüber geschrieben und versucht, ihn im ›Freien Wort‹ unterzubringen. Vergeblich. Man bringt einen bekannten Dichter, einen Meister, in die Situation, sich wie ein Lehrling kleinzumachen und zu bitten, zu bitten, zu bitten.
Große Meldung in der Zeitung: ›Erich Honecker übermittelt brüderliche Grüße zum 70.Geburtstag an Nicolae Ceauşescu.‹ Wann werden wir erfahren, was dieser Mann seinem Volk angetan hat? Mit Hunger, Stromsperren, fehlender Heizung. Ein Stalin Rumäniens?
Natürlich berichten wir in unseren Medien ausführlich und aufmunternd über kritische Geister und wie sie sich um einen reformierten Sozialismus bemühen und für Offenheit streiten. Wir formulieren das nur etwas anders: ›Das gegen den Sänger Stephan Krawczyk wegen krimineller Handlungen laufende Ermittlungsverfahren wurde inzwischen nach Feststellung von Verbindungen zu geheimdienstlich gesteuerten Kreisen in Westberlin wegen landesverräterischer Beziehungen erweitert.‹ Wir sind ein Land des einseitigsten Sports der Welt geworden: Man kann nur immer den Kopf schütteln …
27.Januar 1988: Große Runde gedreht: mein Manuskript ›Der Erste‹ in Betrieben abgesprochen. Alle Parteisekretäre waren einverstanden. Gut sei, dass Probleme offen benannt würden. Das würden sie jeden Tag auch versuchen, soweit möglich. Die Basis der Partei drängt auf ehrliche Atmosphäre – man will nicht mehr länger von oben agitiert werden, nötig ist, ›die da oben‹ aufzuklären über die Lage. Der Parteiapparat läuft auf quietschenden Hochtouren für den fortwährenden Stillstand. Im Glaswerk Immelborn muss der Parteisekretär über einen Arbeiter berichten, der zu Besuch in die BRD will. Einstellung zur Arbeit, zum Kollektiv – die Stasi will das wissen. Der Parteisekretär wehklagt: ›Eine Zwickmühle!‹ Denn: Befürwortet er die Reise und der Mann bleibt drüben, wird er durch die Mangel gedreht. Lehnt er ab, und der Arbeiter stellt vor Zorn einen Ausreiseantrag, droht die Mangel auch. Wir sind Inquisiteure unser selbst. Wie wäre es einfach mal mit Vertrauen!
29.Januar 1988: Bezirkstagung unseres Schriftstellerverbandes. Walter Werner fehlt. Er sei, so heißt es, überlastet. In Wirklichkeit will er nicht (mehr) im Präsidium sitzen. Er kann Nähe zu bestimmten Leuten nicht mehr verkraften. Ein Sekretär von der Bezirksleitung sehr schwach in der Diskussion. Schwitzend und hochrot im Gesicht pochte er darauf, die DDR habe keinerlei Nachholbedarf in Sachen Demokratie. Gegrummel. Nach der Sitzung eine halbe Stunde Diskussion mit ihm auf dem Flur über mein Manuskript ›Der Erste‹. Ihm fehle im Buch der große Atem. Ich sagte, wo soll der herkommen, wir hecheln. Er schöpfe keine Kraft aus dem Geschriebenen. Klartext: Er braucht das Doping der Selbsttäuschung. Das Rezept wahrscheinlich: sein ND-Abonnement. Während unseres Streits stehen Leute um uns herum. Einer sagt, na ja, immerhin auch ein Zeichen für Öffentlichkeit, wenn nicht mehr nur hinter Türen, sondern schon auf Fluren gestritten wird. Mangel macht bescheiden im moralischen Anspruch.
30.Januar 1988: Die Skinhead-Gruppe von Bad Salzungen ist verhaftet worden. Es hätte genaue Pläne gegeben, welche ›FDJler, Polen und andere Kommunistenschweine‹ zusammengeschlagen werden sollten …
15.März 1988: Schneerekorde für März in Thüringen! Im Ort wird kaum geräumt, weil die zwei aus dem Dorf, die einen Traktor besitzen, angeblich die Schneeketten verlegt haben. In Wirklichkeit sind sie der Meinung, zu wenig Geld für die Räumhilfe zu bekommen.
10.April 1988: Gastspiel des Coburger Theaters in Meiningen. Die Techniker empfangen ihre Kollegen mit einer Bratwurstfete. Coburg spielt den ›Marat‹ von Weiss. Erst gemäßigter Applaus, dann die große deutsch-deutsche Verbrüderung. Fünfzehn Minuten gemeinsamer Beifall, auf der Bühne, im Saal. Beim anschließenden Bankett geht es weiter mit der Herzlichkeit. Der anwesende Chef des Bayerischen Landtages und der Oberbürgermeister von Coburg dürfen laut Anweisung der Bezirksleitung nicht offiziell begrüßt werden. So heißt es beim Empfang nur: ›Verehrte Kollegen …‹ Ist ja eigentlich noch schlimmer! Mir untersagt man, den Coburger Intendanten anzusprechen (wegen eines Anlaufpunktes für eine Reportage über bayerische Grenzorte). Der Abend zeigt: Die Barrieren zwischen Künstlern der DDR und der BRD sind nicht so hoch wie die zwischen DDR-Künstlern und ›ihren‹ politischen Funktionären.
27.April 1988: Große Runde im Greifenverlag zum ›Ersten‹. Eine scharfmacherische Lederjacken-ZK-Mitarbeiterin (›Ich weiß, wovon ich rede, ich habe selber in einer Kreisleitung gearbeitet‹) und eine Beckmesserin aus dem Höpcke-Ministerium versuchen, das Manuskript in einer Fünf-Stunden-Diskussion grundsätzlich zu diskreditieren. Leider schweigen die Leute vom Verlag. Ich verteidige mich fast allein.«
Oftmals bleibt er als Autor allein. Kämpft allein. Schreiben auch als ein Abenteuer der Einsamkeit.
Scherzer ist ein Witterungsbegabter für Umbrüche. Nach dem Ende der DDR versucht sich der Reporter – zum Schein – als Treuhand-Nutznießer, bewirbt sich in der Nähe von Gera als Käufer eines ehemaligen Rittergutes, im Wartburgkreis als Käufer eines Schlösschens. Taucht auch an anderen Industrieorten des Ostens ein in die Welt aus kalt regierendem Geld und sozialem Kahlschlag. »Eine Art Wallraff ohne Maske«, schreibt »Der Spiegel«.
Er hat Prostituierte in einem Thüringer Dorf aufgesucht, begab sich im sächsischen Radebeul auf die Spur plötzlich hereinstiebender Immobilienjäger. Er schreibt: »Durch die Marx’sche Lehre bekam ich ein haltbar gestörtes Verhältnis zum Drang nach immer mehr Eigentum. Zu tausend Hektar noch tausend Hektar? Zu einem Dutzend Eigentumshäusern noch ein Dutzend?«
Scherzer nähert sich den Leuten, um in die Wahrheit ihrer Lebens-Läufe zu schauen, in all das Wilde, Wüste, Weiche, Wühlende, Wattige, Wetterfeste ihrer Beweggründe und Abgründe. Vertrauen ist ein Schlüsselwort zur Erklärung dessen, was sich zwischen diesem Reporter und seinen Gesprächspartnern vollzieht.
Was ihm fehlt, ist die Kühle eines distanzierten Aufrechners. So betrat der Autor zum Beispiel manchen Ort der geliebten, dann brüchigen Sowjetunion, wie ein Erwachsener das einstige eigene Kinderzimmer betritt: mit Herzklopfen und der wehmutsvollen Entdeckung, dass in den aufgeräumten Ecken, wenn man genauer hinsieht, doch noch Traumreste liegen.
Das Werk dieses Autors geht in die Tiefe. Nach unten, wo die Träume dunkeln, wo sie es schwer und schwerer haben mit jener unbeschwerten Helle, die oben propagiert wird. Zwischen Suhl-Heinrichs, wo einst Wohnheime der moçambiquanischen Gastarbeiter standen, und Kazims Dönerbude im Erfurter Bahnhof, zwischen russischem Wolgograd und tschechischem Pec bewegt sich Scherzer als Arbeiter gegen den anteilnahmelosen Raum, bewegt sich als Anwalt jener »schlaflosen Welt«, die für Stefan Zweig innerste Heimat des Reisenden zu sein habe. Weil »vom Nahen zum Fernen unsichtbare Fäden der Liebe und Besorgnis schweben«; keiner ist schließlich allein mit sich und seinem Schicksal.
Als der Theatermann Einar Schleef Ende der siebziger Jahre aus der DDR in den Westen ging, konnte er eines nicht verwinden: in Frankfurt (Main) über Obdachlose steigen zu müssen. In seinen Tagebüchern schreibt er: »Ich habe mich nicht daran gewöhnt, und ich werde es nicht tun, und ich hasse die gönnerische Gelehrsamkeit der Intelligenzler hier, die mir helfen wollen, indem sie mir ihren Zynismus als Lernprozess verklickern.« An dieses Empfinden erinnern manche Reportagen Scherzers.
In seinen Reportagen nimmt er sich selber immer wieder auf eine Weise zurück, die staunen darüber macht, welche Spannung Lakonik und Sachlichkeit erzeugen können. Sein Arbeiten hat Straßenstaub und Grassamen an den Schuhen. »Was für ein geschickter Geschichtenerzähler« (Ostthüringer Zeitung). Die Schriftstellerin Ruth Kraft sah »die Normen des üblichen Reportageschreibens« durchbrochen. Schriftsteller Peter Gosse stellt in seiner Laudatio zum Walter-Bauer-Preis fest, dass Scherzer sich in die Welt »zart verbeiße«, seine Kunst sei »Sicht, nicht Ansicht«. Günter Wallraff bescheinigt dem Reporter, er behandele Menschen in seinen Texten »liebevoll, ist oft verwundert, sogar fassungslos, nie hasserfüllt. Selbst die miesesten Gestalten seiner sozialkritischen Erkundungen, politische Schaumschläger und Betrüger, windige Wendegeschäftemacher, mehrfach gewendete Wendehälse, führt er nicht als verabscheuungswürdige Schurken vor, vielmehr in ihrem Spielraum und in ihrer Rolle oft als konsequent handelnde Erfüllungsgehilfen und Handlanger vorgegebener Entscheidungen.«
Im »Freitag« schreibt Regina General: »Scherzer sucht nicht nach Schuldigen, aber erspart niemandem die Verantwortung.« Von »wetterfestem Holz« sei dieser »Graukopf« – Scherzer zeige: »Neureich und Neuarm wohnen dicht beieinander«. Erich Loest in der FAZ. Des Reporters »Leitstern ist Toleranz, aber manche sehen in ihm eher einen Moralisten, der in jedem Staat der Welt anecken würde«, Fazit eines Porträts in der »Neuen Zürcher Zeitung«. Seine Lageberichte aus den Niederungen des politischen Alltags, urteilt der Soziologe Wolfgang Engler in der »Berliner Zeitung«, erinnerten daran, »dass die Befreiung der Politik auch nach dem Ende des Staatssozialismus auf der Tagesordnung steht«. Im »Spiegel« zu lesen: Scherzers Reportagen seien »Geschichtsschreibung von unten«. In der »Thüringischen Landeszeitung« notiert der Jenaer Literaturwissenschaftler Martin Straub: »Geht der Sachse einen Umweg, sagt er, er mache einen Umbogen. Der gebürtige, wenngleich akzentfreie Dresdner Landolf Scherzer baut auf Umbögen und zufällige Begegnungen – als erzählerisches Lebensprinzip.«
Er weiß, was Zensur heißt – obwohl er in der DDR alles andere als ein Dissident war. In seinem Archiv stapeln sich unveröffentlichte Texte. Vergilbt. Aufgegeben. Vergessen fast. Auch Hörspiele hat er geschrieben. Eines hieß »Kirschblüten«. Ein SED-Kreissekretär beklagt den Tod seiner Mutter. Eine alte Frau aus der Nachbarschaft leistet ihm bei Trauer und Schnaps Gesellschaft. Das Hörspiel wird wegen Stellen wie der folgenden nicht gesendet:
»Olaf: Keiner kommt mehr. Dieses Haus ist ein Totenhaus geworden. Es schimmelt schon überall. Aber ich bin doch mal einer von allen gewesen. Hier, meine Hände.
Die alte Gädicke: Trink nicht den Fusel, nimm Saft von der ausgepressten Kalmuswurzel.
Olaf: Kalmus?
Die alte Gädicke: Wächst noch drüben in Schwarzhausen. Hier nicht mehr. Hast ja den Waldsee zuschütten lassen. Der Waldsee … Forellen schwammen drin, und die Kinder stakten mit selbstgebauten Flößen. Die Birken am Ufer zündeten im Herbst einen Feuerrahmen an. Und unter der Böschung Rotkappen, so groß wie Salatköpfe. Ich hör noch deine Stimme von damals …
Olaf (verzerrte Lautsprecherstimme): Liebe Genossen, liebe Einwohner, wir wollen heute über das Problem des Waldsees miteinander beraten und beschließen. Wir müssen den See zuschütten, weil wir einen Parkplatz brauchen. Diesen Parkplatz brauchen wir, weil auf dem Ochsenberg, wo die Kirschplantage steht, zwei große Gästehäuser gebaut werden sollen.
Die alte Gädicke: Nur der Bäckermeister fragte damals noch …
Bäcker (Lautsprecherstimme): Und Kirschen, wo kriegen wir dann frische Kirschen her?
Olaf (Lautprecherstimme): Leute, das ist doch gar kein Problem. Die Personen, die in den Gästehäusern wohnen werden, die haben überallhin Verbindungen. Ein Wink von ihnen genügt, und unser Dorfkonsum bekommt eine Sonderzuteilung aus der Bezirksstadt.
Egon (Lautsprecherstimme): Unsere Kinder können nicht mehr auf Bäume klettern und sich die Bäuche vollschlagen.
Olaf (Lautsprecherstimme): Ist ja auch ungesund, ungewaschenes Obst.
Die alte Gädicke: Du hast gelacht und eine Saalrunde bestellt. Die meisten ließen den Korn stehen.
Olaf: Aber ich habe später gesehen, wie der Wirt die Schnäpse in die Flasche zurückgekippt hat. Doppelter Gewinn.
Die alte Gädicke: Kirschen gab es in den Jahren danach niemals mehr, auch im Konsum nicht. Und den Tumult auf der Versammlung hast du ausgehalten, als wäre das der wahre Mut. Und dann wurde der Parkplatz durchgesetzt. Sozusagen einstimmig, mit einer einzigen Stimme nämlich, der Stimme deiner Partei – die in dem furchtbaren Moment damals du warst. Nur du. Die Macht. Hast du wegen solcher bösen Siege angefangen zu saufen?«
Der »Rheinische Merkur« schrieb zum Buch »Immer geradeaus. Zu Fuß durch Europas Osten«, das 2010 erschien: Scherzer sei »ein wandernder Handke für die Erweiterte Oberschule«. Das ist Anerkennung, versehen freilich mit einem Peitschenschlag Ironie. Auf der einen Seite Lob für eine gespannte Aufmerksamkeit im Unterwegssein – auf der anderen Seite aber der spitze (abfällige?) Verweis auf angebliche Belehrung und Pädagogik.
Mit Handkes Literatur hat Scherzer so gar nichts zu tun. Überhaupt nichts! Besucht man Scherzer aber in seinem Arbeitshäuschen und kennt Fotos von Handkes Haus bei Paris, so stellt sich durchaus – ich behaupte es mit der Lust, etwas zusammenzuzwingen! – das Gemeinsame einer so beeindruckenden Geländenahme her: die besagte Verwunschenheit und das »Balkanische« (ein Handke-Wort) der unaufgeräumten Ecken und vollgestopften Winkel; das mehr und mehr Zuwachsende gegen die Durchblicke in Baum- und Buschwerk, hochschießend und tiefhängend.
Innen und außen – alles in einer Ordnung, die als solche funktionieren, aber gefälligst nicht prahlen möge. Eine solide Bauart in Liaison mit Wellblech und flatternder Plane. Die Gießkannen hängen, als seien sie Leihgaben von einem russischen Gartenzaun. Kein Geschirrspüler im Haus und die Badewanne im Wald. Jede Wand drinnen eine Pinnwand, auf Schiefertäfelchen die Pläne der nächsten Tage: wo zu jäten, was zu reparieren, wie viel zu besorgen sei. Am Hauseingang, hinterm Vorhang, derbes Schuhzeug. Das Provisorische hat hier eine Feste; gewissermaßen hat sich der Bauer mit dem Wanderer eine kleine Bleibe geschaffen. Die der Schriftsteller nutzen darf.
Hier begreifst du: Gras und Blume brauchen keine Dichter. Was für die Reportage strafbar wäre, gereicht dem Gärtner zur Ehre: Beihilfe zur Schönfärberei.
Der notorisch Bewegte: Er liebt es dennoch, wie angewurzelt vorm Haus zu sitzen, ins Ferne zu blicken – und Pläne zu machen. Die meinen das Schreiben und die längst fällige Beetpflege. Oder irgendeine Handwerkerei. Noch mehr aber mag er den Gegenplan, der die immer wieder zu beklagenden Versäumnisse des Planens in neue Konzepte gießt. Am meisten aber mag er die Ofenbank, auf der sich von allen Planspielen wunderbar ausruhen lässt.
Der Blick aus dem Arbeitshäuschen geht hinaus ins Tal. Ein sehr schöner Blick. Drüben der nahe Hang, datschenbestückt. Auf der Wiese weiden zwei schottische Hochlandrinder. An den sehr frühen Morgen, wenn der Schriftsteller ins Dorf geht, die Post zu holen, füttert er die Tiere mit Gemüseresten und Obst. Und immer, sagt Scherzer, rede er mit ihnen. Scherzer spricht, die Tiere schweigen zurück. Jedenfalls sagen wir Fremden dazu: schweigen. Aber was wissen denn wir.
Draußen im Geäst schreien Vögel, wahrscheinlich aus Freude, dass wir sie nicht sehen können. Und keiner der fast schwarzen Bäume, so denke ich plötzlich, möchte in der Stadt leben. Ich möchte wissen, ob man hier die Zeit spürt, so wie man den Sturm spürt und die Hitze und das Wasser. Den frühen klaren Wintermorgen – so es ihn noch als Schneefülle gibt – stelle ich mir vor wie in Versen von Hans-Jürgen Döring, dem Dichter, von Scherzer gemocht und geachtet, er wird im Buch »Der Letzte«, für den Reporter überraschend, in der Politik auftauchen: »Aus dem kleinsten Riss / herausplatzen / ins blutige Licht // Jeder Schritt / neben / der Zeit«.
Das Unkraut. Auch im grünen Reiche Scherzers ist es siegreich. Und obwohl es beim Obst- und Gemüsegärtner um die Zähmung des Widerspenstigen geht, sehe ich just im Unkraut etwas vom Kern jenes Lebens, das dieser Reporter führt. Winzige Wildheit und uralte Kraft. Das Unkraut ist der wahre Botschafter alles Natürlichen. Es ist das Existenz-Gleichnis schlechthin: Niemand verlangt nach ihm – aber es wächst; keiner schenkt ihm zusätzlichen Regen – aber es grünt; wo Erde verwundet wurde – da blüht es zuerst. Wer das Unkraut fürchtet – der fürchtet dessen Fruchtbarkeit.
Scherzer ist Ordnungshüter der Beete und Bäume. Er hegt und pflegt. Kreislauf von Aufblühen und Verwitterung. Der Garten füllt sich durchs Jahr mit einer nutzbringenden Schönheit, an dem Gärtner und gemeine Fliege, Wind und Regen, »die Bienen und von mir aus auch ein mir unbekannter und ferner Gott zugleich gearbeitet haben«. Tag und Nacht, Monate hindurch, ohne Ziel – »wenn nicht eines Tages ich herantrete und die Tomate pflücke«.
Sitzt du draußen am Tisch und schaust, da muss dir selbst der Reporter gestatten, dass du mal kurz Abschied nimmst vom Realen im Sozialen – und die Exerzitien der Anschauung genießt. Poesie des unrasierten Gartens, gesetzt gegen die Durchrationalisierung der Hirne und gegen unser verfluchtes »Gewusstwie und Gewusstwo, unsere Programme, unsere Abkürzungen, unsere Geheimnummern, unsere Zweit- und Zehntwohnungen« (Handke).
Der Reporter ist, zu seinem Glück, mit dem Zwang begabt, die schönen Dinge mit jemandem teilen zu wollen, zu müssen. In seiner unmittelbaren Profession ist dieser Schreibende ein Gefühlsgezügelter, aber er hat seine Frau, Ellen. Sie arbeitet als Projektmanagerin eines literarischen Vereins in Erfurt. Täglich zwischen beiden: Telefonate. Und täglich originell gestaltete und beschriftete Ansichtskarten in die Landeshauptstadt. Er nennt seine Frau »Löwin«, sie malt und zeichnet, das Schreibhäuschen ist auch eine Galerie.
Seinen gesamten Vorlass hat der Schriftsteller dem Staatsarchiv Meiningen übergeben. Dutzende Kartons, die meisten bereits ausgewertet, geordnet. Manuskripte, Reden, Notizen, Artikel, Fotos. Scherzer begleitet mich in die ehemalige Residenzstadt. Ich lese in den Stapeln, er aber hält es inmitten der »verstaubten Sachen« nicht lange aus.
Als er sieht, wie ich alte Fragebögen für Zeitungen und Bücher durchblättere, winkt er unwirsch ab. »Krimskrams. Mir fehlt die Ironie für solche Spielchen. Ich nehme jede Frage ernst – und wirke rasch bieder. Weg damit! Blätter’ weiter!« Nein, ich lese.
»Was macht Sie verlegen?
Wenn ich so unbeherrscht rede, dass eine Frau die Augen senkt.
Was war Ihr aufregendstes Erlebnis?
Habe ich in irgendeinem meiner Bücher aufgeschrieben.
Was machen Sie nur heimlich?
Marzipan essen wie Brot.
Wofür möchten Sie endlich mal genug Zeit haben?
Schuppen aufräumen, Bäume fällen, Holz hacken, Plane fürs Beet imprägnieren.
Welche Person der Zeitgeschichte würden Sie gern mal zum Essen einladen?
Niemanden. Ich lade nur Freunde ein.
Wen oder was würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen?
Den, die oder das, was mich nach einer gewissen Auszeit wieder von der Insel runterbringt.
Ihr wichtigstes Buch?
Das Geheimalbum meiner Feigheiten.
Denken Sie schon an eine Lebensbilanz?
Damit kann ich nicht dienen, ich bin kein Buchhalter.«
Zurück in Dietzhausen. Gespräche und Gastfreundschaft. Sie ist das Resultat einer geradezu unbarmherzigen Röntgenaufnahme des Gastes. Wir reden tagelang, er weiß irgendwann, was ich gern esse, was nicht, Zwiebeln oder nicht, soßendurchweichtes Brot oder nicht, er kriegt – feinfühligst! – heraus, ob du dünnen oder starken Kaffee trinkst, er sieht dir an, ob du den Salat gleich auf den Teller oder in ein Extraschälchen willst … immer möchtest du ihm Küchenarbeit ersparen, aber da hat er schon bei dir zu Hause angerufen und genau recherchiert, wie das mit deinen Frühstücks-, Mittags- und Abendbrotgewohnheiten bestellt ist. Irgendwann kapitulierst du, lässt dich bedienen, dass es kaum aushaltbar ist, sagst ein Dankeschön, für das er dich sofort rüffelt: »Wofür denn?!« Landolf, der Dietzhäuser Russe.
Was er tut, hat oft im wahren Sinn des Wortes Hand und Fuß. Die Finger zum Essen, die Füße zum Gehen. Wenn schon Messer auf dem Tisch, dann Holzgriff und matt geworden der Stahl der Schneidefläche. Als müsse noch das kleinste zivile Werkzeug eine Verwandtschaft von Sichel und Sense aufweisen. Seit seiner Reise nach Afrika vor fast vier Jahrzehnten hat er unterwegs ein Taschenmesser bei sich, aber kein Besteck. »Die Finger waren der erste Löffel des Menschen«, ein Spruch, den er aus Moçambique mitbrachte.
In diesem Haus geht das Rustikale frontal auf deine Sinne zu, der Kerl hat Kraft. Achte bei Umarmungen auf deine Rippen. Andererseits: Er ist kein Mann des Überschaums. Er klagt nicht laut über Schmerz. Er ist der Indianer, den die Kinderspiele übrig ließen. Das Ruppige gut trainiert. Das Offenherzige kühn durchgehalten. Im Gegerbten die Durchlässigkeit bewahrt.
Intensive Begegnungen mit Landolf Scherzer. Ein Reden wie das Unterwegssein: Sprünge, Innehalten, Umweg, erneut Sprünge. Gespräch ist Gewebe, der Riss darin lockender als das Muster. Auch das Zickzack gehört zur Zielgenauigkeit. Bruchstücke und Bögen. Seltsame Veränderung: Der Meister der schriftlichen Selbstzügelung wird im ausführlichen Gespräch, im zyklischen Umkreisen von Erkenntnis und Erfahrung formulierungsoffen, als geschehe Aufenthalt nun außerhalb jenes gewohnten Schutzraumes, dessen Auftrag Abwehr und Vorsicht ist.
Hochkonjunktur unter Reportern hat heutzutage das mediale Doppelspiel von einnehmender Freundlichkeit, die ein Gegenüber öffnen möchte, und jenem öfters anzutreffenden Hinterhaltstrieb, der dieses Gegenüber immer auch ein wenig bloßstellen, ausnehmen möchte. Es wächst allenthalben der journalistische Mut, Menschen aus dem Schutz ihrer eigenen Geschichte zu vertreiben. Das Lädierte des Berufs besteht vielerorts in der Auffassung, dass jeder Tag eine Sensation haben könne und haben müsse. Das schafft in Medien eine Spirale unablässiger Steigerungsformen. Berichterstattern treibt’s permanent den Schweiß auf die Stirn: Bin ich dran, bin ich drauf, bin ich topp, bin ich cool? Überall Zerstreuungsfieber, ein Hoch- und Abschießen von Menschen, Meinungen, Mentalitäten. Das war Scherzers Sache nie.
Über den konservativen Reporter zu schreiben, das heißt also: eine Biographie gegen jene Kultur des neuen Jahrtausends zu setzen, die alle Aufmerksamkeit für ein Thema mit dem geschickten Ausnutzen bestimmter Wellen verbindet, um darauf mitzureiten. Scherzer reitet nicht mit. Er sagt von sich: »Ich bin ein Dinosaurier.«
Ich weiß nicht, wo genau Reportage in Literatur übergeht. Ein guter Reporter erzählt jedenfalls eine Geschichte, ohne über sie zu siegen. Eine Geschichte, die in der Zeit lebt – und ihr zugleich ein wenig entkommt. Eine Geschichte, in der Menschen nicht schlechthin dargestellt werden, sondern einem aufgehen. Und dann in einer Erinnerung bleiben, die mit einem selbst zu tun hat.
Wir träumen das Meer und kommen nicht über die nächstbeste Pfütze. Um damit auf »Fänger & Gefangene« zurückzukommen: Leben auf dem Schiff wie in einem Gefängnis, aber im Hochgefühl einer Solidarität, die sich fest (und manchmal unerwartet) hoch aufrichtete. Gegen die Kälte von Natur und Soziallage. Scherzer sah im Hafen trotz der hässlichen, zerbeulten Schiffe doch immer – Heimat. Besser gesagt: das Leben. Die wahrhaftigste Botschaft des Abenteuers, sie zielt gar nicht so sehr auf Kraft, sondern – paradox? – aufs Ereignis der Verwundbarkeit.
Landolf Scherzer: als Wirklichkeitssüchtiger ein Gefangener und doch immer wieder Fänger. Im Netz: Geschichten.
Frank Quilitzsch »Ja, aber …« – »Aber ja!«
Als wir nach einer halben Stunde aus der Vier-Millionen-Stadt Kiew heraus sind, wird der smoggraue Himmel blau. Die Birken rechts und links neben der Fernverkehrsstraße schmückt junges Grün. Aber auf fast jeder der Weißstämmigen wachsen Misteln. Schmarotzer. Kilometerweit nur Felder und Wiesen. Nach einer Stunde sehen wir die ersten wie von einem bösen Fluch verwunschenen Holzhäuschen in der verstrahlten Gegend von Tschernobyl. Aus den Dächern wächst Baumgesträuch. Vor den glaslosen Fenstern wehen Gardinenfetzen wie Schleier im Wind. Auf der Fernverkehrsstraße warnt ein Schild: »Vorsicht Fußgänger!« Aber kein Autofahrer muss hier noch vorsichtig sein. Hier lebt niemand mehr. Inmitten der Häuschen, deren Farbe abgeplatzt ist, strahlt in ihrer Buntheit lediglich noch die Kirche. Davor steht ein Schild: »Auch Gott hat uns verlassen.«
Landolf Scherzer, aus »Das Sarggeld von Uljanowna«, 2009
1.
Seit Minuten quält sich der Wagen eine Anhöhe hinauf. Die tief stehende Sonne blendet, ich habe Mühe, die Augen offen zu halten. Mein Beifahrer ist still in die Thüringer Landschaft vertieft.
Ich leiere die Scheibe hinunter und lasse mir den Fahrtwind um die Nase wehen. Es hilft nichts, ich muss schon wieder gähnen.
»Mach doch Musik an«, sagt Landolf Scherzer.
Das Radio bietet nur Popschnulzen oder Geschwätz.
»Moment.« Ich lange ins Handschuhfach, wo die CDs liegen, und finde auf Anhieb die richtige.
»You see them in Old Havana«, ertönt Allan Taylors sonorige Stimme, »playing cards, smoking cigares …« Ich spüre, wie mein Nebenmann die Ohren spitzt. Landolf hat den Takt instinktiv aufgenommen, trommelt ihn mit den Fingern auf den Oberschenkeln mit. Dann der Refrain: »Once we were bold compañeros«, raunt der Sänger, »Running guns from the Florida keys. / On the beach from Santiago to Cuba, / We were fighting …«
»… with Fidel and Che«, stimmen wir lauthals ein.
Fidel Castro und Che Guevara, die »bold compañeros« – wie soll man das übersetzen: kühne, mutige, verwegene Kameraden?
Kuba ist schon immer sein Traum gewesen. Ein Ort, an dem das Feuer der Revolution noch glüht? Wo die Helden der Jugend nicht altern und die Hoffnung als Allerletztes stirbt? Als mir Landolf Scherzer bei dieser Autofahrt – vor Jahren – seine Reportageprojekte aufzählte, war auch Kuba dabei.
Dann ging alles ganz schnell. Viel schneller als gedacht.
Scherzer landet in Havanna, und am nächsten Morgen ist Fidel Castro tot.
Meine Ergriffenheit weicht einem Gefühl der Freude: Was für ein Einstieg in die Reportage, denke ich. Der Ankömmling erlebt Kuba im Ausnahmezustand – ein ganzes Volk in Trauer. Klar, nur wenige Meilen nordwärts, in Florida, USA, wird gejubelt. Dort tanzen die vor dem Regime geflohenen Emigranten. Zwei Welten, wie sie unterschiedlicher nicht sein können.
Fidel Castro hat mit den compañeros den Diktator Batista gestürzt. Er verjagte die US-Invasoren aus der Schweinebucht. Und auch er unterlag den Mühen der Ebene. Kamerad Che stahl sich fort in die bolivianischen Berge.
»Once we were bold compañeros …«
2.
Landolfo, wie ich Freund Scherzer seit seiner Kuba-Reise 2017 nenne, ist in der Welt herumgekommen. Doch er ist kein Weltenbummler, weder will er Rekorde aufstellen noch sich etwas beweisen. Gut, als Willis Traktor vor der Osteuropa-Erkundung ausfiel, ging der Ehrgeiz mit ihm durch, da wollte er es allein und zu Fuß schaffen. Da schloss er sogar mit einem Kellner in Harkány eine Wette ab. Es ging um zehn Flaschen ungarischen Weins, die er am Ende auch gewann.
Aber eigentlich lässt sich Landolfo von seiner Neugier und seinem Gewissen leiten. Um zu ergründen, was die soziale Welt im Innersten zusammenhält. Und wenn er dabei auf Mitstreiter stößt, Gleichgesinnte, Freunde, compañeros eben, ist er glücklich, was man seinen Berichten auch anmerkt.
Zwar spielt ihm der Zufall oft die schönsten Geschichten zu, doch ohne Plan geht er keinen Schritt. Auch die Kuba-Reise folgte einem Plan, den er in seinem Waldhäuschen in Dietzhausen ausgetüftelt hatte …
Erst nach seiner Rückkehr erfuhr ich, dass er als »Briefträger« nach Havanna geflogen war. Einige Wochen vor seinem Abflug hatte er einen Leserbrief für die Lokalzeitung verfasst: »Wen soll ich in Kuba grüßen?« Daraufhin meldeten sich viele und vertrauten dem Reporter Briefe an, die er persönlich überbringen sollte. So knüpft man Kontakte in ein fremdes Land. Die Leute gaben ihm Dinge mit für Freunde und Verwandte: Gitarrensaiten, die auf Kuba Mangelware sind, oder Kabelbinder für die Auspuffe der maroden Limousinen. Einen Scheck über 30000 Euro für die Opfer eines Hurrikans. Rezepte für das einzige vegetarische Restaurant auf der Insel. Die Mitbringsel haben compañero Landolfo die Türen zu den Kubanern geöffnet, vom hohen Beamten im Tourismusministerium bis zum Köhler und Tabakbauern im abgelegenen Dorf.
Und Fidel?
Als Castros Tod im Radio verkündet wurde, habe er, so Landolfo, keine lähmende, sondern eine sehr lebendige Trauer erlebt. Dennoch blieb ein Zwiespalt: War der Staatsmann Fidel Castro noch ehrlich, wenn er mit allen Mitteln die Errungenschaften der Revolution verteidigt hatte? War er gerecht oder schon selbstgerecht? Das habe er die Kubaner gefragt. Einer gab ihm zur Antwort, in Kuba sei niemand verhungert. Ein anderer, mit Fidel habe man die Blockade überlebt. Und einer meinte, Fidel, Che und ihre engsten Mitkämpfer seien sehr jung gewesen, als sie den verhassten Diktator stürzten. Wegen ihrer Jugend verzeihe man ihnen so manchen Fehler.
»Once we were bold compañeros …«
»Warum Kuba jetzt?«
Landolfo zögert einen Moment.
»Vielleicht«, sagt er, »weil ich keine Lust habe, später noch einen Zusammenbruch vor Ort mitzuerleben.«
3.
Einer fehlt. Wir merken es bereits bei der Suche nach der richtigen Kneipe. Keiner will die Führung übernehmen. Mal geht der Literaturmanager Martin S. voran, mal trippelt im langen, feinen Mantel der dichtende Landtagsabgeordnete Hans-Jürgen D. an der Spitze. Der Satiriker Matthias B. schlurft in Turnschuhen hinterher.
»Wohin denn nun?«, nörgelt er. »Bei Wielands ist es zu laut, Sommers haben noch geschlossen, und im Frauentor-Café sind zu viele Touristen. Vielleicht sollten wir uns mal entscheiden.«
»Versuchen wir’s bei Eckermann«, schlage ich vor.
Ein Ort, wie geschaffen für unser Unterfangen.
»Tja«, seufzt Martin, als wir im neu eröffneten Eckermann-Stübchen in der Weimarer Brauhausgasse sitzen, »wenn er jetzt hier wäre, würde er seinen Rucksack öffnen, und Äpfel und Thüringer Wurst kämen auf den Tisch.«
»Und eine Pulle Rhöntropfen machte die Runde«, ergänzt Hans-Jürgen und blickt sich nach dem Kellner um.
Matthias leckt sich die trockenen Lippen.
Ich habe verstanden und ordere fünf eiskalte Wodka.