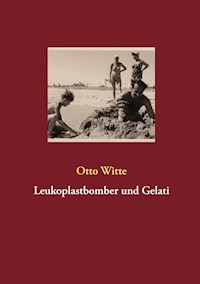
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Buch „Leukoplastbomber und Gelati“ handelt in den „Fünfzigern“ als es fast schon ein Abenteuer war, mit dem Auto oder dem Motorrad über den Brenner zu fahren, um in einem Zweimannzelt, den lang ersehnten Campingurlaub in Italien zu verbringen. Das Buch erzählt die Geschichte von Schule, Freundschaft, Lausbubereien und einer unvergessenen und wundervollen Kindheit. Otto Witte hat in seinem dritten Buch, wiederum mit viel Humor sowie einer kräftigen Portion Selbstironie - aber auch mit Teilen sentimentaler Beschaulichkeit, einen weiteren Teil seines Lebens niedergeschrieben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Otto Witte
Leukoplastbomber und Gelati
Books on Demand
In Erinnerung an meine Eltern und an meine Schwester Ursula.
„Wie gerne würde ich ihnen diese Geschichten vorlesen – um nochmals ihr Lachen zu hören.“
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Epilog
Vorwort
Die nachfolgenden Geschichten spielen irgendwann in den Fünfzigern.
Die Ereignisse von damals liegen nun weit mehr als fünfzig Jahre zurück, daher bin ich mir heute nicht mehr sicher, ob die geschilderten Erlebnisse in genau der Reihenfolge stattfanden in der ich diese niedergeschrieben habe. Auch besteht die Möglichkeit, dass die eine oder andere Episode aus getrennt verlaufenen Zeiträumen mit in die Geschichten eingeflossen sind. Und natürlich sind da, die herrlichen – in Erinnerung gebliebenen - Erzählungen meiner Eltern und meiner Schwester.
Ich hoffe es ist auch verzeihlich, dass ich mir bei bestimmten Formulierungen eine kräftige Portion schriftstellerische Freiheiten erlaubt habe.
Eines jedoch ist gewiss, alle Begebenheiten haben sich so – oder zumindest so ähnlich – zugetragen.
Zum Schutz einiger handelnden Personen habe ich deren tatsächliche Namen sowie einige Ortsangaben abgeändert.
Besonderen Dank gilt meiner Cousine „Brigitte Lazar“, die mir bei einigen Erinnerungslücken maßgeblich weiterhelfen konnte.
Dank auch an Jürgen Lamprecht und Willi Boll vom Touristenverein „Die Naturfreunde“, Landesverband Hessen e. V. die mir die Verwendung einiger Texte von Naturfreundliedern gestattet haben.
Otto Witte
1
…..Pecos Bill hetzte auf seinem Schimmel am Ufer des Yukon entlang und Marco Polo kämpfte in Knickerbockerhosen und mit einem karierten Barett auf dem Kopf todesmutig mit einem einbeinigen Piraten. Ich selbst ritt auf einem Maulesel in wildem Galopp über eine angelegte Gangway, direkt auf das Deck eines wurmstichigen Schaufelraddampfers und versteckte mich hinter einer, mit Goldnuggets vollgepackten Holzkiste. Im Krähennest des Schiffes stand Alaska Kid und kratzte herzerweichend auf einer ebenfalls leicht wurmstichigen Fidel herum. Kurz bevor der schießwütige Schurke das Ufer erreicht hatte, begann sich das Schaufelrad des Dampfers langsam zu drehen und das Schiff verlies unter zurücklassen von schmutzigem, schäumendem und aufgewühltem Flusswasser die Anlegestelle von Dawson City.
Mit einer schwarzen Klappe über dem rechten Auge, einem Dreispitz auf dem Kopf und einem rostigen Eisenhaken am Unterarm stand mein Klassenlehrer „Scholli“ an dem riesigen hölzernen Steuerrad und fuchtelte mit meinem Zeugnisheft in der Luft herum. Dabei schrie er ständig: „Witte du elender Hohlkopf, alles Vierer, alles Vierer.“ Dann zog er an einer Leine, und mit einem schaurigen „Tuut, Tuut, Tuut“ aus dem Nebelhorn, entschwand das Schiff in dem, über dem Strom liegenden, morgendlichen Dunst …
Pitschnass geschwitzt schreckte ich auf und sah mich erst einmal verwirrt um. Zu meiner Erleichterung lag ich sicher und wohlbehalten in meinem engen Patentklappbett und dachte nur noch erleichtert: „Was für ein Glück - ich habe alles nur geträumt“
Seltsamerweise hörte ich jedoch noch immer das unheimliche „Tuut, Tuut, Tuut“ des Nebelhorns und das durchdringende Gekrächze der angefaulten Fidel.
Das Schiff musste in der Zwischenzeit unsere Küche erreicht haben, denn diese Geräusche kamen eindeutig aus diesem Bereich unserer Wohnung.
Ich sprang eilig aus meinem Bett und raste, verschwitzt, wie ich war, in die Küche.
Der Anblick, der sich mir bot, war überwältigend.
Mein Vater hatte das etwa fünfzig Zentimeter lange Rohr – das zum trocknen von Handtüchern, am Küchenherd angebracht war – abmontiert und blies darauf - mitten in der Küche stehend, in langen Unterhosen – die von mir bereits im Traum gehörten schauderhaften Töne. Meine Mutter saß am Küchentisch und hielt sich mit entsetztem Gesicht die Ohren zu.
„Was ist denn hier los?“ fragte ich wiehernd. Mein Vater setzte das Rohr ab und grinste. „Ich blase zum Gegenangriff.“ Jetzt wusste ich prompt, was los war. Zuverlässig wie jeden Sonntagmorgen hatte der mit seinen Eltern unter uns wohnende Peter Schlupp pünktlich um 8:15 Uhr begonnen, seine Geige zu foltern.
Die dünne Decke zwischen den zwei Neubauwohnungen konnte nicht verhindern, dass das fürchterliche Gekratze von Peters „Kolophonium gestütztem“ Katzengejammer laut in unsere Wohnräume vordrang. Mein Vater behauptete sogar, unsere Wohnung wäre so hellhörig, dass man deutlich wahrnehmen könnte, wenn Frau Schlupp gerade einen Zwieback kauen würde.
Nachdem von unten, wiederholt erfolglose Versuchsballons gestartet wurden, der „Stradivari für Unbegabte“ wenigstens einige annehmbare Töne zu entlocken, setzte mein Vater erneut seine stählerne Rohrposaune an den Mund und blies mit dicken Backen und hochrotem Kopf erneut zum Angriff.
Als meine Schwester jetzt mit verschlafenen Augen in der Küche anrückte, hatte Peter Schlupp - anscheinend gelähmt von der ungeheueren akustischen Attacke meines Vaters - seine Streicherübungen eingestellt. Meine Schwester behauptete die „Trompeten von Jericho“ wären gegen das gewaltige Getöse unseres Vaters wie das Flötenkonzert von Sanssouci gewesen.
*
Nach dem Mittagessen ging ich mit meinem Freund Jürgen Bubler in unser Stammkino „Silva“ und sah mir- auf einem der zehn ausklappbaren, knochenharten Notsitze, für fünfzig Pfennig Eintrittsgeld - den Film „Dick und Doof in der Fremdenlegion“ an. Als ich Jürgen vorjammerte, dass mir auf dem harten Sperrholzstuhl fürchterlich der Hintern wehtäte, meinte der nur gelassen: „Für fünf Groschen kannst du für deinen dürren Arsch keinen Ohrensessel verlangen.“
Nach der Vorstellung raste ich mit Jürgen und dem Rest meines Taschengeldes in Höhe 1.50 DM in die Bleichstraße, um mir im Astoria mit Jürgen noch den Film „Herr des Wilden Westens“ mit Errol Flynn anzusehen.
Als wir am Kino ankamen, konnten wir an der Anzeige über der Kasse erkennen, dass der Hauptfilm noch nicht angefangen hatte. Wir erstanden für je 1.25 DM zwei Eintrittskarten. Von dem mir noch verbleibenden Rest von fünfundzwanzig Pfennigen, kaufte ich noch eine Rolle Drops und zwei bereits knochenharte Karamellriegel. Damit hatte ich mein gesamtes wöchentliches Betriebskapital total auf den Kopf gehauen.
Unter lautstarkem Protest der bereits sitzenden Zuschauer stolperten wir im dunklen Kinosaal über etliche Beine, zu unseren Sitzplätzen.
„Eh du Blödmann, zieh ganz schnell deinen Nischel ein, ich sehe sonst nichts“ röhrte Jürgen seinem Vordermann ins Ohr. Der war über den verbalen rückwärtigen Angriff so erschrocken, dass er schlagartig in seinem Sitz nach unten rutschte und nun nur noch seine Haarspitzen über der Rückenlehne zu sehen waren. „Siehst du, es geht doch du Armleuchter“ knurrte Jürgen und machte es sich in seinem Sitz bequem.
Jetzt zeterte ein älterer Westernfreund, der hinter Jürgen saß, stinksauer: „Nimm deinen Eierkopf aus der Richtung, oder meinst du ich hätte Eintrittsgeld bezahlt, um mir deine Glühbirne von hinten anzugucken“.
Nachdem Jürgen kleinlaut nach unten gerutscht war, gab es endlich Ruhe auf den billigen Plätzen.
Nach dem Rest des „spannenden“ Vorprogrammes über die „Käseherstellung in Holland“ begann mit einem dreifachen Gong und einem allgemeinen „Aaah und Oooh“ endlich der Hauptfilm.
Die Rolle Drops und die zwei karamellisierten Plompenzieher hatten wir bereits vernichtet, ehe Errol Flynn überhaupt nur einen Schuss abgefeuert hatte.
*
Bevor ich mit Jürgen Bubler und Volker Poppel am Montagmorgen zur Schule trabte, kupferte ich unter der Kellertreppe noch schnell die Hausaufgaben aus Volkers Rechenheft ab.
Als wir kurze Zeit später durch die Kastanienallee, in Richtung Aßmannshäuser Straße stromerten, kam gerade unser Klassenlehrer - genannt Scholli – wie immer begleitet, von Friedrich Hundt, unserem Klassenbesten, die Niederwaldstraße hochgelatscht. Friedrich schleppte auch heute wieder mit hochrotem Kopf, die mit achtundvierzig, übers Wochenende korrigierten Schulheften und zahlreichen Lehrbüchern vollgepackte Aktentasche, unseres Lehrers.
„Kein Wunder das dieser Liebediener immer die besten Noten bekommt“ maulte Jürgen leise vor sich hin. „Außerdem lässt sich der Scholli im Friseurladen von Friedrichs Vater alle drei Wochen kostenlos die Haare von der Rübe scheren. Da kann man leicht Klassenerster werden“ fügte ich gehässig hinzu.
Eigentlich hieß unser Klassenlehrer „Georgi“. Da er, wenn er aufgebracht war, oder wenn ein Schüler nicht so funktionierte, wie er das wollte, laut herumschrie: „Mein lieber Scholli, mein lieber Scholli“ hatte er schnell seinen Spitznamen weg.
Scholli war mittelgroß und von kräftiger Figur, hatte störrige, grau melierte – mit viel Pomade glatt nach hinten gebändigte Haare - einen sorgfältig gezogenen Mittelscheitel und durch seine herabhängenden Augenlieder, einen extrem ausgebildeten Schlafzimmerblick. Am meisten faszinierten mich jedoch, die grauen Haarborsten, die ihm wild aus seinen Ohren und Nasenlöscher wuchsen.
Um Scholli und Friedrich Hundt an uns vorbei zu lassen, ohne von ihnen gesehen zu werden, verdrückten wir uns vorsichtshalber hinter einer dicken Kastanie und warteten ab, bis die zwei außer Sichtweite waren.
„Ehe ich diesem Arschpauker die bleischwere Aktentasche schleppe, hacke ich lieber Holz fürs Altersheim“ belferte Volker Poppel und tippte sich vielsagend an die Stirn.
Am Schreibwarenkiosk kaufte sich Jürgen, für zwanzig Pfennige noch das neue „Akim Heftchen“ und sicherte mir, mit den imitatorisch galligen Worten von Scholli zu: „Wenn ich das „Schundheft“ ausgelesen habe, können wir gegen dein Sigurdheftchen tauschen. „Klar doch“ grinste ich erfreut und hoffte darauf, dass Jürgen das Heft wie immer, während des Unterrichts unter der Bank lesen würde. Umso schneller käme ich nämlich in den Genuss dieser dramatischen Bildergeschichte aus dem Dschungeldasein des druckfrischen Tarzanersatzes „Akim“.
Da „Zuspätkommen“ meist unangenehme Konsequenzen nach sich zogen, strömten jetzt, aus allen Himmelsrichtungen die letzten Schüler und Schülerinnen im Sturmschritt der „Knaben - und Mädchenschule zu.
„Guten Morgen Herr Lehrer“ Wie auf Kommando waren alle Schüler beim Eintreten von „Scholli“ von ihren Stühlen aufgesprungen, und hatten ihren Morgengruß dem Lehrer entgegengeschmettert.
Scholli knallte seine Aktentasche auf das Pult und brüllte: „Setzen“, um eine Minute später zu befehlen: „Aufstehen“ Mit jetzt leiser und süffisanter Stimme säuselte er: „Wir singen zu Beginn des Unterrichtes das „Westerwaldlied“ Die erste Strophe singt uns Witte vor“.
Ich dachte noch: „Komisch, den Friedrich Hundt nennt er immer beim Vornamen“. Dann trällerte ich aber sogleich los:
„O du schöner Westerwald!
Über deinen Höhen pfeift der Wind so kalt…..“
Beim Refrain blökte mir Horst Bredeberg so lauthals ins Ohr, dass es auch Scholli noch hörte:
„O du schöner Westerwald, wo der Furz im Hemde knallt“
Scholli raste wie von einer Tarantel gestochen durch die Bankreihe, und scheuerte Horst Bredeberg gewaltig eine gegen die Backe und schrie „So du unflätiges Früchtchen jetzt spürst du, wem im Westerwald etwas im Hemde knallt“.
Nachdem die Klasse mich bei den restlichen zwei Strophen, artig unterstützt hatte, donnerte Scholli: „Setzen - Rechenhefte raus“ Demonstrativ legte er seinen dünnen Rohrstock vor sich auf den Tisch und fragte aalglatt grinsend: „Na, wer von euch Faulpelze gibt freiwillig zu, dass er seine Hausaufgaben nicht gemacht hat?“
Diesen Trick kannten wir schon zu genüge.
Derjenige, der sich aus „freien Stücken“ meldete, bekam mit dem Bambusrohr nur zwei kräftige Schläge aufs Hinterteil. Wehe aber dem, der bei den anschließenden Stichproben als Nichtstuer erwischt wurde. Über die Bank gelegt, bekam der Delinquent sechs äußerst schmerzhafte Hiebe über den stramm gespannten Hosenboden gezogen.
Nachdem sich wie so oft, keiner freiwillig gemeldet hatte, ging Scholli zielstrebig auf Herbert Reh zu: „Reh, Heft raus. Zeig mal her, was du übers Wochenende so verzapft hast.“
Herbert Reh der käseweiß und bibbernd in seiner Bank saß, stotterte leise: „Herr Lehrer, ich habe leider mein Heft versehendlich zu Hause vergessen.“
Mit starrer Miene zerrte Scholli den zitternden Herbert aus der Bank und zog im die üblichen sechs Schläge über den Hintern. Als Herbert mit den Händen versuchte, die Hiebe abzumildern, gab es als portofreie Zugabe, noch zwei Schläge extra. „Ich beschwere mich beim Bundeskanzler Adenauer“ heulte Herbert Reh und verdrückte sich, nachdem er noch eine kräftige Kopfnuss einkassiert hatte, schnell auf seinen Platz.
Trotz intensiver Nachforschung erwischte Scholli an diesem Tag keinen Schüler mehr, der seine Aufgaben nicht vorweisen konnte.
Ich war heilfroh, dass ich die Rechenaufgaben morgens noch schnell bei Volker Poppel abgeschrieben hatte.
2
„Mama, Maamaa“ Ich stand an den Mülltonnen und schaute zu unserer Wohnung hoch und wartete darauf, dass meine Mutter auf mein Rufen reagieren und sich am Fenster zeigen würde. Aber erst, als ich unser Familienerkennungssignal – die Anfangstakte von dem Lied „Am Brunnen vor dem Tore“ pfiff, erschien meine Mutter auf dem Balkon. „Was gibt denn?“ Ich deutete auf meinen Bauch und rief: „Ich habe Hunger. Wirf mir doch bitte ein doppeltes Senfbrot runter.“ (Senfbrot war schlicht und einfach, eine mit Margarine und Senf bestrichene Scheibe Brot.)
Meine Mutter nickte ergeben, und verschwand wieder in der Wohnung.
Fünf Minuten später stand sie mit dem dick in Zeitungspapier eingepackten Brot wieder am Balkongeländer. „Ottochen fang auf“ und schon segelte das Senfbrot aus dem dritten Stock in Richtung Mülltonne.
„Pass auf, ich habe dir noch fünfzig Pfennige mit beigelegt. Gehe zum Kannengieser und lass dir die Haare schneiden.“ rief sie hinterher.
„Ooch, wieso denn, die sind doch noch kurz genug“ maulte ich und packte Brot und Geld aus dem Zeitungspapier aus.
„Keine Widerrede, du machst jetzt, was ich dir sage. Du siehst ja am Kopf aus wie der alte Tulpenstiel.“ (Tulpenstiel war angeblich ein Künstler aus den zwanziger Jahren, der seine Haare aus Protest gegen die sogenannten Spießbürger lang wachsen lies.)
Missmutig trottete ich also in die Hallstraße und setzte mich im Friseurladen, auf einen der harten und unbequemen Holzstühle, und wartete, bis der „Kannengieser“ über mich herfiel.
Da außer ein paar uralten, zerflederten Zeitungen aus dem Lesezirkel, nichts zur Ablenkung da war, wartete ich geduldig, bis ich an die Reihe kam.
Ich beobachtete misstrauisch, wie der Friseurmeister Kannengieser den Kopf eines älteren Mannes bearbeitete.
Alle paar Minuten hielt er die Schere in die Höhe und schnippelte dabei unentwegt weiter, so als wolle er die Luft um ihn herum gleich mitschneiden.
Ich hoffte inständig, dass ihm bei seiner Arbeit vielleicht der Kamm oder die Schere abbrechen würde und ich somit, sprichwörtlich „ungeschoren“ wieder abhauen könnte.
Zu meinem Bedauern, blieben Kamm und Schere heil und mit einem galanten: „Der Nächste bitte“ komplimentierte er mich auf seinen Folterstuhl. Zuvor hatte er jedoch noch schnell das vom Vorgänger warm – und durchgesessene lederne Sitzpolster umgedreht. Ich schaute mich vorsichtshalber doch noch einmal um, ob vielleicht ein anderer Kunde meinen Platz einnehmen könnte – aber leider war außer dem alten Kannengieser und seinem in der Mauser befindlichen Wellensittich, kein anderes Lebewesen in dem Laden zu entdecken.
Nachdem der unheimliche „Barbier von Sevilla“ mir schwungvoll ein schwarz – weiß gewürfeltes Handtuch umgehängt hatte, fragte er: „Na Kurzer, wie soll’s denn sein?“
„Für fünfzig Pfennig. Aber nicht so, dass ich anschließend aussehe, wie Ihr federloser Wellensittich“ knurrte ich leise und zog ängstlich das Genick ein.
Herr Kannengieser setze seine handbetriebene Haarschneidemaschine an und scherte mir vom Hals aufwärts, rücksichtslos und oft schmerzhaft zwickend die Haare ab, sodass nur noch ganz oben der Bewuchs stehen blieb.
Dieser Haarkünstler nannte es eine „Rasur bis zur Baumgrenze.“ Sie müssen Ihren Glatzenhobel endlich einmal zum Scherenschleifer bringen. Sie reißen mir mit dem Mistding ja die ganzen Haare aus“ moserte ich verzweifelt. Meister Kannengieser lies sich von meinem Gejammer jedoch nicht im geringsten beeindrucken und schnippelte unbarmherzig weiter. Zum krönenden Abschluss sprühte er mir noch ein fürchterlich stinkendes und unangenehm beißendes Haarwasser auf meinen, gewissermaßen baumlosen Kürbis. Danach hielt er mir von hinten einen Spiegel zur Begutachtung hin. „Recht so?“ fragte er in bester Laune. Ich sah erschrocken auf das Resultat seiner Arbeit und schimpfte schrill: „Das ist ja eine Totalabholzung. Waren Sie früher mal Wanderschäfer? Ich sehe ja an der Glocke aus wie Karl der Kahle“ Ich knallte ihm die fünfzig Pfennige auf den Frisiertisch und verlies stinksauer den Ort meiner Verunstaltung.
„Halt“ rief der „Glatzenschneider“ hinter mir her, „mein Umhang ist nicht im Preis inbegriffen, den brauche ich noch.“
Ich riss mir, das immer noch um meine Schulter hängende Handtuch herunter, und schleuderte es wütend in den Laden. „So ein Holzkopf, der wäre besser Bäcker geworden, da könnte er den Knorz, den er verzapft wenigstens auffressen“ nuschelte ich zornig, und trabte eilig nach Hause.
Als mir, in der Niederwaldstraße dann noch Onkel Paul begegnete und mich fragte, ob sie mich in der Schlosserei Menkes in die Drehbank eingespannt und mir den Kolektor sauber abgedreht hätten, war ich endgültig bedient.
*
„Ottochen komm zum Nachtessen“ rief meine Mutter aus der Küche. Da ich richtig Kohldampf hatte, legte ich mein Buch“ Zwanzigtausend Meilen unter dem Meer“ zur Seite setzte meine Skimütze auf und marschierte in die Kombüse.
Seit ich die Lesebekanntschaft mit Kapitän Nemo und seinem Unterseeboot Nautilus gemacht hatte, schlief ich nicht mehr im Bett sondern in meiner Koje. Wenn ich vom Spielen nach Hause musste, ging ich auf die Brücke und zum Abendessen suchte ich infolgedessen nicht die Küche, sondern die Kombüse auf.
Meine Schwester Ursula meinte zwar, ich hätte einen Dachschaden, aber ich lies mich dadurch nicht beirren.
Als ich mich auf meinen Platz setzte, fragte mein Vater: „Hast du Spatzen unterm Filz?“ und deutete auf meine Skimütze. „Ich gehe doch so nicht unter die Leute“ antwortete ich griesgrämig und zog meine Mütze vom Kopf.
„Bist du aus Versehen unter einen Mähdrescher geraten“ fragte mein Vater entgeistert, als er meinen Haarschnitt sah. „Wer hat dich denn so zugerichtet?“
„Frag Mama, die hat mich ja schließlich zu dem bematschten Kannengieser geschickt.“
„Sieht wirklich Klasse aus“, gab meine Schwester ihren Senf dazu. „Jetzt wo deine Ohren frei sind, kannst du ja von der Nautilus auf einen Dreimastschoner wechseln, dann können die sich nämlich die Segel sparen.“ Ich tippte mir an die Stirn: „Ha, ha sehr geistreich.“
Mein Vater blödelte. „Der Kannengieser hat 1914/18 sicher als Friseur beim Kommiss gearbeitet. Da war so ein Kahlschlag der allerneueste Schrei“.
„Der Blödmann kann sich ja beim Bundeskanzler melden. Der will ja bald wieder Soldaten einführen. Da kann er dem alten Conrad ja schon mal probeweise die Haare abkrotzen.“ moserte ich noch immer aufgebracht.
Nach dem Abendessen verdrückte ich mich wieder in das Zimmer, das ich mir mit meiner Schwester teilte, und erkundete erneut mit der Nautilus die unendlichen Weiten der Weltmeere.
Mit Bammel dachte ich vor dem Einschlafen, an die Frotzeleien meiner Klassenkameraden, wenn ich am nächsten Morgen mit meiner neuen Haartracht in der Schule einlief.
Es war dann aber gar nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte. Es war sogar ein recht angenehmer Schultag.
Erstens war ich nicht der einzige der am Vortag bei Kannengieser war, zweitens hatte sich Scholli wegen eines üblen Durchfalls kränklich gemeldet und drittens, war ab der dritten Stunde ein Film angesagt.
Hinsichtlich von Schollis Durchfallerkrankung, hielt sich unantastbar das Gerücht, Herbert Reh hätte ihm am Vortag während der großen Pause ein Abführmittel in die Thermosflasche geschüttet.
Herbert Reh beteuerte inständig, er hätte mit Schollis „Dünnschiss“ nichts zu tun. Trotz dieser Unschuldsbeteuerungen klopfte jeder aus unserer Klasse, Herbert immer wieder wohlwollend auf die Schulter - und das solange, bis der selbst glaubte, er wäre es gewesen.
Die ersten zwei Stunden hatten wir bei Frau Kluck „Sozialkunde und Rechnen“ Nach der Pause ging es dann in die Aula zur angesagten Filmvorführung „Unterwegs in Afrika - von und mit Helmut Knorr“.
Als unser Rektor, wie immer in dunkelblauem Anzug, weißem Hemd und gestreifter Krawatte, die Aula betrat, wurde es schlagartig still im Raum.
Rektor Graf stolzierte kerzengerade durch den Mittelgang und stellte sich direkt vor die Kinoleinwand. „Ich darf den Afrikareisenden Herrn Helmut Knorr recht herzlich in unserer Lehranstalt begrüßen. Herr Knorr wird uns in einem, von ihm selbst gedrehten Film seine ereignisreiche Expetition ins Innere des schwarzen Kontinents vorführen. Ich erwarte, dass äußerste Ruhe im Saal herrscht und jeder Schüler diesen Film aufmerksam verfolgt. Ich habe die Klassenlehrer bereits angewiesen, über diesen Film einen Aufsatz schreiben zu lassen. Herr Knorr wird vor Beginn noch einige Worte an euch richten. Ich wünsche viel Vergnügen.“
Helmut Knorr trat nun vor die Leinwand, bedankte sich bei Rektor Graf für die einleitenden Worte und klärte uns schon einmal, in gekürzter Form, über das bevorstehende Filmereignis auf.
Herr Knorr war ein großer, braungebrannter, breitschultriger Mann mit langen schwarzen welligen Haaren und einem säuberlich gestutzten Kinn – und Oberlippenbart. Ein bisschen erinnerte er mich an Hans Hass den bekannten Taucher und Unterwasserforscher. Ich dachte: „Hat der ein Glück, das er nicht dem ollen Kannengieser in die Hände gefallen ist.“
Nachdem der Afrikareisende Knorr seinem Mitarbeiter am Filmprojektor ein Zeichen gegeben hatte, wurde das Licht in der Aula abgedunkelt und ratternd lief das Vorführgerät an. Der Film begann in Südfrankreich - im verschneiten Hafen von Marseille. Der Geländewagen von Helmut Knorr wurde auf einen Trawler verladen und an Deck ordentlich festgezurrt.
Nachdem die Expetitionsteilnehmer an Bord waren, stach das weiße Frachtschiff mit Sirenengeheul und aufschäumenden Heckwasser – mit Kurs auf den Atlantik - ins winterliche Mittelmeer.
Über Tanger und Casablanca, vorbei an den Kanarischen Inseln, pflügte der Trawler durch die aufgewühlte See Richtung Dakar an der westafrikanischen Küste.
Von Dakar aus fuhr Helmut Knorr dann mit dem Jeep durch die Wüste und Steppe Westafrikas, mitten hinein ins Herz des schwarzen Kontinents. Auf seiner Fahrt überquerte er auf altersschwachen Fähren und über hinfällige Holzbrücken, Bäche und Flüsse, besuchte Eingeborenendörfer, beschenkte dort die Kinder mit kleinen mitgebrachten Gaben und schlich sich zum Filmen, todesmutig an so manches wilde Tier heran. Als an einem morastigen Flussufer dann noch der Vorderreifen von Helmut Knorrs Auto, von einem Pfeil durchbohrt wurde, entwickelte sich im Filmvorführraum eine beachtliche Unruhe.
Ich dachte für mich; „Spätestens jetzt müsste eigentlich Jonny Weißmüller im Lendenschurz und mit Äffchen Cheeta auf dem Buckel durch den Bambus flitzen, um Herrn Knorr, vor dem Angriff erbarmungsloser Watussikrieger zu schützen.“
Nichts von alledem passierte. Nicht einmal John Wayne und die Kavallerie kamen mit Trompetengeschmetter und flatternden Fahnen am Horizont angaloppiert.
Wer den Pfeil in den Reifen des Geländewagens geschossen hatte, blieb unaufgeklärt. Helmut Knorr wechselte lediglich, mittels Wagenheber und Radkreuz den defekten Reifen, und gondelte dann schwitzend, und ohne weitere nennenswerte Ereignisse weiter – bis nach Timbuktu.
Auf welchem Weg der Forscher wieder nach Deutschland zurückkam, blieb in dem Film offen.
Der Projektor ratterte, wurde auf einmal lauter, auf der Leinwand erschienen plötzlich Punkte, Sterne und Striche und mit einem klatschenden Geräusch verließen die letzten Zentimeter Filmmaterial das Vorführgerät.
Die Mahnung unseres Rektors, den Film aufmerksam zu verfolgen, wäre gar nicht nötig gewesen.
Alle Schüler hatten gebannt diesem wirklich spannenden und bemerkenswerten Film zugeschaut – außer Herbert Reh – der war eingeschlafen.
Herr Löwenstern, der neben Herbert saß, räusperte sich leise und schüttelte den Schläfer sanft an der Schulter.
Herbert riss die Augen auf und sah den Lehrer erschrocken an. Der tat aber so als habe er gar nichts bemerkt, und sah in eine andere Richtung. Der von allen Schülern geliebte und geachtete Lehrer wusste, dass Herbert nicht aus Langeweile oder Interesselosigkeit eingenickt war.
Herberts Vater war ein „Kriegsblinder“ der mühsam versuchte mit seiner kleinen Rente, die vierköpfige Familie mehr schlecht, wie recht, über die Runden zu bringen.
Herbert trug morgens, schon lange vor Schulbeginn, Zeitungen und Brötchen aus und begleitete seinen Vater, wenn dieser – um die Haushaltskasse der Familie etwas aufzubessern - mit einer alten auf einem Kinderwagenchassis montierten Drehorgel durch die Wiesbadener Hinterhöfe zog.
„Da darf so ein elfjähriger Bub ruhig schon mal müde sein“ murmelte Herr Löwenstern leise und betrübt vor sich hin.“
Ich hatte es trotzdem gehört, und dachte für mich: „Der Scholli hätte sicher wieder seinen Rohrstock tanzen lassen.“
Als ich die Aula mit den anderen verlassen wollte, hielt mich Herr Löwenstern zurück, nahm mich um die Schulter und sagte mit gedämpfter Stimme: „Otto, ich würde mich freuen, wenn du dem Herbert beim Nacherzählen des Filmes behilflich sein könntest – so und jetzt zittere ab.“
Eine Woche später bekamen wir vom „Löwen“ die Aufsätze korrigiert und benotet zurück. Obwohl Herberts Arbeit – einschließlich diverser Fehler – der meinen fast aufs Haar glich, hatten wir beide eine glatte „Zwei“ bekommen.
Beim Verteilen der Hefte hatte mir Herr Löwenstern schmunzelnd zugeflüstert: „Gut gemacht Otto. Das geht aber nicht immer so, Ihr zwei Heringsbändiger“.
Seit diesem Erfolgserlebnis wollten Herbert und ich, nach der Schulzeit, so schnell wie möglich „Entdecker“ werden und mit einem Kanu wagemutig den Blauen Nil und den Sambesifluss bis zu den Quellen erkunden.
Leider erstreckte sich unser angestrebtes Abenteurerleben vorerst nur auf vertraute Gewässer wie Rhein, Lahn und das Becken des städtischen Schwimmbades.
(Herbert Reh wurde später Augenoptiker und ich Feuerwehrmann.)
Den Nil und den Sambesi haben wir beide nie gesehen.
3
„Ich gehe mal auf die Schnelle zu Bleistein`s, ob die was Neues reinbekommen haben“ sagte ich meiner Mutter nach dem Mittagessen.
„Da kannst du dir noch zwei Stunden Zeit lassen, die öffnen erst um fünfzehn Uhr“ klärte mich meine Mutter auf.
Herr und Frau Bleistein betrieben in den Souterrainräumen eines Altbaues in der Erbacher Straße eine kleine Leihbücherei, in der es für dreißig Pfennige aufwärts pro Woche interessante Bücher zum ausborgen gab.
Das Ehepaar waren zwei sehr freundliche und liebenswerte Menschen. Sie amüsierten sich immer köstlich, wenn ich nach langem stöbern in den Regalen, doch nicht das passende Buch fand, oder ich innerhalb von einer Woche, zum zehnten Mal nach der angekündigten Neuerscheinung der „Fünf Freunde“ von Enid Blyton fragte.
Herr Bleistein empfahl mir dann – meistens zu meiner Zufriedenheit – vergleichbaren Ersatzlesestoff.
Wenn ich – was häufig passierte – die Ausleihfrist überschritten hatte, spekulierte ich immer darauf, dass Herr Bleistein alleine im Laden war. Herr Bleistein drückte dann immer beide Augen zu, kratzte sich am Kopf und brummte: „Ist schon in Ordnung Otto, das nächste Mal kommst du aber früher.“ Seine Frau hingegen verlangte von mir, ohne Herzerweichen und gnadenlos, den zu zahlenden Säumniszuschlag bar auf den Tisch.
Trotz des Hinweises meiner Mutter bezüglich der Öffnungszeiten, stand ich nun doch eine halbe Stunde zu früh vor der noch verschlossenen Bücherei.
Pünktlich um fünfzehn Uhr, kamen die Bleisteins die Erbacher Straße hoch gewackelt und kurbelten umständlich die Rollläden der Bücherei hoch.
„Na endlich“ dachte ich, und stürmte die Treppe in den Souterrainladen runter. „Haben Sie schon….“Bevor ich meine Frage überhaupt richtig gestellt hatte, antwortete Herr Bleistein schon. „Ja Otto, deine neuen „Fünf Freunde“ sind endlich eingetroffen." Er griff unter die Theke und zog das von mir so lang erwartete Buch „Fünf Freunde auf der Felseninsel“ hervor. „Mach aber nicht gleich wieder Marmeladenflecken rein“ ermahnte mich Frau Bleistein mit einem warnenden Blick über den Rand ihrer Brille.
„Ich doch nicht“ entgegnete ich großspurig und dachte dabei an den Karl May, dessen Buchdeckel ich vor einiger Zeit versehendlich aber kunstvoll mit Himbeergelee dekoriert hatte.
Frau Bleistein hatte damals herumgezetert: „Beim Lesen geliehener Bücher, futtert man nicht gleichzeitig ein Brot mit Brombeermarmelade.“
„Ich war das überhaupt nicht“ hatte ich entrüstet abgestritten. „Und außerdem war das keine Brombeermarmelade sondern Himbeergelee“.
Herr Bleistein hatte daraufhin seine Frau angegrinst und gesagt: „Siehst du Sarah, du musst in Zukunft erst mal abschmecken, bevor du jemanden unschuldig verdächtigst. Außerdem können wir froh sein, dass der Schlingel das Schweineschnitzel, dass er sonst als Lesezeichen benutzt, vor der Rückgabe aus dem Buch genommen hat.“
Um vom Thema abzukommen, fragte ich nun mit harmloser Stimme: „Gibt es sonst noch was Neues zwischen Ihrem alten Plunder?“ Frau Bleistein hob stirnrunzelnd den Zeigefinger: „Freundchen, Freundchen, wenn du jetzt nicht gleich abgaloppierst, rappelt, es gewaltig im Karton.“
Nachdem mir Herr Bleistein dann noch den abgewetzten und zerflederten Seeräuberroman „Piraten der Karibik“ geschenkt hatte, verdrückte ich mich eilig in Richtung Küfestraße.
Unterwegs beschloss ich, noch auf einen Sprung bei Tante Elsa vorbeizugehen.
Also trabte ich über den Wallufer Platz und die Niederwaldstraße zu Tante Elsas und Onkel Pauls Wohnung in der Geisenheimer Straße.
Drei mal kurz einmal lang zweimal kurz, war das nur für Familienmitglieder gebräuchliche Klingelzeichen, bei dem Tante Elsa, Onkel Paul und Gitta sichergehen konnten, dass keine ungebetene Gesellschaft vor der Tür stand.
Trotz des vereinbarten Klingelsignals dauerte es ewig lange, bis der Summer der elektrischen Türverriegelung ertönte. Ich stieß die Tür auf und sprang – immer zwei Treppenstufen auf einmal nehmend – zum dritten Geschoss hoch.
Die Wohnungszugangstür war offen, aber von Tante Elsa war nichts zu sehen. „Hallo Tante Elsa ich bin es“ rief ich in den dunklen Flur. „Ottochen komme nur rein, ich liege im Bett“ erklang leise die Stimme von Tante Elsa aus dem Schlafzimmer.
Da wusste ich, was los war. Tante Elsa hatte wieder einmal ihre unerträglichen Kopfschmerzen.
Als ich vorsichtig das Schlafzimmer betrat, sah ich erst einmal überhaupt nichts. Da die Vorhänge zugezogen waren, war es stockfinster in dem Raum. Erst als sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, konnte ich Tante Elsa erkennen. Sie lag bis zu Nasenspitze zugedeckt und mit einem nassen Waschlappen auf der Stirn in ihrem Bett und stöhnte leise vor sich hin.
„Soll ich den Doktor Rommer rufen – oder die Mama?“ fragte ich erschrocken. „Nein, nein lass nur, das geht schon wieder vorbei. Außerdem kommt ja Gitta gleich nach Hause“ murmelte Tante Elsa. „Du könnest mir aber in der Drogerie Dreis zwei Briefchen mit Melabon holen. Das Geld liegt auf dem Küchenschrank. Nimm dir aber den Hausschlüssel mit. Sonst muss ich zum Türöffnen wieder aufstehen.“
Bevor ich zur Drogerie düste, fragte ich noch: „Wo ist denn Onkel Paul?“ „Der ist heute früh mit Ministerialrat Kaiser nach Bonn gefahren und kommt erst spät in der Nacht zurück“ ächzte meine Tante und hielt sich dabei mit beiden Händen den schmerzenden Kopf fest. (Onkel Paul war Fahrer beim Innenministerium und demzufolge oft auf längeren Dienstreisen außerhalb von Wiesbaden unterwegs.)
Ich schnappte mir Geld und Hausschlüssel und lief im Eiltempo zur Drogerie.
Als mich Herr Dreis nach meinem Wunsch fragte, hatte ich den Namen des Kopfschmerzpulvers vergessen.
„Meine Tante Elsa hat böse Kopfschmerzen und braucht dringend ein Mittel dagegen.“
Da der Drogist meine Tante gut kannte, und demzufolge wusste was sie des Öfteren benötigte, holte er sofort das Schmerzmittel aus einer der hundert Schubladen und meinte: „Es wäre vielleicht doch besser einen Arzt zu rufen.“ „Nee die will keinen“ rief ich, warf das Geld auf die Theke, griff mir das Kopfschmerzpulver und galoppierte zur Geisenheimer Straße zurück.
Als ich wieder in die Wohnung kam, war meine Cousine Gitta bereits daheim und versorgte ihre Mutter gerade mit Tee. „Ottochen sage doch der Ursula, dass ich heute Abend nicht mit zu den Naturfreunden gehe. Ich bleibe doch lieber bei meiner Mama.“
Ich wetzte nach Hause und berichtete meiner Mutter genau von Tante Elsas schlimmen Schmerzen, und das Onkel Paul für unbestimmte Zeit auf Dienstreise wäre.
Meine Mutter zog sich daraufhin, wie der Blitz ihren Mantel über und ging sofort los, um nach ihrer Schwester zu schauen. „Wenn Papa aus dem Büro kommt, macht euch eine Tütchensuppe warm. Ich weiß nicht, bis wann ich zurück bin“
Obwohl meine Mutter dann doch früher zurück war, als erwartet, gab es an diesem Abend trotzdem nur Ochsenschwanzsuppe aus der Tüte.
„Das gibt Fett auf die Kniescheiben“ grinste mein Vater und suchte mit dem Löffel demonstrativ aber erfolglos nach dem angeblich in der Suppe befindlichen Ochsenschwanz.
4
Fasching stand vor der Tür und ich überlegte krampfhaft, als was ich mich in diesem Jahr kostümieren sollte. Ich schwankte zwischen Cowboy, Indianer und Seeräuber. Das Fiasko vom vergangenen Jahr hing mir noch wie Mehlpampe in den Knochen.
Meine Mutter hatte mich mit einer umgearbeiteten alten Stresemannhose meines Opas, einem schwarz gefärbten Hemd, einer kleinen Holzleiter, dem selbst gebastelten Zylinder und mit einem total zerrupften Handbesen aus unserem Kohlekeller, zum Schornsteinfeger aufgetakelt.
Unter dem allgemeinen Gejohle meiner Freunde lief ich mit meiner Maskierung in der Kastanienallee ein.
Nur Jupp Kuttenselzer kam noch schlechter weg. Den hatten seine Eltern als Csardasfürstin verkleidet. Beim Cowboy und Indianer spielen konnte der aber wenigsten noch als die völlig bematschte Indianersquaw „Furchtlose Julischka“ mitreiten.
Ich aber war sicher der einzige Cowboy, der mit schwarzem Pappedeckelzylinder und Holzleiter durch den Wilden Westen trabte, und mit einem umgedrehten Handfeger auf feindliche Rothäute feuerte.
Während des Abendessens sagte meine Mutter so ganz nebenbei. „Ich habe mit Frau Niemann gesprochen, die hat noch einen Restposten Stoff mit Hahnentrittmuster auf Lager und näht uns daraus für Ottochen ein schönes Bäckerkostüm. Da braucht unser Bub nicht wieder als Schornsteinfeger durch die Prärie zu galoppieren.“
Ich blies erschrocken die Backen auf. „Ich glaube bei euch hämmert es. Da geh ich ja lieber gleich als zahmer Engländer.“ Ich wusste zwar nicht, wie ein zahmer Engländer aussah, aber mir fiel in der Aufregung gerade nichts Vergleichbares ein.
„Kennst du eigentlich den Bäcker Gossong?“ fragte mich mein Vater mit einem breiten Grinsen. „Nö, ich kenne nur den Bäcker aus der Johannisberger Straße, den Gossong will ich gar nicht erst kennenlernen“ murrte ich zurück.“ Darauf deklamierte mein Vater lachend:
„Der Gossong hängt seinen dicken Hintern zum Fenster raus, und ruft, so sehn bei mir die Brötchen aus.“ Unter anderen Umständen hätte ich mich über solche Sprüche baufällig gelacht. Aber im Moment war mir nicht danach.
Als meine Schwester dann noch den Vorschlag machte: „Verkleide dich doch als Hänsel und Gretel, da kannst du beim Mittagessen zwei Portionen verlangen“ verdrückte ich mich eingeschnappt in mein Zimmer, und schwor bittere Rache.
Der Zeitpunkt meiner Vergeltung kam bereits eine halbe Stunde später, als meine Schwester ins Zimmer kam, um sich ihre Turnschuhe aus dem Schrank zu holen. Mit unschuldiger Miene fragte ich: „Ursel, könntest du mir mal ein schönes Foto von dir ausleihen?“
Meine Schwester fiel doch tatsächlich auf diesen uralten Ulk herein. „Wieso? Willst du deinen Klassenkameraden zeigen, dass du eine hübsche und bezaubernde Schwester hast?“ „Nein“ wieherte ich vergnügt, der Scholli hat gestern gesagt: „Wer ein Bild von einer Naturkatastrophe besitzt, soll es mit in den Unterricht bringen.“
Meine Schwester musste über diesen Kalauer so heftig lachen, dass ihr das Wasser aus den Augen lief. Trotzdem warf sie einen Turnschlappen nach mir, der aber an meinem Kopf vorbeisegelte und die kostbare Blumenvase – ein ungeliebter Jahrmarktsgewinn - vom Fensterbrett katapultierte und irreparabel in ihre Bestandteile zerlegte.
Glücklich meine Revanche gehabt zu haben, ging ich zum Zähneputzen ins Badezimmer, um es mir danach mit einem spannenden Buch im Bett, so richtig gemütlich zu machen.
*
Da ich um drei Uhr pünktlich zur Kindergruppenstunde der Naturfreunde* wollte, setzte ich mich sofort nach dem Mittagessen an meine Schularbeiten. Den Aufsatz „Die Tiere der heimischen Wälder“ hatte ich in kurzer Zeit zu Papier gebracht. Da ich aber mit dem Rechnen wie so oft auf Kriegsfuß stand, quälte ich mich mit den zehn Aufgaben ewig lange herum. Sicherheitshalber wollte ich jedoch vor Schulbeginn, meine Ergebnisse, mit Jürgens Resultaten, eingehend vergleichen - sicher war sicher.
(*Meine Mitgliedschaft bei den Naturfreunden, verdankte ich dem Umstand, dass es in Wiesbaden keine Jugendgruppe der „Roten Falken“ gab. Da die Naturfreunde eine Kindergruppe hatten, meldete mich mein Vater kurzerhand dort an.)
*
Punkt fünfzehn Uhr, stand ich am Elsasser Platz vor dem „Haus der Jugend.“ Jürgen Hinze kam auch gerade angetrabt, und wir gingen gemeinsam zum Zimmer 218 – dem Jugendraum der Naturfreunde.
Jürgen und ich waren die Letzten. Alle anderen Gefährten der Kindergruppe saßen bereit um den Tisch und warteten darauf, was die Gruppenleiterin „Herta Röhm“ heute mit uns unternehmen würde.
Neben Jürgen Hinze und mir waren noch Dieter Kleinberg, Fritz Strasser, Roland Mann, Ortwin Burg, Willy Kerkers, Karin Rouge, Annemarie Krieger, Hannelore Sturmkamp – und natürlich Marion Prenzel aus der Winkler Straße, zur Gruppenstunde gekommen.
Marion war ein elfjähriges, blondes Mädchen mit Pferdeschwanzfrisur und lustig leuchtenden Augen, die ich vom ersten Tag an ins Herz geschlossen hatte. Marion sorgte während der Gruppenstunden mit ihrer fröhlichen Art, immer für gute Laune. Ich nahm mir vor, sie in Kürze mal zu fragen, ob sie mich später - vielleicht so in fünfzehn bis zwanzig Jahren - heiraten würde.
Auch diesmal wirbelte Marion wieder durch den Raum und brachte uns, mit ihren Scherzen, immer wieder zum jubeln. Sie war eben ein richtig „Lustiges Haus“ und zudem ein Mädchen, auf das man sich immer verlassen konnte.
Heute war Bastelstunde angesagt. Herta Röhm wollte mit uns, Papierkörbe aus Peddigrohr und Bleistiftablagen aus gespaltenen Bambusrohrhälften fabrizieren.
„Dufte“ dachte ich. „Den Papierkorb kann ich dann meinen Eltern und die Bleistiftablage meiner Schwester zu Weihnachten schenken“
Da wir gerade erst Anfang Februar hatten, war ich guter Hoffnung, dass ich meine Geschenke bis zum Heiligen Abend fertiggestellt haben würde.
Jürgen Hinze, der keine Lust auf Papierkorb basteln hatte, verzog sich in eine Ecke, wo er mit nervtötender Ausdauer, die kürzlich angeschafften „Orffschen Instrumente“ folterte.
Als er dann aber, zehn Minuten lang, gnadenlos auf einer Triangel herumhämmerte, nahm ihm Herta Röhm das Instrument ab und verschloss dieses – für Jürgen unerreichbar – in einem Wandschrank. Ungerührt nahm Jürgen nun die Klampfe von der Wand und klimperte darauf – nun aber gekonnt – ein paar Naturfreundelieder. Selbst Herta Röhm hatte jetzt nichts mehr entgegenzuhalten.
Bei dem Lied „Wo wollt Ihr hin, Ihr tollen Jungen“ sangen wir alle – auch die Mädchen - lauthals mit.
Wo wollt Ihr hin, Ihr tolle Jungen? Wir wissen`s nicht, in fernes Land. Wir singen frei aus vollen Lungen, nun wird die weite Welt bezwungen. In wilder Fahrt – uns hält kein Band.
Der Sommer glüht, die Lieder schallen, wir zieh`n hinaus in wildem Saus. Lachendes Leben blüht uns allen, erst wenn die letzten Blätter fallen, kehr `n fernertrunken wir nach Haus.
Nachdem bis zum Ende der Gruppenstunde, lediglich das Peddigrohr in Wasser eingeweicht war, hatte ich bezüglich des angestrebten weihnachtlichen Liefertermins von Papierkorb und Bleistiftschale doch erhebliche Bedenken. Um fünf Uhr machten wir uns dann alle auf den Nachhauseweg.
Willy Kerkers, Anneliese Krieger, Marion Prenzel und ich hatten die gleiche Richtung. Einer nach dem anderen verabschiedete sich und eilte nun der elterlichen Wohnung entgegen.
In der Eltviller Straße traf ich dann noch Manfred Range. Manfred war zwei Jahre älter, mindestens zwei Köpfe größer und allemal stärker als ich.
Er war Mitglied einer, nur aus Jungen bestehenden Pfadfindergruppe und lief jeden Tag – sogar in der Schule – wichtigtuerisch in seiner Vereinskluft herum.
Da den Naturfreunden auch Mädchen angehörten, verspottete er mich deshalb immerzu.
Mit hämischem Grinsen fragte er auch diesmal: „Kommst du gerade von den Blümchenpflückern? Hast sicher mit den kleinen Fräuleins, wacker Ringelreihen getanzt, du Milchbubi?“
„Nö" antwortete ich gutmütig. „Wir haben heute Papierkörbe aus Peddigrohr gebastelt und Fahrtenlieder gesungen.“
„Ich wusste gar nicht, dass der Kinderreim „Es geht, ein Bi – Ba Butzemann in unserm Kreis herum, fidelbumm“ ein Fahrtenlied ist“ johlte Manfred nun noch gehässiger.
„Außerdem, wenn du heute gelernt hast, Papierkörbe zu flechten, kann dich deine Mama zu Fastnacht ja als Korbflicker kostümieren. Dann brauchst du nicht mehr als Schornsteinfeger mit einem Handfeger die Viehdiebe von Kentucky“ zu verfolgen, sondern kannst als der gefürchtete „Peddigrohr Bill“ den Banditen todesmutig, die selbst gebastelten Abfallkörbe über die Birne stülpen“ lästerte er bissig weiter.
Langsam aber sicher wurde ich über Manfreds bösartige Frotzeleien wütend. Jetzt fuhr ich schwere Geschütze auf, und schrie zornig: „Nein, meine Mama malt mir zwanzig Pickel ins Gesicht, damit ich aussehe wie du. Dann kann ich nämlich als Arsch mit Ohren durch Kentucky reiten - du dumme Sau.“
Bevor Manfred Range, auf meine Antwort reagieren und mir eine scheuern konnte, sauste ich – erschrocken über meine eigene Courage – wie von Furien gehetzt nach Hause. Ich nahm mir vor, diesem „Wandervogel“ in den nächsten Tagen, lieber weiträumig aus dem Weg zu gehen.
*
Angestachelt von Manfred Ranges Hetzerei, lag ich – bezüglich eines originellen Fastnachtkostüms – meinen Eltern nun ständig in den Ohren.
Mein Vater versicherte daraufhin hoch und heilig, dass er mir über einen Bekannten, der im Staatstheater arbeitete, ein echtes Cowboykostüm besorgen würde.
„Diesmal stichst du deine Kumpels mit Sicherheit alle aus“ erklärte er mir fröhlich. „Da bin ich aber gespannt wie ein Flitzebogen“ kommentierte ich diese erfreuliche Ankündigung trotzdem mit äußerst misstrauischer Miene.
„Morgen nach Dienstschluss kann ich das Kostüm abholen. Dann hat Mama noch genügend Zeit, es so abzuändern, dass es dir wie angegossen passt. Obwohl ich als Pazifist eigentlich alle Arten von Waffen prinzipiell ablehne, bekommst du ausnahmsweise sogar einen Zündplättchencolt – und einen Gürtel erhältst du auch noch. Tom Mix ist dann ein armseliger Mückenschiss gegen dich“.
Als ich dann aber noch fragte, ob mein Vater mir vielleicht von der berittenen Polizei, auch noch einen zahmen ausgedienten Gaul besorgen könnte, griff mir meine Schwester an den Kopf, um zu prüfen, ob ich vielleicht Fieber hätte.
Auch ohne Gaul freute ich mich nun auf die Fastnacht – fast so wie auf Heiligabend.
Am nächsten Tag sauste ich nach der Schule, in den Kramladen von Eduard Klump und kaufte mir für die zehn Mark, die mir meine Mutter gegeben hatte, einen gummiartigen Patronengürtel mit Holster und zwanzig Holzpatronen, ein silbernes Zündplättchenschießeisen aus Plastik und einen echt goldenen Sheriffstern aus Blech.
Da ich noch fünfundsiebzig Pfennige übrig hatte, erstand ich dafür noch eine bunte Faschingsklatsche und das neueste Pecos Bill Heftchen „Rio Grande“.
So ausgerüstet trabte ich frohgelaunt wieder nach Hause.
Jetzt fehlten nur noch das versprochene Kostüm und ein Cowboyhut.
Aber das alles, sollte ich ja heute noch bekommen.
„Donnerwetter, was ist das denn für ein Gelumpe“ fragte ich entgeistert und deutete auf das farbenprächtige Stoffbündel, das mein Vater aus einem großen Pappkarton gezogen hatte. Ich setzte mich, mit üblen Vorahnungen, fassungslos auf den Küchenstuhl.
„Was soll das schon sein, das ist dein Cowboykostüm“ antwortete mein Vater freudestrahlend. Ich wusste nicht, ob ich „Lachen oder Heulen“ sollte.
„Ihr glaubt doch wohl selbst nicht, dass ich diesen Fetzen anziehe. Da drin, sehe ich ja aus wie Clown Bimbolino aus dem Zirkus Saratussi. Das kannst du gleich wieder einkoffern.“ „Probiere das Kostüm doch erst einmal an, bevor du nörgelst“ versuchte meine Mutter die Wogen zu glätten, und holte dabei den „Cowboyhut“ aus der Schachtel.
Jetzt war die Katastrophe ordnungsgemäß vollendet.
Bei dem angeblichen Cowboyhut handelte es sich um einen flachen schwarzen Filzdeckel, dessen Rand, zu meinem Entsetzen auch noch mit einem roten Band und gleichfarbigen Zotteln eingefasst war. „Das ist doch kein Stetson“ moserte ich enttäuscht. „Der sieht ja aus, wie ein geplatzter Handkäse.“ Meine Schwester bemerkte trocken: „Wenn dir Mama noch ein paar rote Wollbommel auf den Hut näht, kannst du mit Willy Reichert im Schwarzwaldmädel auftreten.“
Obwohl sich alles in mir sträubte, diese Klamotten anzuziehen, probierte ich das – augenscheinlich aus einer Westernkomödie stammende - Kostüm dann doch an.
„Sieht doch toll aus“ sagte mein Vater nicht sehr überzeugend und führte mich vor den großen, im Flur aufgehängten Spiegel.
Jetzt sah ich mich in meiner ganzen Herrlichkeit.
Die Jacke hing an mir, wie ein plissierter Kartoffelsack und der gewaltige Kragen dieser Joppe, lag über meiner Schulter, wie die aufgestellten Ohren eines blindwütigen afrikanischen Elefantenbullen. Links und rechts war die Jacke, mit keilförmig nach unten gehenden, großen silbernen Schmuckknöpfen verziert.
Die Hose war so weit geschnitten, dass sie von vorne aussah, wie ein riesiger, unter Druck stehender Feuerwehrschlauch. Der Hosenlatz war ebenfalls – in Doppeltreihe – mit silbernen Knöpfen besetzt. Als Knalleffekte, waren in die besonders geräumigen Hosenbeine, auch noch – aus rosa Seidenstoff bestehende – dreieckige Spittel eingenäht. Doch die absolute Krönung war die abscheulich schrille „Apfelsinenfarbe“ des Kostüms.
„Welcher Spaßvogel hat dir denn diese Kluft, als Cowboykostüm angedreht? Ich sehe ja aus wie „Hugo der Verschleimte“ schimpfte ich missgelaunt.
„Ich glaube, der Herr Dolfinger hat sich da tatsächlich ein bisschen vergriffen“ feixte mein Vater. Er zog bedächtig einen kleinen Papieranhänger aus dem Kragen der Jacke.
Darauf war zu lesen: „Kostümfundus – Die lustige Witwe“
Jetzt war ich restlos bedient.
*
Für Faschingssamstag 20:11 Uhr hatten meine Eltern zum großen Hausmaskenball geladen. Gegen zwanzig Uhr trudelten die Gäste nacheinander in unserer Wohnung ein. Herr und Frau Struck aus dem ersten Stock, die Schlupp`s aus der Wohnung unter uns, die besten Freunde meiner Eltern Alfred und Karla Mayer, die Sekretärin meines Vaters Frau Mischewsky mit Ehemann, der Stellvertreter meines Vaters Herr Schleifenberg mit seiner Frau und selbstverständlich Tante Elsa, Onkel Paul und Gitta.
Alle hatten sich mehr oder weniger selbstschöpferisch kostümiert und farbenprächtig herausgeputzt.
Meine Mutter, Tante Elsa und Ursula hatten bis zur letzten Minute in der Küche gestanden, um ausreichend Essen und Trinken für die „Narrenschar“ vorzubereiten. Unser Hund Jenny sprang aufgeregt zwischen den Leuten herum und begrüßte jeden mit einem lauten fröhlichen Bellen.
„Jenny sei schleunigst still“ rief meine Mutter. „Sonst hetzt uns der alte Göhlig, schon jetzt die Polizei auf den Hals.“
Karl Göhlig wohnte im ersten Stock unseres Hauses –direkt neben der Wohnung von Frau Dr. Struck – und war als Querulant und bösartiger und starrköpfiger Kinderfeind im gesamten Rheingauviertel bekannt.
Bei geringstem Geräusch im Haus, oder gar bei lautstarkem Kinderspiel, rief er sofort die Polizei oder drohte massiv mit gerichtlichen Schritten gegen die Verursacher.
„Heute wird dieser Mückenfänger, so richtig auf seine Kosten kommen“ wieherte Onkel Paul in Vorfreude auf die bevorstehende Festlichkeit.
Mich hatten meine Eltern an diesem Abend – äußerst kreativ – mit Lederhose, kariertem Hemd und Tirolerhut als Seppl verkleidet.
Als Onkel Paul mich fragte, warum ich nicht mein neues Cowboykostüm angelegt hätte, winkte ich, nur eine Fratze schneidend ab. Mit Schrecken dachte ich, an den Moment zurück, in dem ich mit dem orangeroten Frackes und dem flachen Stierkämpferhut bei meinen Freunden aufgetaucht war. Jürgen Bubler hatte grinsend gefragt, ob ich jetzt als Torero bei der Müllabfuhr arbeiten würde. Daraufhin war ich postwendend in unsere Wohnung zurückgerast, und hatte mein Schornsteinfegerkostüm vom vergangenen Jahr wieder angezogen. Mit Gürtel, Revolver und Sheriffstern sah das Ganze gar nicht so übel aus. Nur der Zylinder störte ein bisschen. Beim Cowboy – und Indianerspielen, durfte ich mich daher auch nur, als schrulliger Indianer „Hoher Hut“ beteiligen. Als mein Vater mir abends eröffnete, im nächsten Jahr würde er mir für Fasching eine echte eiserne Ritterrüstung mit Helm, Visier und Gummischwert besorgen, hatte ich nach kurzem Nachdenken dankend verzichtet. Obwohl so ein heruntergeklapptes Visier auch seine Vorteile hätte. Meine Freunde würden mich, bei einem ähnlichen Kostümfehlschlag, wie er mir in diesem Jahr beschert wurde, wenigstens nicht gleich erkennen.
Nun aber waren wir beim Feiern – und das war nicht von schlechten Eltern.
Wein und andere diverse alkoholische Getränke zeigten bei den Erwachsenen langsam aber sicher, ihre durchschlagende Wirkung.
Zu den rheinischen Liedern aus dem Schallplattenspieler wurde geschunkelt, getanzt und zunehmend lauter gesungen.
Der absolute Brüller war, als Onkel Paul und mein Vater, Backe an Backe und mit Papiernelken quer im Mund, einen flotten Tango aufs Parkett legten. Als dabei Onkel Paul auch noch die Hose runterrutschte und er in langer Unterhose weiter tanzte, kannte das Gejohle keine Grenzen mehr.
Es war bereits spät nach Mitternacht, als die komplette Gesellschaft einschließlich unseres Hunds Jenny – angeführt von Frau Dr. Struck mit Gitarre – in einer Polonaise, singend durch das Treppenhaus zog.
Aus der Parterrewohnung schloss sich Herr Mengt im gestreiften Schlafanzug und wirr abstehenden Haaren – trotz seiner Beinprothese – humpelnd und singend dem ausgelassenen Umzug an.
Prompt kam der Griesgram „Karl Göhlig“ aus seiner Wohnung geschossen und brüllte: „Ihr Verbrecher, elender Abschaum, ich hole die Polizei, ich bringe euch alle hinter Gitter ihr unverschämten Gorillas“.
Als Herr Schleifenberg ihm mit einer Fastnachtsklatsche dann noch scherzend auf die wie immer hochglänzende Glatze patschte, verschwand Herr Göhlig, weiterhin wüste Beschimpfungen ausstoßend und die Abschlusstür zuknallend, in seiner Wohnung.





























