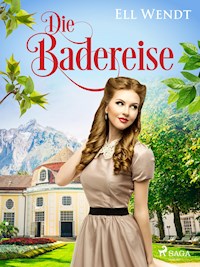Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lindhardt og Ringhof Forlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dem manchmal etwas mühsamen Alltag an der Seite ihres Mannes Alexander begegnet die junge Sibylle mit Humor und vergnügter Lebenslust. Dabei hat das Bohemeleben in der Atelierwohnung in München auch seine Schattenseiten. Der ewig rauchende Ofen, die Geldsorgen, die unbegabten Klavierschüler …Aber eines Tages, da ist sich Sibylle sicher, kommt für den Pianisten der Durchbruch. Alexanders gutbürgerliche Familie ist da allerdings anderer Ansicht. Alexanders Entschluss, Pianist zu werden, schlug im Hause Birk ein wie eine Bombe. Der Nachhall dieses mit Trotz erzwungenen Sieges ist jeden Sonntag zu spüren, wenn alle Mitglieder sich unter dem Vorsitz des gestrengen Herrn Papa am Mittagstisch versammeln. Als das Geld wieder einmal besonders knapp ist, ringt sich Alexander durch, an einem Abend bei Frau Osterwald als Gastkünstler zu spielen. Ob der Abend ein beruflicher Erfolg ist, lässt sich nicht sagen. Offensichtlich am meisten begeistert ist die junge, unkonventionelle Ola Johannsen. Unverhohlen schwärmt sie für den „Meister", den sie mit Charme überredet, ihr Unterricht zu geben. Bald kommt Fräulein Johannsen jeden Tag auf einen Sprung vorbei und Sibylle ahnt, dass Alexanders nervöse Streitlust mit der feurigen Rothaarigen zu tun hat. Als sie eines Tages in der Unterhaltung der beiden eine verkappte Liebeserklärung Alexander herauszuhören glaubt, verlässt sie unter Tränen die Wohnung. Die große Liebe ist für sie gestorben!Heiter und schwungvoll erzählt der humorvolle Roman von dem chaotischen Leben der jungen Sibylle an der Seite ihres nervösen Künstlerehemanns. Als die „Verführung" in Form einer attraktiven, lebenslustigen Frau in ihren Alltag einbricht, gerät ihre Liebe allerdings in große Gefahr.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ell Wendt
Liebe in Gefahr
Roman
Saga
Liebe in Gefahr
© 1939 Ell Wendt
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711592823
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
1.
Sibylle wurde von einem Sonnenstrahl geweckt, der sich in ihre Augenlider stahl. Neben ihr atmete Alexander in tiefen, gleichmäßigen Zügen. Sein Gesicht war ihr zugewandt, eine kleine, steile Falte stand zwischen seinen Brauen, das hellbraune Haar hing wirr in die schöne Stirn.
Wie fest er schlief! Sibylle lächelte zärtlich. Sie war bereit, zehn zu eins zu wetten, daß er beim Aufwachen behaupten würde, er habe die ganze Nacht kein Auge zugetan. Künstler dürfen nicht mit gewöhnlichem Maß gemessen werden; irgendwie haben sie alle etwas von der Prinzessin auf der Erbse an sich. Sie stand leise auf und zog den grünen Fenstervorhang fester zusammen, damit Alexander nicht von der Sonne gestört werde. Draußen war der Himmel von einem kalten, blankgeputzten Blau, Glockengeläut schwang feierlich in der klaren Luft.
Sibylle schlüpfte ins Bett zurück und zog die Decke eng um ihre Schultern. Sonntag! Das bedeutete: schlafen, so lange man Lust hatte, heißen Toast und Orangenmarmelade zum Frühstück, Spazierengehen mit Alexander und Polster, Mittagessen im Hause Birk. — —
Hier machten Sibylles freundlich schweifende Gedanken halt. Das Mittagessen war nicht unbedingt den Reizen des Sonntags zuzuzählen. Alexanders Vater besaß einen ungewöhnlich stark entwickelten Sinn für Familie und Tradition. Ihm war es zu verdanken, daß alles, was Birk hieß, sich allsonntäglich zu gemeinsamem Mittagsmahl zu versammeln hatte. Alexander behauptete boshaft, nur ein Amtsgerichtsrat sei imstande, mit soviel pedantischer Hartnäckigkeit auf einem Brauch zu bestehen, der sich im Zeitalter der Wochenendausflüge überlebt habe und alle Beteiligten empfindlich in ihrer Freiheit beschränke.
Er entstammte einer Familie von Rechtsgelehrten, strengen, nüchternen Herren, die es im Dienst der Justiz zu Ehre und Ansehen gebracht hatten. Es schien selbstverständlich, daß er ihrem Beispiel folgen würde, obwohl seine starke musikalische Begabung schon in früher Kindheit zutage getreten war. Sein Entschluß, Pianist zu werden, schlug im Hause Birk ein wie eine Bombe. Es war etwas noch nie Dagewesenes, daß ein Sproß dieser wohlbestallten Beamtenfamilie die gesicherte Existenz im Dienste des Staates einer Laufbahn opferte, die den Birks ebenso zweifelhaft erschien wie Trapezakrobatik oder Drahtseillauf. Nach Auftritten, bei denen Alexander den Donnerworten des Vaters mit dem zähen Widerstand eines eigensinnigen Esels begegnet war, hatte der Amtsgerichtsrat endlich, vollkommen erschöpft, die Waffen gestreckt.
„Tu’ was du willst“, hatte er gesagt, „aber gib dich nicht der Hoffnung hin, daß ich dich in alle Ewigkeit unterstützen werde. Ich wasche meine Hände in Unschuld, wenn du als Hungerleider in einer Dachkammer endest.“
In den Augen des Amtsgerichtsrats hing jede Art von Kunst auf das engste mit Hunger und Dachkammern zusammen. Hinweise auf Künstler, die es zu etwas gebracht hatten, pflegte er mit der lakonischen Bemerkung abzutun, da habe halt mal einer Glück gehabt.
Es erleichterte Alexander das Leben durchaus nicht, daß der Vater, seiner düsteren Prognose zum Trotz, von Tag zu Tag auf die Früchte seiner Opferbereitschaft wartete. Selbst, wenn der Amtsgerichtsrat es bisweilen unterließ, seine Gedanken in dieser Hinsicht in Worte zu kleiden, glaubte Alexander ewigen Vorwurf in seinen Blicken zu lesen.
Er litt darunter, ohne es zuzugeben. Wie viele zarte Naturen, verbarg er innere Unsicherheit unter einer Maske undurchdringlichen Hochmutes. Aber er vibrierte vor nervöser Gereiztheit, und es gab Tage, an denen er einem Vulkan glich, brodelnd, und jeden Augenblick bereit, auszubrechen.
„Er hat Launen wie eine Primadonna“, behauptete sein Freund Andreas, während Tante Gudula Sibylle anvertraut hatte, Alexander arte seiner Urgroßmutter nach, deren Porträt in zarten Pastellfarben im Birkschen Eßzimmer hing.
Rein äußerlich betrachtet, glich er ihr in der Tat auf überraschende Weise: das ausdrucksvolle Oval des Gesichtes, die tiefblauen Augen unter hellbraunem Haar, nicht zuletzt der weiche, schön geschwungene Mund mit dem kleinen, spöttischen Lächeln in den Mundwinkeln. Alles sprach dafür, daß sie Alexander auch die Liebe zur Musik vererbt hatte, denn sie hatte eine sehr hübsche Stimme ihr eigen genannt, deren Ausbildung einem italienischen Gesangsprofessor, namens Martinuzzi oder Martinelli — des Namens entsann Tante Gudula sich nicht mehr genau — übertragen worden war. Die Familie tat jener Urgroßmutter ungern und selten Erwähnung. Es war nämlich geschehen, daß sie eines Tages mit besagtem Martinuzzi auf und davon gegangen war, unter Hinterlassung eines Briefes, in dem sie Kaspar Birk wissen ließ, sie langweile sich in der Ehe mit ihm zu Tode. Niemand wird es den Birks verdenken, wenn dieser Grund für sie der Stichhaltigkeit ermangelte. Sie scheuten weder Mühe noch Kosten, die Pflichtvergessene ohne Skandal dem häuslichen Herd wieder zuzuführen, und es ging ein Aufatmen durch die Familie, nachdem es gelungen war. Eheliche Fahnenflucht war in den Annalen der Birks ohne Beispiel und ganz und gar unerhört.
Was übrigens Alexanders Heirat mit Sibylle betraf, so war sie der zweite Schlag gewesen, den Alexander den Seinen zugefügt hatte. Sibylle war sich schamhaft bewußt, genau das Gegenteil von dem zu sein, was Birks sich als Schwiegertochter gewünscht hatten. Als Tochter eines Privatgelehrten und Kunstsammlers, der gestorben war, ohne ihr etwas zu hinterlassen außer einigen schönen alten Möbeln und einem Bilde von Spitzweg, dessen Echtheit jedoch angezweifelt wurde, hatte sie keinerlei Anspruch auf Ansehen in der Familie. Weder ihr anmutiges Äußere, noch die Fähigkeit, Kunstgewerbliches geschmackvoll anzufertigen, hatte den Amtsgerichtsrat von ihren Qualitäten zu überzeugen vermocht. Er nannte die Ehe seines Sohnes einen glatten Wahnsinn und weigerte sich hartnäckig, Alexanders Zuschuß auch nur um einen roten Heller zu erhöhen.
Dieser Zuschuß, verbunden mit dem Honorar für einige Klavierstunden, und dem kärglichen Erlös aus Sibylles kunstgewerblichen Arbeiten, bildete die Basis, auf der sie ihr gemeinsames Leben aufbauten.
Unnötig, zu sagen, daß sie nicht auf Rosen gebettet waren! Alexander, dem die Existenz des freien Künstlers aus der Perspektive selbstverständlicher bürgerlicher Gesichertheit romantischer erschienen sein mochte, als sie es tatsächlich war, litt unter den Beschränkungen, die der Mangel an Geld ihm allenthalben auferlegte. Obwohl er behauptete, den „Mammon“ zu verachten, konnte er ihn nicht im geringsten entbehren. Hieraus ergab sich ein Widerspruch zwischen Theorie und Praxis, der das Leben oft sehr schwierig machte. Aber sie liebten einander. Es war zwar nicht mehr so oft die Rede davon, wie im Anfang, als die Wunder der Welt nur darauf zu warten schienen, im Sturm von ihnen erobert zu werden; aber sie wußten um das Gefühl tiefer Zusammengehörigkeit, das sie den Schwierigkeiten des Alltags zum Trotz, oder vielleicht gerade um ihretwillen verband.
Ein Kratzen an der Tür ließ Sibylle aufhorchen. Sie sprang aus dem Bett und drückte behutsam die Klinke herab. Draußen saß der Hund Polster; er sah sie mit schief geneigtem Kopf aus bernsteingelben Augen an, sein Schwanz klopfte in heftiger Gemütsbewegung den Boden.
Sibylle mußte lachen.
„Pst“, sagte sie, „wir müssen leise sein.“
Der Hund jedoch drängte sich an ihr vorbei ins Zimmer. Er liebte Sibylle über alles, jede Begegnung mit ihr war ein jubelndes Wiedersehensfest. Winselnd vor Glück umkreiste er sie und brachte, springend und tanzend, den Hocker vor dem Toilettentisch zu Fall.
Alexander fuhr verstört auf.
„Siehst du“, sagte Sibylle vorwurfsvoll, „jetzt haben wir ihn aufgeweckt.“
Sie ging zum Fenster und zog den Vorhang zurück. Die Sonne flutete in breitem Strom ins Zimmer.
Es war ein sehr merkwürdiges Schlafgemach. Sibylle haßte Betten, sofern es sich nicht um Lagerstätten aus der Zeit des Barock, des Empire oder der Renaissance handelte, wie sie in Museen und Schlössern zu finden waren. Sie hatte der Banalität des zweibettigen bürgerlichen Schlafzimmers zu entgehen versucht, indem in ihrer Wohnung zwei große Matratzen, am Tage von einer grünen Decke verhüllt, mit zahllosen bunten Kissen als Diwan prunkten, während sie zur Nacht mit ein paar Handgriffen in Betten verwandelt wurden. Auf diese Weise war ein gewichtiges Möbelstück entstanden, das den kleinen Raum vollkommen beherrschte. Kaum, daß ein gebrechliches Toilettentischchen, mit einem halbblinden Barockspiegel darüber, nahe beim Fenster Platz fand. Kleider und Wäsche waren in einem Wandschrank untergebracht, während ein winziges Gelaß neben der Küche mit einer hochbeinigen Blechwanne den stolzen Namen Badezimmer führte.
„Guten Morgen“, sagte Sibylle und lächelte Alexander gewinnend an, „sieh nur, welch herrlicher Tag!“
Alexander jedoch erwies sich als unempfänglich für die Schönheit des Sonntags. Er gehörte zu den Menschen, die Morgensonne als persönliche Kränkung empfinden. Nachdem er den freudetrunkenen Polster zornig von seinem Bett verscheucht hatte, zog er die Decke über den Kopf, so daß nichts als ein Büschel brauner Haare hervorschaute, und tauchte nur noch einmal auf, um Sibylle vorwurfsvoll mitzuteilen, er habe die ganze Nacht kein Auge zugetan.
Sibylle zog den Bademantel über ihr Pyjama, sie gab ihrem kurzen, glatten Blondhaar einen kräftigen Bürstenstrich und verschwand im Badezimmer, wo sie sich aus Gründen der Sparsamkeit mit einer kalten Dusche begnügte. Dann begab sie sich daran, das Frühstück zu bereiten und den Tisch im Atelier zu decken.
Das Atelier — ein richtiges Maleratelier mit einem Riesenfenster — war ihr „Zimmer für alles“. Hier stand der große schwarz glänzende Konzertflügel, hier prangte die Barockkommode aus der Hinterlassenschaft des Kunstmalers mit üppig geschwungenen Formen und kunstvollen Beschlägen. Vor das Sofa aus der Zeit der Madame Recamier war der niedrige Tisch geschoben, an dem sie ihre Mahlzeiten einzunehmen pflegten; ein paar ebenso dekorative wie unbequeme Stühle paradierten an den Wänden, die mit dem angezweifelten Spitzweg und einigen schönen alten Stichen geschmückt waren.
Sibylle war der Atelierromantik hoffnungslos verfallen. Es focht sie nicht im geringsten an, daß das Zimmerthermometer sich im Winter hartnäckig weigerte, über 15 Grad zu steigen, den Kohlenmengen zum Trotz, die Jeremias, das häßliche, schwarze Öfchen, wie ein Moloch verschlang. Dafür schien am Vormittag die Sonne hinein, ein Umstand, der alle Kunstmaler auf die Dauer zwang, das Atelier aufzugeben. Sibylle liebte den schwachen Duft von Farbe und Terpentin, den sie hinterlassen hatten; sie liebte den Blick über Dächer und Türme — an föhnigen Tagen schweifte er ungehemmt bis zur blauen Kulisse des fernen Gebirges. Sie liebte den Himmel vor dem Fenster mit dem Spiel ziehender Wolken, dem tiefen Blau stiller Sommertage und dem funkelnden Sternenmeer klarer Nächte.
Die Familie hatte die Wahl der Wohnung seufzend den mancherlei Verstiegenheiten zugerechnet, an die Alexander und Sibylle sie im Lauf ihrer vierjährigen Ehe gewöhnt hatten. Aber das Badezimmer erfüllte Mama immer aufs neue mit stiller Trauer, ebenso wie es sie verdroß, daß das Atelier vom Schlafzimmer lediglich durch einen Vorhang abgetrennt war. Sie begriff nicht, wie Alexander, von jeher an solide Behaglichkeit gewöhnt, sich im Milieu eines „bohémien“ — ein Wort übrigens, das die Familie mit unsäglicher Verachtung aussprach — wohlfühlen konnte. Nichts jedoch hätte Alexander und Sibylle zu bewegen vermocht, um größerer Bequemlichkeit willen auf die mannigfachen und unbeschreiblichen Reize des Ateliers zu verzichten.
Alexander kam aus dem Badezimmer in seinem dunkelblauen Bademantel, rote Saffianpantoffel an den Füßen. Sibylle goß Kaffee ein und bestrich heiße Toastschnitten mit Butter. Zwischendurch bedachte sie Polster mit einem Stückchen Zucker. Er saß zwischen ihr und Alexander, ein ungewöhnlich schwarzer Hund von fragwürdiger Herkunft. Sein Kopf glich einer zerzausten Chrysantheme, über den gelben Augen sträubte sich das Haar zu kleinen Dächern. Der Mann, der ihn Alexander verkauft hatte, behauptete, er sei ungarischer Abkunft, ein Sohn der Pußta, wo seinesgleichen die Herden bewache. Wie dem auch sein mochte, Sibylles Seligkeit kannte keine Grenzen, als sie das struppige, schwarze Knäuel zum ersten Male im Arm hielt. Der Hund war Alexanders erstes Weihnachtsgeschenk gewesen, von Rechts wegen hieß er Janosz, aber seine wollige Beschaffenheit hatte ihm alsbald den Namen Polster eingetragen.
„Du verwöhnst den Hund“, sagte Alexander mißmutig.
Er saß in dem einzigen bequemen Sessel, den sein schönheitsdurstiger Schwiegervater hinterlassen hatte, während Sibylle auf dem Récamiersofa Platz genommen hatte, dessen stilvolle Unbequemlichkeit notdürftig durch einige Kissen gemildert wurde. Gewöhnlich war Alexander nach der ersten Zigarette imstande, den Dingen des täglichen Lebens ins Auge zu sehen. Sibylle beschloß, den günstigen Augenblick zu nutzen.
„Hast du schon darüber nachgedacht, was du am Mittwoch bei Osterwalds spielen wirst?“ begann sie behutsam.
Alexander blies den Rauch seiner Zigarette unwillig durch die Nase.
„Ich werde überhaupt nicht spielen“, sagte er kurz.
„Du bist wahnsinnig“, stellte Sibylle kopfschüttelnd fest, „eine derartige Chance auszuschlagen. Frau Konsul Osterwald ist in hundert Vereinen und Ausschüssen, sie kann dir bestimmt von Nutzen sein.“
„Glaubst du etwa, es sei eine Ehre für mich, in Wohltätigkeitsvereinen und Hauskonzerten zu spielen?“ fragte Alexander höhnisch zurück, „ich bin kein Salonmusikant und wünsche ernstgenommen zu werden, verstehst du mich?“
„Ja.“ Es ging Sibylle durch den Kopf, daß Künstler vom Range Chopins und Liszts es nicht verschmäht hatten, in Salons zu spielen, aber sie wagte nicht, Alexander in diesem Augenblick darauf aufmerksam zu machen.
Sie stand auf und setzte sich auf seine Sessellehne.
„Lexl“, schmeichelte sie, „tu es mir zuliebe. Schau, man darf nicht allzu wählerisch sein. Wie willst du bekannt werden, wenn man dich nirgends hört? Frau Osterwald ist immer sehr freundlich zu uns — —“
„Sie sieht wie ein Marzipanschweinchen aus“, unterbrach Alexander grimmig.
Sibylle mußte lachen.
„Sie ist aber ein einflußreiches Marzipanschweinchen, und wir können ein bißchen Protektion sehr gut gebrauchen. Denk’ nur an die unbezahlten Rechnungen drüben auf dem Schreibtisch. Vor ein paar Tagen hat Herr Gareisl gemahnt wegen der Kohlen, und was den Schneider betrifft —“
Alexander stöhnte laut auf. „Welch grauenhafter Materialismus! Man könnte meinen, du seist Papas leibliche Tochter.“
Sibylle schwieg. Sie dachte, daß das Leben einen zwinge, praktisch zu denken, wenn man mit einem Mann verheiratet ist, der die Lösung aller irdischen Probleme einer glücklichen Fügung überließ.
„Schneekopf ist übrigens auch eingeladen“, spielte sie nach einer Pause ihren letzten Trumpf aus.
Endlich horchte Alexander auf. Professor Schneekopf, Direktor der musikalischen Akademie und Dirigent der Odeonkonzerte, war immerhin ein Faktor, mit dem zu rechnen es sich verlohnte.
„Sagst du nun auch noch nein?“ fragte Sibylle frohlockend. Sie wußte ihn besiegt, obwohl er murrend erklärte, er laufe niemandem nach, auch Schneekopf nicht.
„Du unverbesserlicher Querkopf!“ Sibylle erhob sich und begann, den Frühstückstisch abzuräumen. „Wenn es nach dir ginge, würden wir bald an den Hungerpfoten saugen.“
Während sie hin- und herging, erzählte sie lachend, wie sich ihr als Kind schreckliche Vorstellungen mit dieser Redensart verbunden hatten, ein ewiges Daumenlutschen etwa, dessen grausame Unergiebigkeit nur durch die Erfahrung gemildert worden war, daß ein in Zuckerwasser getauchter Daumen gar nicht übel schmecke.
Auch Alexander mußte lachen.
„Also, das Zuckerwasser bleibt uns immer noch, wenn alle Stricke reißen. Arme Billie, mache ich dir das Leben so schwer?“
„Manchmal — ein bißchen“, sagte Sibylle und lächelte.
Sie stand mitten im Zimmer, das Tablett mit dem Frühstücksgeschirr in den Händen, eine schmale Gestalt mit einem nachdenklichen Kindergesicht.
„Woran denkst du?“ fragte Alexander.
„Du hast lange nicht mehr Billie zu mir gesagt —“
„Nanu!“ Alexander schien sehr erstaunt. „Wie sage ich denn jetzt zu dir?“
„Eigentlich gar nicht. Du sagst: ‚hallo‘ oder: ‚du hör’ mal‘, und da außer Polster niemand in der Wohnung ist, weiß ich, daß ich gemeint bin.“
Alexander verschanzte sich raschelnd hinter die Sonntagszeitung.
„Darauf kommt es ja letzten Endes auch nicht an“, sagte er abweisend.
Sibylle trug das Geschirr in die Küche. Sie mußte an einen Ausspruch denken, den sie einmal irgendwo gelesen hatte: „Wenn die Männer aufhören, Reizendes zu sagen, hören sie auch auf, Reizendes zu denken.“
Dies hielt sie jedoch, was Alexander betraf, zumindest für übertrieben. Verliebter Überschwang läßt sich nicht in einen Dauerzustand verwandeln. Sibylle war vernünftig genug, das einzusehen. Trotzdem konnte sie es nicht hindern, daß die Erkenntnis ein wenig bitter schmeckte. Wer wäre nicht geneigt, die eigene Ehe für eine Ausnahme zu halten?
Von der Ludwigskirche kamen zwölf hallende Schläge.
Sibylle stürzte ins Schlafzimmer. „Um Gottes willen, Lexl, wir müssen uns beeilen! Du weißt, wie Papa auf Pünktlichkeit hält!“
Alexander, vor dem halbblinden Spiegel mit seiner Krawatte beschäftigt, schnitt seinem Spiegelbild eine Grimasse. Er verabscheute das Sonntagsessen im Familienkreise aus Herzensgrund. Er verabscheute Familiensinn und Tradition, des Amtsgerichtsrats ehernes Despotentum und die ängstliche Betulichkeit seiner Mutter, die er sklavenhaft nannte. Ganz besonders verabscheute er die heuchlerische Demut, mit der sich die Familie den Ansichten des Amtsgerichtsrats unterwarf.
Als Kind hatte er eine heftige Abneigung gegen die Ausflüge verspürt, die sommers und winters ins Isartal unternommen wurden. An einem Aussichtspunkt, es war immer der gleiche, pflegte Papa die Seinen gebieterisch zur Bewunderung der Natur aufzufordern. Man hatte alsdann eine Weile in stummer Andacht zu verharren. Dieses auf Befehl andächtig sein hatte Stürme des Widerstandes in der Seele des jungen Alexander entfesselt. Selbst die Aussicht auf das übliche Stück Torte beim Kaffee hatte ihn nicht vermocht, die Miene scheinheiligen Entzückens zu wahren.
Im Atelier klingelte das Telefon.
„Ach, bitte, geh’ du!“ Sibylle, notdürftig bekleidet, war mit der Rückverwandlung der Betten in einen Diwan beschäftigt. Als sie damit fertig war, holte sie Nadel und Faden herbei und begann, einen abgerissenen Knopf an Alexanders Jackett zu nähen.
Alexander kam zurück. „Es war Andi“, sagte er.
Sibylle sah fragend auf.
„Er fährt über Mittag mit Lili hinaus und möchte uns durchaus mitnehmen.“
„Aber er weiß doch —“
„Natürlich weiß er! Aber das hindert ihn nicht, uns für ausgemachte Narren zu halten. Zeige mir den Menschen, der den Birkschen Familienterror begreift!“
„Andi hat keinen Sinn für Tradition“, sagte Sibylle. „Was, glaubst du, würde geschehen, wenn wir einfach nicht zu Tisch erschienen?“
Alexander zuckte die Achseln.
„Ich habe es einmal versucht. Damals ging ich noch zur Schule. Ein Freund überredete mich, bei ihm zu bleiben. Ich tat es, weniger aus Vergnügen, als um zu sehen, was daraus entstehen würde.“
„Und was entstand?“ fragte Sibylle erwartungsvoll.
„Der Amtsgerichtsrat sprach zwei Wochen lang kein Wort mit mir, Mama lief umher wie eine verängstigte Henne, ich wurde wie ein Verworfener behandelt. Es war sehr unerfreulich.“
Sibylle lachte; sie konnte sich nur zu gut vorstellen, wie Alexander wider den Stachel gelöckt hatte.
„Übrigens erregt Andi Anstoß mit seine Lili“, sagte sie, um ihn abzulenken, und gab eine Geschichte zum besten, in der Andreas eine sittenstrenge alte Dame mit der Mitteilung chokiert habe, die schönsten Stunden seines Lebens seien die, die er mit seiner Lili im Grünen verbringe. „Ja, ja, die jungen Leute heutzutage“, hatte die alte Dame kopfschüttelnd gesagt.
„Natürlich hatte sie von der Existenz eines Autotyps ‚D. K. W. Liliput‘ keine Ahnung“, schloß Sibylle lachend.
„Wie sollte sie auch!“ sagte Alexander, „übrigens würde ich mich an deiner Stelle etwas beeilen. Zum Spazierengehen kommen wir heute sowieso nicht mehr.“
„Sofort!“ Sibylle lief zum Kleiderschrank. „Was soll ich anziehen: das rote vom vorigen Jahr, oder das dunkelblaue mit den Biesen?“
„Welches blaue?“ fragte Alexander im Hinausgehen.
Während Sibylle in das dunkelblaue mit den Biesen schlüpfte, überlegte sie, ob es wohl einen Mann gebe, der in bezug auf die Kleidung seiner Frau nicht mit Blindheit geschlagen sei. Auch ihr verstorbener Vater hatte niemals bemerkt, wenn sie ein neues Kleid getragen hatte, obwohl es selten genug vorgekommen war.
Sie zog ihr graues Lammfelljäckchen an und setzte den runden, ringsum aufgeschlagenen Hut auf, in dem sie wie eine Sechzehnjährige aussah.
Draußen stand Alexander schon in Hut und Mantel.
„Auf in den Kampf!“ zitierte Sibylle fröhlich.
Alexander lächelte wie ein Märtyrer.
2.
Die Straße, in der Sibylle und Alexander wohnten, unterschied sich in nichts von anderen Vorstadtstraßen mit ihrem vollkommenen Mangel an Grün, mit hohen, eintönigen Häusern, in deren Erdgeschoß sich kleine Läden befanden, mit einem trübseligen Café an der Ecke, von dem man sich nicht vorstellen konnte, daß es jemals von irgend jemandem besucht wurde.
Aber sie war in Schwabing gelegen, jenem Stadtteil Münchens, der sich eines gewissen Nimbus’ erfreut, dank der Tatsache, daß von jeher Künstler ihn mit Vorliebe zu ihrem Wohnsitz erwählten. Um keinen Preis hätte Sibylle in einer anderen Gegend leben mögen. Ihre Kindheit, die Erinnerung an den Vater, waren auf das engste mit Schwabing verknüpft, ganz abgesehen von dem unbestimmbaren Reiz, der sich ihr mit Ateliers und dämmerigen Künstler-Weinstuben verband.
Die Sonne, am Morgen von frühlinghaftem Glanz, war hinter Dunstschleiern verschwunden, ein rauher Wind fegte durch die Straßen. Sie wanderten eilig und schweigsam dahin, überschattet von der Gewißheit, zu spät zu kommen. Aber wie immer, wenn sie durch das Siegestor in die Ludwigstraße kamen mit ihren strengen, klassizistischen Fassaden, die von den beiden spitzen Türmen der Ludwigskirche unterbrochen wurden, ging ihnen das Herz auf ob der herben Schönheit der Stadt, die ihre Heimat war.
Als sie das alte Haus in der Nymphenburgerstraße betraten, schlug es ein Uhr. Sibylle seufzte beklommen. Das Mittagessen begann um eins, aber die Tradition erforderte, daß man sich eine halbe Stunde früher einfand, um plaudernd im Salon beisammenzusitzen. In der Tat, die Familie war vollzählig versammelt. Sie saßen und standen umher, die Eltern, Tante Gudula, Wallmosers mit dem fünfjährigen Kurt, Burschi genannt, und der jugendliche Kaspar.
Alexanders und Sibylles Eintritt vollzog sich unter unheilverkündendem Schweigen. Aller Augen waren auf sie gerichtet, die der jüngeren Generation mit einem Gemisch aus Mitleid und Schadenfreude, wie es Schüler beim Zuspätkommen eines Kameraden zur Schau tragen.
„Wir bitten um Verzeihung“, sagte Sibylle zaghaft.
Die Familie sah erwartungsvoll den Zorn wie eine rote Welle in das Gesicht ihres Oberhauptes steigen bis zu den silbernen Schläfenhaaren hinauf. Nur Mama wagte ein begütigendes Lächeln, das jedoch im Keim erstickt wurde, denn der Amtsgerichtsrat setzte zu einer längeren Rede an, in derem Verlauf er erklärte, er dulde keine Bohemewirtschaft in seinem Hause und werde sie niemals dulden.
„Sogenannte Künstlerfreiheiten“, sagte er mit erhobener Stimme, „haben vor meiner Schwelle haltzumachen. Ein für allemal!“