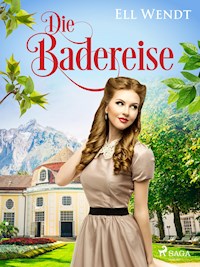Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein unterhaltsamer Sommerroman über die unterschiedlichen Charaktere, die den Sommer in einer Pension am See verbringen: Als die Familie Berthold überraschend das Landhaus Sophienlust in Seewang in Oberbayern erbt, richtet sie kurzerhand einige Zimmer für Feriengäste her. Doch sobald die Gäste da sind, beginnen auch schon die Schwierigkeiten – sei es der Streit um das einzige Balkonzimmer, besondere Essenswünsche oder Fräulein Aurelius' Anziehungskraft auf Männer.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ell Wendt
Sommergäste in Sophienlust
Ein heiterer Roman
Saga
Sommergäste in Sophienlust
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1956, 2020 Ell Wendt und SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726629248
1. Ebook-Auflage, 2020
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
– a part of Egmont www.egmont.com
1
Der fünfte März begann wie alle Tage; vielleicht war er um eine Schattierung grauer und trübseliger als seine Vorgänger.
Beim Frühstück war Johannes schlechter Laune, weil er sich verschlafen hatte und zu spät dran war. Hinz, siebenjährig, schleckte den Honig vom Brot und mußte abwechselnd von Johannes und mir ermahnt werden. Schließlich war es so spät geworden, daß Johannes ihn im Wagen zur Schule nehmen mußte.
Ich war froh, als beide fort waren. Es herrschte nun eine grämliche Stille in der Wohnung. Ich ging umher und wedelte mit dem Staubtuch über die Möbel. Alles kam mir verbraucht und aufbesserungsbedürftig vor im grauen, nichts beschönigenden Licht dieses Tages. Das Wohnzimmer müßte eine neue Tapete haben, dachte ich, und die Bezüge sind auch schon recht verschossen. Ich seufzte bei dem Gedanken, wieviel Geld nötig war, um dem Verfall erfolgreich zu steuern. Wenn man der Wissenschaft glauben darf, erneuert sich der Mensch alle sieben Jahre von Grund auf; warum ist es bei den Dingen unseres täglichen Lebens nicht ebenso?
Meine Gedanken gingen zu Johannes. Wenn der neue Roman von Armin Pütter, den er im Herbst herausbringen will, ein Bombenerfolg wird — — Ich konnte mir die geringe Wahrscheinlichkeit dieser Hypothese nicht verhehlen. Johannes ist ein Idealist; er will das Publikum zu seinem Glück zwingen. Armin Pütters Bücher hingegen haben die Eigenschaft, im gleichen Maße an literarischem Wert zu gewinnen, in dem sie für den Durchschnittsleser ungenießbar werden. Der Vertrieb geistiger Erzeugnisse ist ein ebenso edles wie saures Brot! Wenigen Auserwählten gelingt es, damit auf einen grünen Zweig zu kommen.
Manchmal kann ich mich des ketzerischen Gedankens nicht erwehren, daß Johannes besser getan hätte, Apotheker oder Delikatessenhändler zu werden. Vielleicht stellten wir dann heute eine wohlfundierte Familie dar! Auf keinen Fall jedoch werde ich Hinz gestatten, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, obwohl auch er schon einen unverkennbaren Drang zu künstlerischer Betätigung offenbart.
Auf meinem Schreibtisch prangt von seiner Hand ein getreues Porträt unseres wackeren kleinen Fordwagens, den Freund Tom, weniger seines prunkvollen Äußern, als vielmehr seines unverwüstlichen Motors wegen „August den Starken“ getauft hat. August, ein Modell aus dem Jahre 1929, ist hochrädrig wie ein Zirkuskarren; von Stromlinie, Vorderradantrieb und Schwingachse ist ihm nichts an der Wiege gesungen worden. Dafür verbindet er das Aussehen unbestechlicher Rechtschaffenheit mit dem imponierenden Lärm eines Rennwagens. Wenn wir zu einer kleinen Sonntagsfahrt aufbrechen, strömt die Nachbarschaft an die Fenster, wo ihre Neugier sich alsbald in verständnisvolles Schmunzeln verwandelt.
„Seid froh, daß ihr überhaupt einen Wagen habt“, sagt Tom, der, als Maler einem noch weniger gewinnbringenden Beruf als wir ergeben, auf dem Fahrrad erstaunliche Leistungen im Überbrücken von Entfernungen vollbringt.
An jenem fünften März kam die zweite Post wie gewöhnlich um elf Uhr. Sie brachte einen Einschreibebrief an Johannes. Ich drehte den gelben Umschlag mißtrauisch hin und her; er roch förmlich nach Steuer und Finanzamt! Nun wird er sich wieder ärgern, dachte ich, als ich den Brief auf Johannes’ Schreibtisch legte. Gelbe Umschläge mit Maschinenschrift pflegten im allgemeinen nichts Erfreuliches zu enthalten. Manuskripte waren hoch das Beste, was man von ihnen erwarten durfte, und auch sie stellten meist ein zweifelhaftes Vergnügen dar.
Dieser Brief sah nicht nach Manuskript aus. „Dr. Hellbrich / Rechtsanwalt und Notar“ stand links unten in der Ecke. Also doch nicht vom Finanzamt! Ich wurde sehr neugierig, aber ich versagte es mir heroisch, den Brief zu öffnen. Johannes und ich waren der Ansicht, daß die Gemeinsamkeit der Ehe sich nicht auf das Briefgeheimnis erstreckt.
Auch Johannes betrachtete mittags den gelben Brief voller Argwohn. „Hoffentlich kein romanschreibender Rechtsanwalt“, sagte er, „das hätte mir noch gefehlt!“
„Warum?“ fragte ich, „vielleicht käme einmal etwas Spannendes dabei heraus. Du mit deinem ewigen Armin Pütter — —“
Johannes hatte den Brief geöffnet, er las halblaut: „Sehr geehrter Herr Berthold — — teile ich Ihnen mit — — mangels Leibeserben — —“ Sein Gesicht nahm einen ungläubigen Ausdruck an, seine Augen flogen über die Zeilen — —
„Sag, ist es etwas Schreckliches?“ fragte ich atemlos.
Johannes ließ das Blatt sinken. „Eva“, sagte er erschüttert, „wir sind Hausbesitzer geworden!“
2
Es ist keine Kleinigkeit, sozusagen von einer Minute zur andern in den Besitz eines Hauses zu gelangen, das bisher allen Wünschen so unerreichbar gewesen war wie ein Schloß im Mond. Die Nachricht traf uns unerwartet wie der berühmte Blitz aus heiterem Himmel. Wir brauchten Zeit, unser Glück zu fassen.
Rein äußerlich betrachtet, verhielt sich die Sache folgendermaßen: Wir hatten vor einigen Wochen die Nachricht von Onkel Theodors Tod mit der milden Trauer zur Kenntnis genommen, die man beim Ableben alter und entfernt lebender Verwandten zu empfinden pflegt. Der Onkel hatte das immerhin beachtliche Alter von 75 Jahren erreicht; fast ein Jahrzehnt lang hatten wir ihn nicht mehr gesehen. Er verbrachte seinen Lebensabend, von einer betagten Haushälterin betreut, in L., eine Tagereise von uns entfernt.
Wir wußten, daß er herzleidend und seit dem Tode seiner Frau, der guten Tante Sophie, ohne rechte Lebensfreude gewesen war. So waren wir geneigt, den Tod in diesem Fall als freundlichen Erlöser zu betrachten. Es war uns bekannt, daß des Onkels ehemals beträchtliches Vermögen durch unglückliche Spekulationen stark zusammengeschmolzen war; kein Gedanke an Erbschaft hatte sich in unsere Wehmut um den guten Onkel eingeschlichen. Um so unverhoffter kam uns dieser Brief, in dem schwarz auf weiß zu lesen stand, daß Onkel Theodor mangels Leibeserben seinem Neffen Johannes Berthold das Landhaus Sophienlust in Seewang a. See, Oberbayern, vermache. Mit allem Inventar.
Wir luden Tom zum Abendessen ein, das große Ereignis gebührend mit uns zu feiern. Tom, blond und von riesenhafter Statur, packte Johannes bei den Schultern und schüttelte ihn, bis ihm Hören und Sehen verging. „Gratuliere, alter Junge!“ rief er mit dröhnender Stimme, „haha, das nenne ich Glück — im Unglück“, fügte er, des verstorbenen Onkels eingedenk, taktvoll hinzu.
Auch Hinz war außer Rand und Band. „Warum hat der Onkel uns das Haus nicht schon früher geschenkt?“ fragte er, als ich ihn zu Bett brachte.
„Aber Herzchen, er wollte doch selber darin wohnen.“
„Wollte er gar nicht“, rief Hinz, „Onkel Tom hat gesagt, er versteht nicht, warum der alte Knabe —“
„Putze dir ordentlich die Zähne“, unterbrach ich streng, und nahm mir vor, Tom zur Vorsicht in Gegenwart des Jungen zu ermahnen.
Hinz sprang mit einem Anlauf ins Bett und hupfte darin auf und nieder, daß die Federn krachten. „Ich freue mich, ich freue mich!“ sang er nach einer selbst erfundenen Melodie und wollte anschließend wissen, ob wir nun immer in dem neuen Hause wohnen würden.
„Das wird sich alles finden“, sagte ich und deckte ihn zu mit der dringenden Aufforderung, er möge ein guter Junge sein und schnell einschlafen.
Im Wohnzimmer setzte ich mich in einen der großen, mit buntem Cretonne bezogenen Sessel. Die Stehlampe mit dem geblümten Seidenschirm tauchte den Raum in sanftes Licht; alle Mängel an Wänden und Möbeln schienen ausgelöscht. Ich hörte Johannes sagen, daß Onkel Theodor seit Tante Sophiens Tod nicht mehr gern in Sophienlust geweilt habe. Das Haus sei mehrmals vermietet gewesen, doch nun stehe es schon seit geraumer Zeit leer.
„Und wann werdet ihr hinausziehen?“ fragte Tom.
„Das ist eben die Frage“, sagte Johannes bedächtig (diese Bedächtigkeit brachte mich manchmal zur Raserei), „wahrscheinlich werden wir es uns nicht leisten können, das Haus zu bewohnen.“
„Bist du wahnsinnig?“ riefen Tom und ich aus einem Munde.
Johannes lächelte überlegen. „Wie stellt ihr euch das eigentlich vor?“ hub er an, „Sophienlust ist kein Wochenendhäuschen, sondern eine ausgewachsene Villa mit mindestens zehn Zimmern und einem beträchtlichen Park. Um die Jahrhundertwende legte man Wert auf Geräumigkeit. Rechnet euch mal bitte die Steuern aus, Grundsteuer, Hauszinssteuer usw., von den übrigen Spesen gar nicht zu reden!“
Ich schwieg betreten, während Tom sich erkundigte, ob Johannes an die Möglichkeit glaube, das Haus zu einem annehmbaren Preis zu verkaufen.
„Nein“, sagte Johannes düster, „wer kauft heute schon ein großes Haus?“
„Na also“, sagte Tom befriedigt, als sei damit alles aufs beste geregelt.
„Was soll das heißen?“ fragte Johannes gereizt.
„Daß ihr selber darin wohnen werdet“, verkündete Tom.
„Aber ich sage dir doch gerade —“
In mir schoß ein Gedanke empor wie eine Leuchtrakete. „Wir müßten natürlich die Wohnung während der Sommermonate schließen.“
Johannes sah mich mißbilligend an. „Und das Büro?“ fragte er.
„Wozu habt ihr den braven August?“ kam mir Tom zu Hilfe, „außerdem kannst du jederzeit bei mir übernachten.“
Johannes schwieg nachdenklich. Dann erklärte er in einem Ton finsterer Endgültigkeit, er habe den ganzen Nachmittag mit Berechnungen zugebracht. Wie man es auch drehe und wende, das Haus sei zu groß und zu kostspielig für eine Familie von drei Personen.
Nun konnte ich nicht länger an mich halten. „Wir werden das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden“, rief ich frohlockend.
Johannes und Tom sahen mich erwartungsvoll an.
„Indem wir in Sophienlust wohnen und zahlende Gäste aufnehmen werden“, fuhr ich siegesgewiß fort, „wenn jeder pro Tag zehn Mark zahlt —“
„Hör auf, hör auf“, schrie Johannes, „du bist verrückt geworden!“
„Warum?“ fragte Tom, „ich finde, sie ist vernünftiger als du.“
Ich sandte einen dankbaren Blick zu Tom hinüber. Johannes lächelte mit beleidigender Skepsis, aber dann begannen wir doch, den Plan zu erörtern. Die Rechnung mußte aufgehen, wenn wir imstande waren, genügend Gäste aufzunehmen. In diesem Fall müsse sich sogar ein Überschuß herauswirtschaften lassen, behauptete Tom.
Johannes starrte, von Zweifeln bedrängt, vor sich hin. „Wir werden morgen hinausfahren und uns das Haus ansehen“, entschied er schließlich, „seit zehn Jahren hat Onkel Theodor es nicht mehr bewohnt. Ich könnte mir vorstellen, daß es eine ziemliche Bruchbude ist.“
„Um so romantischer wird es werden“, sagte Tom, „schon der Name Sophienlust strotzt von Romantik. Die Gäste werden sich darum reißen, zu euch zu kommen. Sei kein Narr, Johannes! Das Schicksal gibt euch höchstpersönlich eine Chance!“
Aber Johannes, pessimistisch von Natur, ließ sich nicht ohne weiteres gewinnen. Er fragte düster, ob ich mir darüber klar sei, daß wir auf jedes Privatleben verzichten müßten, falls der Plan sich verwirklichen lasse.
Ich lachte. Im Augenblick kam mir alles ungeheuer einfach vor. Der geldliche Erfolg würde uns für jede Entsagung entschädigen. „Denk nur, Johannes, wir werden es zu Wohlstand und Ansehen bringen. Niemand wird in Zukunft sagen können, daß wir einem brotlosen Beruf obliegen. Und wenn obendrein der Roman von Armin Pütter ein Bombenerfolg wird —“
„Stop!“ rief Tom lachend, „deine Phantasie schießt ins Kraut, meine Liebe!“
3
Am nächsten Tage fuhren wir hinaus nach Seewang a. See. Der sechste März gab dem fünften an Unfreundlichkeit nichts nach. Ein kalter Regen schlug gegen die Windschutzscheibe und zwang Johannes, den Scheibenwischer in Tätigkeit zu setzen, eine Maßnahme, zu der wir uns ungern entschlossen, denn der Scheibenwischer hatte die Gepflogenheit, sich festzuhaken und unsere Fahrt mit dem hartnäckigen Tack-Tack eines Maschinengewehrs zu begleiten. Einer von uns mußte dann aussteigen, um ihn zu seiner Pflicht zurückzuführen.
Nachdem ich zum dritten Male ausgestiegen war, wandte ich mich mit der Frage an Johannes, ob er es für möglich halte, daß wir uns einen neuen Wagen leisten könnten, falls wir über Erwarten zahlreiche Gäste bekämen. Johannes schnob verächtlich durch die Nase. Er war stark von August in Anspruch genommen, der auf der holperigen Straße am Seeufer einer kundigen Hand bedurfte. Seewang war von der Stadt in vierzig Minuten mit dem Auto zu erreichen. August benötigte eine Stunde, um die Strecke zu bewältigen. Wir fuhren mit Getöse in den kleinen Ort ein und hielten an, um einen Einheimischen nach der Wohnung des Schreiners Xaver Windschagl zu fragen, der die Schlüssel zum Hause in Verwahrung hatte.
Wir waren nie zuvor in Sophienlust gewesen, da wir zu einer Zeit nach M. zogen, als der Onkel schon seinen ständigen Wohnsitz in L. hatte. Es war uns nur bekannt, daß das Haus etwa zehn Minuten vom Ort entfernt, in stiller Abgeschiedenheit am Seeufer lag.
Xaver Windschagl war nicht zu Hause; statt seiner erbot sich seine Gattin Rosina, uns nach Sophienlust zu begleiten. Sie war eine rüstige Frau in den Vierzigern, deren Dirndlgewand viel Molliges umschloß; während der kurzen Fahrt beklagte sie wortreich sowohl Onkel Theodors Tod als auch Sophienlust, dem die verschiedenen Mieter arg zugesetzt hätten.
„Ein so ein herrliches Haus“, seufzte Frau Windschagl, als wir von der Landstraße abbogen und nach einer kurzen steilen Abfahrt durch ein hölzernes Gatter, das ehemals grün gewesen sein mochte, das Landhaus erreichten.
Wir verließen August und schauten uns beklommen um. Sophienlust war genau das, was man sich um die Jahrhundertwende unter einem Landhaus vorgestellt hatte. Zweistöckig, mit weißem Verputz und roten Sandsteineinfassungen an den Fenstern, mit trutzigen Giebeln und einem massiven runden Turm, der jedem Schloß zur Zierde gereicht hätte und zum Überfluß von einem winzigen Türmchen gekrönt wurde, lag das Haus wie ein Alptraum aus der Ankersteinbaukastenzeit vor uns.
Rundbogenfenster schauten uns an, deren oberes Drittel grün und obendrein mit Seerosenornamentik geschmückt war; hier und da gab es kleine hölzerne Balkons, sie waren der Fassade wie Vogelnester angeklebt. Sophienlust mochte vor dreißig Jahren ein pompöses Bauwerk gewesen sein; heute standen wir, Kinder einer sachlichen und zweckbetonten Zeit, mit frommem Schauder davor.
„Allerhand, was?“ sagte ich kleinlaut zu Johannes, während Frau Windschagl die Haustür aufschloß. Johannes sagte gar nichts.
Nun standen wir in der großen Diele. Die Luft hier drinnen hatte eine verzweifelte Ähnlichkeit mit dem kühlen und atemraubenden Hauch, der einem aus Grüften entgegenweht. An den Wänden war der, weiße Verputz abgebröckelt; ein lebensgroßes Gemälde, irgendeinen Vorfahren aus Onkel Theodors Familie darstellend, schien ironisch so viel verschollene Romantik zu belächeln.
Wir durchschritten die Räume stumm und andächtig wie ein Museum. Onkel Theodor hatte es mit dem Altdeutschen gehalten: wir fanden dunkel getäfelte Wände und Butzenscheiben im Erker des Speisezimmers; wir fanden ein Büfett von unwahrscheinlichen Ausmaßen, mit Zinnen und Türmchen verziert. Es gab viel Zinn auf Wandbrettern und Truhen, kernige Wandsprüche in Brandmalerei, Stühle, deren Ornamentik sich schmerzhaft in den Rücken bohren mußte, und Geweihe! Vor allen Dingen Geweihe!
„Ich wußte gar nicht, daß der Onkel Jäger war“, sagte Johannes verwundert.
In Sophienlust sei der gnädige Herr niemals auf die Jagd gegangen, warf Frau Windschagl ein. Ich erkundigte mich leise bei Johannes, ob man Hirschgeweihe kaufen könne, einfach so im Laden, wie Zinn und Wandsprüche.
„Unsinn“, sagte Johannes ärgerlich und verharrte mit gerunzelter Stirn in Tante Sophiens Wohnzimmer.
Hier feierte der Jugendstil Orgien! Wiederum waren es Seerosen, die sich auf dem verschossenen graugrünen Plüsch der Möbel wanden; sie wiederholten sich auf dem Fries, mit dem die olivenfarbene Tapete abschloß, und kehrten in kunstvoller Holzarbeit auf einer Vitrine wieder, die, ehemals gewiß voll zierlicher Nippes, uns nun aus blinden Glasscheiben anstarrte. Über dem Sofa hing in schwerem Goldrahmen ein Reigen bacchantischer Mädchen in griechischen Gewändern, mit Rosenkränzen im Haar.
Tante Sophiens Wohnzimmer war der erste Raum im Hause, in dem es keine Hirschgeweihe gab. Aber man wurde dessen nicht recht froh.
„Laß uns einen Augenblick hinausschauen“, bat Johannes und trat ans Fenster. Vor uns lag, nur durch eine Wiese mit einem großen Lindenbaum getrennt, der See in grausilberner Weite. Hinter Regenschleiern ahnte man am anderen Ufer die zarten Umrisse sanft geschwungener bewaldeter Hügel. Es war ein Bild von großer geruhsamer Schönheit. Der Druck, der mein Herz umklammert hielt, seitdem wir das Haus betreten hatten, begann sich zu lösen.
Während wir die geschwungene Treppe zum ersten Stock hinaufstiegen, sagte ich zu Johannes: „Wir werden natürlich etwas hineinstecken müssen.“
Johannes sagte nichts; er ging, von unheildrohendem Schweigen umhüllt, durch die Räume. Es waren lauter Schlafzimmer. Wer Onkel Theodors Hang zur Einsamkeit nicht kannte, mußte den Eindruck gewinnen, daß er einer ausschweifenden Gastlichkeit gehuldigt hatte. Betten bekamen wir auf jeden Fall genug. Auch sie wiesen eine verwirrende Fülle kunstvoll gedrechselter Kugeln und zackiger Muschelaufsätze auf, und über Waschtischen und Kommoden hingen wiederum Geweihe.
„Wenn wir die Wände hell anstreichen lassen, wird es gleich freundlicher aussehen“, sagte ich tröstend zu Johannes.
Er schüttelte nur trübe den Kopf. Männer haben keine Phantasie. Johannes’ Blick haftete am trübselig Gegenwärtigeh, ohne die Möglichkeit, es kraft seiner Vorstellungsgabe in ein freundlich Zukünftiges zu verwandeln.
Zuletzt führte uns Frau Windschagl in den Turm, der unverhofft ein rundes Stübchen barg. Hier hatte Onkel Theodors Liebe zu verschnörkelten Möbeln und Hirschgeweihen haltgemacht; die Wände waren weiß gekalkt, und die Leere des kleinen Raumes legte sich besänftigend auf unsere Nerven. In Gedanken stellte ich helle Möbel hinein und versah die Fenster mit Vorhängen aus buntem Chintz.
„Dies wird unser schönstes Gastzimmer werden!“ rief ich frohlockend. Aber Johannes goß Wasser in den Wein meiner Begeisterung. Er behauptete, der Wind werde durch alle Fugen blasen und den jeweiligen Bewohner mit unheilbarem Rheumatismus schlagen. Ich schalt Johannes einen unverbesserlichen Pessimisten und wandte mich mit der Frage an Frau Windschagl, ob sie Lust verspüre, gegebenenfalls die Rolle einer Zugeherin in Sophienlust zu übernehmen.
„O mei“, verwunderte sich die Brave, „a Pension wollen S’ machen da heraußen?“
„Nicht ganz“, verbesserte ich, „wir werden hier wohnen und Gäste aufnehmen, zahlende Gäste.“
„I sog’s ja, a Pension“, beharrte Frau Windschagl und äußerte Zweifel an der Rentabilität eines derartigen Unternehmens. Ich zog es vor, das Gespräch nach einem Blick auf Johannes abzubrechen. Er sah genau so aus, als stimme er Frau Windschagl aus vollem Herzen zu.
Nachdem wir bei einem Gang durch den Park noch ein verfallenes Gartenhäuschen mit bunten Fenstern entdeckt hatten, das die Reste einer tönernen Zwergenfamilie und ein ebenfalls tönernes Reh mit abgebrochenen Vorderläufen barg, verabschiedeten wir uns erschüttert von Frau Windschagl. Wir bestiegen August den Starken und fuhren unter einem gewaltigen Aufwand an Lärm davon.
Auf der Landstraße tat Johannes endlich den Mund auf. Was dabei herauskam, klang nicht sehr ermutigend. Er nannte Sophienlust eine alte Bruchbude, die es verdiene, vom Erdboden zu verschwinden.
„Wie undankbar du bist“, schalt ich, „wenn das der gute Onkel hörte! Natürlich muß im Hause dies und jenes gerichtet werden.“
„Dies und jenes!“ höhnte Johannes. „Tausende wären nötig, um dieses Raubritterschloß in einen menschenwürdigen Zustand zu versetzen.“
Ich mußte lachen; die Vorstellung von Onkel Theodor als Raubritter entbehrte nicht der Komik. „Mit heller Farbe und Cretonne ist schon viel getan“, nahm ich das Gespräch wieder auf.
„Vor allen Dingen müßten Türen, und Fensterrahmen gestrichen werden“, sagte Johannes, dessen Sinn stets in erster Linie auf das Praktische gerichtet war, „und glaubst du etwa, daß unsere Gäste beim Anblick des Badezimmers jubeln werden?“ Nein, das glaubte ich keineswegs! Das Badezimmer war in der Tat ein dunkler Punkt. Es enthielt nichts außer einer verbeulten Blechwanne auf hohen Füßen und einem alten Ofen, der mit Holz zu heizen und schief wie der Turm von Pisa war. Auf Badekultur hatten unsere Altvorderen offenbar keinen Wert gelegt!
„Man müßte einen Waschtisch anbringen“, erwog ich nachdenklich.
„Man müßte, man müßte“, spottete Johannes.
„Mit deinem Pessimismus um jeden Preis kommen wir auch nicht weiter“, sagte ich böse.
Wir waren auf dem besten Wege, in Streit zu geraten. Eine Weile fuhren wir schweigend dahin. August schnob die Straße entlang wie ein Drachen; es war ein Wunder, daß er nicht auch Feuer spie.
„Nun, wir werden sehen, was sich tun läßt“, lenkte Johannes endlich ein.
Wir ließen das Innenarchitektonische vorläufig ruhen und wandten uns der Frage zu, ob Sophienlust gegebenenfalls umzutaufen sei. Es gab allerlei, was dagegen sprach, in erster Linie die Tatsache, daß das Haus unter dem Namen in der Gegend bekannt war. Außerdem hatte der Name etwas von lavendelduftender Altertümlichkeit. Er erinnerte mich an ein altes Schlößchen; es war in einem wundervollen Park gelegen, verwunschen wie Dornröschen, und hatte Sibyllenort geheißen.
„Wie werden sich unsere Gäste freuen, wenn sie sich etwas Ähnliches unter Sophienlust vorgestellt haben und dann der Wirklichkeit ins Auge sehen müssen“, bemerkte Johannes und steuerte August durch die Gefahren des städtischen Verkehrs unserer Wohnung zu.
4
Einige Tage später fuhr Johannes nach L., um die Formalitäten der Erbschaft mit Onkel Theodors Rechtsanwalt zu erledigen. Ich verhieß ihm bei seiner Rückkehr eine genaue Liste der neu anzuschaffenden Gegenstände. Johannes hatte sich bereit erklärt, der Instandsetzung von Sophienlust einen Tausender zu opfern. Die Summe kam mir riesengroß vor. Damals ahnte ich noch nicht, daß Sophienlust ein Moloch war, unersättlich im Verschlingen von Zahlungsmitteln.
Abends erschien zuweilen Tom; auch meine Freundin Lydia stellte sich ein und bot ihren Beistand an. Jeder für sich allein mochte noch angehen; wenn sie jedoch zusammentrafen, war es aus mit ernsthafter Beratung. Tom hatte ein Auge auf Lydia geworfen; er war von Stund an für den Ernst des Lebens verloren. Es blieb mir nichts übrig, als die beiden, mit Wein und Zigaretten versehen, in der Sofaecke sich selbst zu überlassen.
Eine Frage von entscheidender Bedeutung war die Festsetzung der Pensionspreise gewesen. Johannes und Tom hatten den von mir vorgeschlagenen Tagespreis von zehn Mark für die Ausgeburt einer größenwahnsinnigen Phantasie erklärt. Sie ließen auch einen schüchternen Hinweis auf den Nachmittagstee, der im Gegensatz zu anderen Pensionen in Sophienlust verabreicht werden sollte, nicht gelten.
„Mehr als 7 Mark 50 können wir auf keinen Fall verlangen“, erklärte Johannes und hielt mir alle Mängel, einschließlich des Badezimmers mit dem „schiefen Turm“ eindringlich vor Augen.
„Du vergißt die persönliche Behandlung, die wir unseren Gästen angedeihen lassen werden“, wandte ich ein.
„Dafür zahlt kein Mensch auch nur einen Groschen mehr“, sagte Johannes pessimistisch und fügte hinzu, daß wir Nordzimmer und Turmgelaß nur mit 6 Mark 50 in Rechnung bringen dürften.
Wir hatten einen Plan des Hauses ausgearbeitet, an Hand dessen wir feststellten, daß wir sechs, unter Hinzuziehung des Turmgemachs sogar sieben Gäste beherbergen konnten. Ich war voller Optimismus. Es mußte mit dem Teufel zugehen, wenn wir nicht auf unsere Kosten und sogar ein wenig darüber hinaus kämen!
Während Johannes fort war, fuhr ich nach Sophienlust hinaus. Ohne August erwies, sich die Fahrt nach Seewang a. See als mühseliges Unternehmen. Die Reichsbahn befuhr nur das Westufer des Sees. Von Amsteg aus war man auf den Postautobus angewiesen, der, laut Fahrplan, nur in den Monaten Juni bis Oktober mehr als dreimal täglich verkehrte. Was den Dampfer anging, so überquerte er unter souveräner Nichtachtung der Zuganschlüsse zweimal am Tage den See. Es gelang mir, Seewang mittels Bahn und Postauto in fast dreistündiger Fahrt zu erreichen. Wieder durchschritt ich mit der braven Frau Windschagl das Haus. Es fehlte an allen Ecken und Enden, meine Liste wurde über alle Befürchtungen hinaus lang. Johannes’ Gesicht umdüsterte sich, als er sie zu Gesicht bekam; er schärfte mir immer wieder ein, nur das Allernötigste dürfe angeschafft werden.
Die nächsten Wochen brachte ich in Warenhäusern und auf Versteigerungen zu. Meine Familie sah mich nur bei den Mahlzeiten; Hinz verwilderte zusehends, er trieb sich den ganzen Tag auf der Straße herum; ich hatte ihn im Verdacht, daß er überhaupt keine Schularbeiten mehr machte. Aber ich konnte es im Augenblick beim besten Willen nicht ändern.
Meine Gedanken gehörten einem Eßservice aus Nymphenburger Porzellan, das auf einer Auktion billig zu haben war, weil einige Stücke fehlten. Ich fand Stühle für das Eßzimmer, die den vorhandenen wohl an Pracht, nicht jedoch an Unbequemlichkeit nachstanden. Im Warenhaus liebäugelte ich mit einem Waschgeschirr, das mit Szenen aus Grimms Märchen geschmückt war, entschloß mich jedoch des Preises wegen schweren Herzens zu einem einfarbigen. Ich gedachte, die Waschgeschirre dem jeweiligen Wandanstrich anzupassen, in der Hoffnung, daß eine so feinsinnige Übereinstimmung der Farben die Gäste über das Fehlen fließenden Wassers trösten würde. Es galt, die Bestände an Bett- und Tischwäsche aufzubessern, Möbel für die große Terrasse und Liegestühle mußten gekauft werden. Fünfhundert Mark waren im Nu dahin.
Als wir das nächste Mal hinausfuhren, begleitete uns Tom mit Frieda. Es muß hier zum Verständnis des geschätzten Lesers eingeschaltet werden, daß Frieda weder Toms Frau noch seine Freundin ist. Wir sehen vielmehr in Frieda einen pechschwarzen Hund von gänzlich unbestimmbarer Rasse vor uns. Tom hatte ihn eines Tages halbverhungert auf der Straße aufgelesen; keine Frau konnte seither zärtlicher an ihm hängen als Frieda. Sie besaß unter ihrem düsteren Fell ein Herz voll goldener Treue. Tom hatte sie zur Erinnerung an seine erste Liebe Frieda getauft.
Während wir mit den Handwerkern verhandelten, wandelte er, von Frieda gefolgt, durch die Räume und brach angesichts der Hirschgeweihe, der Bilder und des ganzen verstaubten Hausrats in helle Begeisterung aus. Ihm zufolge gehörte Sophienlust einer Epoche an, die schon fast klassisch zu nennen war.
„Alles wiederholt sich“, predigte er entflammt, „unsere Generation läßt Biedermeier und Barock neu erstehen, oder sie huldigt der modernen Sachlichkeit. Unsere Kinder und Kindeskinder jedoch werden wieder in Plüschportieren und quastengeschmückten Polstermöbeln schwelgen. Ein paar Jahrzehnte höchstens, und Sophienlust ist, so wie es dasteht, hochaktuell. Ich für mein Teil bin heute schon so weit, diese ganze verstaubte Behaglichkeit zu genießen, ohne mich allerdings in ihren Besitz zu wünschen. Aber denkt an mich! Wenn Hinz einmal heiratet —“
„Halt ein“, riefen wir lachend, aber Tom war in großer Form wie immer, wenn er eines seiner Steckenpferde ritt.
Zum Schluß zeigten wir ihm das verfallene Gartenhäuschen; es brachte ihn vollends außer Rand und Band. Er konnte nicht genug davon bekommen, die Welt vermittels der bunten Scheiben in rotem, blauem und grünem Licht zu sehen. Dies Gartenhäuschen sei ein Stück wiedererstandener Kindheit, sagte er und versank in Erinnerungen an den Park seiner Großmutter, in dem es einen Irrgarten und ein „Persisches Zelt“ gegeben hatte.
Während der ganzen Rückfahrt schwärmte er davon und nahm uns zum Schluß feierlich das Versprechen ab, das Gartenhäuschen nicht abbrechen zu lassen.
5
Wie zieht man zahlende Gäste in sein Haus?
Wir sagten es allen Freunden und Bekannten, außerdem beschlossen wir, es mit einer Anzeige in den großen Tageszeitungen zu versuchen. Eines Abends legte ich Johannes einen Entwurf vor. Er hatte mich viel Kopfzerbrechen gekostet, und ich beobachtete mit geheimem Stolz Johannes’ Gesicht, während er halblaut las:
Sommer in Sophienlust
Zahlende Gäste finden Erholung in Landhaus an
schönstem oberbayerischem See. Jeder moderne
Komfort! Schöne Balkonzimmer mit herrlichem
Blick auf See und Gebirge! Sehr gute Verpfle-
gung! Lärm- und staubfrei. Idealer Aufenthalt
für geistige Arbeiter!
Preise von 6,50 Mk. bis 7,50 Mk.
Anfr.: Berthold, Landhaus Sophienlust,
Seewang a. See, Oberbayern
Johannes ließ das Blatt sinken. „,Jeder moderne Komfort‘ ist gut“, bemerkte er trocken.
„Du suchst mit Fleiß immer die Schwächen heraus“, rief ich ärgerlich, „so paradox es klingt: das ist nun einmal deine Stärke.“
Johannes verwies mich milde auf das Fehlen fließenden kalten und warmen Wassers und auf den schiefen Turm von Pisa. Wir ersetzten den modernen Komfort durch die unverbindlicheren Worte: komfortabel eingerichtet.
„Und wie kommst du auf den Idealaufenthalt für geistige Arbeiter?“ fuhr Johannes lachend fort.
Ich setzte ihm wortreich auseinander, daß geistige Arbeiter angenehme Mieter seien; von ihrer Mission erfüllt, pflegten sie blind zu sein für kleine Mängel in ihrer Umgebung.
„Na schön“, sagte Johannes, „hoffen wir also auf einen Zustrom an geistigen Arbeitern! Ein wenig Blindheit kann in Sophienlust nicht schaden.“
Die Arbeiten in Sophienlust gingen ihrer Vollendung entgegen. Herr Wunderl, der Malermeister, machte seinem Namen Ehre; er vollbrachte Großes im Verfertigen zartfarbiger Wandbemalungen. In den unteren Räumen hatten wir es aus pekuniären Gründen bei der dunkeln Wandvertäfelung gelassen. Wir machten aus der Not eine Tugend, indem wir feststellten, daß sie, im Verein mit den Geweihen, dem Ganzen das Ansehen wohlhabender Gediegenheit verlieh. Nur in Tante Sophiens Jugendstilsalon hatte die olivgrüne Tapete einem elfenbeinfarbenen Anstrich weichen müssen; Sofa und Sessel verbargen ihre stilisierten Seerosen unter Hüllen aus geblumtem Stoff. In diesem Zimmer würden sich unsere Gäste zu harmonischer Geselligkeit vereinen!
Soweit es möglich war, hatten wir in den Schlafgemächern die Muschelaufsätze und gedrechselten Kugeln an den. Betten entfernen lassen; Vorhänge und Decken aus heiterem Cretonne taten das Ihre, einen freundlichen Eindruck hervorzurufen.
Allmählich kam es dahin, daß wir uns mit Stolz als Besitzer von Sophienlust ausweisen konnten. Dieses Bewußtsein mußte uns über die betrübliche Tatsache trösten, daß der von Johannes ausgesetzte Tausender nicht unbeträchtlich überschritten worden war.
„Die Gäste werden es wieder hereinbringen“, sagte ich tröstend, „ein Unternehmen ohne Risiko gibt es bekannt lich nicht!“ Johannes konnte nicht umhin, diesen Ausspruch zu belächeln; seine Meinung von meinen geschäftlichen Fähigkeiten war außerordentlich gering.