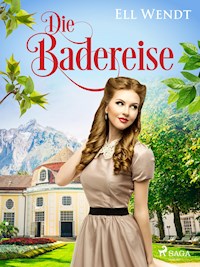Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Familienroman der besonderen Art: Als die Protagonistin mit ihrem Mann und drei Kindern in einen kleinen Ort nach Oberbayern zieht, treffen sie auf die Oberpostratswitwe, Major Quant und seine Frau sowie einen Professor. Die Idylle scheint perfekt – bis die Walfischerehefrau Nina Groll von ihrem Mann bei Major Quant einquartiert wird und es mit der Ruhe erst einmal vorbei ist. Von Langeweile getrieben reist Nina ihrem neuen Schwarm, einem Dirigenten, hinterher nach Berlin. Doch Stefan ist auch in Berlin – sehr zum Missfallen seiner Frau.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ell Wendt
Wir plus drei
Saga
Wir plus dreiCoverbild/Illustration: Shutterstock Copyright © 1947, 2020 Ell Wendt und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726629262
1. Ebook-Auflage, 2020
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
– a part of Egmont www.egmont.com
DIE KUCKUCKSUHR
Wenn die Kuckucksuhr zum Schlage ausholte, hörte man es im ganzen Hause. Es gab ein heiser rasselndes Geräusch, bevor der hölzerne Vogel aus der kleinen Tür über dem Zifferblatt hervorschnellte, um mit schrillem Eifer die Stunde zu künden.
Stefan haßte Kuckucksuhren, ich nicht minder. Es war nur dem kleinen Michael zu verdanken, wenn die Uhr an ihrem Platz in der Wohnstube gelassen worden war. Als wir hinausfuhren, um das Haus zu mieten, waren die Kinder dabei gewesen, und nichts, weder das Haus selber, noch der Garten, noch die ganze Ortschaft Riedling, hatte Michael so bezaubert wie die Kukkucksuhr. Mit runden Augen und offenem Munde stand er davor, nicht einmal das verächtlich hervorgeschnaubte Wort »Kitsch«, mit dem seine Schwester Corinna die Uhr abtat, hatte seine Begeisterung zu trüben vermocht. Aber schließlich war Corinna neunzehn Jahre alt und Michael erst acht. Ihre Ansichten über Kitsch gingen naturgemäß stark auseinander, vorausgesetzt, daß Michael überhaupt welche hatte. Vielleicht hätte Stefan trotzdem auf Entfernung der Uhr bestanden, denn seiner Behauptung, sie werde ihn bei der Arbeit stören, konnte auch Michael sich nicht verschließen, wenn nicht die Dame, die uns das Haus vermietete, sie mit bewegten Worten unserer Fürsorge anempfohlen hätte.
»Ich habe leider keinen Platz für die Uhr«, sagte sie und schneuzte sich in ein schwarz gerändertes Taschentuch, bevor sie mit umflorter Stimme hinzufügte: »Mein verewigter Gatte hing so sehr an ihr.« Wir standen umher und schwiegen verlegen und achtungsvoll. Obwohl Herr Oberpostrat Kleinschroth schon vor drei Jahren von dieser Welt Abschied genommen hatte, schien seine Witwe ihn mit unverminderter Heftigkeit zu betrauern, und zwar tat sie es mit einem beträchtlichen Aufwand an schwarzem Stoff und Schleiern. Von Kopf bis Fuß in Schwarz gehüllt, bot sie einen zugleich pompösen und ergreifenden Anblick, der auch dann kaum an Wirkung verlor, als wir erfuhren, daß sie mit dem »Verewigten« wie Katz und Hund gelebt hatte.
Nachdem wir das Haus bezogen hatten, siedelte die Oberposträtin ins Dachgeschoß über, das sie, uneingedenk der Tatsache, daß es aus drei Zimmern bestand, schmerzlich lächelnd ihr »Witwenstübchen« nannte. Über dem Sofa hing eine achtfach vergrößerte Fotografie des »Verewigten«, von Trauerflor und Immortellen umrahmt.
Sie ist der leibhaftige Pompe funèbre, stellte Stefan eines Tages mißbilligend fest.
Natürlich wollte Michael wissen, was Pompe funèbre sei, und da wir keine Lust zeigten, es ihm zu erklären, wandte er sich an seine Schwestern: »Juli, was heißt Pomp-Pomp fü – –?«
»Keine Ahnung.«
»Aber du hast doch schon Englisch in der Schule«, sagte Michael vorwurfsvoll.
»Es ist kein Englisch«, verteidigte sich Julia. »Frag Co. Sie weiß es sicher.«
»Co, was heißt Pomp fü-füneber?« forschte Michael unerbittlich.
»Es heißt Trauerpomp«, sagte Corinna und sah Stefan, der sich ein Lachen verbiß, unsicher an, »nicht wahr, Vater?«
Aber Michael war noch nicht befriedigt. Er war ein hartnäckiges Kind und ging den Dingen gern auf den Grund. Wir hörten ihn mit Julia über das Wesen eines Trauerpomps beraten.
»Es gehören Kränze dazu«, erläuterte Julia, »und Lichter und Pferde mit schwarzen Büschen auf dem Kopf.«
»Schöön!« sagte Michael im Brustton der Überzeugung.
Wir gewöhnten uns an die Kuckucksuhr. Unversehens kam es dahin, daß sie den Lauf unserer Tage bestimmte. Wehn sie in der Frühe behauptete, es sei sechs Uhr, so wußte ich, daß ich noch ein paar friedliche Atemzüge tun durfte, bis die Kirchturmuhr von Riedling die unangenehme Tatsache bestätigte. Aber dann gab es kein Zaudern mehr. Unser Tag begann.
Resi kam die knarrende Treppe vom Dachgeschoß herunter, wo sie neben Pompe funèbres »Witwenstübchen« eine Kammer bewohnte, und weckte die Kinder. Ich erhob mich leise, um Stefan nicht zu stören, und ging hinüber. Seitdem Corinna, ihres Studiums wegen, die Woche über in der Stadt blieb, mußte ich mich selber der Sache annehmen. Sonst hatte sie, pünktlich und gewissenhaft, es auf sich genommen, die jüngeren Geschwister aus den Betten zu treiben. Namentlich bei der dreizehnjährigen Julia war das keine Kleinigkeit. Ihre Verträumtheit verhinderte erfolgreich, daß sie jemals zur rechten Zeit am rechten Ort war. Ich fand sie, auf dem Bettrand sitzend, wie sie nachdenklich ein Loch in ihrem Strumpf betrachtete.
»Aber Juli, warum hast du mir nicht gesagt, daß der Strumpf zerrissen ist?«
Julia hob mir ihr rosiges, verschlafenes Gesicht entgegen; es trug einen Ausdruck lieblicher Ratlosigkeit, der es einem schwer machte, ihr böse zu sein: »Ich hab’s nicht gemerkt.«
»So hole dir schnell ein Paar neue Strümpfe!«
Juli erhob sich und schlich zur Kommode. Ich öffnete seufzend die Tür zum Nebenzimmer. Dort stand Michael und ließ mit eifrig vorgeschobener Unterlippe die Seifenschale in der Waschschüssel schwimmen. Ich tauchte den Schwamm ins Wasser und drückte ihn über seinem Kopfe aus. Michael hüpfte wie ein Gummiball unter dem kalten Wasserstrahl, dabei redete er unaufhörlich. Der Schustertoni habe gesagt, es werde heuer viel Schnee geben. »Weil die Bäume so lange grün bleiben, weißt«, erläuterte Michael und erwog nachdenklich, ob das Christkind ihm ein Paar Schlittschuhe bringen werde.
»Wenn du dich nicht beeilst, wird es dir überhaupt nichts bringen«, sagte ich streng, während ich sein flachsblondes Haar striegelte. Zugleich bedachte ich Julia durch die offene Tür mit warnenden Zurufen. Hatte man jemals einen Menschen mit so aufreizender Langsamkeit sich anziehen sehen?
»Soll ich das rote Haarband nehmen oder das blaue?« erwog Julia.
Ich fühlte Verzweiflung in mir aufsteigen. Julia mußte den 7.15-Zug erreichen, um rechtzeitig in ihre Schule zu kommen. Soeben hatte der Kuckuck zwei Rufe ausgestoßen – halb sieben –.
»Nimm, welches du willst«, rief ich, »nur, um Himmels willen, beeile dich!«
Julia entschloß sich für das rote Band. Vor dem Spiegel stehend, lächelte sie sich selber verloren zu. Sie wußte, daß sie hübsch war, vielleicht ahnte sie sogar, daß hübschen Menschen manches nachgesehen wird im Leben.
Endlich war es soweit. Die Kinder saßen in der Wohnstube beim Frühstück. Die Wohnstube war der behaglichste Raum im Hause mit zirbelholzgetäfelten Wänden und bunt bemalten Bauernmöbeln. Es gab einen herrlichen grünen Kachelofen und einen großen Ohrensessel, dessen schwarze Wachstuchpolsterung kühl durch alle Kleider drang. Die von blauweiß karierten Vorhängen umrahmten Fenster öffneten sich auf ein winziges Gärtchen. Im Sommer blühten Stockrosen zwischen bunten Glaskugeln darin; jetzt scharrten Pompe funèbres Hühner, mißtönend gackernd, unter den welken Sträuchern herum. Jenseits des Gartenzaunes senkte sich der Hang sanft zur Ortschaft Riedling hin, mit saftigen Wiesen, darin, wie aus der Spielzeugschachtel verstreut, schmucke, kleine Häuser standen, von Menschen bewohnt, die der Stadt entflohen waren, sei es, um einen geruhsamen Lebensabend zu verbringen, sei es, um unbehelligt einem künstlerischen Beruf nachzugehen.
Wir gehörten der zweiten Gattung an. Bisher hätten wir mit Rücksicht auf die Schulzeit der Kinder den größten Teil des Jahres in der Stadt verbracht. Aber Stefans Nerven waren durch eine Grippe im Frühjahr in einen erbärmlichen Zustand geraten. Eines Tages hatte er behauptet, wahnsinnig zu werden, wenn er noch länger dem Hupen von Autos, dem Klingeln von Straßenbahnen und dem Läuten des Telefons ausgesetzt sei. Auch der Arzt hatte einen Ortswechsel empfohlen. So hatten wir die Stadtwohnung kurzerhand abgesperrt und waren mit Kind und Kegel herausgezogen. In Riedling machte Stefans Erholung schnelle Fortschritte, er steckte in einer neuen Arbeit und dachte nicht daran, in die Stadt zurückzukehren. Auch ich war vollkommen glücklich. Das einzige, was mich bedrückte, war, daß wir Miete zahlen mußten, hier wie dort, ein Problem, dessen Lösung Stefan mit bewundernswertem. Geschick aus dem Wege ging.
Es gibt Menschen, die die Ehe mit einem Dichter für ein Dasein in höheren Sphären halten. Sie schwärmen von gemeinsamem Gedankenflug und halten die Frau des Dichters für eine Art Muse, der er die Schleusen seines reichen Innenlebens hemmungslos öffnet.
Ich fürchte, ich muß sie, was Stefan betrifft, ein wenig enttäuschen, Wenn er arbeitete, war er unzugänglicher als eine Auster. Er glich einem Nachtwandler, der blind und taub für das, was um ihn her vorging, unter uns weilte. Wochen großer Schaffensseligkeit wechselten mit solchen ab, in denen er an sich selbst und seinem Werk verzweifelte. Wir nannten diesen Zustand den »toten Punkt« und fürchteten ihn sehr. Wieviel Mühe wir uns auch geben mochten, es war fast unmöglich, Stefan im Stadium des »toten Punktes« nicht auf die Nerven zu fallen. Am liebsten hätte er sich wie ein Mönch in eine Zelle eingesperrt, aber diese Zelle sollte behaglich sein wie Abrahams Schoß und Stefans Leben mehr denn je von einer Fürsorge erfüllt, die ihm jeden Stein aus dem Wege räumte. In solchen Zeiten war es keine Kleinigkeit, Stefan und die Kinder unter einen Hut zu bringen. Er hatte mich mit der Aufgabe betraut, ihnen Respekt vor der väterlichen Arbeit einzuimpfen. Ich tat, was ich konnte, aber es war nicht immer möglich zu verhindern, daß Michaels durchdringende Stimme in die heilige Ruhe seines Arbeitszimmers drang oder daß seine kleinen Füße ein heftiges Getrappel auf der Holzveranda vollführten. Dann konnte es geschehen, daß Stefan wie ein zürnender Gott unter uns fuhr und mit Donnerworten für eine kurze Weile einen Zustand verängstigter Stille schuf.
Draußen kämpfte die Sonne sich durch den milchigen Dunst des späten Oktobermorgens, der Himmel hing voll perlmutterfarbener Wölkchen. Im Gärtchen gackerten die Hühner, Orpheus’ schmetterndes Kikeriki grüßte sieghaft den Tag.
»Eurydike verliert ihre schönsten Federn«, berichtete Julia. »Resi sagt, sie sei in der Mauser.«
»Warum heißt das bunte Huhn Eu-Eury-?« Michael stolperte; mit Fremdwörtern stand er auf schlechtem Fuße.
»Eu-ry-di-ke«, buchstabierte Julia, während sie träumerisch Honig in goldenen Fäden auf ihr Brot rieseln ließ.
»Mumi – warum?« wandte sich Michael an mich.
»Frag nicht so viel«, verwies ich ihn, »zumal, wenn du etwas ganz genau weißt.«
Wir hatten ihm oft genug von Orpheus, dem begnadeten Sänger der griechischen Sage erzählt. Pompe funèbres Hahn verdankte seinen Namen einem besonders wohllautenden Organ, und da er in der Schar seiner Hennen einem bunten Minorkahuhn besondere Aufmerksamkeiten zu bezeigen pflegte, hatten wir es Eurydike getauft.
Rrrr – Chchchch – – Michaels Augen hefteten sich selbstvergessen auf die Kuckucksuhr.
Ich trieb Julia zur Eile an. »Glaubst du etwa, der ›Expreß‹ wartet auf dich?«
Man brauchte zehn Minuten, um zum Bahnhof zu gelangen; von Julia war nicht zu erwarten, daß sie es in weniger als einer Viertelstunde schaffen würde. Endlich stopfte sie den Rest ihrer Semmel in den Mund, stülpte den runden grünen Hut mit der Spieihahnfeder auf den Kopf und setzte sich, die Schulmappe unter dem Arm, in einen gelinden Trab. Michael, der in die Dorfschule ging, hüpfte wie ein junger Hund nebenher.
Ich stand am Zaun und sah ihnen nach, wie sie den Hang hinunterliefen. Julias Locken tanzten auf den kindlichen Schulfern, an der Wegbiegung drehte sie sich noch einmal um und winkte mir zu. Drunten fauchte der »Expreß« heran. Mit seinen hochräderigen Wagen und der stämmigen, kleinen Lokomotive, die bösartige schwarze Rauchwolken entsandte, schien er der Zeit der ersten Eisenbahn zu entstammen und hätte jedem technischen Museum zur Zierde gereicht. Eine Weile begleitete er das graue Band der Landstraße, um dann hinter den Häusern des Dorfes zu verschwinden. Das Rattern wurde schwächer und verstummte vor dem schmucken, weißen Bahnhofsgebäude mit der Aufschrift Riedling/Obb., daraus in diesem Augenblick der Stationsvorsteher Wurzbichler hervortrat, die Signalstange wie ein Zepter in der Hand. Ein gellender Pfiff. Das Rattern klang wieder auf und verklang. Hoffentlich hatte Juli den Zug erwischt!
Ich stand noch eine Weile und genoß den Morgenfrieden, die Wiesen, funkelnd von Tau, den herbstlich gefärbten Wald, der diesseits und jenseits des Tals die Höhen krönte, den barocken Kirchturm von Riedling inmitten der breit hingelagerten Bauernhöfe, und am Horizont, sanft von Dunst umhüllt, die Kette der Berge vom Wendelstein bis zur Zugspitze. Jenseits des Dorfes führte ein Serpentinenpfad zum Fluß hinab. Wir waren ihn im Sommer oft, gegangen, eingehüllt in den harzigen Duft des Waldes. Die Kinder hatten Beeren gesucht, und Michael hatte seine Papierschiffchen dem schäumenden Gebirgswasser anvertraut, das keine Schiffe auf seinen tanzenden Wellen duldete, außer den Flößen aus frischgehauenen Baumstämmen, die im Herbst von kräftigen Bauernfäusten talwärts gesteuert wurden.
Im Dachgeschoß knarrte eine Tür. Pompe funèbre betrat ihren Balkon und schmückte die Brüstung mit einem gewaltigen Federbett. Wir wechselten ein paar Worte, dahingehend, daß dem Wetter nicht zu trauen sei. Sie spüre es in ihrer linken großen Zehe, erklärte Pompe funèbre, und ihre linke große Zehe sei verläßlicher als ein Barometer. Dann teilte sie mir mit, bei Major Quantes sei gestern ein Gast eingezogen. Es handle sich um eine entfernte Verwandte, die, so munkle man, von den Aufregungen eines Scheidungsprozesses in ländlicher Einsamkeit Erholung suche.
»Hoffentlich zahlt sie für das Zimmer«, sagte Pompe funèbre, »Quantes könnten es gebrauchen, sie haben viel zu großzügig gebaut; Ich bitte Sie, sechs Zimmer für zwei Personen!« »Frau Major«, sagte ich, »warum vermieten Sie nicht?« Sie sah mich von oben herab an, als sei Vermieten für Majors eine Schande. »Mein Gott, mir ist es auch nicht an der Wiege gesungen worden, daß ich eines Tages gezwungen sein würde, zu vermieten, aber als wir seinerzeit bauten, sagte mein verewigter Mann –«
An den Zaun gelehnt, ließ ich zum hundertsten Male die Entstehungsgeschichte des Hauses, ausgeschmückt mit den goldenen Worten des »Verewigten«, über mich ergehen. Pompe funèbre tat sich viel darauf zugute, daß ihr Haus das erste am Hang gewesen war. Ein Jahr später hatte Professor Ambrosius Riedling entdeckt; ihm folgten Quantes und Frau Willbrandt-Schrödl. Im Laufe von wenigen Jahren war eine kleine Kolonie entstanden, deren Bewohner einander kannten wie Geschwister. Namentlich Pompe funèbre wußte in allen Häusern Bescheid. War es nicht erstaunlich? Gestern hatten Quantes einen Gast bekommen, und heute in der Frühe war Pompe funèbre bereits über alles Wissenswerte im Bilde!
Während ich ins Haus zurückging, fiel mir wieder einmal die Vorliebe des »Verewigten« für das Pittoreske auf. Nicht allein die Kuckucksuhr legte Zeugnis dafür ab, das ganze Haus war ein getreues Abbild jener Schweizerhäuschen, die man in Basaren zum Andenken an froh verlebte Ferien kauft und deren Inneres aus unerfindlichen Gründen ein Tintenfaß oder ein Nähkästchen beherbergt. Allenthalben fand sich Geschnitztes, an Giebeln und Balkonen, am Dachfirst und an den Fensterladen, die Haustür nicht zu vergessen, die ein von Heckenrosen umrahmtes SALVE zierte. Das Innere des Hauses wurde von der Malkunst beherrscht. Jede Tür trug ein alpines Emblem, ein Edelweiß etwa oder eine Enzianblüte, einen Gamsbock oder einen Steinadler. Wahrscheinlich hatte der Schöpfer der Embleme auch die Ölbilder in den Zimmern auf dem Gewissen. Sie wiesen eine gewisse Eintönigkeit sowohl in der Wahl der Motive als auch in den Farben auf. Bei allen handelte es sich um Berghäupter, grau und drohend vor einem Himmel von durchdringendem Blau. In der Wohnstube grüßten uns Zugspitze und Venediger, Stefan wurde an seinem Schreibtisch von der finsteren Größe des Matterhorns beeindruckt, über unseren Betten prangte der Großglockner, während Watzmann, Wendelstein und Benediktenwand sich auf die Zimmer der Kinder verteilten.
Wir hatten uns ehrfurchtsvoll gefragt, ob der »Verewigte« alle diese Gipfel bezwungen habe, aber eine Nachfrage bei Pompe funèbre hatte ergeben, daß sein Herzleiden ihm das Bergsteigen vor der Zeit verboten habe. So hatte er wenigstens seine Lieblinge im Bilde um sich haben wollen. Mit der Zeit war er von Sammelleidenschaft ergriffen worden; er hatte Gipfel gesammelt, so wie andere Freimarken oder Tabaksdosen oder Uhren sammeln.
»Wenn wenigstens nicht auf allen Bildern die Sonne schiene«, hatte Stefan eines Tages in einem Anfall von schlechter Laune ausgerufen, »ausgerechnet im Gebirge, wo es den halben Sommer regnet!«
»Aber dann sieht man die Berge nicht«, hatte Michael geantwortet. Vor dieser schlichten Logik mußten wir verstummen. Vielleicht war sie es gewesen, die dem Schöpfer der Bilder die Tube mit Kobaltblau in die Hand gedrückt hatte!
STEFAN
Um neun Uhr trat Stefan in Erscheinung. Er pflegte bis in die Nacht hinein zu arbeiten; die Folge davon war, daß er dem Leben, wie es sich in der Frühe darbot, mißtrauisch und ablehnend gegenüberstand. Man tat am besten, seine Gesellschaft am Morgen zu meiden. Die Beschaffenheit des Kaffees und der Semmeln, die Frische der Eier, die verlegte Morgenzeitung, alles konnte zum Stein des Anstoßes und zum Gegenstand gereizter Debatten werden. Ich beschränkte mich darauf, ihm das Nötigste in gefälliger Form mitzuteilen und allen Zündstoff, so weit als möglich, von ihm fernzuhalten.
Niemand wäre verwunderter gewesen als Stefan, wenn man ihn einen Tyrannen genannt hätte. Er war weder hochfahrend noch herrisch oder anmaßend; er kommandierte nicht und ließ sich nur selten zu Zornesausbrüchen hinreißen. Aber es gibt eine passive Form der Tyrannei, die darin besteht, von einem anderen stillschweigend zu erwarten, daß er alle jene Dinge tut, die man selber nicht gern tut. Stefan hatte eine Art, sich den unangenehmen Forderungen des täglichen Lebens zu entziehen, die mich manchmal zur Verzweiflung brachte. Er wollte durchaus nichts mit Steuerbehörden und Finanzämtern zu tun haben; Fragen, die Kinder und ihre Schulen betreffend, mußten von mir entschieden werden; ich erledigte seine Korrespondenz mit Verlegern und Schriftleitern. Nur wenn es um die Fabrik ging, streikte ich. Die Fabrik, seit Jahrzehnten im Besitz von Stefans Familie, stellte die Grundlage unseres Daseins dar, denn Stefans literarische Erfolge lagen mehr auf ideellem als auf materiellem Gebiet. Meine Meinung ging infolgedessen dahin, daß wir allen Grund hatten, uns über das Vorhandensein der Fabrik zu freuen. Stefan jedoch brachte der Herstellung von Marmelade eine aufreizende Interesselosigkeit entgegen. Erinnerungen an die Zeit, da er gezwungen gewesen war, gemeinsam mit seinem Vetter Kurt Lorentz in der Fabrik zu arbeiten, mochten schuld daran sein. Er behauptete erbittert, es sei die schlimmste Zeit seines Lebens gewesen, und der Geruch von Marmelade genüge seither, ihn krank zu machen.
Ich hörte die schmale Holztreppe unter seinen Füßen knarren, nun trat er ins Zimmer. Stefan gehörte zu den Menschen, die ihr eigenes Äußeres Lügen strafen. Seine herkulische Gestalt, der Kopf mit dem blonden, schon ein wenig schütteren Haar und den klaren, festen Zügen sagten nichts über die mimosenhafte Empfindsamkeit seiner Seele. Man war eher geneigt, ihn für einen Draufgänger zu halten, der Hindernisse im Sturm nahm. In Wirklichkeit jedoch wünschte er nichts sehnlicher, als ihnen aus dem Wege zu gehen. War er dennoch gezwungen, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, so geschah es auf eine lapidare Weise, die aus dem Hindernis ein Bollwerk machte. Zu guter Letzt sah ich mich vor die undankbare Aufgabe gestellt zu retten, was zu retten war.
Stefan war nahe an fünfzig. Seine hohe Stirn trug die Spuren geistiger Arbeit, zwei schärfe Falten zogen sich von der Nase zu den Mundwinkeln herab, seine hellen Augen hatten den wachsamen Blick des Menschen, der gewohnt ist, hinter die Dinge zu schauen; am liebenswertesten war ein Zug von Humor um den Mund, der den Ernst seiner Züge auflockerte.
Während des Frühstücks erzählte ich, daß Quantes einen Gast bekommen hätten. »Pompe funèbre wußte schon eine ganze Menge darüber«, sagte ich und lächelte, weil in unserem kleinen Kreise jedes Vorkommnis übertriebene Bedeutung gewann.
Stefan nahm die Nachricht kaltblütig auf. Er empfand nicht allzuviel für Quantes, ihre Interessen gingen zu sehr auseinander. Der Major hielt nichts von Dichtkunst, in seinen Augen waren Schriftsteller, Bildhauer und Maler Müßiggänger, die »etwas Besseres hätten tun können«.
»Hätten Sie nichts Besseres tun können«, hatte er eines Tages zu Kunstmaler Sörensen gesagt, »als den ganzen Tag dazustehen und Leinwände vollzuschmieren? Wer kauft Ihnen das Zeugs ab? Ich für mein Teil sehe mir die Natur lieber in Wirklichkeit an, als sie in Öl an der Wand hängen zu haben.«
Sörensen hatte es uns lachend erzählt. Er bewohnte mit seiner jungen Frau und einem zwei Monate alten Buben ein winziges Häuschen, das oberste am Hang. Eigentlich war es nur ein Atelier mit einer Puppenküche als Anhängsel. »Es ist die reinste Hundehütte«, sagte Pompe funèbre schaudernd. »Ich glaube, sie schlafen am Boden. Nirgends habe ich ein Bett gesehen!«
Weder Stefan noch Sörensen nahmen dem Major seine negative Einstellung zur Kunst übel. Major Quante war stachlig wie eine Roßkastanie, aber hinter seiner barschen Außenseite barg sich ein warmes Herz. Außerdem mußte man ihm manches zugute halten, denn er litt still und heldenhaft unter der erzwungenen Untätigkeit, zu der eine schwere Kriegsverletzung ihn verdammte.
Stefan trank geistesabwesend seinen Kaffee, seine Gedanken waren schon bei der Arbeit. Wir schwiegen beide. Ohne das gleichmäßige Tick-tack der Kuckucksuhr und das sanfte Gegacker der Hühner im Garten wäre die Stille vollkommen gewesen. Der Himmel hatte sich bezogen. Sollte Pompe funèbres linke große Zehe recht behalten?
Auf dem sandbestreuten Pfad vor dem Hause erklang ein fester Schritt, einen Augenblick später tauchte der bärtige Kopf des Briefträgers Waggerl im offenen Fenster auf. »An Brief hätt i für Eahna«, sagte er und legte einen blauen Umschlag auf das Fensterbrett, »und a Drucksachn aa.«
Die Drucksache stellte sich als der Katalog einer Sämereienhandlung heraus, von der wir vor Jahren einmal Blumenzwiebeln bezogen hatten. Der Brief – blauer Umschlag, Maschinenschrift – verkündete neben der Warnung, Aufschrift und Marke nicht zu vergessen, in Fettdruck: Lorentz-Marmeladen sind die besten! »Von der Fabrik«, sagte ich und legte den Brief vor Stefan hin.
Er runzelte unwillig die Stirn. »Bitte, lies du ihn.«
Ich öffnete den Brief. Vetter Kurt berichtete über den Geschäftsgang. Ihm zufolge hatte die Obsternte unter dem verregneten Sommer gelitten. Ohne Obst keine Marmelade. Die Firma Lorentz & Co. ließ sich nicht zu unlauteren Methoden herbei wie beispielsweise das Konkurrenzunternehmen Pomona, das Marmelade aus gefärbtem Leim und Zucker herstellte. »Die Leute machen eine wahnsinnige Reklame für ihren Kleister«, schrieb Kurt. »Wir müssen uns auch zu einer verstärkten Propaganda entschließen. Propaganda ist alles. Wie wäre es, wenn du uns ein paar hübsche Verschen dichten würdest?«
»Er ist wahnsinnig«, sagte Stefan.
Zu jeder anderen Tageszeit hätte das Ansinnen, er solle seine Muse in den Dienst von Marmelade stellen, seinen Sinn für Humor geweckt. Zu so früher Stunde aber weckte es nichts als einen empörten Monolog über Menschen, die keine Achtung vor geistiger Arbeit hätten.
»Was kann man von einem Menschen erwarten, dem Marmelade das A und O des Lebens ist?« rief er erbittert aus.
»Du bist ungerecht«, sagte ich. »Wenn Kurt und die Fabrik nicht wären –«
Stefan sah mich vorwurfsvoll an. »Ich finde es nicht sehr taktvoll von dir, mich darauf aufmerksam zu machen, daß ich mit meiner Arbeit nicht genug verdiene, um meine Familie zu ernähren.«
Ich schwieg. Es hätte keinen Sinn gehabt, ihn wieder einmal daran zu erinnern, daß für die Mehrzahl der Menschen Marmelade mehr bedeutet als ein gutes Buch. Ein Buch zumal, wie Stefan es schrieb, still, unter Verzicht auf grobe Spannung und Sensationen jeder Art. Seine Bücher waren keine »Reißer« und würden es niemals werden. Viele liebten sie um der liebevollen Behutsamkeit willen, mit der er sich zu den Gründen und Hintergründen der menschlichen Seele vortastete, sie liebten seinen Humor und die Wahrhaftigkeit seiner Darstellung. Aber es war nicht anzunehmen, daß seine Bücher jemals jene Auflagenziffern erreichen würden, die aus einem Dichter einen reichen Mann machen.
Nach dem Frühstück steckte Stefan seine kurze Pfeife an und ging in sein Arbeitszimmer hinüber. Ein großer Tisch, vor das Fenster geschoben, bildete außer ein paar Stühlen die ganze Einrichtung. Dieses Zimmer war die Zuflucht des »Verewigten« gewesen. Wir hatten es vorgefunden, vollgestopft mit Möbeln aus der Plüsch- und Quastenzeit.
Es handle sich um alte Familienstücke, hatte Pompe funèbre wehmütig erklärt und zu unserer Erleichterung hinzugefügt, sie könne sich nicht von ihnen trennen.
Stefan haßte es, viel Möbel um sich zu haben. Er pflegte während der Arbeit im Zimmer umherzulaufen und brauchte volle Bewegungsfreiheit sowohl für seine Glieder als für seine Gedanken. Ein großer Tonkrug, mit Wiesenblumen oder buntem Laub gefüllt, war der einzige Luxus, den er sich gestattete.
Im Oberstock hörten wir Pompe funèbre mit Eimer und Besen hantieren. Sie war eine Fanatikerin der Sauberkeit und ließ es sich nicht nehmen, ihr »Witwenstübchen« täglich auszuräumen, um wie sie sagte, »gründliche Ordnung zu schaffen«.
Stefan seufzte. »Nicht einmal auf dem Lande hat man Ruhe.«
Ich trat hinter seinen Stuhl und streichelte sein Haar. »Wenn wir es erst zu einem eigenen Häuschen gebracht haben –« Dieses eigene Haus war das Ziel, dem alle unsere Wünsche zustrebten. Wir hatten schon einen Platz ausgesucht, wo es stehen sollte, ganz oben am Waldrand neben Sörensens »Hundehütte«. An stillen Abenden überboten wir uns im Pläneschmieden. Keiner von uns konnte zeichnen. Trotzdem fertigten wir einen Grundriß an, in dem niemand sich auskannte, nicht einmal wir selber. Aber wir zeichneten immer mehr hinein, so daß er allmählich einem Schnittmusterbogen glich mit seinem Gewirr rätselhafter Linien. Wir führten stundenlange Gespräche über die Zahl der Räume, über die Größe der Fenster und die Farbe des Holzes; wir ereiferten uns und vergaßen manchmal vollkommen, daß wir ein Luftschloß bauten, zu dessen Verwirklichung vorläufig alle Voraussetzungen fehlten. Zuweilen behauptete Stefan mit einem vorwurfsvollen Blick auf mich, die Kinder verschlängen Unsummen. Aber ich glaube nicht, daß unsere Kinder mehr kosteten als die anderer Leute. Außerdem war es Stefan, der ihnen, seinen Theorien von spartanischer Erziehung zum Trotz, keinen Wunsch abschlagen konnte.
Stefan befreite die »große Erika« von ihrer Wachstuchhülle. Seine Schreibmaschine hieß die »große Erika« im Gegensatz zur kleinen, die ihn auf Reisen begleitete und obendrein mir zur Erledigung seiner beruflichen Korrespondenz diente. Er spitzte umständlich mehrere Bleistifte, legte Papier zurecht und fluchte, weil er seinen Radiergummi nicht finden konnte. Seine Vorbereitungen erinnerten mich an die eines Menschen im Schwimmbad, der mit allerlei Listen und Ränken den Augenblick hinauszögert, in dem er sich dem nassen Element ausliefern muß. Endlich lagen und standen alle Dinge an ihrem Platz; der Augenblick, in dem nichts mehr den Schwimmer hindert, sich ins Wasser zu stürzen, war gekommen.
Ich zog leise die Tür hinter mir zu. Für die nächsten Stunden war Stefan der Welt und ihrem Treiben so entrückt, als lebe er auf einem anderen Stern.
PROFESSOR AMBROSIUS
Als ich aus dem Hause trat, war der Himmel grau in grau. Ein rauher Wind wirbelte ein paar bunte Blätter durch die Luft, die Berge waren hinter einer Wolkenwand verschwunden. Ich schlug den Kragen meines Mantels hoch und ging schnell den Pfad zum Dorf hinab, den ein windschiefes Schild als Benediktenwandstraße bezeichnete. Eine kühne Bezeichnung übrigens, denn wenn man es recht besah, konnte von einer Straße nicht die Rede sein. Aber der Gemeinderat war offenbar der Ansicht gewesen, daß das Vorhandensein von Häusern das Vorhandensein von Straßen bedinge. So waren die schmalen Pfade, die sich durch die Wiesen zogen, vermittels Beschriftung in den Straßenstand erhoben worden. In der Benediktenwandstraße wohnte außer Pompe funèbre und uns Professor Ambrosius; Quantes Haus stand an der Zugspitzstraße und das von Frau Willbrandt-Schrödl an der Ludwig-Thoma-Straße. Den Vogel aber hatten Sörensens abgeschossen, denn der liebliche Wiesenpfad, der sich an der »Hundehütte« vorbei zum Waldrand hinaufschlängelte, hieß Immanuel-Kant-Straße. Wir schrieben diesen genialen Einfall der Anwesenheit des Bäckermeisters Senftl im Gemeinderat zu. Herr Senftl war ein Mann, dessen Neigungen über das Bäckcereigewerbe hinaus den Bezirken des Geistigen zustrebten. Sein von paradiesischen Düften erfüllter Laden gegenüber dem Schulhaus war ein Magnet, der die Kinder unwiderstehlich anzog. Den Mittelpunkt des Dorfes aber bildete der Gasthof »Zum grünen Baum«, »ausgeübt« von Herrn Emanuel Holzeder. Hier hatten sowohl die Einheimischen als auch die Bewohner der »Kolonie« ihren Stammtisch; Höhepunkte des menschlichen Daseins als da sind Hochzeits-, Taufund Begräbnisschmaus, spielten sich im »Grünen Baum« ab; an stillen Abenden hörte man das Rollen der hölzernen Kugeln auf der Kegelbahn bis zum Walde herauf.
Neben dem Gasthof »Zum grünen Baum« betrieb Herr Holzeder einen Laden, von uns »Holzeders Bazar« genannt, denn es gab dort alles zu kaufen, angefangen bei Geräten für die Landwirtschaft bis zu kolonialen Erzeugnissen, wollener Unterwäsche, buntgeblumten Dirndlstoffen, Geschirr, Spielzeug, Nähnadeln und Ansichtskarten. Herr Holzeder durfte sich mit Recht rühmen, der reichste Mann des Dorfes zu sein, aber auch er hatte sein Kreuz zu tragen in Gestalt seiner einzigen Tochter, die eine schwere Erkrankung in früher Kindheit zum Krüppel gemacht hatte.
»Unser Herrgott sorgt schon dafür, daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen«, pflegte Pompe funèbre im Hinblick auf Herrn Holzeders Tochter zu sagen, mit einer Miene triumphierender Gerechtigkeit, die ich aus Herzensgrund verabscheute.
Elf Uhr! Aus dem Schulhause strömten, schreiend und lachend, die Kinder. Meine Augen entdeckten Michael inmitten einer Schar raufender Buben, und mein Herz schlug höher beim Anblick seiner kleinen, festen Gestalt in der ausgewachsenen Lederhose. Ich liebte meine drei Kinder mit der gleichen Zärtlichkeit, in einem verborgenen Winkel meines Herzens jedoch war der kleine Michael unumschränkter Herrscher. Vielleicht weil er der Jüngste war, vielleicht aber auch aus dem unterbewußten Gefühl einer besonderen Verbundenheit zwisehen Mutter und Sohn heraus, deren Ursprung zu den Rätseln der Natur gehört.
»Mick hat niemals aufgehört, Mumis Schoßkind zu sein«, hatte Corinna einmal gesagt. Natürlich war es übertrieben, aber ein Körnchen Wahrheit steckte doch darin.