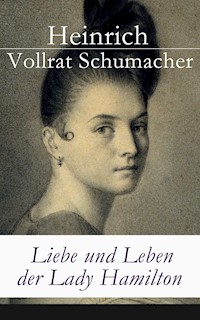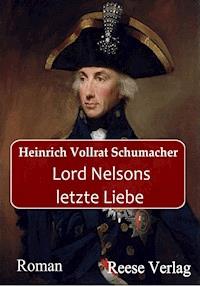Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Loreart
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der historische Roman umfaßt etwa die Jahre von 1760 bis 1791 und ist interessant vor allem als Sittendokument dieser Zeit. Er handelt vom Aufstieg der abenteuerlichen Lady Hamilton zur Gemahlin des englischen Gesandten am neapolitanischen Hofe. Durch ihre von vielen Zeitgenossen als skandalös betrachteten Liebesbeziehungen, ihre Schönheit und als Künstlerin war sie am Ende des 18. Jahrhunderts eine europaweit bekannte Berühmtheit. Sie war die Geliebte Lord Nelsons, endete in armen Verhältnissen in Frankreich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Liebe und Leben der Lady Hamilton
Kapitel I.
Kapitel II.
Kapitel III.
Kapitel IV.
Kapitel V.
Kapitel VI.
Kapitel VII.
Kapitel VIII.
Kapitel IX.
Kapitel X.
Kapitel XI.
Kapitel XII.
Kapitel XIII.
Kapitel XIV.
Kapitel XV.
Kapitel XVI.
Kapitel XVII.
Kapitel XVIII.
Kapitel XIX.
Kapitel XX.
Kapitel XXI.
Kapitel XXII.
Kapitel XXIII.
Kapitel XXIV.
Kapitel XXV.
Kapitel XXVI.
Kapitel XXVII.
Kapitel XXVIII.
Kapitel XXIX.
Kapitel XXX.
Kapitel XXXI.
Kapitel XXXII.
Kapitel XXXIII.
Kapitel XXXIV.
Über den Autor
Impressum
Hinweise und Rechtliches
E-Books Edition Loreart:
Heinrich Vollrat Schumacher
Liebe und Leben der Lady Hamilton
Liebe und Leben der Lady Hamilton
I.
„Ein Schiff! Emma, ein Schiff!“
Jubelnd liefen die Kinder dem Strande zu, mit ihren jungen Stimmen die Luft erfüllend. Im stillen Wasser des Deegolfs lag eine Barke am Ufer. Über ihre mit bunten Teppichen und seidenen Kissen bedeckten Bänke spannte sich ein Baldachin, an dem schmale Wimpel flatterten. Von der warmen Sonne des Maientages bestrahlt wiegte sich die Barke auf der klaren Flut, in rosigen, goldgelben, purpurnen und azurblauen Farben schillernd. Wie ein großer, fremdländischer Vogel, von den Winden des Irischen Meeres an die Küste von Wales getrieben.
Emma suchte die Kinder zurückzurufen, aber sie waren schon bei den Fremden, die sich in langsamem Wandern näherten.
Der Herr fing den Knaben in seinen Armen auf.
„Halt, Bürschlein!“ rief er lachend und bog ihm den Kopf zurück, um ihm ins Gesicht zu sehen. „Was für ein hübscher Junge du bist! Wie heißt der kleine Mann?“
Der Knabe sträubte sich gegen die haltende Hand und sah neugierig nach dem Schiffe.
„John“, sagte er hastig. „John Thomas!“
Der Fremde ließ ihn zu Boden gleiten.
„John?“ Er wandte sich zu der Kleinen, die durch das Gewirr ihrer Locken zu ihm aufsah. „Und du, Blonding, wie nennt man dich?“
Sie machte einen zierlichen Knicks.
„Sarah! Ich heiße Sarah Thomas! Laß uns das Schiff sehen!“
Seine verdüsterten Augen glitten über die jungen Gestalten.
„John! Sarah! Haben Sie gehört, Miß Kelly? Die Namen meiner Kinder. So alt wie diese waren sie, als ich sie zum letzten Male sah!“
Die Dame hörte nicht zu. Sie betrachtete Emma, die nähergekommen war.
„Sehen Sie doch, Romney!“ sagte sie halblaut. „Das kleine Landmädchen da! Ist Ihnen jemals ein reizenderes Geschöpf vorgekommen?“
Sie faßte seine Hand und zwang ihn aufzublicken. Seine prüfenden Augen umfaßten Emmas ganze Gestalt. Plötzlich öffneten sie sich weit und etwas blitzte in ihnen auf.
„Wirklich, Miß Kelly, sie ist wundervoll! Sie stellt unsere berühmtesten Schönheiten in den Schatten! Selbst Sie, Arabella, selbst Sie!“
Miß Kelly lächelte.
„Sie wissen, Romney, ich verzichte gern auf den Preis der Schönheit, wenn man mir nur ein wenig Geist zuerkennt!“ Sie winkte Emma lebhaft zu. „Kommen Sie doch näher, Kind, und lassen Sie sich anschauen! Wissen Sie, daß das ein Vergnügen ist? Oder ahnen Sie noch nicht, daß Sie imstande sind, die anspruchsvollsten Männerköpfe in Verwirrung zu setzen?“
Sie suchte sie an sich heranzuziehen. Aber Emma widerstrebte. Dunkle Röte brannte auf ihren Wangen. Kein Laut dieser lebhaften Stimmen war ihr entgangen. Seltsam, wie die Sprache einer fremden Welt waren ihr die Worte ins Ohr gedrungen. Weich, mit schmeichelnder Berührung.
Aber der flammende Blick des Mannes bedrückte sie. Gierig schien er ihre Kleider zu durchwühlen, ihren Leib zu enthüllen, ihre Glieder zu betasten. Scheu machte sie sich von der Hand der Fremden los.
„Ich bitte, lassen Sie mich! Ich kenne Sie nicht und will nicht mit Ihnen sprechen! Kommt, Kinder! Wir gehen!“
Der Herr brach in ein gutmütiges Gelächter aus.
„O weh, Arabella! Wir sind mit unserem Enthusiasmus an eine Herzogin geraten! Hoheit läßt uns ungnädigst abfallen!“
Auch Miß Kelly lachte.
„Keine Herzogin, mein Freund!“ sagte sie etwas scharf. „Eine Herzogin hätte mehr Geist gezeigt!“
Emma wandte sich kurz herum und sah ihr gerade ins Gesicht.
„Eine Herzogin hätten Sie auch wohl nicht in dieser Weise anzureden gewagt!“ stieß sie blitzenden Auges heraus. „Und auch dieser Herr hätte eine Herzogin wohl kaum so angesehen, wie er mich ansah!“
Die Fremden tauschten einen schnellen Blick, dann eilte Miß Kelly Emma nach.
„Sie haben Geist und Gefühl, mein Kindl“ sagte sie sanft und schmeichelnd. „Wir wollten Sie nicht verletzen. Aber“, setzte sie wie scherzend hinzu, „wenn Sie glauben, daß dieser Herr es nicht wagt, Herzoginnen so anzusehen, wie er Sie ansah, so sind Sie im Irrtum. Mr. George Romney ist einer der berühmtesten Maler Englands, und jede Fürstin würde es sich zur Ehre schätzen, von seiner Hand verewigt zu werden. Wissen Sie nun, warum er Sie so ansah?“
„Und würden Sie mir erlauben“, fügte Romney hinzu, der ihr gefolgt war, „Sie in dieses Buch einzuzeichnen, in das nicht jede Herzogin Aufnahme findet?“
Er schlug ein Skizzenbuch auf, das er in der Hand hielt, und öffnete einen kleinen Malkasten, den Miß Kelly getragen hatte, während diese eine Dienerin herbeiwinkte, die in respektvoller Entfernung wartete. Sie befahl ihr, den Kindern die Barke zu zeigen und Sorge zu tragen, daß ihnen nichts zustieße.
Emma vermochte nicht zu widerstehen. Sie ließ es zu, daß Miß Kelly sie auf einer grasbewachsenen Erhöhung zurechtstellte und ihr das Haar löste. Miß Kelly stieß einen Ruf des Entzückens aus. Rotleuchtend fiel die Flut über Schulter und Rücken, einen schimmernden Mantel ausbreitend, dessen Saum den Boden berührte.
Aber als die Fremde ihr das Kleid auf der Brust öffnen wollte, wehrte sich Emma. Alles Bitten war umsonst; selbst die drei Pfund, die der Maler ihr bot, vermochten ihren Sinn nicht zu ändern. Kopf, Arme und Hände und ein Stück des Halses gab sie ihm preis, sonst nichts. Und während Romney in schnellen Strichen malte, stand sie regungslos in den ihr gegebenen Haltungen und wagte kaum zu atmen. Und hörte zu, wie die Fremden ihre Schönheit lobten.
Worte gebrauchten sie, die Emma nie vernommen.
Blaue Sterne waren ihre Augen, rote Rubine ihre Lippen, zarte Rosen ihre Wangen. Die Gestalt einer Hebe hatte sie, das Profil einer Diana, die Hände einer Venus. Der weiche Schmelz unaussprechlicher Anmut breitete sich über ihr ganzes Wesen. Ein Bild holdester Jugend war sie, vollkommener, als ein Künstler in seinen kühnsten Träumen es je gesehen.
Eine süße Trunkenheit hatte sich Emmas bemächtigt. Die Worte trafen sie, wie ihren nackten Leib die kühlen Silbertropfen des Wasserfalles, in dem sie in schwülen Sommernächten gebadet, damals, als sie noch die Schafe weidete in den Bergen von Wales. Zitternde Schauer rannen ihr über den Rücken, unnennbares Wohlgefühl dehnte ihr die Brust.
Hatte sie nicht schon als Kind geträumt, daß sie eines Tages schön sein würde? Märchenhaft schön?
Was das war, hatte niemand ihr bisher gesagt. Nur einer, Tom Kidd. Aber der war ein unwissender Fischerknecht und niemals vom Strande des Deegolfs fortgekommen.
Und er liebte sie.
Emma hatte ihm nicht geglaubt.
Nun aber — auch diese Fremden sagten es. Und sie wußten, was schön war. Der Maler mit dem blassen, durchwühlten Gesicht und dem wie müde verschleierten Blick, in dem es leidenschaftlich aufflammte, wenn er sie ansah; die Dame mit den flinken, geschmeidigen Bewegungen einer Eidechse.
Sie war selbst schön. Lang und schmal waren ihre Hände und strömten einen feinen Duft aus wie Blumen ... brennend rote Lippen hatte sie. Wie die Königinnen, die Emma zuweilen in ihren seltsamen Träumen sah ...
Lippen, die wohl heiß zu küssen verstanden ...
Gern hätte sie diese roten, heißen Lippen einmal geküßt ...
Gerade, da sie es dachte, begegnete sie den Augen der Fremden. Verwirrt senkte sie die ihren. Brausend stieg ihr das Blut ins Gesicht.
Als der Maler mit der Zeichnung fertig war, sank sie mit einem Seufzer in sich zusammen. Hastig schlang sie das Haar wieder in den einfachen Knoten. Aber sie wagte nicht, sich zu rühren. Sie fürchtete, daß sie voll Neugier hinstürzen würde, das Bild zu sehen. Dm endlich einmal zu sehen, wie ihre Schönheit war.
Miß Kelly brachte ihr das Buch. Vier verschiedene Bilder hatte Romney gemacht. Lange starrte Emma hin.
„Das bin ich?“ stammelte sie endlich. „Es ist nicht wahr! Es ist nicht möglich! So schön bin ich nicht!“
„Hören Sie, was sie sagt, Romney? Sie will nicht glauben, daß sie es ist.“
Er stand in sich versunken. Sein Gesicht war wieder schlaff und welk und seine Augen blickten müde. Er sah aus wie ein alter Mann.
„Sie hat recht; sie ist es nicht!“ sagte er dumpf. „Sie ist unendlich viel schöner. Ein Stümper bin ich, ein Nichtskönner. Gainsborough, Reynolds hätten das tausendmal besser gemacht. Her mit dem Buch, Arabella!“ schrie er plötzlich voll Wut auf. „Zerreißen, verbrennen, in die Erde stampfen! Verflucht sei diese ganze mörderische Kunst! Ich gebe mich auf! Niemals wieder rühre ich einen Pinsel an!“
Wild griff er nach dem Buche. Aber Miß Kelly versteckte es vor ihm in ihrem Kleide. Da warf er sich zu Boden und bedeckte sein Gesicht mit den Händen. Seine Schultern zuckten.
Um Miß Kellys volle Lippen flog ein halb mitleidiges, halb grausames Lächeln.
„Wieder Ihre Künstlerschrullen, lieber Freund? Hören Sie doch endlich auf, nach Gainsborough und Reynolds zu fragen. Ob sie es besser gemacht hätten, ist gleichgültig. Romney hat es gemacht, wie Romney es machen mußte. Gainsborough ist einer, Reynolds ist einer und Romney ist auch einer. Und für England und die Kunst ist’s ein Glück, daß die drei nicht dasselbe sind und dasselbe machen. Stehen Sie auf, Sie großes, altes Kind, und erschrecken Sie unsere Hebe nicht länger!“
Mit seinen drei-, vierundvierzig Jahren schien er wirklich ein großes Kind. Gehorsam stand er auf, und durch die finsteren Wolken auf seiner Stirn brach es schon wieder wie heller Sonnenschein.
„Es ist wahr, mit Sepia kann man diesen wunderbaren Fleischton nicht wiedergeben!“ murmelte er. „Das gelingt nur mit Öl. Und in zwanzig, dreißig verschiedenen Gestalten müßte man sie malen. Haben Sie bemerkt, Arabella, wie ihr Gesichtsausdruck unaufhörlich wechselte?“
Miß Kelly nickte.
„Wenn ich Schauspielerin wäre, würde ich sie zu meiner Schülerin machen. Eigenartige Gedanken scheinen sich hinter dieser Stirn zu wälzen. Und doch kann sie kaum achtzehn Jahre sein!“
Unwillkürlich lächelte Emma.
„Noch nicht vierzehn!“
„Vierzehn!“ rief Miß Arabella erstaunt, während sie Emmas Gestalt mit einem seltsamen Blick umfaßte.
„Erst vierzehn und schon Weib! In Ihren Adern, Kind, muß heißeres Blut fließen. Wer ist Ihre Mutter? Wohnt sie hier in der Gegend? Sind die beiden Kinder Ihre Geschwister?“
Schnell waren die Fragen einander gefolgt, mit einem Interesse, das nicht erheuchelt schien. Miß Kellys Stimme klang eindringlich und ihre Augen richteten sich leidenschaftlich auf Emmas Gesicht.
Emma erblaßte. Widerwille erfaßte sie. Warum fragte diese vornehme Dame? Aus flüchtiger Laune? Um die Langeweile einer leeren Stunde auszufüllen? Um sich an dem Unglück anderer zu weiden? Jene war reich und glücklich. Alles hatte sie, was ihr Herz begehrte. Emma aber ...
Haß beschlich sie.
Ja, sie wollte antworten. Wie eine Anklage wollte sie ihr Elend dieser Zudringlichen ins Gesicht schleudern. Sich einmal wenigstens die erstickende Last von der Seele schreien ...
Emma Lyon hieß sie. Holzknecht war ihr Vater gewesen. In den Bergen von Wales. Ein stürzender Baum hatte ihn erschlagen.
Man hatte ihn eingescharrt und seine Witwe aus der Hütte gejagt. Das Kind an die versiegende Brust — fort! In die eisige Winternacht! Mit blutenden Füßen über scharfe Felsen, durch reißende Gebirgsbäche ...
Fluchende Bauern hatten ihr ein armseliges Stück Brot zugeworfen oder ihre Hunde auf sie gehetzt...
So war sie nach Hawarden gekommen, nach Flintshire, in die Heimat. Wohlhabende Verwandte lebten ihr hier. Und die Mutter. Nun würde das Elend ein Ende haben. So hatte sie gehofft.
Aber hart war die Heimat, die Großmutter selbst arm, mitleidlos die Verwandten. Froh konnte die Mutter sein, daß ein Pächter sie in Dienst nahm.
Das Leben einer niederen Magd ... Arbeit von früh bis spät ... karge Nahrung, widerwillig hingeworfen ... nachts ein Winkel im Stall....
Früh hatte Emma dieses Leben der Armut kennengelernt. Kaum sechsjährig hatte sie bereits anfangen müssen zu arbeiten. Sie weidete die Schafe. Black, der Hund, war ihr Gefährte, Vetter Tom Kidd, der Hütejunge der Nachbarfarm, ihr Gespiele. Schon verstand sie den sorgenschweren Blick, mit dem die Mutter sie morgens wie auf Nimmerwiedersehen entließ; den Freudenschrei, mit dem sie abends das Kind in ihre Arme riß, als sei es ihr neu geschenkt.
Dennoch war Emma nicht ganz unglücklich in jener Zeit. Um die Wiesen, auf denen sie ihre Tiere weidete, um die Büsche, unter denen der Deefluß glucksend dahinfloß, um die Gestalten der Großmutter, der Mutter und Toms spannen ihre Träume bunte, phantastische Fäden.
Und eines war allen diesen Träumen gemeinsam: Immer sah Emma sich reich und vornehm. Angetan mit goldenen Neidern kam sie in einer gläsernen Kutsche gefahren, um die drei Menschen, die sie liebte, in ihr großes, herrliches, strahlendes Schloß zu holen.
Bis eines Tages ...
Ein entfernter Verwandter starb und hinterließ der Mutter eine größere Summe. Da umschmeichelten die Menschen dieselbe Frau, die sie gestern noch verachtet und gestoßen hatten. Bloss, der Pächter, machte die Magd zur Wirtschafterin und setzte sie über alle, denen sie bisher gedient hatte. Der angesehenste Kaufmann der Stadt, ein Witwer, umwarb sie und legte ihr Geld nutzbringend in seinem Geschäft an. Mrs. Barker, die Vorsteherin einer vornehmen Erziehungsanstalt, nahm Emma unter die Zahl ihrer Schülerinnen auf.
Nach einem Jahr machte der Kaufmann Bankrott und die Tochter der Magd wurde unter dem Spottgelächter ihrer adeligen Mitschülerinnen aus der Anstalt entlassen.
Seitdem war sie Kinderwärterin. Aus Gnade und Barmherzigkeit aufgenommen. Gemieden von allen, die sie früher umschmeichelt hatten.
Aber bei Mrs. Barker hatte sie einen neuen Traum geträumt. Nicht jenen Prinzessinnentraum der Kindheit. Einen Traum mit wachen, hellen Augen.
Sie wußte, draußen in der großen, unbekannten Welt war ein Herrliches, Schönes, zu dem man durch Wissen gelangte. Danach hatte sie sich gesehnt.
Nun war auch dieser Traum verweht.
Dem Gelde beugten sich die Menschen. Dem Reichen öffnete, dem Armen verschloß sich alles.
Arm sein hieß elend sein. So war das Leben.
Sie sprach es nicht mit klaren Worten aus. Aber die Bewegung ihrer Hände, der flammende Blick ihrer Augen, der heisere Ton ihrer Stimme — alles verriet den bitteren Eindruck, den die Erfahrungen ihres jungen Lebens auf sie gemacht hatten.
Sanft zog Miß Kelly Emma an sich und strich ihr zärtlich das Haar aus der heißen Stirn.
„Armes Kind! Früh schon haben Sie Schweres erlebt. Aber bessere Zeiten werden kommen. Wenn man so schön ist...“
Ungestüm machte Emma sich los.
„Was nützt mir alle Schönheit der Welt?“ stieß sie finster heraus. „Hier weiß niemand etwas von Schönheit! Alle verachten mich. Und ich — ich weiß es, sterben werde ich in Elend und Niedrigkeit.“
Miß Kelly lächelte.
„Sie sind etwas voreilig, mein Kind. Man kann nie Vorhersagen, was aus einem Menschen wird, was nicht. Sehen Sie mich an! Ich weiß nicht, wo ich geboren bin und wer meine Eltern waren. In einer Jahrmarktsbude bin ich aufgewachsen, konnte mit sechzehn Jahren noch nicht lesen und schreiben. Und heute? Besitzerin eines Hotels in London, eines Landgutes in Irland, eines Depots in der Englischen Bank. Ganz London kennt mich. Die Weiber beneiden mich und bestechen meine Schneiderin um die Modelle zu meinen Kleidern; die Männer laufen mir nach und ruinieren sich für ein Lächeln meines Mundes. Und einer ... Eines Tages wird er König von England sein, Kaiser von Indien, der mächtigste Herrscher der Welt! „Gentleman George“ nennen ihn die Leute. Mich aber liebt er und ist mein Sklave. Und ich — Dickerchen! Kleines Dickerchen! nenne ich ihn.“
Sie lachte hell auf. In ausgelassener Lustigkeit hob sie ihr kostbares Kleid vorn empor, zeigte über seidenen Strümpfen ihre nackten Knie, und warf das linke Bein plötzlich hoch in die Luft.
„Arabella!“ rief Romney tadelnd. „Wie können Sie?“ „Misanthrop!“ sagte sie achselzuckend. „Die Kleine würde in London ein rasendes Glück machen.“
Der Maler zeigte ein finsteres Gesicht und seine Stimme klang scharf.
„Wollen Sie sie verderben?“
Miß Kelly lachte.
„Verderben — puh! Außerdem verstehen Sie sich nicht auf Ihren Vorteil, Freund! Wenn Miß Lyon nach London kommt, können Sie sie malen, in zwanzig, dreißig verschiedenen Gestalten. So oft Sie wollen. Eben wünschten Sie es doch selbst!“
In seine Augen kam wieder das gierige Leuchten. „Es ist wahr! Gainsborough und alle andern würde ich mit ihr schlagen.“ Dann besann er sich. „Hören Sie nicht auf die Versucherin, Kind. Bleiben Sie hier, bei Ihrer Mutter. Hier sind Sie — “
Mit einer ungeduldigen Handbewegung schnitt ihm Miß Kelly das Weitere ab.
„Verschonen Sie uns mit Tiraden, Romney! Sprechen wir lieber vernünftig! Was geben Sie Miß Lyon für jede Sitzung? Fünf Pfund?“
Er nickte, schon wieder ganz in Emma vertieft. „Fünf Pfund! Hundert Sitzungen zugesichert.“ „Und ich“, setzte Miß Kelly hinzu, sich zu Emma wendend, „ich engagiere Sie als Gesellschafterin mit einem Monatsgehalt von zehn Pfund. Nun, was meinen Sie? Nehmen Sie an?“
Unsicher sah Emma sie an. Das Neue, das auf sie eindrang, verwirrte sie.
„Ich weiß nicht ...“ stammelte sie. „Es wäre ja ein großes Glück für mich, aber ...“
„Aber? Ist Ihnen das Gebotene noch nicht genug? Was für eine fürstliche Apanage beziehen Sie denn jetzt als Kindermädchen?“
„Vier Pfund jährlich.“
„Und da besinnen Sie sich noch? In Ihrem Alter hätte ich für ein solches Anerbieten Leib und Seele dem Teufel verschrieben!“
Emma wurde plötzlich blaß.
„Meine Mutter ... sie hat mich lieb ... wenn ich sie verlasse ...“
„Sie wird froh sein, wenn Sie sich aus dem Elend hier retten.“ Sie wandte sich zu Romney. „Geben Sie mir Ihren Malstift. Ich werde Miß Lyon meine Adresse aufschreiben.“
Sie riß ein Blatt aus dem Skizzenbuch, schrieb in großen, steilen Buchstaben: „Miß Kelly, London, Arlington Street 14“, und setzte an den unteren Rand des Papiers das Datum des Tages: „6. Mai 1779.“
„Warum das?“ fragte Romney erstaunt. Sie lachte.
„Weil ich sehr vergeßlich bin und für mein eifersüchtiges Dickerchen genau Tagebuch führen muß. Natürlich schreibe ich nur auf, was ich nicht vergessen habe, was Dickerchen also wissen darf. Meine Bekanntschaft mit Miß Lyon aber darf Dickerchen wissen.“
Auch Romney lachte.
„Obgleich Miß Lyon schön ist? Fürchten Sie die Rivalin nicht?“
Sie zuckte übermütig die Schultern, aber in ihre Augen kam ein kaltes Licht.
„Ich weiß mich schon zu wehren!“ Sie steckte Emma mit einer schnellen Bewegung das Papier in den Halsausschnitt ihres Kleides. „Wenn Sie nun nach London kommen und mir das Blatt zu senden, brauche ich nur in meinem Tagebuch nachzusehen, um mich sofort an alles zu erinnern. Ich hoffe, daß es recht bald geschieht! Auf Wiedersehen also in London!“
Sie nickte Emma zu und nahm Romneys Arm, um zu der Barke zurückzukehren, von der die Kinder eben mit der alten Dienerin kamen.
Romneys Gesicht zeigte wieder den müden, traurigen Ausdruck, während er abschiednehmend Emma zuwinkte.
„Ich sage nicht auf Wiedersehen, Miß Lyon. Überall ist es für Sie besser als in London!“
Wortlos sah Emma ihnen nach.
Plötzlich kam Miß Kelly zurück. Mit wirrem Flackern fuhren ihre Augen über Emmas ganze Gestalt. Grellrot brannten in ihrem blassen Gesicht die halbgeöffneten Lippen.
„Ich kann nicht so von dir gehen, Mädchen!“ flüsterte sie mit schwerem Atem. „Du bist schön ... schön ... und ich ... es sind viel Menschen um mich her ... sie schmeicheln mir und sind mir zu Willen ... ich hasse sie, ich verabscheue sie. Keinen liebe ich, keinen! ... Einsam bin ich, einsam ... Aber wenn du zu mir kommst... Schwestern werden wir sein ... auf Händen werde ich dich tragen ... lieben werde ich dich ... lieben ...“
Ihre Stimme brach wie in einem Schluchzen. Wie einen Halt suchend klammerte sie sich an Emma.
Und plötzlich beugte sie sich vor und küßte, wie von Sinnen, zwei-, dreimal gierig Emmas Mund.
Dann, in ein seltsames, girrendes Lachen ausbrechend, eilte sie fort zu dem Strande. In ihren schillernden Gewändern glitt sie dahin, flink, geschmeidig, wie eine Eidechse ...
Die Ruderer zogen an. Unter den flatternden Wimpeln von Wales flog die Barke über die klare Flut. Strahlend in rosigen und goldgelben, purpurnen und azurblauen Farben.
Ein großer, fremdländischer Vogel, von den Winden des Meeres entführt in weite, geheimnisvolle Fernen.
Emma stand wie betäubt. Heiß kreiste das Blut in ihr, machte ihre Pulse hämmern, ergoß sich in ihre Augen und in die äußersten Spitzen ihrer Finger.
Das Wunderbare, das sie in seine weichen, starken Arme nahm, sie ihrer trostlosen Niedrigkeit entriß, mit ihr davonschwebte in rätselhafte, winkende Weite — war es nun zu ihr gekommen?
Das Wunderbare ... In stillen, einsamen Stunden der Nacht träumte sie von ihm mit offenen Augen, die das Dunkel zu durchdringen strebten.
Weiße, wallende Gestalten nahten sich ihr, funkelnde Kronen auf den Häuptern, lange, schlanke Lilienstengel in den bleichen Händen. Aus den grünen Wogen ferner Meere stiegen sie empor, hohe, blasse Frauen mit blutroten, wie lechzend geöffneten Lippen. Wohlgerüche zogen hinter ihnen her, wie sie wohl den Gewändern von Königinnen entströmten ...
Königinnen waren sie. Und nahten Emma, neigten sich vor ihr, dienten ihr ... Emma aber fühlte einen glühenden Lebensstrom durch ihre Adern rinnen; hoch reckte sie sich, blickte aus herrischen Augen um sich ...
Bis das Blut in ihr sich kühlte und verrann. Eine hilflose Mattigkeit kam dann über sie und nahm ihr alle Kraft, allen Willen. Von dem Traum blieb keine Spur. Im kühlen Lichte der nordischen Sonne erblickte sie alles um sich her, wie es war.
Sie sah das träge Wasser der Dee sich in den engen Golf ergießen, hinter dem ein ferner, grüner Streifen sich dehnte, das Irische Meer. Sie sah das Land, auf dem sie stand, in dem sie geboren war — ein grauer Erdstreifen, eingeklemmt zwischen den Golf und die Berge von Wales. Sie sah Hawarden, die kleine Stadt, mit ihrer altersgrauen Burgruine, mit den niederen, trübseligen Bauernhäusern und den winkeligen, schmutzbedeckten Straßen, in denen ein ewiges Schweigen zu nisten schien. Trostlos, leer, ohne Wachstum, ohne Hoffnung war alles. Totes Gestein, an das sie angekettet stand, unfähig, sich zu bewegen.
Während die Ferne lockte.
Weites, freies Land lag hinter den Bergen. Und eine breite Heerstraße zog sich hindurch. Zu der großen, geheimnisvollen Stadt, in der das Leben wohnte, das Glück ...
London ...
Die Stimmen der Kinder störten sie auf. Noch einen Blick warf sie über das Meer. Die Barke war verschwunden.
Schweigend führte sie die Kinder nach Hause zurück.
II.
Schlaflos brachte sie die Nacht zu.
Durfte sie der Fremden folgen und alles aufgeben, die Mutter und die Geborgenheit ihrer Stellung?
Wie ein Alp lag ihr die Frage auf der Brust.
Die leichten Atemzüge der Kinder drangen zu ihr herein, die nebenan in ihren Bettchen schliefen. Leise rauschten die Blätter der Bäume im Park. Sonst war es still.
Ach, wie sie diese Stille haßte!
Eingeschlossen war sie hier wie in einem Gefängnis. Ohne Wechsel, ohne einen freien Atemzug rannen die Tage dahin. Herrschaft und Diener — alte Leute waren sie, die niemals einen Schritt schneller machten, niemals ein Wort lauter sprachen als das andere. Sie lachten nicht, sie erregten sich nicht. Sie waren gütig; aber von einer kühlen Güte, die kein wärmeres Gefühl aufkommen ließ. In ihrer Leidenschaftslosigkeit erschienen sie Emma wie Wesen aus einer Welt, in der nichts Menschliches war.
Auf den Spaziergängen mit den Kindern immer dieselben Wege, dieselben Ziele. Man bestieg den Hügel, um nach dem fernen Meere zu spähen, zu dem man niemals kam. Oder man erging sich im Park. Auf den mit weißem Sande bestreuten, sorgfältig geharkten Wegen, die man kaum zu betreten wagte. Zwischen den hohen Taxushecken, deren Dunkel auf der Brust lastete wie ein schwerer, schwarzer Stein. Vorüber an Gartenbeeten mit matten, bleichen Blumenwiesen, die man nicht berühren durfte.
Blutlos war alles, schattenhaft, ohne Regung.
Ein jähes Angstgefühl, als müsse sie im nächsten Augenblicke sterben, überfiel Emma. Brennend heiß wurde ihr unter der leichten Decke. Taumelnd sprang sie aus dem Bette, lief zum Fenster und riß es auf.
Aber unter den dichten Bäumen des Parks brütete noch die Schwüle des vergangenen Abends. Ein glühender Dunst schlug Emma entgegen, daß sie glaubte, ersticken zu müssen.
Dennoch kehrte sie nicht ins Bett zurück. Am offenen Fenster stehend wartete sie auf den Tag.
Es war der Tag, an dem sie mit dem Gärtner auf den Wochenmarkt nach Hawarden durfte. Dort traf sie mit der Mutter zusammen, die Früchte und Geflügel von der Farm ihres Brotherrn verkaufte.
Zwei kurze Stunden gehörten dann ihnen. Sie sprachen miteinander, sahen sich in die Augen, drückten sich die Hände. Sie liebten sich und waren glücklich, daß sie einander hatten. Sie waren doch nicht ganz verloren in der kalten Welt um sie her ...
Sollte sie es der Mutter sagen? Der Mutter, der die Trennung das Herz zerreißen würde?
Ungeduldig sah sie dem ersten Sonnenstrahl entgegen. Aber als er dann kam, bebte sie vor der nahenden Entscheidung zurück.
Langsam kleidete sie sich an und übergab die Kinder einer alten Dienerin. Der Gärtner wartete bereits im Hof. Zögernd stieg Emma auf den Karren und setzte sich neben den wortkargen Alten.
Emma fand die Mutter auf Mr. Bloss’ Marktstand, wie sie zwischen blitzenden Milchkannen, mit grünen Blättern ausgelegten Butterkörben und aufeinandergetürmten Geflügelkäfigen ihre Kunden bediente. Als sie Emma erblickte, leuchtete es in ihrem vergrämten Gesicht auf. Mit ausgestreckten Händen lief sie der Tochter entgegen, zog sie an ihre Brust, küßte ihr die Stirn.
Aber dann brach sie in Klagen aus. Mr. Bloss, der Pächter, wurde mit jedem Tage unangenehmer. Seit sie die Erbschaft verloren hatte, mäkelte er an allem herum, was sie tat. Nichts machte sie ihm recht. Eine Faulenzerin nannte er sie, die das Brot nicht verdiente, das er ihr aus Gnade und Barmherzigkeit zukommen ließ.
Schweigend hörte Emma zu. Sie sah, wie grau der Mutter Haar an den Schläfen wurde und wie tief die Falten waren, die Sorge und Mühsal ihr in Stirn und Wangen gegraben hatten.
In einer Pause, als Käufer sie nicht störten, sagte sie der Mutter alles.
„Wenn ich zu Miß Kelly gehe“, schloß sie erregt, „brauchst du dich nicht mehr um mich zu sorgen. Ja, ich hoffe, daß ich dir Geld schicken kann, um dich von Mr. Bloss loszumachen.“
Die Mutter war heftig erschrocken.
„Miß Kelly! Du kennst sie ja nicht! Wie kannst du ihr trauen? Große Damen sind unberechenbar. Heute kleiden sie dich in Samt und Seide, morgen werfen sie dich auf die Straße, wenn ihnen eine andere besser gefällt!“
Emma lächelte.
„Dann gehe ich zu Mr. Romney! Er will mich malen. Für jede einzelne Sitzung gibt er mir mehr, als ich jetzt im ganzen Jahre verdiene. Alles an mir hat ihm gefallen. Ganz vernarrt ist er in mich. Berühmt will er mich machen! Berühmt, Mutter, berühmt!“
Sie strahlte. Aber die Sorge wich nicht vom Gesicht der Mutter.
„Berühmt — das ist es! Daran denkst du nur, seit du bei Mrs. Barker warst! Aber weißt du denn, was das ist: ein berühmtes Modell? Gewiß, die Menschen kennen dich. Alles, was an dir ist, wissen sie. Nackt und schamlos stehst du vor ihnen. Und wenn sie dir begegnen, zeigen sie mit Fingern auf dich: Das ist Emma Lyon, die schönste Dirne in London!“
„Mutter!“
„Jawohl, Dirne! Ein Modell kann man kaufen. Jeder kann dich kaufen mit ein paar Pfund, die er dir zuwirft. Und das dauert so lange, wie du jung und schön bist. Nachher aber kümmert sich niemand mehr um dich. Auf der Straße liegst du, zerlumpt, ehrlos, ausgemergelt. Und ich, deine Mutter — o, mein Gott, dazu hätte ich dich geboren? Dazu dich unter Demütigungen, Mühsal und Sorge großgezogen?“
Sie schlug die Hände vors Gesicht und brach in Schluchzen aus. Wie gebrochen saß sie auf einer Kiste im Hintergründe der Bude, in ihrem Schmerze noch ängstlich bemüht, sich den Blicken der Vorübergehenden zu entziehen.
Emma starrte finster vor sich nieder.
„Hör’ auf mit Weinen, Mutter“, sagte sie endlich, mühsam die Worte hervorwürgend. „Wenn es dir so schwer wird, mich gehen zu lassen — nun denn, ich will versuchen, ob ich dies Leben noch länger ertrage.“
Sie wandte sich ab, um die Tränen zu verbergen, die ihr wider Willen in die Augen stiegen. Ihre Blicke schweiften achtlos über das Kommen und Gehen der Menschen, über das bunte Gewühl des Marktes.
Plötzlich fuhr sie zusammen. Was dort den engen Gang zwischen den Buden heraufkam ...
In ihrer Erinnerung stieg der Tag herauf, an dem sie bei Mrs. Barker eingetreten war. Greifbar deutlich stand alles wieder vor ihr, was damals geschehen war. Und noch immer glaubte sie die Worte zu hören, die wie Dolchstiche in ihr Herz eingedrungen waren ...
Jane Middleton, die Schwester eines Lords, hatte Emma plötzlich angeredet.
„Miß Lyon, sagen Sie uns doch, wer ist Ihr hochgeehrter Herr Vater gewesen?“
Anna Gray, die Nichte eines Baronets, hatte die Melodie eines alten Volksliedes vor sich hingeträllert.
Herr Lyon war ein Holzknecht,
Ein Holzknecht in Nordwales ...
Darauf wieder Jane Middleton —
„Und, Miß Lyon, wer ist Ihre hochgeehrte Frau Mutter?“
Darauf Anna Gray —
Frau Lyon ist ’ne Kuhmagd
Und duftet nach dem Stall.
Abermals Jane Middleton -
„Miß Lyon, in welchem stolzen Schlosse sind Sie geboren?“
Abermals Anna Gray —
Frau Lyons Schloß ’ne Hecke war,
Wo sie ihr schönes Kind gebar.
Und mit einer tiefen Verbeugung hatten sie Emma den übrigen Mädchen vorgestellt:
„Meine Herrschaften, unsere neue Hausgenossin Emma Lyon, das schöne Schäfermädchen von Hawarden, Tochter eines Holzknechts und einer Kuhmagd, unter einer Hecke geboren!“
Niemals, solange sie lebte, würde Emma diese Stunde vergessen.
Und nun kamen sie den Gang herauf. Jane Middleton — klein, zierlich, mit scharfgeschnittenem Gesicht, in dem hochmütige Augen funkelten. Anna Gray — groß, weich, blond, mit dem runden Lockenkopf einer Puppe. Janes Verlobter begleitete sie, Kord Halifax, ein langer, hagerer Mensch mit starren, nichtssagenden Zügen. Lachend und schwatzend kamen sie näher, des Volkes nicht achtend, das ihnen unterwürfig Platz machte.
Plötzlich sah Emma, wie Jane Middletons Augen auf ihr haften blieben. Wie einem Einfall nachgebend, blieb Jane vor der Bude von Emmas Mutter stehen.
„Da fällt mir ein, Anna, wir müssen Mrs. Barker etwas mitbringen. Wie wär’s mit einem Truthahn? Haben Sie Geld bei sich, Augustus?“
Lord Halifax zuckte vornehm die Achseln.
„Niemals, meine teure Jane. Dazu ist der Haushofmeister da. Aber wir können trotzdem alles kaufen, was wir wollen.“ Er sah Emmas Mutter mit schläfrigen Augen an. „Kennst du mich, gute Frau?“
Sie kam aus der Bude hervor und verbeugte sich tief, mit eilfertiger Demut.
„Wie sollte ich nicht, Euere Herrlichkeit? Mr. Bloss, mein Brotherr, ist Mylords Pächter.“
„Bloss? Pächter?“ Er blies den Namen in die Luft, als hätte er ihn nie gehört. „Also, gute Frau, diese Damen ... Truthahn kaufen ... besten aussuchen ... Geld von Haushofmeister holen ... Truthahn sofort nehmen ... hinter Damen und mir hertragen ... zu Mrs. Barker. Verstanden?“
„Vollkommen, Euere Lordschaft! Ich würde es mir ja auch zur Ehre schätzen, den Käfig mit dem Truthahn zu Mrs. Barker zu tragen, aber Euere Herrlichkeit wollen gnädigst verzeihen ... es könnten Kunden kommen ... ich darf den Stand nicht allein lassen. Wenn Mylord gestatten, rufe ich einen dieser Jungen da.“
Sie wollte einen der Knaben holen, die müßig herumlungerten. Aber Jane hielt sie zurück.
„Das ist wohl nicht nötig, liebe Frau. Das Mädchen da kann den Truthahn tragen!“ Und ihre boshaften Augen auf Emma richtend, befahl sie:
„Nimm den Käfig und folge uns!“
Emma zuckte wie unter einem Schlage auf und wurde totenblaß.
„Miß Middleton!“ stieß sie heiser, atemlos heraus. „Wenn Sie mir das antun ... Miß Gray, ich bitte Sie, lassen Sie es nicht zu! Lassen Sie es nicht zu!“
Anna Gray wandte sich achselzuckend ab. Jane Middleton aber betrachtete mit geheucheltem Erstaunen Emma durch ihr Lorgnon.
„Was hat denn das Mädchen?“ fragte sie. „Ist sie krank?“
Als die alte Frau die Namen hörte, begriff sie alles. „Miß Middleton“, sagte sie sich aufrichtend mit zitternder Stimme, „Sie sollten Ihre ehemalige Schulkameradin nicht unnötig erniedrigen. Unverschuldetes Unglück muß auch bei den Reichen und Vornehmen Teilnahme finden.“
Der sanfte, würdige Ton jagte eine fliegende Röte über Janes Gesicht. Sie wollte scharf erwidern, als Lord Halifax ihr zuvorkam.
„Du bist unverschämt, Frau!“ sagte er in seiner schleppenden Weise. „Mein Haushofmeister wird mit meinem Pächter sprechen, daß er seine Leute besser auswählt. Willst du nun den Käfig tragen oder nicht?“
Sie sank in ihre frühere Unterwürfigkeit zurück.
„Gewiß, Mylord. Es würde mich ja mein Brot kosten, wenn ich nicht zu Mylords Befehl wäre.“ Und hastig den Käfig aufhebend wandte sie sich zu Emma. „Bleib hier, Kind, bis ich zurückkomme.“
Emma lachte rauh auf und nahm ihr den Käfig aus den Händen.
„Aber Mutter, merkst du denn nicht, was Miß Middleton will? Emma Lyon, das schöne Schäfermädchen von Hawarden, Tochter eines Holzknechts und einer Kuhmagd, unter einer Hecke geboren, soll demütig hinter ihr hergehen und als niedere Magd vor ihren ehemaligen Mitschülerinnen erscheinen.“ Und sich tief verneigend setzte sie mit schneidender Stimme hinzu:
„Bitte, meine Damen, gehen Sie voran. Ich folge Ihnen.“
Sie ging dann hinter ihnen her, den Käfig in den ausgestreckten Händen haltend. Steif aufgereckt, die Augen starr geradeaus gerichtet, die Lippen zusammengepreßt.
Auf dem Hof der Anstalt hieß Jane sie warten und ging mit Anna und Lord Halifax ins Haus. Von allen Seiten strömten Schülerinnen herbei; sie umringten Emma, staunten sie an, lachten schadenfroh, warfen ihr spottende Fragen zu. Sie antwortete nicht. Keine Miene ihres bleichen Gesichts zuckte. Wie eine Diebin am Pranger stand sie an der Tür dieses Hauses, das einst das Ziel ihrer heißen Wünsche gewesen war.
Jane Middleton kam mit einer Magd zurück.
„Nimm deiner Kollegin den Truthahn ab, Mary!“ befahl sie und wandte sich zu Emma. „Und du, Mädchen, wie heißt du?“
Emma sah sie schweigend an. Auge in Auge standen sie einander gegenüber und sahen sich an.
„Aber Miß Jane, Sie kennen sie doch!“ rief Mary verwundert. „Das ist ja Emma Lyon! Unsere schöne Emma Lyon!“
Ein Chor von zwanzig lachenden, spottenden Stimmen wiederholte den Namen.
„Emma Lyon! Die schöne Emma Lyon!“
Jane Middleton griff in ihre Tasche.
„Mach’ deine Hand auf, Emma Lyon. Ich will dir etwas schenken, damit du dir ein anständiges Kleid kaufen kannst.“
Mit derselben starren Ruhe streckte Emma ihre Hand aus. Jane Middleton legte einen Schilling hinein.
Dann wies sie nach dem Hoftor.
„Du kannst gehen, Emma Lyon.“
Langsam ging Emma hinaus. In ihrer Hand brannte das Silberstück.
Auf der Straße blieb sie stehen und starrte auf das Haus zurück. Ein Bibelwort fuhr ihr durch den Sinn.
... Und ich will deine Feinde zum Schemel deiner Füße machen ...
Wie eine Mauer, die den Himmel versperrte, erhob sich in ihr der Haß.
III.
Arlington Street 14 ...
Der Schweizer Portier gab Emma Auskunft. Miß Kelly war nicht in London. Unmittelbar nach ihrer Rückkehr aus Wales war sie mit Mr. Romney nach Paris gereist. Wann sie zurück sein würde, war unbestimmt. Sicherlich aber zu den Rennen von Epsom, die am fünfzehnten August begannen.
„Wenn Sie mir Ihre Adresse geben, wird man Sie von Miß Kellys Rückkunft benachrichtigen.“
Emma dachte an die niedere Herberge, in der sie abgestiegen war.
„Ich bleibe nicht in meinem Gasthof“, erwiderte sie verlegen. „Sobald ich eine feste Wohnung habe, teile ich Ihnen die Adresse mit.“
Sie trat auf die Straße zurück und tauchte in dem Menschenstrom unter, den der schöne Maitag ins Freie gelockt hatte. Planlos ließ sich mit forttreiben.
Daß Miß Kelly nicht in London war, erschreckte sie nicht. Während der langen Postfahrt von Chester hatte sie sich in ihren Phantasien von ungeheuren Schwierigkeiten bedroht gesehen, die sie alle siegreich überwunden hatte. Was konnte ihr nun diese erste kleine Unebenheit schaden? Schlimmstenfalls vermietete sie sich, bis Miß Kelly zurückkam, irgendwo als Dienstmädchen.
Auch das Gewühl um sie her flößte ihr keine Furcht ein. In dem kleinen, stillen Hawarden hatte sie sich immer bedrückt gefühlt, hier in dem großen, brausenden London kam sie sich vor wie ein Fisch in seinem Element. Frei war sie, an keine Rücksicht mehr gebunden. Konnte tun und lassen was sie wollte.
Ein lustiges Lied summend sah sie den Begegnenden ins Gesicht, lächelte über das plumpe Aussehen der Bürgerfrauen, weidete sich an den schmeichlerisch-herausfordernden Blicken der Männer. Fest und elastisch klangen ihre Schritte auf dem Steinpflaster. Als ginge sie über erobertes Land. Als brauchte sie nur die Hand auszustrecken, um all den Glanz ihr eigen zu nennen.
Vor einem Schaufenster blieb sie stehen. Damenkleider aus leichten, weißen und bunten Stoffen waren ausgestellt, indische Schals, gold- und silbergestickte Mäntel, Hüte mit wallenden Straußenfedern.
Emma kannte Namen und Wert der Kostbarkeiten nicht, aber ihre Schönheit fesselte sie. Auch war in der Mitte des Schaufensters ein Spiegel angebracht, der das Bild des vor ihm Stehenden in voller Größe zurückwarf.
Zum ersten Male sah sie sich in ihrer ganzen Gestalt. Von allen Seiten musterte sie sich, scharf, ohne Eigenliebe. Sie fand sich hübsch, aber den Bauernkittel schrecklich. Das erste, was sie sich anschaffen mußte, war ein Kleid, wie sie im Schaufenster hingen. Es war für sie, was für den Ritter das Schwert, für den Schiffer das Segel.
Sie zählte ihr Geld und sah, daß sie noch sieben Pfund hatte. Kurz entschlossen trat sie in den Laden.
Ein junger Mann kam ihr entgegen.
„Ist der Geschäftsinhaber zugegen?“ fragte sie. „Ich möchte ihn sprechen.“
Der junge Mann deutete auf eine ältere Frau, die sich im Hintergründe mit einer Dame unterhielt.
„Das Magazin gehört Madame Beaulieu. In welcher Angelegenheit?“
Emma musterte ihn mit kühlem Blick und ging an ihm vorüber, ohne zu antworten.
„Sie gestatten, Ma’am. Kann ich bei Ihnen für zwei bis drei Pfund ein elegantes Kostüm kaufen?“
Madame Beaulieu lächelte.
„Hier in der Fleet Street gibt es nur Kostüme, die viel, viel mehr kosten“, sagte sie freundlich mit fremdem Akzent. „Billige Sachen kaufen Sie besser in der Drummond Street, auf dem Eustonplatz oder auch am Surreyufer.“
„Ich höre diese Namen zum ersten Mal“, erwiderte Emma. „Ich bin gestern abend erst nach London gekommen. Und wie teuer ist das Kleid; das neben dem Spiegel in Ihrem Schaufenster hängt?“
„Acht Pfund, mein Kind.“
„Das ist mir zuviel. Ich besitze nur noch sieben und weiß nicht, ob ich in nächster Zeit etwas verdienen werde. Wenn ich das Geld habe, werde ich wiederkommen.“ Sie wandte sich, wie um zu gehen. Dann aber schien ihr etwas einzufallen. „Dürfte ich das Kleid nicht wenigstens einmal anziehen?“
Madame Beaulieu lachte hell auf.
„Haben Sie gehört, Mrs. Cane?“ rief sie der Dame zu, mit der sie sich unterhalten hatte. „Die kleine Unschuld vom Lande möchte mein schönstes Kostüm nur einmal anziehen!“
Mrs. Cane kam näher, um Emma neugierig zu betrachten.
„Sind Sie so eitel, mein Kind?“
„Ich bin nicht eitler als andere“, sagte Emma ruhig. „Aber ich bin fremd nach London gekommen, um bei einer vornehmen Dame in Dienst zu treten. Unglücklicherweise ist sie nach Paris verreist und kehrt erst im August zurück. Ich muß also sehen, daß ich mich bis dahin auf anständige Weise durchbringe.“
„Und dazu brauchen Sie ein schönes Kleid? Sie sind noch sehr jung ... zu jung, als daß ich annehmen möchte ...“
Emma warf den Kopf zurück, ihre Augen blitzten stolz. „Bitte, nicht weiter, Ma’am! Ich hoffte, hier werde vielleicht ein junges Mädchen gebraucht, das hübsch genug ist, um den Kundinnen die Kostüme des Magazins vorteilhaft zu zeigen. Deshalb wünschte ich, vor Ihren Augen jenes Kleid anzuziehen!“
Die beiden Damen sahen einander erstaunt an.
„Ihr Gesicht ist hübsch genug!“ sagte Madame Beaulieu dann mit scharf prüfendem Blick. „Aber zu der Beschäftigung, die Sie wünschen, gehört mehr. Man muß auch eine tadellose Figur haben.“
Emma nickte.
„Ich weiß es, Ma’am! Und ich habe sie. Mr. Romney wenigstens fand meine Figur vollkommen!“
„Romney?“ Die beiden Damen schrien fast auf. „Der Maler Romney?“
„Er will mich malen und hat mir für jede Sitzung fünf Pfund geboten.“ Auf Mrs. Canes Gesicht spiegelte sich etwas wie Mißtrauen.
„Sie sagen das, als wenn es nichts wäre! Warum gehen Sie denn nicht zu ihm?“
„Herr Romney ist ebenfalls verreist.“
Die Augen der Dame blickten plötzlich streng abweisend.
„Das ist nicht richtig! Ich habe noch vor drei Wochen mit ihm gesprochen.“
Ruhig sah Emma zu ihr auf.
„Wohl möglich, Ma’am! Vor zehn Tagen aber hat er mich am Deegolf in der Nähe von Hawarden gemalt. Als ich vorhin in Miß Kellys Haus war, sagte mir der Portier, sie sei mit Mr. Romney nach Paris gereist. Miß Kelly war dabei, als er mich zeichnete. Sie engagierte mich als Gesellschafterin und schrieb mir ihre Adresse auf.“
Sie holte das Blatt aus Romneys Skizzenbuche hervor und reichte es den Damen hin. Mrs. Cane nahm es und prüfte es sorgfältig.
„Es ist Nellys Handschrift“, sagte sie endlich. „Ich kenne sie genau. Schon manche Anweisung von ihr auf einen gewissen Gentleman ist durch meine Hand gegangen.“
Emma lächelte. „Eine Anweisung auf Gentleman George? Auf — Dickerchen?“
Mrs. Cane sah überrascht auf.
„Sie wissen?“ Sie wandte sich zu Madame Beaulieu. „Ich glaube, die Kleine spricht die Wahrheit. Können Sie ihr nicht helfen, meine Liebe?“
Madame Beaulieu zuckte die Achseln.
„Wir sind in der toten Saison. Zum Herbst vielleicht.“
„Wenn Miß Kelly zurück ist, braucht sie keine Hilfe mehr!“ Sie sah Emma nachdenklich und zweifelnd an. „Ich selbst würde vielleicht etwas für Sie tun können ... aber dies schreckliche London ... man kann den Menschen nicht ins Herz sehen. Auch weiß ich nicht, was Sie gelernt haben und ob Sie überhaupt etwas leisten können.“
Emma preßte die Lippen zusammen.
„Ich begreife Ihre Bedenken, Ma’am. Ich selbst würde mich an Ihrer Stelle tausendmal besinnen. Jedenfalls aber belüge ich niemand!“
Und sie erzählte alles: ihre niedere Herkunft, ihre kurze Schulzeit bei Mrs. Barker, ihre Flucht aus Hawarden. Sie verhehlte und beschönigte nichts.
Mrs. Cane hörte aufmerksam zu; ihr scharfer Blick schien Emma bis ins Innerste ihrer Seele dringen zu wollen.
„Und Ihre Mutter?“ fragte sie dann. „War sie mit Ihrer Handlungsweise einverstanden?“
„Ich habe sie nicht gefragt“, erwiderte Emma offen. „Sie ist durch ihr Unglück so ängstlich geworden, daß sie es nicht zugegeben hätte. Ich habe ihr geschrieben, daß ich nach London gehe, um die Stellung bei Miß Kelly anzutreten. So wird sie vorläufig beruhigt sein.“
„Und für die Zukunft?“
Emma preßte die Lippen zusammen.
„Sie wird immer nur gute Nachrichten von mir erhalten.“
„Und wenn es Ihnen schlecht geht?“
„Dann erst recht!“
„Sie scheinen Ihre Mutter sehr lieb zu haben, mein Kind!“ sagte Mrs. Cane warm und wandte sich zu Madame Beaulieu. „Wie wär’s, meine Liebe, wenn wir prüften, ob Mr. Romney recht hatte, als er die:, kleine, tapfere Mädchen für eine vollkommene Schönheit erklärte? Darf sie das Kostüm aus Ihrem Schaufenster einmal anlegen?“
Madame Beaulieu winkte einer Verkäuferin, das Kleid zu holen.
„Gern, Mrs. Cane, wenn Sie es wünschen. Leider aber kann ich Miß Lyon keine Stellung bei mit anbieten.“
Mrs. Cane lächelte. „Wir werden sehen!“
Das Kleid wurde gebracht, Emma zog es an, und die beiden Damen betrachteten sie lange.
„Es wird sich vielleicht doch einrichten lassen, daß Sie bei mir bleiben“, sagte Madame Beaulieu dann. „Ich werde eine meiner Verkäuferinnen entlassen und Ihnen die Stelle geben.“
Emma errötete.
„Verzeihen Sie, Ma’am, Sie sind sehr liebenswürdig, aber ich möchte nicht gern eine andere verdrängen ...“
Mrs. Cane nickte ihr freundlich zu.
„Ihre Gesinnung macht Ihnen Ehre, mein Kind. Und sie bestärkt mich, Ihnen einen anderen Vorschlag zu machen. Mr. Cane, mein Mann, ist einer der ersten Juweliere in London. Unser Geschäft liegt ein paar Schritte von hier entfernt und zählt Damen und Herren der höchsten Aristokratie zu seiner Kundschaft. Haben Sie Lust, als Empfangsdame bei uns einzutreten? Es könnte gleich geschehen und mit der Zeit würde es Ihnen wohl leicht werden, sich die nötigen Kenntnisse auch für den Verkauf anzueignen. Au Unterweisung soll es Ihnen nicht fehlen. Über die Bedingungen werden wir uns schon einigen.“
Emma war von dem Glück, das sich ihr bot, einen Augenblick wie betäubt.
„Wie gut Sie sind, Ma’am!“ rief sie dann und beugte sich auf Mrs. Canes Hand herab, um sie zu küssen. „Ich werde mir Mühe geben, daß Sie Ihre Güte nie zu bereuen haben!“
Mrs. Cane lächelte fein. „Machen Sie sich keine übertriebenen Vorstellungen, Kind! Wären Sie häßlich, so hätte ich Ihnen nicht helfen können. Unsere Kunden lieben es, schöne Gesichter zu sehen, und wir Geschäftsleute müssen darauf Rücksicht nehmen. So ganz uneigennützig ist mein Vorschlag also nicht. Wie ist es, können wir gleich zu uns hinübergehen, um mit Mr. Cane das Weitere abzumachen? Oder haben Sie etwas anderes vor?“
„Nichts, Ma’am, nichts! Ich habe hier in London ja nach niemandem zu fragen. Ach, wenn Mr. Cane nur Ihren Vorschlag billigt!“
Wieder lächelte die alte Dame.
„Mr. Cane billigt meine Vorschläge immer! Aber was tun Sie denn da? Ich sagte Ihnen doch, daß bei uns die beste Gesellschaft verkehrt. Sie müssen stets elegant sein. Behalten Sie also das Kleid nur an; wir verrechnen es gelegentlich. Und Madame Beaulieu wird uns noch ein paar Kleinigkeiten geben müssen, um Ihre Toilette zu vervollständigen. Wäsche, Schuhe, alles, was nötig ist. Mr. Cane soll sich gleich überzeugen, daß ich eine gute Erwerbung gemacht habe.“
Als Emma sich am Abend dieses Tages entkleidet hatte, betrachtete sie sich lange in dem kleinen Spiegel der Mansarde, die in Mr. Canes Haus nun ihr Heim war. Ein Lächeln der Zuversicht kräuselte ihre Lippen.
Der erste Tag in London! Der erste Schritt auf ihrem neuen Wege zum Glück! Ihre alten Kleider hob sie sorgfältig auf. Einst, wenn sie eine Lady war, sollte ihr der grobe Bauernkittel ein Sinnbild ihres Triumphes sein.
Wochenlang lebte Emma nun ein stilles Leben im Hause des Juweliers. In dem großen Laden des Erdgeschosses empfing sie die Kunden und legte ihnen die Kostbarkeiten des berühmten Magazins vor. Ihre Hände wühlten in den Schätzen der Welt und ihre Augen tranken den Glanz, der von ihnen ausgehend das Halbdunkel des Raumes mit tausendfarbigen Lichtern zu erfüllen schien.
Wasserhelle Diamanten aus Indien und Brasilien blitzten neben himmelblauen persischen Türkisen und violetten Amethysten vom Ural. Gelbe Topase aus Sachsen, blutrote Rubine .ms Birma, kornblumenblaue Saphire vom Himalaja wetteiferten mit dunkelgrünen Smaragden aus Kolumbien und indischen goldroten Karneolen. Lapislazuli aus Afghanistan und vom Baikalsee ließen auf ultramarinblauem Grundgestein ihre goldenen Flitter erglänzen.
Sie hatte sie alle kennengelernt, diese Wunder des Lichts und der Farbe. Aus allen Teilen der Erde hatte der Handel sie hier zusammengetragen, um die Frauen Englands zu schmücken. Die Frauen von ein paar tausenden Bevorzugter, die sich zu Herren über die Masse der Millionen emporgeschwungen hatten. Jeden Stein wußte sie nach seinem Werte zu schätzen, so daß Mr. Cane, der erfahrene Juwelier, sich oft darüber verwunderte, woher dem einfachen Mädchen aus dem Volke das Gefühl für das Echte gekommen. Es war ihr natürlicher Sinn für Schönheit, der sie leitete, geschärft durch das Begehren.
Denn eine brennende Gier nach diesen Kostbarkeiten hatte Emma erfaßt. Wenn sie einen Stein von besonderer Färbung oder außergewöhnlichem Glanze verkaufen mußte, hatte sie Wallungen eines zornigen Schmerzes. Wie beraubt kam sie sich dann vor. Als habe nur sie ein Anrecht auf königlichen Schmuck und als bestehle man sie schon durch das bloße Anschauen.
Niemals aber kam ihr die Versuchung, sich eines dieser heißbegehrten Stücke anzueignen. Mit einem heimlichen Lächeln beobachtete sie die Vorsichtsmaßregeln, die Mr. Cane seinen Verkäuferinnen gegenüber traf. Ihretwegen konnte er alles unverschlossen umherliegen lassen! Um einen Stein setzte sie ihre Zukunft nicht aufs Spiel!
Die Zukunft...
Eines Tages würde dieselbe Emma Lyon, die jetzt hinter dem Ladentische stand und fremden Wünschen diente, dort vor der Tür in einer eigenen Equipage Vorfahren und eintreten, geleitet von Lakaien in goldstrotzenden Livreen. Mr. Canes geschmeidige Verbeugungen würden sie empfangen und das staunende Geflüster der armen Verkäuferinnen. Was sie sich auch von diesen Schätzen wünschte, alles würde ihr gehören.
So würde es geschehen. Sie wußte es genau.
Aber noch zeigte sich zu dieser Zukunft kein Weg. Die Herren, die eintraten, bewunderten ihre Schönheit, warfen ihr verstohlene Blicke zu, raunten ihr kecke Worte ins Ohr. Keiner aber näherte sich ihr ernstlich. Sie kauften, um die Diademe in andere Haare zu flechten, die Kolliers auf anderen Nacken funkeln zu lassen, die Ringe an andere Finger zu stecken. Wie eine Durstende kam sie sich vor, bis an den Hals in einen rieselnden Quell gestellt. Sobald sie sich aber bückte zu trinken, wich das Wasser zurück.
Zorn und Ungeduld ergriff sie über die Langsamkeit, mit der das Glück nahte. Was nutzte es, daß sie hier in dem Glanze lebte, wenn sie selbst keinen Teil an ihm hatte?