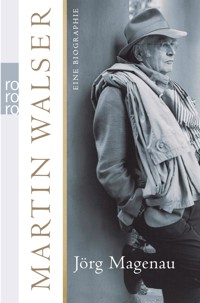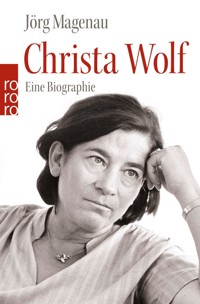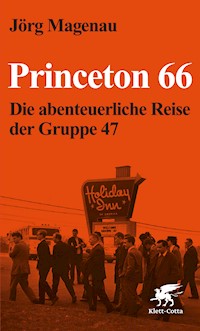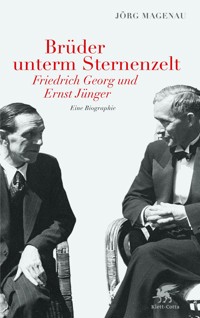18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Geschichte von Sehnsucht, Aufbruch und Vergeblichkeit zwischen Berlin und Nicaragua Die 80er Jahre: Paul verlässt sein Berliner Studentendasein und den Traum der großen Liebe zu Beate, um sich in Nicaragua für den Aufbau einer besseren Gesellschaft einzusetzen. Als er zurückkehrt, fällt die Berliner Mauer. Die Welt verändert sich grundsätzlich, aber ganz anders, als zuvor gedacht. Kann man noch an die Revolution und an die Liebe glauben? Paul lebt Mitte der 80er Jahre im linken Milieu West-Berlins. In den Lesekreisen und aktivistischen Zirkeln wird über die Revolution nachgedacht. Als er Beate trifft, entdeckt er die Liebe und muss erkennen, wie schnell sie einem entgleiten kann. Wie viele aus seiner Generation geht er nach Nicaragua, wo er hofft, sich nützlich machen zu können und Beate zu vergessen. In der Profanität des Revolutionsalltags zwischen Betonmischer und Hängematte deutet sich die Vergeblichkeit des politischen Kampfes an. Wäre da nicht die entschlossene Sigrid, deren Wesen ebenso rätselhaft ist, wie ihr plötzliches Verschwinden. »Liebe und Revolution« ist ein Epochen- und Generationenroman, der mitreißend erzählt, dass das Politische stets auch privat ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 358
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Jörg Magenau
Liebe und Revolution
Roman
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2023 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Anzinger und Rasp Kommunikation GmbH, München
unter Verwendung einer Abbildung von © Andy Bridge
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-608-98748-5
E-Book ISBN 978-3-608-12203-9
1
Die Nacht, an die er immer wieder zurückdachte, auch jetzt, hier, mitten unter den Schaulustigen vor der Oberbaumbrücke, hatte er ganz allein am Strand verbracht. Er hatte sich auf die Isomatte gelegt, ohne schlafen zu können, weil er mit Sternezählen nicht fertig wurde. Nie zuvor hatte er so viele Sterne gesehen, nie zuvor so tief ins Universum hineingeschaut. Der Pazifik dröhnte, warf unermüdlich Welle um Welle an den Strand, so wie seit Ewigkeiten und für alle absehbare Zukunft. Schwarz rollten die Wellen heran, um weiß aufzuschäumen und gurgelnd im Dunkel zu verlöschen. Paul kam es so vor, als wäre der Himmel räumlich, als ließe sich die Entferntheit der einzelnen Lichtpunkte darin abschätzen – oder vielmehr die Dauer des Unterwegsseins der Lichtstrahlen.
Altert das Licht unterwegs? Hat es eine Geschichte?
Und da, während er nach oben schaute und sich nicht sattsehen konnte, hörte er es schaben und schnaufen und scheuern. Der Strand geriet in Bewegung. Sieben riesenhafte Meeresschildkröten kamen in breiter Front aus dem Wasser. Wie eine Panzerarmee krochen sie auf ihn zu und an ihm vorbei, um sich mit dem Hinterleib in den Sand einzugraben und ihre Eier abzulegen.
Das dauerte, das war ein mühevolles Geschäft.
Die Schildkröte, die ihm am nächsten war, schaute ihn aus ihren hundertjährigen Augen an, als wüsste sie einen Menschen aus Erfahrung einzuschätzen. Paul rührte sich nicht, weil er das Schauspiel nicht stören wollte. Doch hinter den Schildkröten, kaum waren sie fertig mit ihrer Legestrapaze und machten sich schwer atmend auf den Weg zurück ins Meer, näherte sich eilig ein gebückter, kleiner Mann mit einem zerbeulten Strohhut auf dem Kopf, grub seine Arme in den lockeren Sand, holte die Eier, eins nach dem anderen, heraus und verstaute sie vorsichtig in einem Sack. Er lachte glückselig in Pauls Richtung, nickte mehrmals und hielt den Zeigefinger vor den Mund, vielleicht, um Paul zu signalisieren, dass er die Tiere nicht erschrecken dürfe, vielleicht aber auch, um ihm eine Art Schweigegelübde abzunehmen.
Paul hatte keine Ahnung, ob es in einem revolutionären Land erlaubt war, Schildkröteneier zu stehlen.
Im Universum fallen Raum und Zeit zusammen, dachte er. Lichtjahre sind ein Zeitmaß und geben trotzdem die Entfernung an. Was er als gleichzeitig und nebeneinanderliegend wahrnahm, stellte, wie er wusste, tatsächlich ein wildes Durcheinander vergangener Äonen dar, weil es von den näher gelegenen Sonnen vielleicht bloß tausend, von den ferneren aber Millionen Jahre gedauert haben mochte, bis das von ihnen ausgesandte Licht hier am Strand sein Ziel erreichte, indem es in seine Pupillen fiel und auf der Netzhaut ein Bild erzeugte, dem nichts Wirkliches entsprach, weil die Sterne, die er sah, vielleicht schon lange nicht mehr existierten. Oder war Wirklichkeit das, was er für sich zusammenfügte?
Knapp über dem Holzkreuz, am oberen Ende des Strandes, hing als fingernageldünne Sichel der Mond. Der immerhin war gegenwärtig, leuchtete in Echtzeit oder nur um eine gute Sekunde versetzt. Wie auf einem Gemälde von Caspar David Friedrich sah er aus, aber dann würde es sich bloß um die Ostsee handeln und nicht um die palmengesäumte Küste Nicaraguas, und er, Paul, stünde als sinnender Mönch im Nebel. Das Kreuz erinnerte an all die Fischer, die nicht zurückgekehrt waren von ihren Fahrten, damit die verlorenen Seelen sich um diesen Orientierungspunkt herum versammeln konnten. Direkt dahinter mündete der Rio Casares in den Pazifik, ein munteres Flüsschen in felsigem Bett. An Waschtagen standen die Frauen des Dorfes dort bis zur Hüfte im Wasser und im Seifenschaum.
Am nächsten Morgen deutete nichts auf die nächtlichen Ereignisse hin. Die Schildkröten hatten keine Spuren hinterlassen. Paul schaute den Fischern zu, die ihre Boote über den Strand zogen, um noch vor Sonnenaufgang hinauszufahren aufs Meer, das in rötlichen Streifen aufleuchtete.
So weit weg diese Nacht auch war – ob in Kilometern oder in Monaten gerechnet –, blieb sie in ihm lebendig. Er trug sie mit sich herum, die Sterne, das Meer, die Schildkröten, auch jetzt, wo er versuchte zu verstehen, was sich direkt vor ihm unter dem trüben Berliner Novemberhimmel ereignete.
Normalerweise huschten nur ein paar Rentner über die Oberbaumbrücke, denen anzusehen war, wie unwohl sie sich im Visier der Grenzsoldaten fühlten. Die Backsteinzinnen mit den traurigen, von Birken bewachsenen Turmstümpfen, der vermauerte Arkadengang, der hässliche viereckige Wachturm und die Panzersperren in der Mitte der Fahrbahn wirkten wie eine Kriegskulisse, ein Minenfeld, und Paul stellte sich gerne vor, wie es früher gewesen sein musste, mit der U-Bahn oben drüberzufahren und flussaufwärts zu schauen, wo in der Ferne die Schlote eines Kraftwerks qualmten. Er konnte ja nicht ahnen, dass das in ein paar Jahren wieder möglich sein würde. Die Gleise waren mit Stacheldraht und durch ein rostiges Metalltor verrammelt, das ihn an den Eingang zu einem Schrottplatz erinnerte. Am anderen Ufer wurde die Brücke durch das quer über die Straße geklotzte Grenzkontrollgebäude abgeriegelt, ein flacher Plattenbau, der im gelben Neonlicht der Peitschenleuchten zu zerfließen schien.
Exakt zwei Jahre zuvor, im November 1987, war er aus Nicaragua zurückgekehrt. Dort, auf dem Aeropuerto Augusto César Sandino, hatte er sich von allem, was ihm lieb geworden war, verabschiedet. Die Frauen herzten und drückten ihn der Reihe nach, während die Kinder zwischen ihnen herumsprangen, und sie wurden nicht fertig damit, ihn abzuküssen und zu umarmen, obwohl der Flug nach Havanna schon ausgerufen worden war. Paloma hockte still daneben auf ihrem Schwanz, hechelte mit seitwärts aus dem Maul hängender Zunge und blickte in stummem Schmerz zu ihm auf. Pablo, wie Paul dort hieß, kraulte sie hinter den Ohren. Ein ums andere Mal, während er so gebückt neben der Hündin stand, wurde er gefragt, wann er wiederkomme, und jedes Mal sagte er in seinem holprigen Spanisch: »El año que viene, definitivamente«, so sicher war er sich, nach allem, was geschehen war. Er konnte nur hoffen, dass nicht alles vergeblich gewesen sein würde und dass die Kooperative im neuen Gebäude gerüstet wäre für die Zukunft.
Er hatte sogar darüber nachgedacht, das Studium aufzugeben und in Managua zu bleiben, weil er weder Amanda noch Hartmut und am allerwenigsten Sigrid im Stich lassen wollte, der sie aber nicht helfen konnten. Sie hatten das Mögliche getan. Doch die Hoffnung war schwächer geworden mit jedem Tag, an dem sie nichts von ihr hörten, so dass die zersetzende, quälende Ungewissheit allmählich in eine noch schrecklichere Gewissheit überging. Wenn Sigrid noch am Leben wäre, hätte sie längst ein Zeichen gegeben. Irgendwie hätte sie das geschafft. Ein Mensch kann doch nicht einfach spurlos verschwinden.
Inzwischen war das nächste Jahr vorbeigegangen, 1989 war auch schon fast um, und er lebte in diesem eingemauerten Berlin wie ein Zombie vor sich hin. Die Tage reihten sich aneinander, ohne dass er ihnen viel Interesse entgegenbrachte. Er schöpfte aus den Farben und Gerüchen seiner Erinnerungen, aus den Bildern, die in ihm lauerten und so plötzlich wie wilde Tiere im Dschungel hervorbrachen. Das Getümmel auf dem Markt von Masaya. Das Gelb der wimmelnden Küken in einem flachen, runden Korb und daneben das versonnen lächelnde, in sich versunkene Mädchen. Das fette Grün der zu einem Haufen aufgeschichteten Melonen. Die roten Basecaps der Nicas. Die allgegenwärtige rot-schwarze Fahne. Die dämmerige Seilmacherwerkstatt voll altertümlicher hölzerner Gerätschaften, Schwungräder und Kurbeln. Der aufdringlich süße Duft exotischer Früchte an Yolandas Saftbude. Die Marimbaspieler mit den sehr blauen Papageien auf Schultern und Köpfen. Der Geruch von nassem Staub nach dem Abendregenguss. Der Schwefelqualm aus dem Vulkankrater – eine Straße führte dort hinauf und bis an den Rand des Höllenlochs, in das er mit Sigrid und Hartmut hinabgeschaut hatte – und dann der weite Blick über die Kette der schwarzvioletten Bergkegel.
Doch auch die Schuldgefühle blieben und raubten ihm alle Energie, so dass er die Entscheidung einer baldigen Rückkehr immer weiter vor sich herschob. Seine Solidarität verlor unmerklich an Kraft, und auch der Briefwechsel mit Amanda und ihren Söhnen, die ihm Wunschzettel schickten – Schuhe, Stifte, Hefte, Musikkassetten, por favor! –, schlief in dem Maße ein, in dem seine Spanischkenntnisse einrosteten. Dabei hatte es sich doch um ein wirkliches Liebesverhältnis gehandelt, eine Liebe zur spanischen Sprache und zu Land und Leuten, für die Paul in die Ferne hatte reisen müssen, um sie zu erleben, da sie zu Hause, der eigenen Gesellschaft und deutschen Landschaften gegenüber, vollkommen ausgeschlossen war. Vielleicht liebt man ja überhaupt weniger die Menschen als die Landschaften, oder Menschen in ihrer jeweiligen Landschaft, ohne das eine vom anderen unterscheiden zu können. Zu lieben ist in der Ferne nun mal leichter als zu Hause.
Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker, lautete der Wahlspruch der Brigade, und tatsächlich war das mehr als nur ein Spruch von Che Guevara, denn genau so hatte Paul die Arbeit und den Aufenthalt empfunden, ohne je darüber nachzudenken, dass dann ja auch er selbst und die ganze Brigade im Rahmen dieser Völkerzärtlichkeit als Volksteil zu betrachten wären und nicht bloß als eine zusammengewürfelte Truppe, die sich jenseits alles Volkhaften verstand. Dabei waren sie selbstverständlich los alemanes, die Westdeutschen, genauer gesagt, aus Alemania Federal beziehungsweise Westberlin. Sie waren es nicht nur für die Nicas, sondern auch für die Brigadisten aus den USA, Frankreich oder Italien, denen sie hier und da begegneten. Streng genommen war Pablo deutscher, als Paul es sich je vorstellen konnte.
Das Wort »Mauerfall« gab es noch nicht, und es wäre auch gewiss nicht das richtige Wort gewesen, um das, was sich vor ihm abspielte, zu beschreiben. Die Mauer stand fest wie immer, da fiel niemand runter und nichts fiel um. Doch auf der Brücke tat sich was. Da waren Leute. Einzelne zunächst, dann immer mehr. Sie erschienen in dem nachtschwarzen Durchlass zwischen Mauer und Brückengeländer wie in der Luke einer soeben gelandeten Raumfähre.
Gibt’s doch gar nicht, dachte Paul.
Er hatte noch keine Ahnung von der historischen Bedeutung des Augenblicks. Woher auch. Geschichte ist ja immer erst dann Geschichte, wenn alles vorbei ist. Aber wann ist schon alles vorbei?
Die Frauen hatten es sich nicht nehmen lassen, zum Flughafen mitzukommen. Die Camioneta war vollbeladen, alle saßen hinten auf der Pritsche, noch verkatert von der Fiesta am Abend zuvor, die stattgefunden hatte wie alle paar Wochen, wenn Brigadisten verabschiedet wurden, ganz so, als ob nichts passiert wäre. Was hätten sie auch tun sollen. Eine übriggebliebene Flasche Flor de Caña zirkulierte, Paul schmerzten die Beine, weil er so viel getanzt hatte, mindestens ein Mal mit jeder, vor allem aber mit Meira, die ihn mit rhythmischen Beckenstößen auf offenem Parkett in Verlegenheit brachte und die ihm die schwarz-rot gestreifte Stoffhose genäht hatte, die er zum Abschiedsfest und von da an so lange trug, bis sie Monate später in Berlin, brüchig geworden, entlang der Naht aufriss. Dann mit der schönen María, mit Rosario López und natürlich mit Amanda, die ihm die liebste von allen geworden war, seit sie ihn in ihre Familie aufgenommen hatte.
Kaum war ein Tanz zu Ende, wurde er gleich wieder aufgefordert. Das hatte etwas Verzweiflungsvolles. Sie stürzten sich ins Feiern, weil es weitergehen musste. Sie feierten gegen das Geschehene an, bekämpften ihr Entsetzen mit Freude. Sein Hemd war nassgeschwitzt, aber das machte ihm nichts aus, es war heiß, alle schwitzten, Schwitzen gehörte dazu, man griff in Feuchtigkeit und glitschige Haut, die Haare tropften, es spritzte bei jeder Bewegung. Paul war so aufgekratzt, dass er seine Angst und seine Bedrücktheit und all seine Befürchtungen vergaß. Niemand wollte darüber sprechen. Sie feierten das Leben, diesen Augenblick. Víctor warf Uniformjacke und Mütze ab, wackelte mit den Hüften und rief: »Patria libre!« Hartmut, der mit Lijia tanzte und sich, während sie vor ihm Pirouetten drehte, mit beiden Handflächen den Schweiß aus den Stoppelhaaren strich, lachte laut auf: »Sie hat ›Qué rico!‹ gesagt. Tritt mir auf den Fuß und sagt: Wie köstlich!«
Hartmut hatte dann auch eine kleine Ansprache gehalten, ihnen gedankt für ihre Arbeit, vor allem aber den Frauen für ihre Gastfreundschaft. »Wir denken an Sigrid«, hatte er mit leiser Stimme hinzugefügt, »sie gehört zu uns, und wir werden alles tun, sie zu finden«, worauf die Frauen in ein beschwörendes Murmeln verfallen waren. Aus ihrer Unglückserfahrenheit heraus wussten sie, mit der Ungewissheit zu leben, ohne sich dadurch die Stimmung verderben zu lassen.
»Du hättest es verhindern können«, hatte Paul da zu Hartmut gesagt. »Du hast uns immer weitermachen lassen, obwohl du überhaupt nicht mehr an die Sache glaubst.«
»Was denn sonst«, hatte Hartmut erwidert. »Gibt’s eine Alternative? Verloren hast du dann, wenn du aufhörst. Und außerdem sind wir nicht in der Kirche.«
»Aber du hättest Sigrid aufhalten können. Du hättest das gekonnt. Auf dich hätte sie gehört, wenn du ihr klargemacht hättest, dass sie für uns unverzichtbar ist.«
»Das wusste sie doch eh. Ich bin nicht ihr Vormund. Jeder muss selber wissen, was er tut und lässt.«
»Aber wenn du gar nicht mehr an die Revolution glaubst?«
»Das entscheidet sich nicht im Glauben, sondern im Handeln.«
»Dann hättest du sie nicht gehen lassen dürfen.«
»Ihre Sache.«
Die Nähmaschinen hatten sie beiseitegeschoben, so war die Werkstatt zur Tanzfläche geworden. Das Banner mit der Parole Aquí no se rinde nadie und dem Namen der Kooperative Magdalena Herrera de Gutiérrez prangte wie immer an der hinteren Wand. Das Bildnis der Namensgeberin, das zwischen gerahmten Fotos von Staatspräsident Daniel Ortega in Uniform und einem Paul nicht bekannten bärtigen Comandante hing, zeigte ein fromm aussehendes junges Mädchen mit weißem Haarband und geblümter Bluse, kaum zu glauben, dass diese brave Studentin, zweiundzwanzig Jahre alt, als Kämpferin der FSLN in einem Gefecht mit Somozas Truppen getötet worden war. Zur FSLN war sie gestoßen, nachdem einer ihrer Brüder nach der Verhaftung verschwunden blieb und befürchtet werden musste, dass er, wie es den Gepflogenheiten des Diktators im Umgang mit Oppositionellen entsprach, erschossen und seine Leiche in den Krater des Vulkans von Masaya geworfen worden war. Allerdings erzählten die Frauen verschiedene Geschichten über sie. Eine handelte von Magdalenas Liebe zu dem Guerillero Germán Gutiérrez, mit dem sie in die Wälder gegangen und dort, wegen eines Verräters in den eigenen Reihen, ums Leben gekommen sei. In einer anderen war die gute Magdalena keine Studentin, sondern Näherin gewesen und verwandelte sich mit ihrem Tod in eine Art Schutzheilige ihrer Zunft.
Paul tanzte bis zur Erschöpfung. Víctor taumelte und hielt sich an ihm fest, indem er ihm den Arm um die Schulter legte. Das T-Shirt mit dem aufgenähten Policía-Emblem klebte ihm am Leib. Männerfreundschaften wachsen mit dem Alkoholpegel, obwohl Paul gegenüber Víctor immer ein wenig misstrauisch blieb. Amanda hatte ihm erzählt, Víctor sei früher einmal bei der Guardia gewesen, habe aber rechtzeitig vor der Revolution die Uniform gewechselt, ein Wolf im Schafspelz, er solle sich also vor ihm hüten.
Die Frauen tranken Flor de Caña aus Blechbechern und sangen gemeinsam, mit trotzig erhobener Faust, die Hymne der FSLN: Adelante marchemos compañeros, avancemos a la revolución! Paul sang aus voller Kehle mit und war für Momente so siegesgewiss, wie er das nie für möglich gehalten hätte nach allem, was geschehen war. Als Pablo gehörte er dazu, selbst seine Ängste waren Teil des Ganzen, es gab ein Ziel, Bewegung, Kraft, Gemeinschaft, aber eben auch das Risiko und die Gefahr. Alles war richtig, auch wenn es schiefging. Dass er in der folgenden Zeile sueño statt dueño sang – nuestro pueblo es el sueño de su historia – und damit das Volk vom Besitzer – dueño – zum Traum – sueño – der eigenen Geschichte machte, fiel niemandem auf. Er hatte das immer falsch verstanden und liebte die Hymne der Sandinisten gerade deshalb, weil sie ihn an Goyas berühmte Radierung El sueño de la razón produce monstruos erinnerte und damit an den Streit, ob sueño mit Traum oder mit Schlaf zu übersetzen wäre.
Darüber dachte er jetzt wieder einmal nach, am Rande der Oberbaumbrücke und inmitten des anschwellenden Getümmels, wo die Freudenschreie und das Gejohle immer lauter wurden, denn es ist doch ein fundamentaler Unterschied, ob die Monster den Schlaf der Vernunft nutzen, um ihr Unwesen zu treiben, oder ob es die Vernunft selbst ist, die ihre Monster träumend gebiert, ob also die Abwesenheit der Vernunft Grund allen Übels ist oder ganz im Gegenteil ihre träumerische Produktivität. Es ist der Unterschied zwischen Aufklärung und Surrealismus, der im Spanischen in einem Wort steckt, so dass beides in eins zusammenfällt, und wenn die Sandinisten das so verstanden hätten, wie Paul irrtümlich meinte, dann hätten sie damit auch den Zweifel an sich selbst ins revolutionäre Programm integriert und die Revolution als eine Art monströsen Schlaftraum begriffen. Dann wären sie eine surrealistische Avantgarde und das Politische ein Phantasma des Unbewussten. Aber so war es eben nicht. Der Sturz eines Diktators ist keine Kunstaktion, und der Krieg gegen die Contras, der auch jetzt, im November 1989, noch nicht wirklich beendet war, ist es ebenso wenig.
Doch vielleicht lag genau darin der Fehler. Vielleicht ist es weder der Schlaf noch der Traum, der die Monster gebiert, sondern die Schlaflosigkeit, die Nervosität, der Argwohn, die Überreiztheit. Wie sonst würde es zu erklären sein, dass Daniel Ortega sich im Lauf der Jahrzehnte vom Revolutionär im Präsidentenamt in einen feisten, kleinen Diktator verwandeln würde, der all das verkörpert, was die Sandinisten einst zu bekämpfen angetreten waren, als müsse ein Naturgesetz vollstreckt werden, das festschreibt, dass einer die frei gewordene Stelle besetzt, die ein gestürzter Tyrann hinterlässt, und, indem er diese Leerstelle füllt, dann allmählich dessen Gestalt annimmt und sich selbst in so ein uniformiertes Monster verwandelt, wie es die Schlaflosigkeit hervorbringt. Wenn es stimmt, was Marx behauptet hat, dass alle geschichtlichen Tatsachen und Personen sich zweimal ereignen, zuerst als Tragödie und dann, in der Wiederholung, als Farce, dann wäre Somoza die Tragödie und Ortega die Farce. Wer an der Macht ist, ist irgendwann nur noch an der Macht, um die Macht zu verteidigen. Dann darf er keinen Moment in erholsamen Schlaf sinken, weil er von Verrätern umzingelt ist. Das Volk jedoch, von dem Paul so begeistert sang, träumte seine eigenen Träume. Aber es waren eben nur Träume, weil niemand auf der Welt die Geschichte – noch nicht einmal die eigene – besitzen kann. So lag Paul mit seiner unwillkürlichen Korrektur der Hymne näher an der Wahrheit, als er ahnte.
Am Morgen, als sie den Abschiedskaffee in der Küche tranken, schrieb Amanda Briefe, die Paul nach Deutschland mitnehmen sollte. Luis tanzte freudestrahlend mit Pauls Rucksack um sie herum. Paul wollte alles hierlassen bis auf das Wenige, was er am Leib trug, und die dicke Jacke, die er brauchen würde, wenn er in Schönefeld aus der Maschine der Aeroflot steigen und im nieselgrauen Berliner November ankommen würde. Mitnehmen wollte er nur einen Packen Hemden und die Hose aus der Kooperative als neue Haut für die Heimat, sichtbares Zeichen seiner Zugehörigkeit und dafür, dass er die alte abgestreift hatte. Außerdem den Pflasterstein, Sigrids Pflasterstein, den er für sie aufzubewahren versprochen hatte, auch wenn er wohl der erste Passagier mit einem Pflasterstein im Gepäck sein würde. Luis machte aus dem Rucksack seine Schultasche, packte sie auch gleich mit seinen Sachen voll und wäre am liebsten sofort losgezogen, obwohl es an diesem Tag keine Schule gab. Er war zehn Jahre alt, der mittlere von drei Brüdern. Den ältesten hatte Paul nie kennengelernt, weil er eingezogen worden war und irgendwo im Norden, in der Gegend von Estelí, gegen die Contras kämpfte.
Um sich zu revanchieren, brachte Luis die kostbarsten Dinge, die er besaß, und machte sie Paul zum Geschenk. Zuerst nahm er das Medaillon ab, das er an einer Schnur um den Hals trug, und legte es Paul um. Es zeigte einen bärtigen Kirchenheiligen mit langem Stock und Jesuskind auf dem Arm. »San Cristóbal«, sagte er. Paul trug das Medaillon aus abgegriffenem, rauem Kunststoff seither immer, nur die mürbe Schnur hatte er durch einen Lederriemen ersetzt. Zudem überreichte Luis ihm ein Passfoto und dazu sein FSLN-Halstuch, und schließlich legte er noch seine Klick-Klack-Kugeln auf das Tuch, was Paul total aus der Fassung brachte, denn diese an den Enden einer kurzen Wäscheleine befestigten Plastikkugeln hatte Luis ebenso wie sein jüngerer Bruder David eigentlich immer zur Hand, so wie alle Kinder in Managua ständig mit diesen Klackerkugeln herumliefen, die auf Spanisch Tiki-Taka hießen und die einen ohrenbetäubenden, die Stadt systematisch durchlöchernden Lärm erzeugten. MG-Salven aus Kinderhand. In Deutschland waren sie auch einmal Mode gewesen, aber das war schon eine Weile her, und wenn Paul sich daran versuchte, schlugen ihm die Kugeln schmerzhaft auf die Finger.
Die Ersten am Mauerdurchlass bewegten sich wie in Zeitlupe. Vorsichtig, tastend traten sie heraus, als prüften sie den Boden eines unbekannten Planeten auf seine Festigkeit hin und fürchteten, darin zu versinken. Behutsam machten sie ihre ersten Schritte auf fremdem Terrain, das, so kam es Paul vor, eine andere Konsistenz besitzen musste als ihre gewohnte Umgebung. Sie wechselten nicht bloß das politische System, sondern die geologische Struktur oder die physikalische Beschaffenheit. Vielleicht war die Erdanziehungskraft im Westen stärker oder die Dichte der Luft. Oder die Zeit lief in einem anderen Tempo, so dass die Bewegungen gedehnt und fast bis zum Stillstand verlangsamt wurden. Doch mit der nachdrängenden, von hinten schiebenden Menge beschleunigte sich der Vorgang, und bald sah es so aus, als würden die Neuankömmlinge magnetisch angezogen wie Eisenspäne, die aneinander festklebten, und in einer einzigen machtvollen Bewegung schnellten sie vorwärts, einem Ziel entgegen, das sie doch eigentlich bereits erreicht hatten. Sie waren da. Sie hatten es tatsächlich geschafft. Es war wahr. Doch jetzt wurden Rufe laut: »Zum Ku’damm, zum Kurfürstendamm!«, und schon gab es ein neues Ziel, dem vermuteten Glanz, dem lange entbehrten Reichtum entgegen.
Weltenwechsel erhöht die Schwerkraft, dachte Paul. Also eher Mars- als Mondlandung. Dann wären alle, die wie er in erregter Erwartung am Kreuzberger Straßenrand standen, um die »Brüder und Schwestern aus dem Osten« willkommen zu heißen, Marsmännchen. Mars macht mobil! Und tatsächlich warfen die Kreuzberger den Ostlern, die jetzt als kompakte Masse aus der schmalen Öffnung des Grenzübergangs quollen, Schokoriegel und Schultheiß-Dosen zu, als gäbe es da drüben nichts Süßes und kein Bier. Die Dose war das Erkennungszeichen der westlichen Hemisphäre, wo den Grenzgängern eine Wüstenwanderung bevorzustehen schien, die sofortige Flüssigkeitszufuhr plus Energiespende erforderte. Wie geblendet taumelten sie ins Licht, Schlafwandler, die Arme schützend erhoben, als hätte schon jemand Scheinwerfer aufgebaut, um den Moment für die Geschichtsbücher auszuleuchten. Aber es war dunkel, da war niemand außer den nun ebenfalls zahlreicher werdenden Anwohnern aus SO 36, die vermutlich genau wie Paul in einer Sondersendung der Abendschau den Regierenden Walter Momper und seinen Amtsvorgänger Eberhard Diepgen gesehen hatten, wie sie in trauter Eintracht und tiefer Ergriffenheit und ganz atemlos die Tragweite der Ereignisse einzuschätzen versuchten.
Paul hatte überhaupt nicht verstanden, worum es ging, und erst allmählich aus Mompers Gestammel herausgehört, dass die Grenzübergänge geöffnet werden sollten oder schon geöffnet worden waren. Das gibt’s doch gar nicht, hatte er da zum ersten Mal an diesem Abend gedacht, unmöglich, unfassbar, und weil das so ganz und gar jenseits seiner und nicht nur seiner, sondern jeglicher Vorstellungskraft lag, hatte er die Lederjacke über sein Nica-Hemd mit dem aufgestickten rot-schwarzen Banner gezogen, von denen er zehn Stück aus Managua mitgebracht hatte, so dass er diese Hemden aus dickem weißem Leinen im Wechsel und also eigentlich immer tragen konnte, und war hierhergekommen, kurz bevor die ersten Wagemutigen über die Oberbaumbrücke vorrückten, dem Ort ihrer Sehnsucht entgegen, um tatsächlich und genau so, wie es dann später in den Geschichtsbüchern stehen würde, »Wahnsinn! Wahnsinn!« auszurufen. Paul hörte sogar vereinzelte »Freiheit! Freiheit!«-Rufe und fragte sich, ob das ernst gemeint sein konnte, auch wenn dies sicher nicht als Stunde der Ironie zu betrachten war. Oder sollten die Bierdosenwürfe womöglich ironisch gemeint sein? Ein bärtiger Mann trat auf ihn zu, umarmte ihn umstandslos und reichte ihn weiter an die Frau an seiner Seite, die ihn drückte und ihm ins Gesicht schrie: »Ich fass es nicht! Ich fass es nicht!« Offenbar musste man in dieser Nacht alles zweimal sagen, einmal nach hinten und einmal nach vorne, zuerst für sich und dann für die Ewigkeit, so wie man sich zwickt, um den Wirklichkeitsgehalt eines Traums zu prüfen.
Eigentlich hatte er nur sechs Wochen in Nicaragua bleiben wollen, dann aber den Aufenthalt immer wieder verlängert, bis sechs Monate daraus geworden waren, doch erst als die Abreise unmittelbar bevorstand, auf dem Flughafen, als die Frauen ihn der Reihe nach umarmten, wurde ihm klar, dass er nicht mehr wegwollte und dass es eine Art Fahnenflucht war, in dieser Situation zu gehen. Doch da schoben sie ihn schon durch die Sperre, er solle sich beeilen, Paloma winselte, stupste ihn zum Abschied mit ihrer feuchten Schnauze an und sah ihm hinterher, sie roch nach ranziger Ziegenmilch, und auch diesen süßen, käsigen Gestank vermisste Paul schon, als er heulend zum Gate lief. Er konnte es nicht fassen, dass es nun vorbei war. So viel Zuneigung hatte er erfahren, und doch könnte er niemals wirklich diesen Menschen und ihrer Welt angehören. Er weinte um die Liebe, die er empfunden hatte, um das Leben, das so schnell verging, um die Toten und Vermissten und um Paloma, die er hinter sich bellen hörte, er weinte um die Vergänglichkeit der Dinge und der Hoffnungen und um die Vergeblichkeit allen Tuns, er weinte, weil er nirgendwo zu Hause und auch hier nur ein Gast gewesen war, es beutelte ihn, weil er nichts begriff, weil er blind und taub und stumm geblieben war, wie immer im Leben, er weinte um seine Feigheit und darum, dass sich nichts mehr ändern ließ, wenn es erst einmal geschehen war. Was hätte er darum gegeben, noch einmal ankommen zu dürfen und die Zeit noch einmal von vorne zu durchleben, besser, intensiver, wahrhaftiger, wirkungsvoller, doch er war nicht mehr der, als der er vor einem halben Jahr gekommen war, er hatte sich verändert, und die Zeit ließ sich nicht zurückdrehen.
Was ihm widerfuhr, verstand er immer erst im Nachhinein und also immer zu spät. Dass Schule mehr ist als ein Ort, an dem man Freunde trifft, hatte er erst begriffen, als die Schulzeit vorbei war. Dass er Philosophie studierte, beruhte eher auf einem Gefühl als auf guten Gründen, hatte mit Plan und Perspektive nichts zu tun, und jetzt war das Studium auch schon fast wieder vorbei, jedenfalls wäre es an der Zeit, irgendwann einmal einen Abschluss zu machen. Er hatte mit Platon angefangen, weil er dachte, man beginnt am besten am Anfang und arbeitet sich dann im Schnelldurchlauf bis in die Gegenwart vor, hatte es aber nie bis zu Aristoteles geschafft, sich stattdessen in Marx verloren, denn die obligate Einführung ins Kapital bei Wolfgang Fritz Haug, der zugehörige Lektürekurs und Haugs Vorlesung zur Warenästhetik waren die nie wieder erreichten Höhepunkte seines Studiums, weil sich daraus die ganz konkrete Frage des persönlichen Engagements ergab, die ihn dann schließlich bis nach Nicaragua brachte.
Bei Haug lasen sie auch Schriften von Gorbatschow, auf den ihr Lehrer große Hoffnungen setzte. Vielleicht würde sich der leninistische Staatssozialismus doch erneuern und aus der ideologischen Erstarrung des Machtapparats lösen lassen. Glasnost und Perestroika waren in aller Munde, Zauberworte, Weltveränderungsbeschwörungen. Gorbatschows Reformbemühungen passten zu Haugs Konzept eines pluralen Marxismus, so dass das, was dort in der Sowjetunion geschah, ihnen als aussichtsreicher Aufbruch und nicht als Abbrucharbeit erschien. Vielleicht ließen sich – bei »Strafe des Untergangs«, wie Haug gerne sagte – Sozialismus und Demokratie ja doch vereinen, waren Organisation und Subjektivität kein Widerspruch, sondern ineinander verzahnte Prinzipien, und vielleicht würde marxistische Kritik zu einem Instrument werden, das nicht nur auf Ideologie und kapitalistische Wirklichkeit, sondern auch auf den Marxismus selbst anwendbar wäre. Das leuchtete Paul ein, der in Gorbatschow einen Macher sah, der die Geschichte nach seinen Vorstellungen veränderte, einen Überblicker, der wusste, an welchen Schräubchen es zu drehen galt, und nicht einen einsamen Mann auf verlorenem Posten, der zu retten versuchte, was nicht mehr zu retten war. Seinen berühmtesten Satz »Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben« hatte Gorbatschow damals noch nicht ausgesprochen. Genau genommen würde er diesen Satz auch niemals aussprechen, weil es sein Pressesprecher war, der ihn formulierte. Aber was änderte das schon. Der Satz war zu schön und passte zu gut ins Bild, um ihn Gorbatschow nicht in den Mund zu legen. Ahnte er, dass er mit seinem Neuen Denken selbst zu spät kam, dass es längst zu spät war und alle Bemühungen vergeblich sein würden?
Alle, die sich um Haug sammelten, hatten auch die frischen Bilder des zerstörten Reaktors in der Ukraine vor Augen, dieses katastrophale Trümmerfeld, das im Unterschied zu den radioaktiven Teilchen, die auf Europa herunterregneten, sichtbar war und eine eigene Symbolkraft entwickelte: Tschernobyl stand für das Scheitern des Sozialismus, der genauso explodieren würde wie das Atomkraftwerk an diesem fernen Ort, von dem Paul zuvor nie etwas gehört hatte. Sogar die Ukraine musste er im Atlas nachschlagen, um sich eine Vorstellung von ihrer Größe und genauen geographischen Lage zu machen. Sie lachten zwar über die Kalten Krieger und die Atomlobbyisten, die erklärten, so etwas könne im Westen niemals geschehen, das sei nur in der technisch rückständigen sozialistischen Ökonomie möglich. »Und was ist mit Harrisburg? Mit Sellafield?«, fragten sie dann. Doch das Wort »marode«, das im Zusammenhang mit den sozialistischen Ländern eine erstaunliche Konjunktur in den Medien erlebte, erhielt durch die Explosion in der Ukraine ein unauslöschliches Bild. Paul trank monatelang keine Milch, aß keinen Salat und schon gar keine Pilze aus Polen oder Weißrussland. Die Pfifferlinge verfaulten in ihren Körbchen in den Supermarktregalen.
Während er damals, im Haug-Kreis, darüber nachzudenken begann, ob auch er sich womöglich als Sozialist verstehe, war es mit dem Sozialismus tatsächlich schon fast vorbei. Auch mit der Liebe war es meistens so gewesen, dass Paul erst nach der Trennung darüber nachdachte, worum es hätte gehen können, aber er war sowieso immer bei den falschen Frauen gelandet. Die, die er begehrte, interessierten sich nicht für ihn und erschienen ihm vollkommen unerreichbar in ihrer Schönheit, und die, von denen er sich verführen ließ, waren solche, auf die er von sich aus nie verfallen wäre. Und wenn es sich dann doch einmal fügte, wie einst mit der wirklich sehr geliebten Esther aus dem Biologie-Leistungskurs, endete das, was er für eine lebenslange Zukunft gehalten hatte, nach einigen rauschhaften Monaten und allerersten Liebesnächten ziemlich abrupt damit, dass sie, die seine Freunde »die blonde Bombe« nannten, ihm am Lippstädter Bernhardbrunnen, nachdem sie seine Umarmung starr wie die einsame Brunnenfigur da oben auf ihrer Säule erduldet hatte, in knappen Worten mitteilte, einen anderen kennengelernt zu haben. Er blieb übrig, er blieb zurück. Das war das Muster, das sich seither beständig wiederholte.
Er wusste, dass er kein Draufgänger war. Er lebte mit der schmerzlichen Gewissheit, mit allem zu spät zu kommen, vor allem aber mit dem Begreifen. So viel hatte er immerhin begriffen. Im Lauf seiner dreiundzwanzig Lebensjahre war ihm klar geworden, dass das Verstehen ein unendlicher, immer erst im Nachhinein einsetzender Prozess ist, mit dem er niemals fertig werden würde. Das war nicht sein Problem, es war ein Problem der Zeit. Erleben und Denken fielen auseinander, dagegen war nichts zu machen. Je intensiver er sich mit einem Erlebnis beschäftigte, desto entschiedener entzog es sich ihm, veränderte sich in der Betrachtung, fächerte sich auf in unterschiedlichste Bedeutungsmöglichkeiten, wurde zu etwas ganz anderem als dem erlebten Augenblick, so dass er manchmal das Gefühl hatte, ausgerechnet die Dinge am besten zu erfassen, die er sofort wieder vergaß, ja die vielleicht gar nicht in sein Bewusstsein gerieten, sondern sich unerkannt am Boden ablagerten wie Sandkörner.
Geschichte stellte er sich wie eine riesige Sanduhr vor, bei der das Material, das im oberen Glaskolben als Zukunft bereitliegt, durch den engen Schlund der Gegenwart fällt, um sich unten als Vergangenes anzuhäufen. Zeit vergeht nicht, sie sammelt sich an. Wenn er diesen Vorgang zu erfassen suchte – in der Sauna am Hermannplatz zumeist, denn er liebte es, dort in der Hitze zu schwitzen –, kam ihm das Rieseln und Rinnen wie ein Stillstand vor, so unmerklich vollzog es sich. Fünfzehn Minuten konnten sich in eine Ewigkeit verwandeln. Dabei bedeutete es für jedes einzelne Sandkorn einen jähen Sturz in den reißenden Abgrund der Zeit, um unten, im neuen Zusammenhang einer veränderten Ordnung, gleich zur Ruhe zu kommen, bis das Geschehen von vorne begann, wenn der nächste Saunagast das Glas umdrehte und damit das eben Vergangene wieder in Zukunft verwandelte. Geschichte war ein andauernder Umschichtungsprozess, ohne dass dabei auch nur ein einziges Sandkorn verloren ging oder hinzugefügt wurde.
Eine revolutionäre Situation zeichnet sich durch das Bewusstsein und den Willen der Akteure aus, das Kontinuum der Geschichte aufzusprengen, hatte Paul bei Walter Benjamin gelesen. Revolutionäre müssen das Stundenglas zerbrechen! Die Gegenwart lässt sich nicht festhalten. Sie ist nichts als der Umschlagpunkt, eine Passage, ein Zwischenraum. Das wissen Revolutionäre am besten, die sich von dem, was war, abstoßen, um mit einem großen Tigersprung in einer besseren Zukunft zu landen, während die Gegenwart ein flüchtiges Provisorium ist, das möglichst schnell überwunden werden muss. Sie leben immer im Transit, historisch gesehen.
Die Menschen, die nacheinander in einer endlosen Reihe aus der Maueröffnung strömten, waren selbst solche Sandkörner, die aus der Vergangenheit in die Zukunft stolperten oder auch umgekehrt, aus einer Zeit in die andere, und die nicht wussten, wohin es sie verschlug. Paul hatte keine Ahnung, dass auch er selbst in diesem Moment aus den gewohnten Zusammenhängen herausgeschleudert wurde, weil die Welt sich veränderte. Er war nicht der unbeteiligte Zuschauer, der er zu sein glaubte, weil es keine unbeteiligten Zuschauer gibt, wenn das ganze System in Bewegung gerät. Dabei hatte er sich sein Leben lang als bloßer Beobachter gefühlt. Seine Erfahrung sagte ihm, dass es auf ihn nicht ankam, weil er gar nicht bemerkt wurde. Er war immer bloß dabei, irgendwie.
Das war sogar in Nicaragua so gewesen, anfangs jedenfalls, als sie vom Flughafen über die Carretera Norte und einmal quer durch Managua fuhren und er zum ersten Mal diesen Berghang sah, auf dem die riesigen weißen Lettern FSLN prangten. Efe, Ese, Ele, Ene. Frente Sandinista de Liberación Nacional.
»Das mit der Schrift auf dem Berg haben die Sandinisten in Hollywood geklaut«, sagte Hartmut.
»Also ist das hier auch eine Traumfabrik?«, fragte Paul.
»Na ja«, sagte Hartmut. »Más o menos. Ein mühsamer Traum. Un sueño fatigoso. Revolution ist kein Kino, sondern Alltag. Das spürst du bei jedem Handgriff. Aber wenn du Illusionen hast, fällt dir die Arbeit leichter. Veränderung ist machbar, Herr Nachbar. Die Sandinisten beweisen es jeden Tag. Diktator gestürzt. Neue Wirtschaftsordnung. Alphabetisierungskampagne. Gesundheitsoffensive. Das ist mehr als ein Traum. Entiendes?«
Auf einer Brache vor dem FSLN-Berg mühte sich ein kleiner Junge mit einer rostigen, viel zu großen Schubkarre ab, ohne dass zu erkennen gewesen wäre, welches Ziel er ansteuerte.
»Was macht er da?«, fragte Paul. »Die Schubkarre ist doch leer!«
»Das ist Teil der Inszenierung«, kicherte Hartmut. »Sie heißt: die Überwindung der Vergeblichkeit. Oder: Aufbruch in die Zukunft.«
Hartmut hatte Paul und die anderen Neuen am Flughafen abgeholt. Er saß am Steuer eines klapprigen VW-Pritschenwagens, dessen Motor dröhnte und stotterte. Er trug Dreitagebart, Stoppelfrisur und eine verspiegelte Pilotenbrille und kaute Sonnenblumenkerne, deren Schalen er während der Fahrt aus dem Fenster spuckte. Mit den Fingern am Lenkrad gab er sparsame Zeichen, wenn er auf nicaraguanische Besonderheiten hinweisen wollte: auf die Zeitungsverkäufer, die vor roten Ampeln zwischen den Autos auf und ab liefen und Barricada oder El Nuevo Diario ausriefen; auf die Kinder, die schreiend über die wartenden Autofahrer herfielen, mehr Schnorrer als Händler, denn die Kaugummis, Kämmchen und all der nutzlose Kleinkram, den sie feilboten, waren nur ein Vorwand, um die Hand aufzuhalten; auf die dicken Frauen mit seltsamen Rüschenschürzchen, die am Straßenrand Fruchtsäfte, vor allem aber Coca-Cola verkauften, die sie zuvor jedoch aus den Flaschen in Plastiktütchen umfüllten. Pfandflaschen waren viel zu kostbar, um sie aus der Hand zu geben. Also sah man überall Leute an zugeknoteten Tüten nuckeln, denen sie eine kleine Ecke abgebissen hatten, um sich die Flüssigkeit direkt in den Mund zu drücken. »El bolso! Das ist die hiesige cultura de la bebida!«, brüllte Hartmut gegen den röhrenden Motor an und ließ zum ersten Mal sein hämisches Meckern hören.
Hartmut spickte seine Sätze gerne mit spanischen Wörtern. Der Flugplatz war der aeropuerto, der VW-Pritschenwagen die camioneta, die Gemeinschaftsunterkunft die casa grande. Die spanischen Bezeichnungen machten aus gewöhnlichen Dingen etwas Besonderes, veredelten sie, als handle es sich um exotische Früchte. Aber auch der Sprecher selbst wurde dadurch ein anderer. Jedes spanische Wort trieb diese Verwandlung voran. Revolutionäre sprachen Spanisch. Das war Paul schon lange klar. Das galt zumindest seit dem Spanischen Bürgerkrieg, mal abgesehen davon, dass damals ja auch die Faschisten Spanisch gesprochen hatten. Und es galt für Kuba und Chile, für El Salvador und Nicaragua. Deshalb hatte Paul begonnen, Spanisch zu lernen und den Spracherwerb nicht bloß als einen Akt der Solidarität und als Vorbereitung auf seine Reise begriffen, sondern als einen ersten Schritt hinein oder vielmehr hinaus in eine andere Existenz, die es ihm erlaubte, das eigene, immer ein wenig fragwürdige und schuldbehaftete Deutschtum hinter sich zu lassen.
Paul saß neben Hartmut in der Mitte, direkt unterm Rückspiegel, an dem ein Kruzifix und ein Fidel-Castro-Püppchen baumelten. Die anderen hockten hinten auf der Pritsche beim Gepäck. Er konnte sich kaum rühren, denn rechts klebte eine Frau an ihm, auch wenn sie versuchte, das zu vermeiden, indem sie ganz an die Seite rutschte und den rechten Arm aus dem Fenster hängen ließ. Schenkel, Hüften und Schultern berührten sich. Paul tat so, als merke er das nicht. Sie trug ein blaukariertes Hemd, das sie wegen der Hitze vor dem Bauch zusammengeknotet hatte, ihr hellblondes Haar zu einem dünnen Pferdeschwanz gerafft. Durch nichts gab sie zu erkennen, dass sie Paul registrierte; sie war nach ihm ins Fahrzeug geklettert, ohne etwas zu sagen, und hatte seither geschwiegen, als hätte er sie durch seine Ankunft gekränkt. Dass sie Sigrid hieß, wusste Paul nur, weil Hartmut sie ihm beim Einsteigen vorgestellt hatte, aber auch da hatte sie nicht zu ihm hergeschaut und kein Wort gesagt.
An einer Kreuzung mussten sie anhalten, weil eine Menschenmenge die Straße blockierte. Rasch waren sie umringt von fröhlichen Demonstranten, alle lachten, klatschten in die Hände, skandierten etwas und winkten ihnen zu, zwei Männer, die sich gegenüberstanden, spielten Gitarre, ein Feuerchen flackerte auf der Straße, weiter hinten verbrannten Autoreifen zu dickem schwarzem Rauch, Fahnen wurden geschwenkt, die blau-weiß-blaue Nicaraguas und die rot-schwarze der Sandinisten, es roch nach verbranntem Gummi, nach Gegrilltem, nach Mais, nach feuchter Hitze und Staub. Paul schaute durchs Rückfenster nach hinten, um sich zu vergewissern, ob sein Rucksack noch dort lag. Rudi, der zusammen mit seiner Freundin am Flughafen in Havanna zur kleinen Reisegruppe gestoßen war, hatte es sich dort bequem gemacht und benutzte den Rucksack als Kopfstütze. Sein Palästinensertuch hatte er sich um den Kopf gewickelt.
Auch wenn Paul nicht verstand, was der Grund der Zusammenkunft war, kam es ihm so vor, als ob diese Menschen nicht gegen etwas demonstrierten, sondern für etwas. Sie versammelten sich zu ihrer eigenen Freude, bloß um sich zu spüren, um eine Gemeinschaft zu bekunden, um anwesend zu sein. Vielleicht hieß Revolution so viel wie dafür sein, und zwar von Herzen, für die Regierung, für den Friedensprozess, für die Entwicklung des Landes, für alles Kipplige und Wacklige und Prekäre, weil es nur so sein konnte und weil es zwischen Dafür und Dagegen keine Kompromisse gab. Darin bestand das Fest.
Auf dem struppigen Ödland, wo früher einmal, vor dem großen Erdbeben, das Stadtzentrum gewesen sein musste und wo jetzt Rinder weideten, standen Plakatwände mit Kinderzeichnungen und Parolen zum achten Jahrestag der Revolution: Somos un pueblo que trabaja y combate para vencer! Oder, auf einem Bild mit Sonne, Bäumchen und Kindern, ganz schlicht: Queremos vivir en paz! Hartmut kicherte wieder und sagte: »Komisch, dass die Leute hier alles ganz toll finden, was sie in der DDR ablehnen, Propaganda inklusive. Nur weil es hier bunter und wärmer ist. Sozialismus unter Palmen: super. Sozialismus im Kiefernwald: Kacke. So einfach ist das.«
Paul nickte zustimmend und lachte mit, fühlte sich jedoch ertappt, denn er war sich alles andere als sicher, ob sein Internationalismus ihn auch nach Grönland oder Sibirien oder in andere unwirtliche Weltgegenden getragen hätte. Sozialismus wollte er schon irgendwie – aber nicht den schlecht gelaunten in der DDR. Und Sonne war nun mal wirklich besser als Regenwetter.
»Wenn es dir echt um die Sache geht, pickst du dir nicht die Länder raus, die dir zusagen«, schob Hartmut hinterher. »Dann gehst du dorthin, wo du gebraucht wirst. Egal, wo. Sozialismus gibt’s nur ganz oder gar nicht. Alles andere ist Augenwischerei. Hab ich kein Verständnis für.«
Aus der Vorbereitungsgruppe wusste Paul, dass Hartmut der SEW angehörte. Das waren die Leute, die Nicaragua stur mit k schrieben, aller Völkerzärtlichkeit zum Trotz. Paul hatte sich deren Mitglieder immer als ziemliche Trottel vorgestellt, die alles, was in Moskau und Ostberlin verlautbart wurde, mit ihren Einheitspartei-Betonköpfen abnickten. Hartmut machte jedoch einen anderen Eindruck auf ihn, so lässig, wie er hinterm Steuer saß. Neben ihm kam er sich wie ein ahnungsloser Trottel vor, und das war er ja auch. Hartmut zündete sich eine Zigarette an und lehnte sich entspannt zurück, man muss halt warten, bis es weitergeht. Den Rauch blies er sorgfältig gegen die Windschutzscheibe, als wollte er sie imprägnieren.
»Gibst du mir auch eine?«
Wortlos schnippte Hartmut eine Marlboro aus der Schachtel und hielt sie ihm hin. Er war von Anfang an vor Ort gewesen und hatte die Brigade mit aufgebaut, hatte also schon etliche Unterstützer kommen und gehen sehen und den Heimvorteil inzwischen auf seiner Seite. In der Soligruppe, an der Berliner Basis, sprach man ehrerbietig von ihm als el responsable. Wenn es irgendein Problem zu lösen galt, dann löste Hartmut es. Man konnte ja nicht einfach zum Baumarkt fahren und dort Zement, Rohre, Fliesen und so weiter kaufen, weil es erstens keinen Baumarkt und zweitens immer nur dies oder das und vielleicht gerade etwas ganz anderes gab, wenn man wusste, wo. Also waren Organisationstalent und Beschaffungsschlauheit gefragt, wie sie eher in der DDR, nicht aber unter Westmenschen gediehen. Hartmut trieb alles irgendwo auf. Eigentlich war er Deutschlehrer, doch als Kommunist bekam er in Westberlin keine Anstellung. Radikalenerlass. Berufsverbot. Nicht mal als Briefträger durften Kommunisten arbeiten. Also hatte er sich in Eigenregie zum revolutionären Bauleiter umgeschult und damit vielleicht auch den SEW-Mief hinter sich gelassen. Jedenfalls zeichnete sich sein Handeln durch eine ganz andere Entschlossenheit aus, als sie für Paul jemals erreichbar gewesen wäre.
Paul wusste noch nicht einmal, warum er eigentlich nach Nicaragua gekommen war und was er hier suchte. Vielleicht einfach nur etwas von Bedeutung. Eine Rolle für sich in der Geschichte. Das Gefühl, ein Schauspieler zu sein, der immer nur sich selbst spielt und auf ein neues Engagement wartet, hatte ihn nie verlassen. Seltsam, dass »Engagement« ein so positiv besetzter, aktivischer Begriff war, etwas, das linke, politisch entschiedene Menschen für sich gepachtet hatten. Sie alle waren »engagiert«. Paul hoffte bloß darauf, ein Engagement zu erhalten. War er deshalb hier?