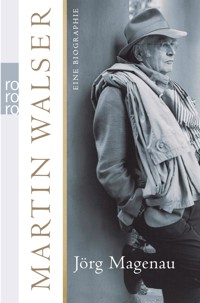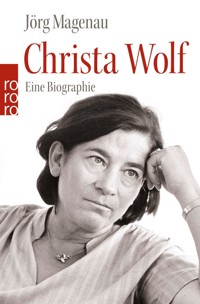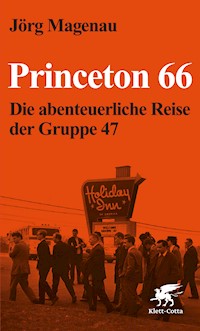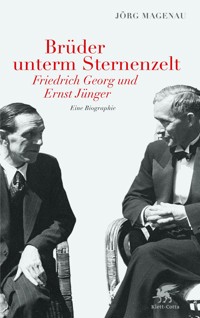17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Bestseller sind mehr als erfolgreiche Bücher. Sie sind Spiegel ihrer Zeit. Jörg Magenau fahndet in den Bestsellerregalen von 1945 bis heute danach, was die Bücher über uns als Gesellschaft und unsere Stimmungen erzählen. Jeder Leser weiß es: Ein Platz auf der Bestsellerliste ist kein Qualitätsmerkmal. Und doch gibt es Gründe und Bedingungen dafür, dass Tausende Leser zur selben Lektüre greifen. Warum traten bestimmte Bücher zu ihrer Zeit eine Debatte los oder lösten einen Hype aus? Warum wurden bestimmte Themen so mächtig? Eine Geschichte des Lesens – eine Geschichte unseres Landes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Jörg Magenau
Bestseller
Bücher, die wir liebten – und was sie über uns verraten
Hoffmann und Campe
Voraussetzungen
Die Bücher, die mir als Kind begegneten, waren immer schon da. So wie die große, weite, rätselhafte Welt um mich herum immer schon da war. Räuber Hotzenplotz, Pippi Langstrumpf, Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer traten als mythische Figuren aus einer zeitlosen Gegenwart heraus. Sie waren vollkommen präsent und so wahrhaftig wie Hänsel und Gretel, Hänschen im Blaubeerwald oder der Mönch von Heisterbach, der an einem einzigen Nachmittag gleich dreihundert Jahre im Wald verbracht hatte und am Abend in eine veränderte Welt zurückkehrte. Ich fragte nicht danach, wer diese Figuren ausgedacht und aufgeschrieben hatte oder seit wann es sie schon gab. Dass Hotzenplotz und Jim Knopf damals nicht viel älter waren als ich selbst, nahezu Neuheiten der Saison, wäre mir nie in den Sinn gekommen. Zeit und Geschichte gab es nicht in der Kindheit, also auch keine Neuerscheinungen und schon gar keine Bestseller. Jedes Buch, das ich las, war ein Klassiker. Jedes Buch, das ich las, war ein Buch für mich. Karlsson vom Dach, Grischka und sein Bär, Tecumseh wurden meine Freunde, und wenn einer von ihnen starb, dann beweinte ich seinen Tod. Oder ich fieberte mit ihnen wie mit dem Müllerburschen Krabat, der dem Teufel begegnete. Aber das war dann schon ein paar Jahre später.
Die frühesten Bücher hatten keine Autoren, sondern bestanden aus Figuren, Geschichten und Bildern. Sie waren nicht geschrieben, sondern ganz einfach der Wirklichkeit entnommen. Irgendwann aber kehrten sich die Verhältnisse um. Erwachsen werden bedeutet, wissen zu wollen, woher etwas kommt, und Ordnungen zu erschaffen, in die sich die Einzelphänomene einordnen lassen. Jetzt wurde ich zu einem Leser, der sich zuerst an den Schriftstellernamen orientierte. Ich las nicht mehr einzelne Bücher, sondern ganze Werke. Dabei fing ich chronologisch mit dem Debüt an und hörte beim letzten Roman auf. Der Gegenwart war ich damit immer noch fern, aber aus anderen Gründen. Ich durchlief, wie wir alle, meine Hermann-Hesse-Phase. Dass es sich bei Siddhartha, Narziss und Goldmund oder dem Steppenwolf um Allzeit-Bestseller handelte, war mir nicht klar. Bestseller hätte ich instinktiv abgelehnt, denn was für alle gut ist, kann doch nicht auch für mich das Richtige sein. Es folgten die Max-Frisch-Phase, die Martin-Walser-Phase, die Jean-Paul-Sartre- und dann auch die Simone-de-Beauvoir-Phase, und überall versteckten sich Bestseller: Homo Faber, Ein fliehendes Pferd, Der Ekel, Die Mandarins von Paris.
Dass es nicht so außergewöhnlich ist, von Hesses meditativem Indien ins existentialistische Frankreich überzusiedeln, hätte mir bewusst sein können. Ich bewegte mich im Kanon, obwohl ich mit dem Markt nichts zu tun haben wollte. Geist ist doch etwas anderes als das, was alle kaufen. Dabei gab es auch Johannes Mario Simmel, die Harmlosigkeiten von Ephraim Kishon oder Wum und Wendelin. Und Jimmy ging zum Regenbogen hatte ich gerne gelesen, über Kishons Familiengeschichten hatte ich herzlich gelacht, und Loriot war schon damals unsterblich. Die kamen direkt von der Bestsellerliste, aber das wusste ich nicht. Geballte Ablehnung dann erst später, gegenüber Uta Danella, Rosamunde Pilcher und dergleichen, aber warum eigentlich, ich hatte sie ja nie gelesen. Das Vorurteil, Bestseller sind Bücher für alle, also für den Durchschnitt, verfestigte sich mehr und mehr.
Auf die Werke folgten die Epochen. Jetzt waren es nicht mehr einzelne Autoren, die ich las, sondern ich benutzte die Bücher, um dadurch etwas über ihre Entstehungszeit zu erfahren. Sturm und Drang, Realismus, Nachkriegsliteratur: Das fing im Deutschunterricht an und setzte sich im Germanistikstudium fort. Die Entdeckung der Zeitgeschichte bedeutete, das Geschriebene historisch zu relativieren. Jetzt waren es nicht mehr einfach nur brauchbare Erkenntnisse, Gefühlslagen und Geschichten, die mir erzählt wurden, sondern zeitgebundene Indizien. Sie verkündeten keine Wahrheiten, sondern verwiesen auf die bestimmten Zustände ihrer Epoche. Als Literaturkritiker, zu dem ich schließlich wurde, ohne das beabsichtigt zu haben (wer will schon Literaturkritiker sein?), versuchte ich, beides miteinander zu verbinden: das Buch als ein Gegenüber zu betrachten, das sich objektiv beschreiben lässt, und dabei doch ein Leser zu bleiben, der in seine Lektüre eintaucht und dabei vor allem etwas über sich selbst erfährt. Denn das Lesen ist ja immer eine Begegnung, zu der zwei gehören: das Buch und der Leser.
Wie aber werden wir zu Lesern? Und wann fangen wir damit an, in Buchhandlungen nicht nach dem Ewigen zu suchen, sondern nach dem Neuen? Oder ist das ein ganz falscher Gegensatz? Wir wollen überrascht werden. Wir wollen lernen, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Wir wollen verstehen. Und wir wollen entführt und abgelenkt werden, um über uns und den eigenen Horizont hinauszugelangen. Deshalb lesen wir und spüren unserer Gegenwart mit ihren immer neuen Phänomenen und erstaunlichen Geschichten hinterher. Der Buchmarkt ist ein Spiegelbild all dessen, was sich ereignet Jahr für Jahr. Er zeigt, was uns umgibt und wie reich an Möglichkeiten die Wirklichkeit ist. Er umfasst in jedem Moment unsere ganze Geschichte und all unsere Wünsche. Damit sind wir nie allein. In den Büchern begegnet uns das, was uns ausmacht und was uns mit allen anderen verbindet. Manchmal sprechen sie zu uns persönlich, ganz direkt, als ob sie uns kennen würden. So genau erfassen sie, was wir denken und wie wir fühlen, nur dass wir selbst es vielleicht nicht so ausgedrückt hätten. Sie nehmen uns auf und führen uns hinaus in unbekannte Regionen.
Erfolg ist kein Makel, sondern ein Ausweis von Aktualität. Das ist an sich weder gut noch schlecht. Ein Platz auf der Bestsellerliste ist kein Qualitätsmerkmal für das betreffende Werk, aber doch ein Beleg dafür, dass es auf irgendeine Weise jetzt gerade, heute, zu uns spricht. Darum geht es mir in dieser kleinen Geschichte der Bestseller. Warum waren bestimmte Titel in Deutschland zu ihrer Zeit so erfolgreich? Was erzählen sie über uns? Welche Instinkte, welche Ängste, welche Hoffnungen verknüpfen sich mit den Büchern, die wir liebten? Das wollte ich wissen, und so fing ich an, vieles von dem zu lesen, was ich früher zur Seite gelegt hatte. Und siehe da: Es gab einiges zu entdecken.
Wenn ich mit Freunden über dieses Thema sprach, dann leuchteten die Augen auf. Dann nannten sie sofort Titel, die für sie wichtig waren, und gerieten in eine erinnerungsfrohe Begeisterung. Kommt denn auch Vom Winde verweht drin vor? Oder Doktor Schiwago? Oder die Love Story? Und was ist mit Heinrich Böll, Luise Rinser oder Hochhuths Stellvertreter? Was mit Jussi Adler-Olsen und Henning Mankell? Mit Michael Crichton und Dan Brown? Mit Otto Waalkes und Axel Hacke? Mit Umberto Eco oder Isabel Allende? Jede Biographie ließe sich auch entlang der eigenen großen, lustvollen Leseerlebnisse erzählen. Wenn der Mensch ist, was er isst, dann ist er noch viel mehr das, was er liest. Und wenn ich mit Schriftstellern zusammentraf, berühmteren zumal, was berufsbedingt öfters geschieht, und mit ihnen über mein Thema sprach, waren sie zart beglückt von der Aussicht, dass es dann ja wohl auch ein Kapitelchen über sie geben müsse und ihren größten Erfolg. Aber ach! Ich musste sie fast alle enttäuschen. Sind so viele Bücher, kann man nicht alle erwähnen, ja die allermeisten bleiben notwendigerweise außen vor, wenn das Ganze nicht enzyklopädische Ausmaße oder lexikalische Nachschlagehaftigkeit annehmen soll.
Die Auswahl, die sich schließlich ergab, ist ganz und gar subjektiv. Es kann nicht anders sein. Und so sehe ich schon jetzt die unendliche Mängelliste und die Beschwerden derer, die nicht darin enthalten sind, die ihr Lieblingsbuch vermissen oder ganz andere epochale Zäsuren gesetzt hätten. Doch Subjektivität ist keine Beliebigkeit. Sie folgt vielmehr den Notwendigkeiten, die sich aus dem eigenen Blick und aus dem Zusammenhang ergeben. Und sie folgt durchaus Kriterien. Darum ging es dann auch immer sehr schnell, in all den Gesprächen mit den Freunden: Wie willst du das denn entscheiden, was in so eine Geschichte hineingehört und was nicht? Ist zum Beispiel die Auflagenhöhe ein Kriterium? Ja und nein, sagte ich. Es werden sicher nicht nur Millionenseller sein, aber auch keine Titel mit weniger als ein paar hunderttausend verkauften Exemplaren. Da Verlage nur selten ehrliche Zahlen herausgeben, ist es schwer, sich nach der Verkaufsauflage zu richten. Außerdem sagt die schiere Quantität nicht so viel aus. Es gibt Millionenseller, die spurlos im Vergessen versunken sind, und andere, nicht so exorbitant gut verkaufte Bücher, die aber heftige Debatten auslösten. Viele der großen Erfolge waren dann halt doch bloß gute Unterhaltung und nicht weiter der Rede wert. Dagegen ist nichts zu sagen, aber eben auch nichts darüber. Die hier vorliegende Geschichte konzentriert sich auf Bestseller, die idealerweise beides verbinden: Hohe Auflagen und Aufmerksamkeit mit einer spürbaren Wirkungsgeschichte. Das Typische ist dabei wichtiger als die lückenlose Dokumentation der konkreten Einzelfälle.
Aus rein pragmatischen Gründen konzentriere ich mich darüber hinaus auf deutschsprachige Titel – von einigen Ausnahmen abgesehen. Der deutsche Buchmarkt ist ja wie die deutsche Kultur überhaupt keine autonome Insel, sondern ein Abbild weltweiter Verflechtungen, Beeinflussungen und Interessen von uns Lesern. Der Buchmarkt ist ganz sicher eine Einwanderungsgesellschaft, die nach keiner Obergrenze verlangt. Wissen und Erfahrungen kommen von überall her. Internationale Phänomene wie Harry Potter oder Shades of Grey spielen natürlich auch hierzulande eine große Rolle. Doch ohne sie zu vernachlässigen, stehen trotzdem andere Bücher im Fokus, die, als spezifisch deutsch, mehr aussagen über uns, die hiesige Leserschaft.
Eine andere Differenzierung des Buchmarktes entfällt dafür völlig: Die zwischen Belletristik und Sachbuch. Diese Grenze ist künstlich und fließend und lässt sich schon gar nicht am Unterschied zwischen »Fiction« und »Non-Fiction« festmachen. Denn so wie es faktenfeste Romane gibt, gibt es Sachbücher, die hochgradig fiktiv sind. Biographien zum Beispiel und Erinnerungsliteratur aller Art gehören dazu; sie werden auf den Listen mal hier und mal da einsortiert. Man muss nicht auf die Memoiren von Albert Speer verweisen, um zu erkennen, dass jede Lebensgeschichte eben vor allem das ist: eine Geschichte voll fragwürdiger Tatsachen und voller Erfindungen und konstruierter Wahrheiten, die noch nicht einmal die Autoren selbst auseinanderhalten können. Und warum Erich von Däniken mit seinen Außerirdischen-Phantasien unter Sachbuch lief und nicht unter Science-Fiction, lässt sich allenfalls aus Marketinggründen, aber nicht aus der Sache heraus erklären.
Entscheidend war in jedem Fall: Es mussten Bücher sein, die mich interessieren, die mir mehr bedeuten als nur das Abarbeiten einer Liste oder das Abtasten einer historischen Stimmungskurve. Alles Lesen ist subjektiv; das ist ein Gemeinplatz. Deshalb aber wäre es verkehrt, über eine Begeisterung zu schreiben, die man selber nicht teilt oder wenigstens nachvollziehen kann. Es geht mir um Bücher, an denen sich zeigen lässt, was Lesen überhaupt ist, was dabei geschieht und welche Bedürfnisse es befriedigt. Es geht also auch um das, was wir verlieren würden, wenn wir aufhörten zu lesen. Es sind Bücher, die wie alle Bestseller aus ihrer Zeit heraus zu begreifen sind, die aber daneben, dahinter, darüber hinaus auch vollkommen zeitlose Strukturen erkennen lassen. Da erst wird es interessant, wo sich zeigt, was in der Begegnung von Buch und Lesern, von Gegenwart und Dauer passiert.
Ich gehöre nicht zu denen, die das Buch für eine aussterbende Gattung halten. Ob es auf Papier gelesen wird, auf einem E-Book-Reader oder als frei flottierende Datei im Internet, spielt nur eine untergeordnete Rolle. Gelesen wird immer, denn sonst ist der Mensch kein Mensch und schon gar kein geschichtliches Wesen. Stimmungen, Meinungen, Lebensweisen sind die Voraussetzung jeder Lektüre – und deren Resultat. Wir sind enthalten in den Büchern, die wir liebten, und die Bücher sind ein Teil von uns. Das gilt für uns als Individuen genauso wie für die kollektive Geschichte der Bundesrepublik. Im Phänomen der Bestseller fällt beides zusammen. Jeder von uns ist Teil dieser Geschichte, ob er will oder nicht. Als Leser schreiben wir sie mit.
Der erste Satz
»Und da war Gnotke.« Auch wenn wir nicht wissen, wer Gnotke ist, wissen wir sofort, dass wir es wissen sollten. Gnotke war da, und wer so sehr da ist, den möchten wir kennenlernen, wir Leser. Denn darauf hoffen wir doch: dass uns einer begegnet, dessen Geschichte uns etwas angeht und der zu uns spricht. Es könnte eine Freundschaft daraus werden, wer weiß. Und Gnotke war da. Er wartete schon auf uns, so wie alle Romanfiguren darauf warten, dass eines Tages jemand kommt, den Buchdeckel aufschlägt und sie lesend zum Leben erweckt.
Mit dem ersten Satz fängt jede Geschichte an. Der erste Satz entscheidet noch nichts. Er setzt eine Duftmarke. Er ruft etwas hervor. Er schließt keine Möglichkeit aus und ist doch bestimmt genug, um uns ins offene, weite Gelände hinauszulocken, das vor uns liegt: das unberührte, ungelesene Buch. So sind wir im zweiten Satz schon unterwegs und mittendrin: »Es war ein grauer Novembertag, und August Gnotke hatte einen Spaten in der Hand.«[1]
Unteroffizier Gnotke grub sich ein ins kollektive Gedächtnis. Acht Meter lang, zwei Meter breit und anderthalb Meter tief war die Grube, die er zusammen mit seinen Kameraden ausgehoben hatte. »Der letzte Spatenstich war gemacht.« So deutete sich das Ende an, knapp drei Jahre zuvor an der Ostfront, und so setzte 1945 der erste große deutsche Nachkriegs-Bestseller ein: Stalingrad von Theodor Plievier.
Gnotke war einer von vielen aus Hitlers Sechster Armee. Weil er vor versammelter Truppe einen Befehl verweigert hatte, war er einem Strafbataillon zugewiesen worden, das an vorderster Front, im Bogen des Don, Leichen beseitigen, Minen räumen und Stacheldraht entwirren musste. Als »Staubkörnchen« empfanden sie sich, als »nächtliche Gespenster«, als »durch den Dunst ziehende Schemen«[2]. Ein paar Seiten weiter sind sie fast alle tot. Nur Gnotke ist noch am Leben und hockt vor einem Haufen bizarr verkrümmter Leichen, die ihm den letzten Hauch ihrer Körperwärme spenden.
Stalingrad erschien wenige Monate nach Kriegsende, zunächst im Ost-Berliner Aufbau-Verlag, und es dauerte nicht lange, bis eine halbe Million verkauft war.[3] Ein Kriegsroman gleich nach Kriegsende, ein vernichtendes Buch über den Vernichtungsfeldzug im Osten, der mit der eigenen Vernichtung endete. Die Lizenzausgabe bei Kurt Desch in München kam bis Anfang der sechziger Jahre auf 287000 verkaufte Exemplare.[4] Doch die Publikationen in den verschiedenen Besatzungszonen sind unübersichtlich, die Zahlen unzuverlässig. Und dann gab es auch noch die auf Zeitungspapier gedruckte Reihe »Rowohlts Rotations Romane« – möglichst viele Worte auf möglichst wenig Papier für möglichst wenig Geld, wie die Verlagswerbung verkündete –, wo Stalingrad1947 mit einer Auflage von mindestens 100000 für fünfzig Pfennig Verbreitung fand.[5]
Hatten wir denn nicht genug vom Krieg, wir Leser? Heißt es nicht, die Deutschen wollten von dem, was hinter ihnen lag, nichts mehr hören und wissen? Warum dann die Begeisterung für diesen gnadenlosen Roman? Mussten wir, um neu anfangen zu können, zurückkehren in das, was wir erst einmal als militärische Niederlage begriffen, als Irrsinn und Verbrechen der Führung, des »Führers« am eigenen Volk? Zum mythisch hochgestimmten Untergangsepos mit Platz für Heldengeschichten wurde die Schlacht um Stalingrad erst später. Plievier hatte im Moskauer Exil die Gelegenheit bekommen, Briefe von Kriegsgefangenen auszuwerten und Interviews zu führen. So konnte er authentische Geschichten mit dokumentarischer Drastik erzählen. Er schilderte das Verrecken im Dreck, die Zerstückelung der Leiber und der Lebensgeschichten im Hagel der Explosionen. Er zeigte die ganze Sinnlosigkeit des Krieges, die Brutalität des Mordens, die Vergeblichkeit des Sterbens. Er blickte in einen Schützenpanzer, den eine Granate getroffen hatte, und beschrieb die Reste der Besatzung als blutigen Schaum an den Innenwänden. Er zitierte aus den Briefen derer, die schon zerfetzt waren. »Geliebtes Goldschatzel«. »Lieber Bruder und Schwager«. »Mein über alles geliebter Matz«. Das ging ans Herz. War das im Jahr 1945 ein Trost? Eine notwendige Lektion? Ein Abschied? Hatten wir denn nicht gerade eben noch mit »Heil Hitler« gegrüßt und auf den Endsieg gehofft? Begann dort, in der Vernichtung, die Suche nach dem Neubeginn?
Vier Jahre später, Ende 1949 und kurz nach der Gründung der Bundesrepublik, hatten wir schon etwas Abstand genommen und hielten uns an das, was uns ein anderer Autor mit seinem ersten Satz empfahl, auch wenn es ungewöhnlich war: »Ich rate dem Leser, das Buch nicht auf der ersten Seite zu beginnen.«[6] Von ihm ließen wir uns zunächst ins alte Ägypten führen, zu den Pyramiden und den Pharaonengräbern, und blätterten von dort aus in die näheren Vergangenheiten des verschütteten Pompeji und des Trojanischen Krieges. Götter, Gräber und Gelehrte hieß dieser Roman der Archäologie, den Kurt W. Marek unter dem Pseudonym C.W. Ceram im Rowohlt Verlag eingeschmuggelt hatte, wo er als Lektor das eigene Manuskript betreut und mit sich selbst den Autorenvertrag abgeschlossen hatte. Auch Plieviers Stalingrad war über seinen Schreibtisch gegangen; er hatte ein Nachwort dazu verfasst, in dem er über die »totale Vermassung«, den »Untergang des Individuums« und das »Sterben der europäischen Seele« spekulierte.[7] Der erste Satz seines eigenen Buches ließ nicht ahnen, dass es über Jahrzehnte hinweg zum größten deutschen Sachbuchbestseller nach 1945 werden würde. Zwar handelte es sich um ein Geschichtsbuch, aber es war weit entfernt von der schmerzhaft gegenwärtigen deutschen Geschichte. Wo wäre da auch der erste Satz zu verankern? Wo beginnen nach dem Untergang, wenn nicht gleich in Babylon?
Die Entstehungsgeschichte der Götter liest sich selbst wie ein Roman, und weil derlei Legenden Teil der Erfolgsstory sind, hat Marek sie später aufgeschrieben. Sie fängt damit an, wie er den Verleger Ernst Rowohlt kennenlernte. Marek war damals, Februar 1946, einem Ruf des Publizisten Hans Zehrer gefolgt und Redakteur der Welt in Hamburg geworden. Er bewohnte zwei Telefonzellen im dritten Stock des schwer zerstörten Broschek-Hauses, einem riesigen Kontorgebäude in der Innenstadt. Die Trennwand zwischen den beiden Zellen war herausgenommen worden, sodass er sich mit Liege und Tischchen darin einrichten konnte. So jedenfalls sollen wir uns seine Wohnlage vorstellen. Rowohlt, der eine Etage höher Quartier bezogen hatte, tappte mit einer Kerze in der Hand durch den finsteren Korridor, und es ist schwer zu entscheiden, wer von den beiden heftiger erschrak, als sie sich dort begegneten. »Wer zum Teufel sind Sie denn?«, soll Rowohlt gesagt haben, worauf Marek ihn zu einem Pfund Weißkäse einlud. »Weißkäse? Meinen Sie Quark?« – »Ja.« – »Mensch, ich hab noch ’nen Kanten trocken Brot! Moment, ich komm runter!« – »Bringen Sie ’nen Löffel mit, ich hab nur ’ne Gabel!«[8]
Die so beginnende kernige Männerfreundschaft wurde bei langen Gesprächen über Literatur vertieft. Marek kannte sich aus. Er hatte Anfang der dreißiger Jahre bei einem Berliner Großantiquar eine Buchhändlerlehre absolviert. Dort wurden nach 1933 die Titel unerwünschter Autoren verramscht, sodass er sich auf diese Weise durchs Rowohlt-Programm rauf und runter gelesen hatte.[9] Dass beide, Rowohlt und Marek, im Krieg in einer Propaganda-Einheit der Wehrmacht gedient hatten, mag ebenso zu ihrer raschen Verbundenheit und zum beherzten Tonfall der Gespräche beigetragen haben. Marek hatte über seine norwegischen Kriegserlebnisse 1941 den Landser-Roman Wir hielten Narvik veröffentlicht. Er hielt sich zugute, dass der Name Adolf Hitler in dieser betont unheroischen Darstellung kein einziges Mal vorkomme[10], und legte Wert auf eine möglichst naturalistische Beschreibung des Soldatenalltags ohne Pathos und ideologische Überhöhung. Hans Zehrer, der den Stalling Verlag in Oldenburg leitete, behauptete, das Buch durch die Zensur geschmuggelt zu haben.[11] Ob das nötig war, ist eine andere Frage. Immerhin erschien – trotz Verbotsgerüchten – eine zweite Auflage im 71. bis 80. Tausend[12], und Mareks Bericht hatte zur Folge, dass er zur Propagandaeinheit eingezogen wurde. Der nüchterne Stil und der kalte Blick waren in Kreisen der Wehrmacht durchaus erwünscht.
Beim Stalling Verlag in Oldenburg sollte nach dem Krieg auch sein nächstes Buch erscheinen. Der Vertrag über den Roman der Archäologie war bereits abgeschlossen. Als Rowohlt ihm nun den Finger in die Brust stieß und ihm sagte: »Sie werden mein Lektor«, war die Sache aber anders entschieden: Marek bat Zehrer um Vertragsauflösung und brachte das ungeschriebene Buch mit einem halbfertigen ersten Kapitel mit, obwohl Rowohlt den Plan für Blödsinn hielt. »Archäologie? Will doch kein Mensch wissen! Aber egal. Kommen Sie rüber damit!«[13] Und so geschah es. Marek schloss als Lektor den Autorenvertrag mit sich selbst (sehr fair, wie er behauptete), und Rowohlt vergaß die Angelegenheit gleich wieder.
Marek aber schrieb. Er schrieb nach Feierabend, denn tagsüber hatte er zu tun. Er war nicht nur Verlagslektor, der die Autoren Wolfgang Borchert, Walter Jens und Arno Schmidt betreute (den er entdeckte und durchsetzte), er blieb daneben weiterhin Autor der britisch lizensierten Tageszeitung Die Welt und Kritiker beim Nordwestdeutschen Rundfunk, wo erstaunlich viele Rowohlt-Bücher besprochen wurden. Drei Jahre brauchte er deshalb, bis er mit seinem Archäologie-Buch so weit gediehen war, dass er mit Rowohlt darüber sprechen konnte. Den Autorennamen hatte Kurt Willi Marek kurzerhand umgedreht und aufgehübscht und C.W. Ceram erfunden. Ein »gewendeter« Autor, der seine Vorgeschichte als Kriegsberichterstatter hinter sich ließ: Das könnte kaum symbolträchtiger sein in der jungen Bundesrepublik. Dass in Marek auch »Marke« steckt, wäre eine weitere Pointe, wurde er doch zum Prototyp eines Bestsellerautors, dessen Name als Markenartikel funktioniert. Dabei wollte er mit dem Pseudonym angeblich genau das verhindern: Weil man ihn als Journalisten kannte, fürchtete er, man würde ihm den Archäologen nicht abnehmen. Also lieferte er auch hier gleich die Erweckungsgeschichte mit, die der Spiegel schon vor Erscheinen des Buches kolportierte: »Im Krieg war er Oberleutnant bei der Fallschirmtruppe. Er zählte fünf Granatsplitter in seinem Arm, als er 1944 aus den Ruinen von Cassino in ein Lazarett von Verona kam. Hier las er sein erstes archäologisches Buch. Hier und nach seiner Heimkehr aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft las er weitere 294 archäologische Bücher und schrieb den ›Roman der Archäologie‹.«[14]
Ernst Rowohlt vertraute seinem Lektor, lesen wollte er nichts, und so ging das Manuskript dieses Ceram in Druck, ohne dass jemand anderes als der Autor es kannte – und es war auch der Autor selbst, der es in seiner Eigenschaft als Lektor angenommen und redigiert hatte. Niemand im Verlag wusste um dieses Geheimnis. Erst viele Wochen später, als Rowohlt dann doch einmal fragte, wer dieser Ceram eigentlich sei, klärte Marek seinen Verleger auf, der ihn daraufhin als »Schuft« bezeichnete, ihn lange stumm ansah und schließlich sagte: »Nun mal ehrlich, unter uns: Taugt das Buch was?« Marek bejahte die Frage, und so stießen die beiden auf diese schöne Offenbarung an.[15] An einen Erfolg glaubte Rowohlt aber noch lange nicht.
Als Lektor betreute Marek auch Ernst von Salomon. Er besuchte ihn auf der Insel Sylt, um mit ihm an seinem Fragebogen zu arbeiten – ein weiteres Buch der jungen Bundesrepublik, das zum Bestseller werden würde.[16] Marek war – über sein eigenes Werk hinaus – ein Zentrum der frühen Bestsellerproduktion des Landes. Salomon hatte sich den Entnazifizierungsfragebogen der Alliierten vorgenommen. Er beantwortete ihn in aller Ausführlichkeit und führte ihn dadurch ad absurdum. Die Antworten wuchsen sich zu einem dicken autobiographischen Roman aus. Doch die Arbeit stagnierte, er kam nicht voran, wusste nicht weiter und lief angeblich – so die von Marek verbreitete Legende – über die Heide, wo er die Manuskriptblätter pathetisch verstreute. Seine Frau, die ihm folgte, sammelte sie hinter ihm wieder auf. Und dann kam Marek. Um Salomon von dessen Nöten abzulenken, zeigte er ihm ein Kapitel seines Archäologie-Buches. Salomon war demnach der Einzige, der etwas davon zu sehen bekam.
Das Manuskript sollte nun aber in Druck gehen. Die beiden saßen in einem Wirtshaus, als Rowohlt anrief, um mit Marek über die Auflagenhöhe zu sprechen. Wieviel? 20000 sagte Marek, was der Verleger mit eisigem Schweigen quittierte. Als dann auch Salomon für 20000 plädierte, fragte Rowohlt den Wirt, was die beiden denn getrunken hätten. Der beruhigte: drei Schnäpse, nicht mehr. Und so gab Rowohlt 12000 Exemplare in Auftrag, obwohl der Verlag nach der Währungsreform in finanziellen Schwierigkeiten steckte und er dafür einen Kredit über 50000 Mark aufnehmen musste. Ein Misserfolg hätte ihn ruiniert.[17]
Götter, Gräber und Gelehrte erschien am 15. November 1949. Es war mit 18 Mark ein teures Buch, in Leinen gebunden, mit Goldprägung und zahlreichen Bildtafeln in Tiefdruck. Das Kalkül, etwas Kostbares würde Begehren wecken und käme im Weihnachtsgeschäft als Geschenk in Frage, ging auf. Der bildlose, eher schlichte Umschlag, der Titel und Autorennamen in stilisiert antikisierten Lettern in Rot und Schwarz wiedergab, machte einen gravitätischen, seriösen Eindruck. Dieses Buch versprach menschheitsgeschichtliche Bildung, zugleich aber auch höchste, romanhafte Lesbarkeit. Drei Tage vor Heiligabend war die erste Auflage ausverkauft, und so ging es weiter, Jahr für Jahr in steter Regelmäßigkeit und mit einem im Lauf der Jahrzehnte – bis heute – nur geringfügig modifizierten Cover. Das Buch entwickelte sich zu einem echten Longseller. Anfang der sechziger Jahre war die erste Million der Götter weg. Der Spiegel meldete 1962 rund 1,3 Millionen verkaufte Exemplare[18], Ende 1964 waren es 1,5 Millionen. Bis zur Jahrtausendwende wurden weltweit rund fünf Millionen abgesetzt[19] mit Lizenzausgaben in 31 Ländern und Übersetzungen in 33 Sprachen.[20]
Cerams Erfolg war kein deutsches, sondern ein internationales Phänomen. Doch zu Beginn, in den Ruinenlandschaften der zerstörten deutschen Städte, wirkten die verschütteten Überreste ferner Epochen besonders anziehend. So war es also schon immer gewesen: Kulturen entstanden und vergingen, und was zurückblieb, waren ein paar versunkene Kostbarkeiten im Wüstenstaub. Vielleicht würde auch in den Trümmern der jüngsten europäischen Katastrophengeschichte eines Tages ein Goldschatz gefunden werden? Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs hatte Oswald Spengler mit Der Untergang des Abendlandes die Theorie des ewigen Kreislaufs der Kulturen – Aufstieg, Blüte und Verfall – vorgelegt; Ceram lieferte einen Krieg später die archäologischen Fundstücke dazu, und er schloss mit einer beruhigenden Botschaft: »Was bleibt zu sagen? Es wird weitergegraben in aller Welt. Denn wir brauchen die letzten 5000 Jahre, um die nächsten 100 mit einiger Gelassenheit ertragen zu können.«[21] Der Verlag warb explizit damit, dass dieses Buch einen Deutschen als Verfasser habe, der jedoch »kein Wort an die beiden Weltkriege, ihre Generale und Staatsmänner« verlöre.[22] Aber genau das war das Spannungsmoment: Im Subtext des Unausgesprochenen war die deutsche Geschichte eben doch präsent – trostreich und schicksalhaft aufgehoben in der großen Geschichte der Götter und der versunkenen Heiligtümer.
Doch Vorsicht! Ist es nicht viel zu einfach, wenn der überraschende Erfolg der Ceram’schen Trümmerliteratur in der Trümmerkulisse der Nachkriegszeit im Nachhinein so bezwingend verständlich erscheint? Wer weiß denn schon, was in jedem von uns beim Lesen vorgeht! Als Leser sind wir immer allein, jeder von uns reagiert auf seine eigene, besondere Weise, und oft wissen wir selbst nicht so genau, was da in uns angesprochen wird und welche Erinnerungen in uns nachklingen. Cerams Angebot, in die Antike auszuweichen, war verführerisch. Er bot andere, weit entfernte Welten an, die zugleich die eigenen jüngsten Erfahrungen und Traumata widerspiegelten und so auch bearbeitbar machten.
Es greift deshalb zu kurz, wenn Christian Adam diese Beschäftigung mit der Vergangenheit als bloße »Vermeidungsstrategie« bezeichnet.[23] In seiner großen Studie über die Bestseller der Nachkriegszeit schreibt er: »An einem Dauererfolg wie dem Roman der Archäologie Götter, Gräber und Gelehrte lässt sich exemplarisch zeigen, dass sogar der Ausflug in ferne Zeitalter vor allem als Flucht vor der jüngsten Vergangenheit inszeniert wird. Gerade jener Fluchtmöglichkeit verdanken dieser und unzählige andere Titel ihren großen Publikumszuspruch.«[24] Das stimmt – und es stimmt nicht. Denn Adams These verkennt die Dialektik der »Fluchtmöglichkeit«. Vielleicht war die Auseinandersetzung mit Krieg und Zerstörung und Schuld nach der allerersten, direkten Konfrontation in Plieviers Stalingrad grade jetzt eben nur so möglich: als Ausflug in ferne Zeiten und Kulturen, in denen das eigene Erleben sichtbar werden konnte, ohne gleich allzu bedrängend zu wirken. Das Verdrängte bleibt präsent, sonst ließe es sich ja nicht verdrängen. Oder anders gesagt: Es ist nur verdrängt, aber als Verdrängtes noch lange nicht verschwunden.
Wie ein spätes Echo auf Cerams Altertumskunde klang es, als Michael Ende vierundzwanzig Jahre später den Roman Momo mit dem Satz beginnen ließ: »In alten, alten Zeiten, als die Menschen noch in ganz anderen Sprachen redeten, gab es in den warmen Ländern schon große und prächtige Städte.«[25] Nachdem er deren Schönheit und Reichtum heraufbeschworen, ihren Untergang und Zerfall beklagt hatte, setzte er mit seiner Geschichte genau dort ein, wo wir uns noch von Cerams Götter, Gräber und Gelehrte her auskannten. In der Ruine einer antiken Theaterstätte erhielt das Mädchen Momo seinen ersten Auftritt. Genau da war ihr Platz, wie sie den besorgten Erwachsenen versicherte, die gelegentlich dort auftauchten, Touristen zumeist. Sie, die von »irgendwoher kommt« und eigentlich »immer schon« da war, fühlte sich in der Ort- und Zeitlosigkeit zu Hause. Von da aus nahm sie den Kampf mit den »grauen Männern« auf, die mit ihren dicken Zigarren die den Menschen gestohlene Zeit wie Tabak verbrauchten und verrauchten. Gegen den alles verwertenden Kapitalismus einer durchökonomisierten Wirklichkeit – und dafür standen diese gesichtslosen grauen Männer doch wohl – halfen die Phantasie, das Märchen und eben auch die antike Gegenwelt.
Über sieben Millionen Mal wurde der in 40 Sprachen übersetzte Roman Michael Endes seither weltweit verkauft. Und doch dauerte es in Deutschland sechs Jahre, bis diese »seltsame Geschichte von den Zeit-Dieben und von dem Kind, das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte«, wie der umständliche Untertitel lautete, zum Mega-Bestseller wurde. 1974 erhielt Momo den Deutschen Jugendbuchpreis, doch auf die Spitzenplätze der Bestsellerliste geriet das Buch erst 1981, im Gefolge des nächsten, noch erfolgreicheren Romans von Ende, Die unendliche Geschichte. Diesem wiederum war der Weg geebnet worden durch den Klassiker der Fantasy-Literatur, der 1980 plötzlich zum bestverkauften Roman wurde und der mit dem Satz zu erzählen begann: »Als Herr Bilbo Beutlin von Beutelsend ankündigte, dass er demnächst zur Feier seines einundelfzigsten Geburtstages ein besonders prächtiges Fest geben wolle, war des Geredes und der Aufregung in Hobbingen kein Ende.«[26] Tolkiens Herr der Ringe aus den fünfziger Jahren, in deutscher Übersetzung 1969 erschienen, war 1980 zum Jahresbestseller herangereift und leitete so die Konjunktur literarischer Phantasiewelten ein, die über Michael Ende zu Umberto Ecos Mittelalter-Klosterdrama Der Name der Rose reichte und von dort weiter zu Patrick Süskinds Parfum – dem 1985 erschienenen Millionen-Seller.
Es wäre zu einfach, unsere Lust an all diesen Büchern als fortgesetzten Eskapismus und als Wirklichkeitsflucht zu begreifen, auch wenn sich dieser Eindruck aufdrängen mag: Die achtziger Jahre waren das Jahrzehnt der »German Angst« und der großen Friedensdemonstrationen. Waldsterben und Nato-Nachrüstung beherrschten die Debatten und die apokalyptische Gefühlslage. Die Anti-AKW-Bewegung protestierte in Gorleben, Brokdorf, Wyhl und Wackersdorf und erhielt schließlich in der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl ihre Bestätigung. Aber auch dieser Super-GAU erwies sich schließlich als überlebbar, sodass paradoxerweise gerade das Eintreffen der Katastrophe das Ende der Angst einläutete.
Das Bedürfnis nach phantastischen Gegenwelten war groß – und doch verwiesen auch diese literarischen Eskapaden zurück auf die Probleme der Gegenwart. Wenn sich Momo als antikapitalistischer Roman lesen lässt, so arbeitete Tolkien die Erfahrung der beiden Weltkriege zum Kampf um Mittelerde um. Die Hobbits als erdverbundene Wesen erschienen zu Beginn der achtziger Jahre plötzlich wie zeitgemäße Vorläufer der Grünen, die mit den Zyklen der Natur und ohne die Hektik industrieller Produktionsweise gut zu leben verstanden. Wenn die finsteren Orks Bäume ausrissen und Wälder zerstörten, beschworen sie den Widerstand der Natur herauf. In den Kampf um Mittelerde griffen schließlich auch die Bäume ein. Auch dieses Motiv erhielt eine aktuelle Bedeutung, schien es doch so, als hätte Tolkien das Waldsterben schon vorausgeahnt.
Die Bewegung aus der Geschichte heraus, die die phantastische Literatur vollzieht, führt immer wieder dorthin zurück. Lesen ist eine Doppelbewegung, die auf dem Umweg über andere Welten unser eigenes Leben neu und anders zu beleuchten vermag. Der serbische Autor Bora Ćosić hat das einmal so formuliert: »Lesen ist Flucht, aber nicht aus der ›Wirklichkeit‹ in ein profanes Exil, Lesen platziert den Leser in einer außergewöhnlichen zeitlichen Kapsel.«[27] Lesen ist eine Flucht, aber es ist eine Flucht in die verwandelte Wirklichkeit und in die Vorstellung, dass das Leben auch ganz anders sein könnte als immer bloß so, wie es gerade ist. Lesen heißt fliehen, um verwandelt zurückzukehren. Auch Träumen ist erlaubt. Darin liegt die subversive Kraft der Bücher.
Liebesverhältnisse
»Wer sind wir, wenn wir lesen? Was passiert mit uns, wenn wir langsam, noch zögernd, in die erste Zeile gleiten, welcher Film läuft ab, wenn wir kopfüber in den Text stürzen? (…) Oft ist Lesen nur ein zerstreutes Vorbeigleiten, ein flüchtiger, unwilliger Kontakt. Dann wieder ist es ein ozeanisches Vergnügen, Eintauchen in eine abgründige Welt, in der wir uns verlieren und vielleicht irgendwann wiederfinden. Ein seltsames Taucherspiel von Selbstverlust und Selbstgewinn.«[28] Lesen ist, so wie Ulrich Raulff es als »ozeanisches Vergnügen« beschwört, ein Liebesakt. Zum Eintauchen in das Textmeer, wie es sich im gelingenden Lesen vollzieht, gehört der Autor als Gefährte unter der Oberfläche der Worte naturgemäß dazu. Dass man sich auch ihn als einen Liebenden vorstellen muss, hat Navid Kermani in seinem Roman Sozusagen Paris spürbar werden lassen. Der Ich-Erzähler dieses Buches ist ein Schriftsteller, der ihm, dem Autor Kermani, geradezu demonstrativ gleicht. Er sagt: »Aber sind Romanschreiber nicht alle irgendwie Liebende, die sich – und sei es postum – nach dir, Leser, verzehren, und gehört nicht die Narrheit zur Liebe dazu? Ja, du, die Anrede genau in der Intimität, die mir im Alltag oft unangenehm, in der Werbung ganz unerträglich ist, du Leser, weil ich gar nicht anders kann, mir dich als einen Freund oder eine Freundin zu wünschen, eine mir nahe und nachsichtige Person, damit ich so literarisiert auch immer schreibe, was mir jetzt wichtig ist.«[29]
Schreiben und Lesen sind Bewegungen aufeinander zu, die eine spürbare Intimität erzeugen. Lesen und Schreiben sind einander nicht nur verwandt, »sondern eine einzige Art Tätigkeit«, meint Martin Walser.[30] Als Schreibender und als ein Lesender, der seine Texte über Literatur Liebeserklärungen nennt, muss er das wissen. Wir beginnen im Lesen ein Spiel aus Berührung und Zurückweichen, aus Anteilnahme und Distanz, aus Faszination und Erschrecken. Gelingende Lektüre ist ein lustvoller Vorgang, ein erotischer Verschmelzungsakt. Literaturwissenschaftler bezeichnen das als »Identifikation«[31]; sie halten »identifikatorisches Lesen« für naiv. Und doch wird Lesen erst dann zum Erlebnis und zum Abenteuer mit offenem Ausgang, wenn wir mit Haut und Haar eintauchen in den uns als Fremdes begegnenden Text.
Lesen ist eine Lust. »Lernen und Genießen sind das Geheimnis eines erfüllten Lebens«, schreibt Richard David Precht in seiner zum Bestseller gewordenen Philosophiegeschichte.[32] Die Verbindung von Lernen und Genießen, von Lesen und der Lust am Denken ist aber auch das Geheimnis seines eigenen phänomenalen Erfolgs. Ein gutes Buch ist wie ein guter Freund. Es ist da, wenn wir es brauchen, und gibt das Vertrauen zurück, das wir ihm schenken. Es ist das Gegenüber, an dem wir wachsen und lernen. Wir Leser. Ein flüsterndes, nächtliches Gespräch entsteht zwischen ihm und uns, eine so starke wie geheimnisvolle Bindung. »Was man beim Lesen finden kann, ist das Lesen«, sagt der Schriftsteller Peter Handke.[33] Das ist nur scheinbar eine Tautologie, denn lesend – wenn es gelingt und wenn wir dabei wirkliche Leser werden – gehen wir tatsächlich in einen anderen Aggregatzustand der Existenz über. Noch einmal Martin Walser: »Jeder Leser liest SEIN Buch. Er bemächtigt sich nicht des Buches, er bezeugt, was das Buch in ihm bewirkt hat.«[34] Lesen verwandelt. In der Sprache erschaffen wir uns immer wieder neu.
Was sich da genau abspielt, ist kaum zu ergründen und bleibt in der Tiefe unzugänglich. Es lässt sich noch nicht einmal genau sagen, was wir währenddessen wahrnehmen, was wir uns merken und was wir sofort wieder vergessen. Mancher Satz entgleitet uns schon, während wir ihn lesen, und wer behält auch nur die zuletzt gelesenen Sätze mehr als schemenhaft im Gedächtnis? Wie nehmen wir Sinn und Bedeutung auf, wenn wir mit den Augen doch immer am gerade aktuell gelesenen Wort kleben? Wie stellen wir Bezüge her? Wie machen wir Erfahrungen im Lesen, und wo lagern sie sich ab? Was nehmen wir auf von einem Text, den wir nicht in all seiner Tiefe verstehen? Welche Spuren hinterlässt er, wenn wir ihn längst vergessen haben? Was suchen wir in ihm? Und was heißt das überhaupt: Verstehen?
»Was Lesen ist und wie Lesen geschieht, scheint mir eines der noch dunkelsten und einer phänomenologischen Analyse am meisten bedürftigen Dinge«, schrieb der Begründer der philosophischen Hermeneutik, Hans-Georg Gadamer.[35] Wir werfen unsere ganze Biographie, all unsere Urteile und Vorurteile, unser Wissen und Nichtwissen, unsere Herkunft und unsere gesellschaftliche Stellung in den Leseprozess hinein und werfen damit aber auch alles weg und vergessen es für den Moment.[36] Beides geschieht zur gleichen Zeit, wir sind da und nicht da. Wir werden berührt, gefesselt, aufgewühlt, manchmal auch bloß gelangweilt oder verärgert und abgestoßen. Spannung stellt sich ein, Neugier und manchmal diese seltsame Art von Nähe, wenn es gelingt, ganz in die erzählte Geschichte einzutreten, als wäre es nicht ein anderes Leben, das vor uns abläuft, sondern tatsächlich das eigene. So erweitern wir unseren Horizont.
Der Schweizer Schriftsteller Peter Bichsel drückte das einmal so aus: »Lesen ist für mich sozusagen immer und unabhängig vom Inhalt der Eintritt in eine Gegenwelt.«[37] Als Leser befinde er sich in einer anderen Welt mit anderen Qualitäten. »Nur wer Lesen als eine Gegenwelt erfährt, wird zum Leser.«[38]Das ist mehr als bloß eine unterhaltsame Beschäftigung oder etwas so Würdeloses wie ein »Hobby«. Es hat etwas mit Leidenschaft zu tun, ja mit Berauschtheit, denn Leser spüren »ein leichtes Abheben vom Boden, das sich steigern kann bis zum Gefühl der Schwerelosigkeit.«[39] Es ist ein leiblicher Vorgang, etwas, das sich in uns vollzieht wie das Atmen und das einen Übergang in einen anderen Bewusstseinszustand bezeichnet wie das Einschlafen. Es setzt viel Zeit voraus, Langsamkeit, Bereitschaft, also so etwas wie Muße. Lesen ist nichts für zwischendurch, kein Zeitvertreib, sondern ein Aufgehen in der Zeit. Es ist, wie Bora Ćosić meint, »gar kein Aufenthalt in der Zeit, sondern außerhalb von ihr.«[40]
Was sich im Lesen ereignet, ist etwas anderes als bloßer Wissenstransfer. Jedes Wort, jeder Satz schillert in seiner Bedeutungsvielfalt. Je genauer wir uns als Leser auf eine Bedeutung festlegen, indem wir das Gelesene deuten, umso mehr verengen wir es und nehmen ihm damit womöglich seine Eigenart. Gerade literarische Texte – Prosa ebenso wie Lyrik – gehen niemals in einer Deutung auf. Jeder Text ist größer als das darin Gemeinte. »Lesen geschieht in der abenteuerlichen Offenheit des Nichtverstehens«, schreibt der Schweizer Literaturwissenschaftler Hans-Jost Frey. Es findet in einem Zwischenraum statt, der sich zwischen »der Absicht des Schreibers« und den »Vorurteilen des Lesers« öffnet.
Lesen ist weder rein passive Aufnahme noch kreativer Schöpfungsakt. Es ist auch etwas anderes als die Wahrnehmung eines Gegenstandes: Zwar erfassen wir den Text sinnlich mit den Augen, doch er bleibt dabei etwas Zeichenhaftes, das auf einen Sinn verweist, der nicht sichtbar ist. Frey nennt den Vorgang des Lesens den »Vollzug« des Textes. Das verlangt, wie er kompliziert, aber treffend formuliert, »dass man den Standpunkt aufgibt, von dem aus man ihm gegenüber ist. Die Vollzugsbewegung ist die des Textes selbst. Lesen ist deshalb, wie das Schreiben und anders, eine Art Hervorbringung des Textes, den es zwar immer schon geben muss, wenn er gelesen werden soll, der aber auch jedesmal, wenn er gelesen wird, noch einmal entsteht.«[41]
Das Buch scheint dich zu kennen und sich genau an dich zu richten. Das Buch macht dir deutlich, wie du immer schon empfunden hast, ohne es so genau in Worte fassen zu können. Das Buch weiß etwas, das schon in dir bereitliegt und das bloß noch geborgen werden muss. Aber zugleich tritt es dir als Fremdes gegenüber, bringt dich auf ganz neue Gedanken, ermöglicht dir den Zugang zu unbekannten Welten, sodass du schließlich von dort aus auf dein eigenes Leben wie mit fremden Augen zu schauen lernst.
»Du musst dein Leben ändern«, heißt die Schlusszeile in dem berühmten Rilke-Gedicht Archaischer Torso Apollos, in dem exemplarisch vorgeführt wird, wie das Kunstwerk den Betrachter in den Blick nimmt: »Denn da ist keine Stelle, die dich nicht sieht«.[42] Rilke schildert in diesem Gedicht, was sich in der Begegnung mit einem Kunstwerk ereignet. Dabei handelt es sich um den Torso einer griechischen Statue. Der Kopf fehlt und damit auch das Entscheidende: die Augen. Doch das gesamte Kunstwerk verwandelt sich unter den Augen des Betrachters in etwas, das »sieht« und zur Selbstveränderung aufruft. Darin liegt für ihn die Moral der Kunst. Wie er es formuliert, ist es ja ein Gebot: Du musst dein Leben ändern. Allerdings ist es nicht »das Kunstwerk«, das spricht, sondern der Blick des Betrachters, der sich in ihm spiegelt und auf ihn selbst zurückfällt. Genau dasselbe geschieht auch im Vorgang des Lesens. Auch der Text »blickt« auf uns Leser und mehr als das: Wenn wir als Lesende aus dem Text heraus auf uns zu blicken lernen, ruft er uns dazu auf, unser Leben zu ändern. Und auch wenn es sich bei Rilke um die ganz »hohe« Kunst handelt: zumindest in Spurenelementen ist diese Blickumkehr in jeder noch so trivialen Lektüre möglich.
Lesend werden wir eine Andere, ein Anderer. Und wenn wir in unsere eigene Existenz zurückkehren, könnte es sein, dass wir uns unterdessen verändert haben. Auch so lässt sich ein Liebesverhältnis begreifen. Doch worin besteht die mögliche Verwandlung? Sie bleibt ja an den Moment der Kunstwahrnehmung gebunden, sie ist, wie der amerikanische Kritiker A.O. Scott meint, eine »sublime Tautologie«. Das Ziel sei »die Art von Leben, die den Geboten gehorcht, wie sie von Skulpturen, Gemälden und Gedichten ausgesprochen werden«. Die Bedeutung eines Kunstwerkes oder eines Romans besteht also darin, zu »einer Veränderung des Lebens auf der Basis der Ermahnungen der Kunst bereit« zu machen.[43]
Rilkes Augenblick der Wandlung ist eine fast schon religiöse Erfahrung, die nur als Begegnung des einzelnen, sich versenkenden Lesers mit dem Kunstwerk möglich scheint und darin zu einer Selbsterfahrung wird. So sieht es Jan Philipp Reemtsma in seinem Buch über die Kunst der Interpretation. Er versteht den Satz: »denn da ist keine Stelle, die dich nicht sieht« als Begründung der durch das Kunstwerk vorgebrachten Aufforderung, das eigene Leben ändern zu müssen. Dieses aber, ein Blick, der alles sieht, sei »gemeinhin nur von Gott geläufig. Gott ist unteilbar, hat keine Partien, die man als ›Stellen‹ bezeichnen könnte, aber Rilkes Reden von den Stellen-die-sehen, genauer: von keiner, die das nicht tut, ist von der Idee des Ganzen getragen.«[44]
Auch Peter Sloterdijk rückt Rilkes Kunsterfahrung in den Kontext der »Religiosität«, die dadurch bestimmt wird, dass Subjekt und Objekt die Plätze tauschen: »Auf der Position, wo üblicherweise das Objekt erscheint, welches ebendarum, weil es Objekt ist, niemals zurückschaut, ›erkenne‹ ich nun ein Subjekt, das die Fähigkeit besitzt, zu schauen und Blicke zu erwidern. (…) Der Lohn für meine Bereitschaft zur Beteiligung an der Objekt-Subjekt-Umkehrung fällt mir unter der Form einer privaten Erleuchtung zu – im vorliegenden Fall als ästhetische Ergriffenheit.«[45]
Sloterdijk und Reemtsma verkennen jedoch, dass es sich nicht einfach nur um einen Platzwechsel von Subjekt und Objekt handelt. Dann wäre es ja immer noch der eigene Blick, der bloß von einer anderen Stelle aus auf den Schauenden oder analog dazu im Leseprozess auf den Lesenden zurückfällt. Sondern es handelt sich um ein prozesshaftes Geschehen zwischen den beiden Polen. Das Subjekt ist das Objekt ist das Subjekt und also keins von beidem. Das Gesehenwerden setzt das Sehen voraus und umgekehrt: Erst das Gesehenwerden ermöglicht den genauen, losgelösten Blick, der nicht mehr von Subjektivität verstellt ist. Jedes Lesen ist auch ein Gelesenwerden, und wenn wir das Buch verstehen, versteht das Buch auch uns.
Die Frage drängt sich auf, ob dieses hohe Kunsterlebnis auch auf Bestseller wie zum Beispiel Charlotte Roches Feuchtgebiete, auf die Memoiren von Konrad Adenauer oder auf die von Wanderhuren und Muschelsuchern durchschrittenen Seichtgebiete der literarischen Niederungen übertragbar ist. Die Antwort lautet: Ja. Weil in jedem Lesevorgang, wie trivial, trocken oder feucht auch immer, etwas von dieser Blickumkehr vorhanden ist, wenn wir als Leser merken, wie der Text »Du« zu uns sagt. Im Phänomen der Bestseller aber wird aus unseren einsamen Lektüren ein gemeinschaftlicher Vorgang: Derselbe Prozess, dieselbe Verschmelzung ereignen sich vielfach. Bücher sind niemals monogam. Das eine Buch spricht nicht nur zu dir so intim, sondern auf nämliche (oder ganz andere) Weise zu vielen anderen. Es sagt Du zu jedem von uns und meint: genau dich, mich, uns alle. Und es trifft uns jenseits unserer Identitäten als Mann oder Frau, Greis oder Jugendlichen, Großstädter oder Landbewohner.
Wie kann das gehen? Sind Bestseller ein Indiz dafür, dass wir uns als Lesende sehr viel stärker ähneln, als wir, die wir doch alle so einzigartig sein möchten, annehmen? Was verschmilzt da womit, im massenhaften Gefallen des einen, von allen geliebten Werks? Und wie kann dieses eine Werk uns alle so gut kennen und zu jedem von uns sprechen? Empfinden wir, obwohl wir doch Individuen und jeweils einzigartige Leser sind, dann doch im kollektiven Gleichklang? Oder haben Bestseller die besondere Qualität, offene Flächen zu bieten, an denen jeder auf seine besondere Weise andocken kann?
Für den Schriftsteller Julian Barnes ist völlig klar, dass er sich schreibend nicht nur an ein Du, sondern an viele Leser wendet. Als schüchterner Mensch sei es ihm immer unmöglich gewesen, zu einer größeren Gruppe zu sprechen. Als er mit Anfang Dreißig für eine Zeitung arbeitete, habe er in Redaktionskonferenzen kein Wort herausgebracht, starr vor Angst, jemand könne ihn zum Reden zwingen. Das Schreiben sei damals seine Rettung gewesen, seine Art, »mit vielen Leuten ins Gespräch zu kommen«.[46] Barnes wendet sich also nicht an ein unbekanntes Du, sondern an uns alle als Gesprächspartner.