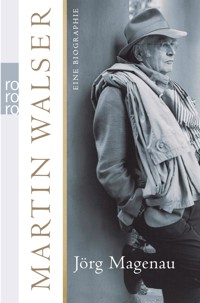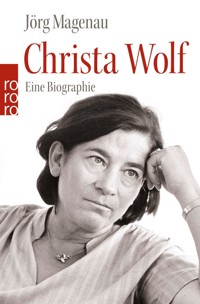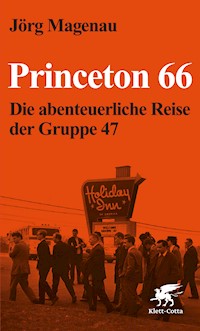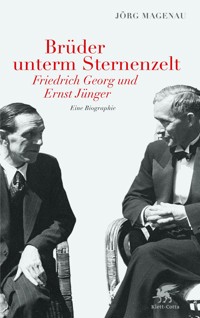10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Helmut Schmidt und Siegfried Lenz: Eine Freundschaft, die deutsche Zeit- und Literaturgeschichte ist. Seit den frühen sechziger Jahren sind Helmut Schmidt und Siegfried Lenz befreundet. Der Politiker bewundert den Literaten, der Schriftsteller weiß um den begrenzten Einfluss der Literatur auf die Zeitläufte. Es ist eine Freundschaft, die von gegenseitigem Respekt Bewunderung geprägt ist, die privat ist - Siegfried Lenz fühlt sich Helmut Schmidts Frau Loki freundschaftlich verbunden, die 1968 von der "Deutschstunde" begeistert war und jedes Buch des Autors las. Aber es ist auch eine Verbindung, die öffentlich wirkt, weil der Schriftsteller den Politiker unterstützt - im Wahlkampf, auf Reisen und als fortwährender Gesprächspartner - so auch während des "Deutschen Herbstes" 1977, bei einer Reise nach Polen und Auschwitz und in der Zeit des Nato-Doppelbeschlusses. Jörg Magenau hat Siegfried Lenz und Helmut Schmidt wiederholt zu Gesprächen getroffen und unveröffentlichtes Archivmaterial ausgewertet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Jörg Magenau
Schmidt – Lenz
Geschichte einer Freundschaft
Hoffmann und Campe
Der Refrain der Zeit
Helmut Schmidt und Siegfried Lenz, Mai 2007
Eine Freundschaft, die länger dauert als ein halbes Jahrhundert, entzieht sich in ihren Einzelheiten der Erinnerung. Was sich wann ereignet hat, ist im Rückblick nur schwer zu bestimmen. Jahreszahlen sind unzuverlässige Zeugen, und manches, was einmal wichtig war, ist längst ins Vergessen versunken. Gespräche sind nicht haltbar, sie gehören ganz dem Augenblick und lassen sich in ihrer lebendigen Bewegung Jahrzehnte später nicht mehr heraufbeschwören. Und doch setzt hier die Arbeit der Erinnerung ein. Sie stellt Stimmungen und Ahnungen bereit, die empfänglich machen. Da reift hier eine Empfindung, dort ein Gedanke, und es wächst ein sicheres Gefühl: In all der Zeit, die seither vergangen ist, hat sich die Gewissheit verfestigt, dass dieser Freundschaft unbedingt zu vertrauen ist. Sie ist mit den Jahren gewachsen und wurde zu einer verlässlichen Größe. Sie ist mit den Freunden alt geworden, so alt, dass die beiden sich heute nicht ganz ohne Rührung begegnen können. So viel Vergangenheit! Es ist, als wären sie selbst am meisten erstaunt darüber, immer noch am Leben zu sein und den Freund noch einmal zu sehen: Auch er ein Überlebender der Zeiten.
Siegfried Lenz geht es an diesem Tag nicht gut.[1] Er hat mit seiner zweiten Frau UllaLenz, Ulla ein Apartment in der Nähe der Elbe bezogen, seinem Fluss, über den er so viel geschrieben hat. Aber von dieser Nachbarschaft hat er nicht mehr viel. Er schafft es nur mit Mühe vom Schlafzimmer in die Wohnräume hinüber, benutzt dafür den Rollator, setzt sorgsam Fuß vor Fuß, bis er endlich in einem mit Lammfell ausgeschlagenen Korbstuhl Platz findet, den er in den folgenden Stunden nicht wieder verlässt. Immer diese Schmerzen, sie hören niemals auf. Aber er gibt ihnen nicht nach. Seine unbedingte Freundlichkeit ist unbeschadet geblieben. Dass diese Begegnung heute zustande kommt, erfüllt ihn mit tiefer Dankbarkeit. Das sagt er auch gleich, als wäre es gar nicht er selbst, um den es dabei geht, als müsste er sich tatsächlich für die Gelegenheit bedanken wie für ein Geschenk. Bescheidenheit ist neben der enormen Menschenfreundschaft seine zweite, große Tugend. Er ist ein Virtuose der Nachsicht und der Einfühlungskunst. »Ach ja«, sagt er leise. Und: »Mein Gott, ja.« Denn eines ist gewiss: Alles, was war, ist lange her, auch dann, wenn es noch in die Gegenwart hineinragt.
»Alter ist keine Zumutung, es ist vielmehr eine alltägliche Auferlegung, ist ein Refrain der Zeit, und der Verfall ist kein Makel, sondern gegeben: das Leben nimmt sich mit Gewalt, was es einst dem Menschen zuerkannt hat«, schrieb Lenz in einem Essay über das Alter, als er selbst mit einundsiebzig Jahren noch vergleichsweise jung gewesen war. Den Text trug er damals der Freitagsgesellschaft im Haus von Helmut Schmidt vor, einer die Jahrzehnte überdauernden Gesprächsrunde, der das Alter naturgemäß zum Thema werden musste. Dass die Literatur sich immer wieder des Alters annimmt, erschien ihm unvermeidlich. Wenn der Mensch vor dem Ende und vor dem Nichts steht, dann kommt er endlich zu sich selbst. Literatur, so Lenz, habe es sich schon immer zur Aufgabe gemacht, »vor Augen zu führen, was es heißt, befristet in der Welt zu sein«.[2]
Helmut Schmidt lässt noch ein wenig auf sich warten. Die Verkehrslage in Hamburg, katastrophal, lässt er telefonisch melden, sogar der Tunnel am Hauptbahnhof verstopft. Aber dann ist er auch schon mitten im Raum und gleich ganz da und zieht alle Aufmerksamkeit auf sich. Weil das Gehen so mühsam ist, wird er von seinem Chauffeur im Rollstuhl an den Tisch geschoben, keine weiteren Präliminarien, kurze Begrüßung: »Gebt mir mal ’nen Kaffee.« Seine Gefährtin Ruth LoahLoah, Ruth, die seit dem Tod von Loki SchmidtSchmidt, Loki an seiner Seite ist, begleitet ihn. Sie zieht sich mit UllaLenz, Ulla Lenz ins Nebenzimmer zurück; das Gespräch der Männer wollen sie nicht stören. Lenz haucht: »Helmut, ich freu mich!«, und reicht ihm beide Hände. Schmidt deutet auf sein Ohr und das Hörgerät und dann auf die Häppchen, die den ganzen Tisch bedecken, sodass kaum noch Platz für Papiere und Aufnahmegerät bleibt. »Das sieht hier aus wie in einem guten Restaurant. Wie geht es Ihnen, Siggi?«
Lenz will kein Krankengespräch führen. Nichts schlimmer als alte Leute, die über ihre Gebrechlichkeit klagen. Aber wenn er gefragt wird, dann gibt er Auskunft, bedauernd zwar, doch der Gesundheitszustand gehört nun mal zur Bestimmung der Lage. »Seit diesen Operationen, Wirbelsäule und Nackenwirbel, aber das haben mir diese hervorragenden Ärzte vorausgesagt, haben die Schmerzen nicht nachgelassen. Ich kann sie genau lokalisieren, die Schmerzen, wo sie auftreten, hier an der Wirbelsäule, quer rüber, und hier von der linken Stirnhälfte runter in den linken Arm. Es ist wie ein Schuss. Ich muss versuchen, mich damit abzufinden. UllaLenz, Ulla achtet darauf, dass ich meine Tabletten nehme. Jeden Morgen vier, manchmal fünf. Je nach Laune und nach Abschätzung meines Zustandes erhöht sie die Dosis.«
Schmidt sagt, er nehme acht verschiedene Tabletten pro Tag. Und das schon seit Jahren. Dass er fast nichts mehr höre, sei schlimm, dass er keine Musik mehr hören könne eine wirkliche Tragödie. Da, wo einmal Töne waren, sei nur noch Krach, ein technisches Geräusch wie das Dröhnen eines Flugzeugs.
»Das ist natürlich eine Selbstentdeckung, die man nur mit größter Anteilnahme hören kann«, flüstert Lenz, der weiß, welche Bedeutung die Musik – BachBach, Johann Sebastian! – und das Klavierspiel für seinen Freund immer hatten.
Schmidt: Ich bin auch ein Stück älter als Sie, Siggi. Wann sind Sie geboren?
Lenz: 1926.
Schmidt: Und ich 1918.
Lenz: Das weiß ich.
Schmidt: Uralt, und verkalkt hier oben.
Lenz: Ich weiß es nicht, ob man von Ihnen als verkalkt sprechen kann.
Schmidt: Schreiben Sie noch was?
Lenz: Schreiben ist, ganz schlicht gesagt, eine von mir entdeckte Selbsttherapie. Wenn ich am Abend oder am nächsten Tag entdecke, dass eine oder zwei, drei Seiten – Gott geb’s! – geschrieben sind, fühle ich mich besser. Vielleicht ist das illusionär, ich weiß es nicht, aber das allgemeine Befinden bessert sich, wenn ich auf die geschriebenen Seiten blicke, und UllaLenz, Ulla vorlese, und an ihrem zustimmenden Lächeln, an ihrem zustimmenden Nicken merke, da hast du was getroffen. Ja. Das hilft.
Schmidt sagt, er wolle keine Bücher mehr veröffentlichen, das gehe nun nicht mehr. Das sagt er seit Jahren, doch seine Produktivität ist trotzdem ungebrochen. Politische Anlässe, die ihn immer wieder zu Wortmeldungen herausfordern, gibt es genug. Nur »dieses hier«, über die Freundschaft mit Siegfried Lenz, wolle er noch machen, sagt er jetzt, aber da habe er ja »nichts mit zu tun, abgesehen von dem Gespräch, das wir hier angeblich führen wollen«. Kalkuliertes Understatement zeichnet ihn aus. Dabei war er es, der den Plan, über die Geschichte seiner Freundschaft mit Siegfried Lenz zu schreiben, von Anfang an entschlossen unterstützte. Die Idee habe ihn sofort »elektrisiert«, sagte er da. Ohne sein Engagement wäre auch das Gespräch zwischen den Freunden, das nun beginnt, nicht realisierbar gewesen. Er legt ein Päckchen Reyno vor sich auf den Tisch und zündet gleich eine Zigarette an, um sich auf Betriebstemperatur zu bringen. Lenz greift, sich mehrmals entschuldigend, zur Pfeife, saugt und pafft, dass es klingt wie der sanft gurgelnde Blasebalg eines Beatmungsgerätes. Erst dann, wenn die Rauchschwaden sich über dem Tisch treffen, kann es losgehen. Erinnerungen sind in den Rauch hinein zu sprechen; sie sind Schall und Rauch. Alle Geschichtsschreibung, auch die in eigener Sache, geschieht a posteriori, aus zeitlichem Abstand. Auf Erinnerungen kann man sich nicht einfach berufen. Sie müssen hervorgelockt und neu geschaffen werden wie alle Vorstellungen.
Wann alles begann? Da gehen die Ansichten auseinander, nach mehr als fünfzig Jahren. Schmidt weiß, dass er Lenz in Bramstedt im Krankenhaus besuchte, 1962 muss das gewesen sein, »Reha-Klinik würde man heute sagen«, meint er, »aber das Wort gab es damals noch nicht«. Doch warum er ihn besuchte – schließlich kann Lenz da schon kein ganz Fremder mehr gewesen sein –, daran erinnert er sich nicht. Vielleicht, weil die beiden sich aus dem Vorstand der Hamburger Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit kannten? »Ja, das stimmt«, sagt Lenz. Oder war es, nachdem Schmidt als Hamburger Innensenator den Schriftsteller zu einem Nachmittagstee eingeladen hatte, um mit ihm über dessen Theaterstück »Zeit der Schuldlosen« zu sprechen? Im September 1961, Gustav GründgensGründgens, Gustav war damals Intendant, wurde das Stück am Deutschen Schauspielhaus inszeniert und sorgte in Hamburg und weit darüber hinaus für heftige Diskussionen. Ohne den Nationalsozialismus und die deutsche Vergangenheit konkret zu benennen, behandelte es das Problem des politischen Widerstandes in einer Despotie, das Schuldigwerden durch Untätigkeit oder durch den Versuch, zuerst einmal sich selbst in Sicherheit zu bringen. Lenz fühlte sich geehrt durch die Einladung des Senators, durch dessen Interesse und wissbegierige Fragen.
Lenz: Das ist eine Kunst, die er damals schon virtuos beherrscht hat, die entscheidenden Fragen zu stellen.
Schmidt: Können Sie sich erinnern, wo dieses Gespräch stattgefunden hat?
Lenz: Bei Ihnen zu Hause, Helmut, bei Ihnen zu Hause. Das hat mich besonders gefreut.
In den Jahren zuvor hatte Schmidt bereits Lenz’ Debütroman »Es waren Habichte in der Luft«, die masurischen Geschichten »So zärtlich war Suleyken« und die 1960 erschienene Erzählung »Das Feuerschiff« gelesen[3] – und das, obwohl er seit 1953, als er Abgeordneter der SPD in Bonn geworden war, kaum noch zum Lesen kam: »Da habe ich nur noch gearbeitet.« Besonders faszinierte ihn »Das Feuerschiff«, die Geschichte eines Kapitäns und seiner Mannschaft, der sich auf seiner letzten Schicht, bevor das Schiff abgewrackt werden soll, mit drei an Bord gelangten Verbrechern auseinandersetzen muss. Unter Führung des mysteriösen Dr. Caspary kapern diese das Schiff und hoffen, damit ihre Flucht fortsetzen zu können. Für den Kapitän geht es um die Frage des Handelns und des Abwartens, um falsches Heldentum und bedächtige Klugheit. Wenn es schließlich an Bord einen Toten gibt, liegt das nicht an ihm, den seine Männer für zu zögerlich halten. Auch sein Sohn ist mit an Bord und wirft ihm in jugendlicher Ungeduld Feigheit vor. Für den Kapitän aber ist der Drang zu handeln »wie eine Krankheit«. Er will – typisch für eine Lenz-Figur – auf seinem Posten bleiben, denn er hat die Verantwortung für alle: »Wenn ein Feuerschiff seine Position verlässt, hört für die anderen die Sicherheit auf. Dann hört die Ordnung der See auf.« Was also tun? Der Kapitän entscheidet, vorerst nichts zu tun, weil ihm alle Handlungsoptionen zu riskant erscheinen. Das Wort »Pflicht« kotze ihn an, sagt er, aber damit meint er nur die Verpflichtung auf die Aktion, obwohl die Vernunft dagegenspricht. Die Pflicht, seinen Auftrag zu erfüllen und das Feuerschiff mit seinen Lichtsignalen zum Schutz der Seefahrt an Ort und Stelle zu verteidigen, stellt er nicht infrage.
1962 war das Jahr der Hamburger Flutkatastrophe, in der Schmidt seinen Ruf als Krisenmanager, als Mann der Tat begründete und durch sein beherztes Handeln wohl viele Menschenleben rettete. Mit der Bewährung in der Katastrophe begann sein Ruhm und der Aufstieg vom Lokal- zum Bundespolitiker. Mit zehntausend Toten habe er zunächst gerechnet, sagt er, am Ende waren es »nur« 340. Lenz muss er damals fast wie eine Figur aus einer seiner Erzählungen erschienen sein: ein Mann im Kampf mit der Flut, ein einsamer Held, der den Krisenstab dirigiert und das Richtige tut, ohne sich um Zuständigkeiten und Gesetze zu kümmern – ganz anders als der skrupulöse Kapitän auf dem »Feuerschiff«. Auch wenn ihre Freundschaft da noch nicht begonnen hatte, so mussten die erzählerischen Möglichkeiten, die in der Figur des beherzten Politikers angelegt waren, den Geschichtensammler Lenz interessieren. Denn so nimmt er die Welt wahr: als Bühne seiner Figuren, als Fundus seiner Geschichten, die, wenn er sie erzählt, ihm selbst und seinen Lesern den Zustand der Gesellschaft verständlich machen. Seine schriftstellerische Arbeit wird getragen von einem unerschütterlichen Vertrauen in die Erzählbarkeit der Welt.
Siegfried Lenz im Hamburger Hafen, 1960er Jahre
»Als verlockendster Anfang böte sich natürlich der Befehlsstand der Hamburger Polizeizentrale an«, schrieb er drei Jahre später in einem Porträt über Helmut Schmidt: »Die Hansestadt ist vom Hochwasser eingeschlossen, Innensenator Schmidt hat das Kommando übernommen, prüft die Lage und die Veränderungen der Lage, lässt sich Vortrag halten von Generalen und Admiralen und trifft seine Entscheidungen bei Zigaretten und Kaffee. Man könnte da die Sprache der Katastrophe sprechen lassen, könnte die Verwandlungen eines Gesichts in den Nächten der Entscheidung beschreiben, auch ließe sich auf unhamburgische Weise einträglich über Bewährung sprechen und eine zarte Verbindung vielleicht zu Wilhelm Tell herstellen: die dramatische Lage würde sich da schon selbst ernähren …«[4]
17. Februar 1962: Innensenator Helmut Schmidt erläutert bei einer Lagebesprechung, was zu tun ist
Schmidt wird mitteilsam bei diesem Thema. Da fühlt er sich wohl und beginnt, ausführlich zu berichten. Ein glücklicher Zufall sei es gewesen, dass er General Lauris NorstadNorstad, Lauris, Nato-Oberbefehlshaber in Fontainebleau, als Mitglied der »International Defence Community« kannte. Außerdem habe er im Jahr zuvor sein erstes Buch publiziert, »Verteidigung oder Vergeltung«, eine Kritik der Nato-Verteidigungsstrategie. NorstadNorstad, Lauris habe das wohl gelesen und ernst genommen, sodass er nun auch den Anruf des Hamburger Provinzpolitikers ernst nahm und dessen Bitte um Hilfe positiv beantwortete. Hubschrauber der Nato-Truppen wurden eingesetzt, um die Flutopfer zu retten, die auf den Dächern ihrer Häuser oder Schrebergartenhütten in der Kälte ausharrten. Auch die Bundeswehr habe sich de facto ihm unterstellt und seine »aus dem Handgelenk gegebenen Befehle« entgegengenommen.
Schmidt: Die wussten, das ist ein Kerl, auf den man sich verlassen kann. In der Nacht davor war die Verantwortung in den Händen der Polizei gewesen. Die Polizeiführung kannte die Generale natürlich auch, aber sie hat hochgeguckt zu den Obersten und den Generalen; die waren zwei, drei Ränge höher als die höchsten Polizeikommandeure. Und jetzt kam einer, den nahmen die Generale ernst – und das mussten sie auch. Aber das ist alles sehr lange her. In Wirklichkeit ist es nicht wichtig.
Helmut Schmidt bei der Verleihung der Dankmedaille der Freien und Hansestadt Hamburg an vierhundert Soldaten für deren Einsatz während der Flutkatastrophe, 3. Dezember 1962 in der Litzmann-Kaserne in Hamburg-Wandsbek
Doch was ist wichtig, wenn nicht Entschlossenheit im Moment der Bewährung? Was Lenz an Schmidt bewunderte – und Bewunderung ist für dieses Verhältnis überhaupt ein wichtiges Wort –, verriet er knapp zwei Jahrzehnte später in einer Wahlkampf-Broschüre, nachdem Schmidt als Bundeskanzler durch den Seitenwechsel der FDP gestürzt worden war. Auch da ist von der »Pflicht« die Rede, einer Pflicht jedoch, die nicht in konventionellen Rücksichten auf Gesetze, bürokratische Genehmigungen oder Befehlsketten bestand. »Wie pflichtschuldig der Innensenator Schmidt in den Tagen der Hamburger Flutkatastrophe handelte – ich habe es, mit vielen Hamburgern, aus der Nähe erfahren«, schrieb Lenz 1982. Schmidt habe »einfach durch die Art, wie er damals reagierte, etwas sinnfällig gemacht; nämlich die Tatsache, dass ein demokratisches Gemeinwesen in kritischer Zeit auf Männer angewiesen ist, die auf unkonventionelle Weise die Initiative übernehmen«.[5]
In dieser Haltung der gemeinsamen Verpflichtung auf Demokratie liegt ein Ursprung der Freundschaft, auch wenn Lenz damals, 1965, die mögliche Erzählung um den Helden Helmut Schmidt nicht schrieb, sondern nur ein Porträt für den Wahlkampf. Seiner Erinnerung nach markiert dieser kleine Beitrag den Anfang ihrer Freundschaft.
Lenz: Es begann mit einem bekenntnishaften Artikel von mir, als mein Freund Günter GrassGrass, Günter und ich uns nach einem langen Gespräch entschlossen haben, die Politiker unseres Herzens darzustellen. Da habe ich – und das konnte in meinem Fall nicht anders sein – den Hamburger Politiker Helmut Schmidt ausgesucht und einen Essay über ihn geschrieben.
Tatsächlich war es Hans Werner RichterRichter, Hans Werner, Spiritus Rector der Gruppe 47, der einen Band mit dem Titel »Plädoyer für eine neue Regierung oder: Keine Alternative« plante. Mehrere Autoren, nicht nur aus der Gruppe 47, sollten dazu beitragen, in der Hoffnung, der SPD und ihrem Kanzlerkandidaten Willy BrandtBrandt, Willy damit im Wahlkampf nützlich zu sein. Aus verschiedenen Einzelporträts summierte sich eine Art Wunschkabinett der Schriftsteller: GrassGrass, Günter schrieb über BrandtBrandt, Willy, Rudolf AugsteinAugstein, Rudolf über Herbert WehnerWehner, Herbert, Hans Werner RichterRichter, Hans Werner beschäftigte sich mit dem Berliner Wirtschaftssenator Karl SchillerSchiller, Karl, Peter RühmkorfRühmkorf, Peter nahm sich Gustav HeinemannHeinemann, Gustav vor und Siegfried Lenz eben Helmut Schmidt, der für den Fall eines Wahlsieges der SPD als Verteidigungsminister gehandelt wurde.
RichterRichter, Hans Werner ging es – wie allen Autoren des Sammelbandes – keineswegs um kritiklose Zustimmung oder platte Propaganda. Das sogenannte »Engagement« der Schriftsteller beruhte eher auf einem großen »Trotzdem«; es war so sehr von Zweifeln und Skepsis durchdrungen, dass mancher Politiker erst lernen musste, das, was dabei herauskam, für Unterstützung zu halten. Paul CelanCelan, Paul, von RichterRichter, Hans Werner ebenfalls angefragt, lehnte mit der Begründung ab, Schriftsteller hätten sich nicht »für das kleine bzw. ›kleinere‹ Übel« zu entscheiden, »sondern jederzeit, und so differenziert als möglich, für das Wahre und Menschliche«.[6] Politik, das ist wahr, ist mit dieser Haltung nicht zu machen. Wer auf Absolutheit zielt, ist für das Tagesgeschäft verloren. Aber vielleicht braucht die Politik ja dieses Gegengewicht als moralisches Korrektiv und bekommt dadurch etwas, was ihr jederzeit verloren zu gehen droht: Standpunkt und Perspektive.
Auch RichtersRichter, Hans Werner Brief an Lenz ist die Skepsis deutlich abzulesen. Nach langem Hin und Her, schrieb er, sei er zu der Überzeugung gelangt, »dass man die SPD – trotz allem – diesmal wieder unterstützen muss. Da die meisten SPD-Leute nicht populär sind, sollte man sie ein wenig populär machen.«[7] Das sah Lenz nicht anders. Er sagte sofort und vorbehaltlos zu und war schon deshalb auf Seiten der Sozialdemokraten, weil es, wie er RichterRichter, Hans Werner wissen ließ, »kein sozialdemokratisch regiertes Land gibt, in dem Freiheit und das Recht des Einzelnen bedroht ist oder bedroht wäre«.[8]
Für Schmidt entschied er sich aus Anschauung und Überzeugung. Er nutzte die Gelegenheit, den Mann nun näher kennenzulernen, den er durchaus liebevoll mit dessen schon damals geläufigem Spitznamen »Schmidt-Schnauze« belegte – ein Wort, das dessen enormes Redetalent ebenso umfasste wie den militärisch knappen Befehlston des ehemaligen Oberleutnants. Ein erster Zwischenbericht, nur an RichterRichter, Hans Werner und nicht an die Öffentlichkeit adressiert, skizziert bereits das Bild, das Lenz dann auch in seinem Porträt zeichnete: »Ich war, um Dir dies zu sagen, in den letzten Wochen ein paar mal mit Schmidt zusammen, im Amt und privat; wir haben uns sehr freimütig unterhalten; er hat einen erstaunlichen Mitteilungsdrang, schießt aus der Hüfte, im Lauf, im Sitzen. Manchmal kommt er mir wie ein Wildwasserkanute der Politik vor, manchmal wie ein Löwe mit Grundsätzen.«[9]
Das Porträt, das am 5. Mai 1965 als Vorabdruck im »Spiegel« erschien, ist bemerkenswert, weil der Schriftsteller Lenz versucht, den Politiker Schmidt aus seiner besonderen Fähigkeit heraus zu begreifen: seiner Sprachkraft, seinem Redetalent. Fast scheint es, als würde Lenz in ihm den Kollegen suchen, der auf seine Weise mit derselben Materie zu tun hat wie er als Schriftsteller: mit den Worten. Und er beginnt mit einer Großaufnahme des Redners, zoomt auf dessen sprechenden Mund: »Man könnte von einem halbgeöffneten Mund ausgehen, der zunächst gar nicht bestimmt ist, der dein oder mein Mund sein könnte, ein wenig scharf, ein bisschen spottbereit, mit Zähnen ausgerüstet, die den starken Raucher erkennen lassen. Dann aber müsste man den Mund sprechen lassen, nichts Verständliches, nichts Gesundheitsschädliches, einfach nur sprechen, und es müsste ein Auditorium ins Bild kommen, das schön entzweit ist in seiner Reaktion: hier, bei der Minderzahl, Frohlocken, Genugtuung, reine Geburtstagsstimmung, dort, bei der Mehrzahl, Entrüstung, begründete Unruhe, eindrucksvoller Zorn. Das wäre so ein wohlfeiles, symbolisches Initial: die gefürchtete ›Schmidt-Schnauze‹ hätte sich ohne Kommentar selbst eingeführt.«[10]
Doch weil ihm dieses schöne Bild allein zu billig wäre, fing er nun an, die Sprache genauer zu erfassen, beschrieb einen Mann, der »Sprache weniger sorglos gebraucht als vergleichbare Politiker«, der sich »zum Selbstvertrauen nicht erst ermuntern muss«, der »ohne das geheiligte Vokabular des Marxismus auskommt« (was damals bei einem SPD-Politiker noch erwähnenswert gewesen ist), und schließlich, zusammenfassend: »Er gebietet über einen Wortschatz, der sich sozusagen in Stromlinie und Tropfenform zeigt.« Schmidt einen guten Redner zu nennen, reiche nicht aus. Vielmehr lasse sich an seinem Beispiel zeigen, dass nicht nur die Partei die Sprache verändere, sondern auch die Sprache die Partei: »Ich glaube, dass dieser Mann durch manches gesprochene Prosastück, in dem er überlegene Gedanken- und Sprachdressur anstellt, einfach schon verändernd gewirkt hat.«
Es ging Lenz gar nicht darum, bestimmte politische Positionen herauszuarbeiten, die Schmidt damals vertreten hätte, sondern ihn als einen Mann mit festem Standpunkt vorzustellen, als einen, der »weniger einer politischen Utopie oder Vision folgt, als Grundsätzen«. Damit ist Schmidt schon recht präzise erfasst und in die Zukunft hinein entworfen; der Satz, den er später als Kanzler einmal gebrauchte und nie wieder loswurde – »Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen« –, lässt sich bereits erahnen. Aber neben der Bewunderung ist auch der leise Zweifel des Schriftstellers spürbar, für den doch die Erfindungsgabe zum Handwerkszeug gehört. Denn was sind Visionen anderes als Erfindungen oder Entwürfe von neuen Möglichkeiten?
Doch nicht diese Differenz, die sich aus ihren Berufen ableiten lässt, war Gegenstand der ersten kritischen Anmerkung, sondern ein Zeitungsartikel, dem Schmidt entnehmen konnte, dass in dem geplanten Wahlkampf-Buch der Schriftsteller auch ein Porträt des IG Metall-Vorsitzenden Otto BrennerBrenner, Otto enthalten sein würde, der aber nicht zur Regierungsmannschaft BrandtsBrandt, Willy zählte. Das missfiel ihm, und so ließ er Lenz wissen, man solle doch besser Georg LeberLeber, Georg, den Chef der IG Bau Steine Erden aufnehmen, mit dem es größere Übereinstimmungen gebe. Da versuchte also der Politiker, politischen Einfluss auf die Publikation zu nehmen. Doch indem er das tat und an Lenz schrieb, demonstrierte er auch schon ein Vertrauen, das über das politische Anliegen hinausging und an das sich anknüpfen lassen würde. Schmidt endete so: »Dieser Brief wird eigentlich nur geschrieben, um Sie anzuregen, meine kritische Bemerkung eventuell noch einmal mit Ihren Freunden und insbesondere mit Hans Werner RichterRichter, Hans Werner zu besprechen. Dabei gehe ich davon aus, dass Sie an meinem Freimut keinen Anstoß nehmen werden.«[11] Lenz nahm keinen Anstoß. Er leitete Schmidts Bedenken auftragsgemäß an RichterRichter, Hans Werner weiter. Der Beitrag über BrennerBrenner, Otto blieb dennoch im Buch; Rolf HochhuthHochhuth, Rolf hatte ihn geschrieben. Es ist der mit Abstand längste Text des Bandes.
Helmut Schmidt an Siegfried Lenz, 17. März 1965
Ein paar Monate später, nach der Bundestagswahl im September 1965, bei der Ludwig ErhardErhard, Ludwig als Kanzler und die Regierung aus CDU/CSU und FDP bestätigt wurden, sandte Schmidt einen späten Dank »für das Konterfei in dem rororo-Bändchen« und mit dem Dank fast schon ein Freundschaftsangebot: »Ich bin nicht ganz sicher, ob Sie mich nicht ein wenig zu freundlich abgemalt haben. Jedenfalls habe ich aber eine sehr freundschaftliche Gesinnung herausgelesen, die ich nicht nur dankbar empfinde, sondern ebenso erwidere. Ich würde mich freuen, wenn wir uns gelegentlich wieder begegnen würden.«[12] Dabei hatte Schmidt – im Gegensatz zu Willy BrandtBrandt, Willy – von der schriftstellerischen Unterstützung im Wahlkampf gar nicht so viel gehalten. Sie war ihm »verdächtig«, und sie hatte ja auch nicht viel bewirkt, jedenfalls keinen Wahlerfolg. Noch heute, in der Erinnerung an diesen Beginn ihrer Freundschaft, ist ihm das Engagement von GrassGrass, Günter und dessen Mitstreitern eher unangenehm: »Ich war sehr skeptisch, und bin es heute noch, gegenüber dieser Instrumentalisierung des guten Rufes der Schriftsteller durch Horst EhmkeEhmke, Horst und Willy BrandtBrandt, Willy und Egon BahrBahr, Egon.« Mit Siegfried Lenz und der Nähe, die zwischen ihnen entstand, hatte das aber nichts zu tun. Schmidts aufrichtiger Dank lässt erkennen, dass es in diesem Fall nicht um Parteipolitik ging, sondern um etwas, das die politische Auseinandersetzung überragt: Sympathie und Zuneigung.
Doch wenn es schon der SPD und Willy BrandtBrandt, Willy nicht nutzte – hat ihr Engagement wenigstens den Schriftstellern selbst genutzt, indem sie sich als engagierte Autoren ins Bewusstsein der Öffentlichkeit brachten? »Es hat ihnen nicht genutzt«, sagt Lenz in seiner unüberwindlichen Zurückhaltung. »Sie haben nichts anderes getan, als ihr politisches Bekenntnis zu veröffentlichen, auf den Tisch zu legen. Darum bin ich für Helmut Schmidt. Darum trete ich für ihn ein. Darum versuche ich mit allen Argumenten, die mir zur Verfügung stehen und die ich aus meinem unmittelbaren Leben beziehe, für ihn einzutreten. Wir müssen die Partei unseres Vertrauens, die Männer unseres Vertrauens in jeder Weise, die uns zur Verfügung steht, unterstützen. Das war der Impetus. Das war ein redlicher bürgerlicher Impetus, eine bürgerliche Selbsternennung zum Ratgeber, zum Ratgeber nicht des Politikers, das wäre hochmütig gewesen, aber der Mitbürger: Wacht auf, hört zu, zieht eure Schlüsse daraus und überlegt, ob ihr euch belehnen könnt mit eurem Vertrauen. Das Resultat hat bei Helmut Schmidt gezeigt, dass wir nicht oft, aber hier und da, gehört wurden. Das war der Lohn für unser Engagement.« Der Lohn bestand aber auch darin, dass Schmidt, dem er sein Vertrauen schenkte, dieses Vertrauen erwiderte. Dabei blieb es zwischen den beiden, bis heute.
Helmut Schmidt sitzt schräg zum Tisch, im Halbprofil, das bessere Ohr in den Raum hineingerichtet. Er schaut aufs Bücherregal, das die ganze Wand hinter Lenz ausfüllt. Die Buchrücken und die Autorennamen verraten ihre Herkunft aus den fünfziger, sechziger Jahren. Mehrere Regalmeter werden von einer umfangreichen Lenz-Abteilung gefüllt, mit Übersetzungen seiner Werke in viele Sprachen, darunter chinesische oder koreanische Ausgaben. Schmidt schaut sich um, er ist noch nie hier gewesen in der neuen Wohnung seines Freundes.
Schmidt: Ich hab mein eigenes Haus zum Altersheim erklärt. Ich zieh nicht mehr um in meinem Leben. Ich wohne da jetzt seit einem halben Jahrhundert, nun bleib ich da auch. Siggi, Sie haben Ihre ganzen Bücher mit hierhergebracht.
Lenz: Ja, das sind alles meine. Alles aus der Preußerstraße.
Das Gespräch driftet ein wenig ab; Schmidt will wissen, wo denn das lateinische Lexikon stehe. Er habe seines zu Hause immer griffbereit, gleich links, erst gestern Abend habe er darin nachgeschaut. Da habe er wissen wollen, woher das deutsche Wort »klammheimlich« kommt und sei dabei auf das lateinische »clam« gestoßen, das aber schon »heimlich« bedeutet. »Klammheimlich« sei also eine unsinnige Verdoppelung, und falsch geschrieben sei es mit k und Doppel-m außerdem. Solche Entdeckungen machen ihm Freude, aber eigentlich geht es ihm doch um etwas anderes. Er will wissen, was aus all den Büchern in den Regalen wird, ob und wie Lenz seinen Nachlass geregelt hat. Interessiert hört er von den Plänen, alles Schriftliche, Manuskripte und Briefe und auch die ganze Bibliothek ins Deutsche Literaturarchiv nach Marbach zu geben, und er will wissen, was die Aufgabe der neu geschaffenen »Siegfried Lenz Stiftung« sein wird.
Schmidt: In unserem Alter kann jeden Tag ein tödlicher Herzinfarkt eintreten.
Lenz: Durchaus.
Schmidt: Und Sie müssen das bedenken.
Lenz: Das Haus bestellen, wie es bei GoetheGoethe, Johann Wolfgang von heißt.
Schmidt: Und zwar endgültig.
Stillschweigend einig
Welche Bedeutung hat eine Altersdifferenz von acht Jahren? Die beiden Männer, die da am Tisch sitzen und rauchen, rechnen eher in Jahrzehnten. Ob einer fünfundneunzig oder achtundachtzig Jahre alt ist – das macht nicht viel aus. Auch zu Beginn ihrer Freundschaft, sagt Lenz, sei ihm kein Generationsunterschied aufgefallen. »Ich dachte nur, der war Soldat, der war Marinemann, der auch, der auch, wer eigentlich nicht. Das war damals meine Frage an die Umgebung. Einer Generation anzugehören hieß, den ganzen Mist ertragen zu haben.« Erstaunlicherweise wurde »der ganze Mist« des durchlittenen Krieges aber nie zum Gegenstand ihrer Gespräche.
»Das haben wir nicht nötig gehabt, uns darüber zu unterhalten, da waren wir uns stillschweigend einig«, sagt Schmidt.
Und Lenz: »Darüber haben wir nicht gesprochen. Bei einem Mann, der wie Helmut Schmidt Offizier war, konnte man voraussetzen, dass er besondere Erlebnisse mit denen da oben gehabt hatte. Und ein besonderes Urteil über die da oben. Aber das führte nicht dazu, dass wir uns darüber lange austauschten. Ich kann mich nicht erinnern.«
Dabei muss es doch ein bedeutender Unterschied gewesen sein, ob einer 1933, bei der Machtübernahme der Nationalsozialisten, vierzehn oder erst sechs Jahre alt gewesen ist. Es ist ein Unterschied, ob man sich, wie Schmidt, 1937, direkt nach dem »Reichsarbeitsdienst«, freiwillig zum Militärdienst meldete, um daran anschließend gleich Architektur studieren zu können, stattdessen dann aber eingezogen wurde, weil der Krieg begann und damit am Ende fast acht Jahre ununterbrochen in der Wehrmacht gewesen sein würde. Oder ob man, wie Lenz, den Kriegsbeginn als dreizehnjähriger Spaliersteher erlebte, der den vorbeimarschierenden Soldaten auf ihrem Weg nach Polen zujubelte, weil das eben so üblich war, und sich dabei als »unentbehrlicher Zuschauer« fühlte. Erst 1944 trat Lenz seinen Dienst als Seekadett auf dem Panzerkreuzer »Admiral Scheer« an. Aber das war für ihn immer noch ein Abenteuer, Fortsetzung der Kindheitsphantasien, in denen er sich mal zum kosakischen Reiter erklärt hatte, mal als Erster Offizier ins U-Boot des Heftchen-Serienhelden Jörn Farrow gestiegen war. Als er in den Krieg auf See geworfen wurde, sei er noch ein Kind gewesen, schrieb er zurückblickend, ein »sogenannter blauer Junge aus dem Bilderbuch, dessen einzige ›Hygiene‹ in Körperpflege bestand«.[13]
Das Wasser war von klein auf sein Element. Im masurischen Lyck wuchs er in einem bescheidenen Haus am Ufer des Lycksees auf, am See und mit dem See, fischend, schwimmend, rudernd, und seit er an einem Märzmorgen durchs Eis gebrochen und nur mit Glück gerettet worden war, glaubte er sich gegen alle möglichen Missgeschicke auf dem Wasser gefeit. Er hielt sich für einen »Günstling einflussreicher Wassergeister«, für einen »masurischen, rundköpfigen Bruder Undines«. Diese Glaubensgewissheit kam ihm auch noch bei der Marine zugute. Die See: Das war eine Märchenwelt, war dunkle Erwartung, die Schönheit der Fische, die Verheißung des Horizonts. Der Krieg war nur ein Anlass, um auf der Ostsee kreuzen zu dürfen und, da war er noch ganz siegesgewiss, dazu beizutragen, die Weltmeere »von den Schiffen unserer Gegner unnachsichtig zu reinigen«. Vielleicht ist Lenz nur deshalb immer so zurückhaltend geblieben, wenn es um Auskünfte über die eigene Biographie ging, weil er keine Fußabdrücke hinterlassen wollte. Er erlebte sich so, als wäre er ein Boot, das mit seinem Bug die Wellen durchschneidet: »Und die einzige Lebensspur, die ich zurückließ, war die schaumige, sacht sterbende Linie des Kielwassers.«[14] Das ist eher eine Frage des Charakters oder des Stils. Es hat nichts damit zu tun, dass er etwas zu verbergen hätte.
Auch Schmidt fühlte sich immer stark zum Wasser hingezogen; sein Lycksee war die Alster. Hier lernte er das Kuttersegeln, dem er aber bald das Rudern vorzog. In der Hamburger Lichtwarkschule, einer auf künstlerische Fächer orientierten Reformschule, hatte er eine »Jahresarbeit« über die Hafenkonkurrenz der Städte Rotterdam, Antwerpen, Bremen und Hamburg geschrieben und war zum »Kapitän« der Rudermannschaft ernannt worden. Als die Gruppe im Frühjahr 1934 in die Marine-HitlerHitler, Adolf-Jugend überführt wurde, erhielt er den Rang des »Kameradschaftsführers« und trug nun eine blaue Marineuniform mit HJ-Armbinde. Ohne den Umweg über den schulischen Ruderclub wäre er wohl nicht in der HJ gelandet; seine Eltern waren dagegen. Als er nach dem Grund für ihr Verbot fragte, erfuhr er, dass er einen jüdischen Großvater habe, dass »Opa Schmidt« gar nicht sein leiblicher Großvater sei, sondern der Ziehvater seines als Säugling adoptierten, unehelich geborenen Vaters.
Bootsfahrt in Dänemark, 1986
Helmut Schmidt, Lilo und Siegfried Lenz, Dänemark 1986
Über den jüdischen Großvater, den Bankkaufmann Ludwig GumpelGumpel, Ludwig, ist nicht viel bekannt; er spielte nur als Gerücht und als gefährdende Herkunft eine Rolle. Auch von der leiblichen Großmutter wusste Schmidt nicht mehr als den Namen. »Opa Schmidt« dagegen war ein ungelernter Hafenarbeiter, nahezu analphabetisch und kaum in der Lage, eine Zeitung zu lesen. Dass sein Adoptivsohn – Helmut Schmidts Vater – Volksschullehrer wurde und sich zum Studienrat und schließlich zum Leiter einer Handelsschule hocharbeitete, ist das erstaunliche, auf harter Disziplin und Ausdauer beruhende Beispiel eines proletarischen Aufstiegs in die gebildete Mittelschicht. Vielleicht trug dazu auch bei, dass seine Frau – Schmidts Mutter – der gebildeten und musikbegabten Familie eines Druckers und Setzers entstammte und damit der Arbeiter-Aristokratie angehörte.
1933 wurde der Vater als Schulleiter abgesetzt. Eine Begründung dafür erhielt er nicht, aber es war klar, dass ein Sozialdemokrat in dieser Funktion unerwünscht war. Die jüdische Herkunft blieb sein Geheimnis, doch das quälte ihn weniger als der Makel, unehelich geboren worden zu sein. Trotzdem spielte die Angst vor der Entdeckung eine entscheidende Rolle und führte dazu, dass Helmut und sein Bruder WolfgangSchmidt, Wolfgang »keineswegs im demokratischen Geist«, sondern ziemlich autoritär erzogen wurden. Im Hause Schmidt ging es betont unpolitisch zu, Zeitungslektüre war unerwünscht, und Gespräche über Politisches gab es nicht – auch nicht nach dem Krieg, und noch nicht einmal dann, als der Sohn zum Bundeskanzler wurde.[15] Die Jahre im Nationalsozialismus und die ständige Angst hätten seinem Vater alle Kraft geraubt, sagte Schmidt einmal. Nach 1945 habe er keine Energie und keinen Antrieb mehr gehabt. »Die jahrelange Angst, seine Stellung zu verlieren, hatte den Mann zerstört.«[16]
Auf andere Weise und sehr viel früher verlor Lenz seinen Vater; ja, er hatte ihn nie. Der Zollbeamte Otto LenzLenz, Otto war kaum einmal zu Hause und verließ die Familie bald ganz. Seine Spuren verlieren sich, er starb wohl zu Beginn der dreißiger Jahre. Die Mutter, Luise LenzLenz, Luise, zog ein paar Jahre später zusammen mit der Schwester nach Braunsberg und heiratete wieder; Siegfried blieb bei der Großmutter in Lyck. Über seine Familie teilte er später nie etwas mit. Doch in seinen Romanen und Erzählungen finden sich immer wieder dominante Vaterfiguren und ihre Söhne, ganz so, als habe Lenz sich den nichtexistierenden Vater und die Auseinandersetzung mit ihm postum herbeigeschrieben. Symptomatisch ist die Szene im Roman »Heimatmuseum«, in der der Vater des Erzählers sich buchstäblich in Luft auflöst: Als Wunderheiler, der mit allerlei seltsamen Tinkturen und Chemikalien experimentiert, wird seine Pferdekutsche in einem Gefecht im Ersten Weltkrieg von einer Granate getroffen und explodiert in vielen bunten Flammen und Rauchwolken. Vom Vater bleibt nichts, gar nichts übrig. So hatten Schmidt und Lenz, als sie sich kennenlernten, auf unterschiedliche Weise mit abwesenden Vätern zu tun: Der eine war immer schon verloren gegangen, der andere lebte zwar noch, war aber sich selbst abhandengekommen. Die Söhne waren es gewohnt, die Verantwortung zu übernehmen und sie nicht auf die Elterngeneration abzuschieben.
Der Schüler und später der Soldat Helmut Schmidt wusste, dass er mit niemandem über seine nicht »rein arische Abstammung« reden durfte. Er lebte mit diesem Geheimnis und dieser latenten Bedrohung, die ihn von den Nazis trennte und damit auch vor ihrem Einfluss schützte: Es war ja klar, dass er nicht dazugehören konnte. Aus der Marine-HJ flog er aber aus anderen Gründen raus: »Weil ich ein freches Mundwerk hatte und oft abfällige Äußerungen über dieses und jenes machte, was mir missfiel.«[17] Nach dem Abitur und einem halben Jahr »Reichsarbeitsdienst«, wo er beim Deichbau an der Dove-Elbe eingesetzt wurde, kam er im Herbst 1937 zur Luftwaffen-Flak nach Vegesack bei Bremen. Dort erlebte er den Kriegsbeginn, den er wie ein Naturereignis hinnahm. Spätestens 1941, mit dem Beginn des Feldzuges gegen die Sowjetunion, war ihm klar, dass der Krieg verloren gehen würde. Doch das änderte nichts daran, dass er seinen Dienst tat, wie es von ihm verlangt wurde.
Schmidt: Ich war einer von diesen Millionen deutscher Soldaten, die wussten nichts anderes als: Das ist meine Pflicht, und die habe ich zu erfüllen. Und gleichzeitig wussten wir, dass alles Blödsinn ist, was wir hier machen.
Als Leutnant der Reserve wurde er 1941 zum Oberkommando der Luftwaffe nach Berlin versetzt und kam schließlich, als Offizier einer Flakabteilung der 1. Panzerdivision, an die Ostfront. Er erlebte die Blockade Leningrads mit, den Vorstoß Richtung Moskau und den anschließenden Rückzug, immer in diesem gespaltenen Bewusstsein der Pflichterfüllung für eine verlorene, zum Untergang verurteilte und falsche Sache, das katastrophale Ende vor Augen.
Helmut Schmidt 1940 als Leutnant der Luftwaffe
Moralisch wappnete er sich in dieser Zeit mit Marc AurelsMarc Aurel »Selbstbetrachtungen« und mit dem »Vermächtnis« von Matthias ClaudiusClaudius, Matthias, dessen Brief an seinen Sohn Johannes aus dem Jahr 1799. Marc AurelsMarc Aurel Lebensregeln, die der Selbstdisziplin, der Ruhe und Gelassenheit dienen, hatte er bereits zur Konfirmation geschenkt bekommen, und sie hatten einen tiefen Eindruck in ihm hinterlassen. Vernunftbestimmtes Handeln, Pflichterfüllung, Tugendhaftigkeit, Stoizismus: Marc AurelMarc Aurel half über die alltäglichen Schrecken des Krieges hinweg. In seinen Jugenderinnerungen schrieb Schmidt zurückblickend: »Für mich spielte Marc AurelMarc Aurel, dessen Selbstbetrachtungen ich immer bei mir hatte, eine wichtige Rolle bei der Beruhigung meiner Seele; er lehrte mich Gelassenheit und Selbstbeherrschung gegenüber Ereignissen, die man nicht beeinflussen kann, weil sie außerhalb der eigenen Reichweite liegen. Zugleich erschien er mir als Vorbild der Pflichterfüllung – auch und gerade im Kriege.«[18]
Auch bei Matthias ClaudiusClaudius, Matthias fand er Verhaltensregeln und Anleitungen für moralisches Handeln; das »Vermächtnis« hatte er den ganzen Krieg über bei sich. Die Maximen, die er darin finden konnte, dienten der Zivilisierung und der Selbstbesinnung auf die eigenen Maßstäbe. Während des Krieges waren ihm drei Sätze besonders wichtig: »Gehorche der Obrigkeit und lass die anderen über sie streiten. Sei rechtschaffen gegen jedermann, doch vertraue dich schwerlich. Mische dich nicht in fremde Dinge, aber die deinigen tue mit Fleiß.«[19] Orientierung auf Obrigkeit und Pflichterfüllung einerseits – das Beharren auf individueller »Rechtschaffenheit« und das Festhalten an einer vernunftorientierten Moral andererseits: In diesem Widerspruch der Tugenden bewegte sich der Soldat Schmidt. Marc AurelMarc Aurel und Matthias ClaudiusClaudius, Matthias halfen ihm über die Kluft im eigenen Bewusstsein hinweg, auch im ganz und gar Falschen eines verbrecherischen Krieges als treuer Soldat seine vaterländische Pflicht zu leisten. Erst nach dem Krieg, so Schmidt in seinen Erinnerungen, sei er zu der Erkenntnis durchgedrungen, dass man nicht jeder Obrigkeit Gehorsam schuldig ist. Denn auch die Obrigkeit muss sich an die Regeln der Vernunft und der Moral halten, wenn sie in ihrem Führungsanspruch legitimiert sein will.
Schmidt: Sie haben damals LiloLenz, Liselotte gen. Lilo noch nicht gekannt.
Lenz: Nein. Wir haben uns erst 1948 in der »Welt« kennengelernt, wo ich als Redakteur im Feuilleton arbeitete. LiloLenz, Liselotte gen. Lilo war Chefsekretärin in der von Engländern gegründeten und redigierten Zeitung.
Schmidt: Und ich bin als verheirateter Mann aus dem Krieg zurückgekehrt. Das ist natürlich ein Riesenunterschied. LokiSchmidt, Loki und ich haben 1942 geheiratet. Wir hatten uns 1941, ehe ich nach Russland ging, gesagt, für den Fall, dass ich gesund und munter wieder nach Hause komme, wollen wir heiraten. Und im nächsten Jahr passierte das. Mein Vater war dagegen, der sagte, du kannst doch gar keine Familie ernähren, du hast gar keinen Beruf. Und LokiSchmidt, Loki hat gesagt, aber ich habe einen Beruf, und ich verdiene auch Geld.
Schmidt weiß, wie wenig glaubhaft es klingt, wenn er behauptet, in seiner ganzen Militärzeit nur einem einzigen überzeugten Nazi begegnet zu sein. Und doch: So sei es nun mal gewesen. Kein Einziger seiner Vorgesetzten sei als Nazi aufgetreten. Doch alle hätten sie geglaubt, ihre patriotische Pflicht als Soldaten erfüllen zu müssen.[20] »Ihr bei der Marine habt ja von den Kriegsverbrechen kaum Kenntnis gehabt«, sagt er jetzt zu Siegfried Lenz, und also reden sie nun doch darüber, worüber sie nie redeten. »Ich habe dergleichen auch niemals miterlebt. Einmal, auf dem Heimweg von Moskau, der ein bisschen abenteuerlich verlief, habe ich einen Zug mit gefangenen Russen gesehen. Das war alles. Das war kein Verbrechen. Die größte Angst, die man hatte, war, in russische Gefangenschaft zu geraten. Man hatte weniger Angst vor dem Tod, man hatte Riesenangst vor sowjetischer Gefangenschaft und vor schwerer Verwundung.«