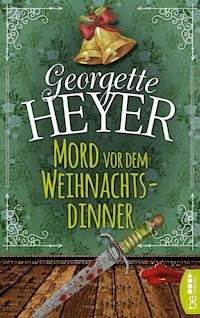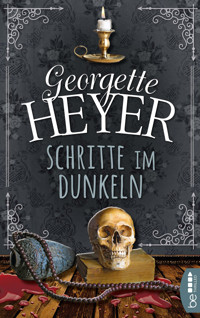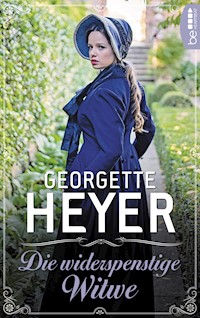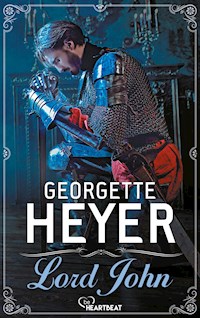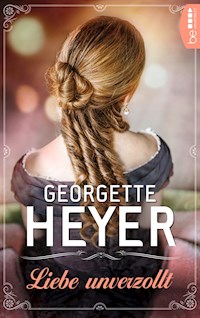
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Liebe, Gerüchte und Skandale - Die unvergesslichen Regency Liebesromane von Georgette
- Sprache: Deutsch
Derbyshire, 1817: In einer regnerischen Nacht gelangt John Staple, ein hünenhafter Gentleman, an eine Mautschranke. Doch weit und breit ist kein Zollwärter zu sehen - was ist hier geschehen? Der abenteuerlustige John beschließt spontan, sich als Schrankenwärter auszugeben und lernt dabei die eigenwillige Nell Stornaway kennen, die ihn um Hilfe bittet. Auf dem Landsitz ihres kranken Großvaters haben sich ungebetene Gäste einquartiert, die etwas Seltsames im Schilde zu führen scheinen. John ist von der mutigen jungen Frau zutiefst beeindruckt und nimmt sich der Sache an. Dabei bekommt er es ganz unstandesgemäß mit Dieben, Wegelagerern und anderen Strolchen zu tun. Aber um die Dame seines Herzens zu beschützen, ist ihm kein Weg zu weit ...
"Liebe Unverzollt" (Im Original: "The Toll-Gate") besticht mit faszinierenden Figuren, humorvollen Dialogen und genau recherchiertem historischen Hintergrundwissen. Ein spannender Regency-Klassiker von Georgette Heyer - jetzt als eBook bei beHEARTBEAT. Herzklopfen garantiert.
"Auch in diesem Roman nimmt uns Georgette Heyer mit auf eine abenteuerliche Reise durch das England des frühen neunzehnten Jahrhunderts und brilliert mit ihrem komödiantischen Talent ..." Chicago Sunday Tribune
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 497
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Über dieses Buch
Derbyshire, 1817: In einer regnerischen Nacht gelangt John Staple, ein hünenhafter Gentleman, an eine Mautschranke. Doch weit und breit ist kein Zollwärter zu sehen – was ist hier geschehen? Der abenteuerlustige John beschließt spontan, sich als Schrankenwärter auszugeben und lernt dabei die eigenwillige Nell Stornaway kennen, die ihn um Hilfe bittet. Auf dem Landsitz ihres kranken Großvaters haben sich ungebetene Gäste einquartiert, die etwas Seltsames im Schilde zu führen scheinen. John ist von der mutigen jungen Frau zutiefst beeindruckt und nimmt sich der Sache an. Dabei bekommt er es ganz unstandesgemäß mit Dieben, Wegelagerern und anderen Strolchen zu tun. Aber um die Dame seines Herzens zu beschützen, ist ihm kein Weg zu weit ...
Über die Autorin
Georgette Heyer, geboren am 16. August 1902, schrieb mit siebzehn Jahren ihren ersten Roman, der zwei Jahre später veröffentlicht wurde. Seit dieser Zeit hat sie eine lange Reihe charmant unterhaltender Bücher verfasst, die weit über die Grenzen Englands hinaus Widerhall fanden. Sie starb am 5. Juli 1974 in London.
Georgette Heyer
Liebe unverzollt
Aus dem Englischen von Emi Ehm
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Copyright © Georgette Heyer, 1954
Die Originalausgabe THE TOLL-GATE erschien 1955 bei William Heinemann.
Copyright der deutschen Erstausgabe:
© Paul Zsolnay Verlag GmbH, Hamburg/Wien, 1965.
Lektorat/Projektmanagement: Kathrin Kummer
Covergestaltung: Guter Punkt, München unter Verwendung von Motiven © Richard Jenkins Photography
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar (www.3wplusp.de)
ISBN 978-3-7517-0303-1
www.lesejury.de
Kapitel 1
Der Sechste Earl of Saltash ließ den Blick um die riesige Tafel schweifen und empfand ein warmes Gefühl der Befriedigung. Ein Gefühl, das allerdings weder sein Butler noch sein Haushofmeister teilten. Sie hatten beide noch unter dem Fünften Earl gedient und erinnerten sich wehmütig bis in die kleinsten Einzelheiten der verschiedenen Gelegenheiten, zu denen im großen Speisesaal für Angehörige des Königshauses, ausländische Gesandte und für die elegante Welt glänzende Gesellschaften gegeben worden waren. Der Fünfte Earl war eben ein Mann der Öffentlichkeit gewesen. Mit seinem Sohn verhielt sich das jedoch ganz anders; er hatte weder das Verlangen noch besaß er die Fähigkeiten, ein hohes Amt zu bekleiden. Ja, er hatte so wenig Aussicht, auch nur den belanglosesten Sprössling eines Königshauses zu bewirten, dass die Galaräume in Easterby überhaupt nicht mehr benutzt worden wären, hätte er sich nicht im Alter von dreißig Jahren mit Lady Charlotte Calne verlobt.
Da er jedoch der einzige überlebende Sohn des Fünften Earls war, konnte er nicht umhin, dieses Ereignis als eine Sache von beträchtlicher Bedeutung für die Familie anzusehen. Um dies zu unterstreichen, hatte er demnach alle erreichbaren Angehörigen des Hauses Staple nach Easterby geladen, damit sie seine zukünftige Frau kennenlernten. Ein schneller Überblick über seine mütterlichen Verwandten hatte genügt, ihn zu überzeugen, dass deren Anwesenheit bei diesem triumphalen Treffen sowohl unnötig wie auch unerwünscht gewesen wäre. Für die Staples war er als Chef der Familie ein Mann von Bedeutung, und nicht einmal seine herrische Schwester Albinia hätte ihm – zumindest nicht vor allen Leuten – den Respekt versagt, der ihm dank seiner Stellung zukam. Anders verhielt es sich mit den Timbercombes, die ihm gegenüber zu keiner Lehenstreue verpflichtet waren. Er brauchte daher nur wenige Minuten zu der Entscheidung, dass sie seine Verheiratung nichts anging.
Demnach setzten sich also unter der bemalten Decke des großen Speisesaals nur zwanzig Personen zum Diner. Und so kam es, dass der Earl am Kopfende einer Tafel, die sich unter der Last des Silbers bog und als Mittelstück einen ungeheuren, von irgendeinem fremden Potentaten dem Fünften Earl verehrten Tafelaufsatz trug, mit Genugtuung um sich blicken konnte.
Es machte ihm nichts aus, dass der Saal viel zu groß für die Gesellschaft war und um zwei Herren mehr als Damen anwesend waren. Denn die Staples hatten in höchst befriedigender Weise auf seine Einladung reagiert und benahmen sich – einschließlich seiner furchterregenden Tante Caroline – durchaus so, wie sie sollten. Er konnte sehen, dass Lady Melksham, seine zukünftige Schwiegermutter, beeindruckt war. Die meisten Staples waren ihr schon bekannt, aber seinen Onkel Trevor, den Archidiakon, der neben ihr saß, hatte sie erst heute kennengelernt, ebenso des Earls hünenhaften Vetter John. Saltashs unverheiratete Tante Maria, die ihm das Haus führte, hatte etwas Gewissensbisse gehabt, weil John einen geringeren Platz an der Tafel erhalten hatte, als seinem Rang zukam, hatte aber dem diesbezüglichen Wunsch des Earls nachgegeben. Sie wusste natürlich, dass ein Archidiakon Vorrang vor einem Captain der Dragoon Guards hatte, aber der Archidiakon war ihr jüngerer Bruder, und es fiel ihr daher schwer einzusehen, dass er eine besondere Stellung in der Welt einnahm. John hingegen war der einzige Sohn ihres zweiten Bruders und der voraussichtliche Erbe des Earl-Titels, womit er in ihren Augen eine wichtige Persönlichkeit war. Sie wagte das dem Earl zu sagen, und er war nicht unangenehm berührt; er meinte, dies sei eine sehr gerechtfertigte Bemerkung.
»Aber ich bin überzeugt, dem lieben John ist es gleichgültig, wo er sitzt!«, hatte Lady Maria tröstend hinzugefügt.
Der Earl hatte das Gefühl, dass das leider Gottes stimmte. Er hatte John sehr gern, war jedoch der Meinung, dass er viel zu wenig Gewicht auf seine Würde legte. Wahrscheinlich war er durch seine jahrelangen Feldzüge auf der spanischen Halbinsel etwas vergesslich in Bezug auf das geworden, was ihm und dem Namen, den er trug, zukam. Seine Manieren waren fast allzu ungezwungen, und er hatte sehr oft solche Schrullen, dass es seinen noblen Verwandten ernstlich entsetzte. Seine Taten auf der Halbinsel hatten ihn bei seinen Offizierskameraden sprichwörtlich gemacht, und zumindest eine seiner Handlungen seit seinem Ausscheiden aus der Armee im Jahre 1814 erschien dem Earl bis zur Ungehörigkeit wunderlich: Kaum hatte John erfahren, dass Napoleon wieder in Freiheit war, als er sich auch schon als gewöhnlicher Freiwilliger zur Armee zurückmeldete. Und als ihm der Earl vorhielt, dass die Pflicht ein solches Opfer seiner Würde nicht verlangte, war er in Gelächter ausgebrochen und hatte ausgerufen: »Oh Bevis, Bevis! Du wirst doch nicht annehmen, dass ich mir diesen Feldzug entgehen lasse – oder? Nicht um ein Vermögen! Zum Teufel mit ›Pflicht‹!«
Und damit war John wieder in den Krieg gezogen. Er war aber nicht lange in der bescheidenen Stellung eines Freiwilligen geblieben. Kaum hatte Colonel Clifton, der Kommandeur des 1. Dragonerregiments, gehört, dass der »Verrückte Jack« zurück sei, als er sich ihn auch schon als Sonderadjutanten holte. John ging aus der Schlacht bei Waterloo sehr angeregt und mit keiner ernsteren Verwundung als einem Säbelhieb und dem Streifschuss einer verirrten Kugel hervor. Der Earl freute sich sehr, ihn wieder sicher daheim zu sehen, und dachte, es sei allmählich Zeit, dass John sich niederlasse und eine standesgemäße Frauensperson heirate. John hatte einen kleinen Besitz von seinem Vater geerbt, war neunundzwanzig Jahre alt und hatte keine Brüder.
Daran dachte seine Lordschaft, als er um die Tafel blickte und seine Augen auf seiner angeheirateten Tante, der Ehrenwerten Mrs Staple, haften blieben. Er wunderte sich, dass sie ihren Sohn John noch immer nicht mit einer passenden Frau versorgt hatte, und nahm sich vor, die Sache vielleicht nachher ihr gegenüber aufs Tapet zu bringen. Er war zwar nicht ganz zwei Jahre älter als John, aber als Chef des Hauses fühlte er sich für seine Vettern verantwortlich. Das half ihm, das Gefühl der Unterlegenheit zu bewältigen, das ihn allzu oft ergriff, wenn er sich vor diese überwältigend hochgewachsenen Leute gestellt sah. Eine mächtige Rasse, diese Staples: Er war ja selbst groß, aber schmalschultrig, und ging gern leicht vorgeneigt. John natürlich war ein Riese; und dessen Schwester, Lady Lichfield, die sich mit entschlossener Liebenswürdigkeit mit dem sehr langweiligen Schwager des Earls, Mr Tackenham, unterhielt, maß barfuß einen Meter fünfundsiebzig. Auch Lucius Staple, das einzige Kind des dritten Sohnes des Vierten Earls, war groß; ebenso Arthur, der Älteste des Archidiakons, der sich soeben bemühte, seine Cousine Lettice zu unterhalten, die John über die Tafel hinweg mit Kalbsaugen anhimmelte. Selbst Lettices Bruder, der junge Geoffrey Yatton, versprach, obwohl er noch leicht schlenkrig war, dem Earl über den Kopf zu wachsen; und beider Mutter, Lady Caroline, konnte man nur als massig bezeichnen.
Die Verlobte des Earls, Lady Charlotte Calne, war über die prächtigen Ausmaße der Staples derart verblüfft, dass sie sich zu einer spontanen Bemerkung hinreißen ließ. »Wie riesig doch deine Vettern sind!«, sagte sie. »Sie sehen alle sehr gut aus; ungewöhnlich gut, glaube ich.«
Er war erfreut und sagte eifrig: »Meinst du wirklich? Aber weißt du, Lucius hat rotes Haar. Geoffrey sieht ja wirklich gut aus, aber Arthur ist meiner Meinung nach nicht überdurchschnittlich. Hingegen ist John wirklich ein schöner Mensch, nicht? Ich hoffe, du wirst ihn gern haben – alle mögen John gern! Ich selbst habe sehr viel für ihn übrig.«
»Wenn dem so ist, dann hat er auch auf meine Zuneigung Anspruch. Ich versichere dir, ich werde ihn äußerst gernhaben«, erwiderte die Dame pflichtbewusst.
Es war nicht das erste Mal, dass er sich zu der Wahl seiner Braut gratulierte. Da er nicht übermäßig sensibel war, fand er an der farblosen Art seiner Charlotte nichts auszusetzen; ja, es hätte ihn ziemlich überrascht, hätte er gewusst, dass sie von seiner Familie nicht allgemein gebilligt wurde. Zwar meinte Lady Maria, sie würde Bevis eine vortreffliche Frau sein, der Archidiakon, sie sei ein Mädchen mit hübschen Manieren, und Lady Caroline, ihr einziger Fehler sei der Mangel an Mitgift; jedoch war zu merken, dass sich Mrs Staple zurückhielt, eine Meinung zu äußern, und Mr Yatton ging sogar so weit zu sagen – allerdings nicht in Hörweite seiner Gemahlin – für seinen Geschmack hänge sie viel zu sehr an ihrer Mutter.
Die jüngere Generation sprach sich viel offener aus. Nur die Schwester des Earls, die sehr wesentlich am Zustandekommen der Verbindung beteiligt gewesen war, billigte Lady Charlotte voll und ganz. Miss Yatton verkündete mit der ganzen Selbstsicherheit einer jungen Dame, die eine erfolgreiche Londoner Season hinter sich hatte, Charlotte sei ein altmodisches Ding. Ihr Bruder Geoffrey vertraute seinem Vetter Arthur an, er persönlich würde lieber einen kalten Breiumschlag heiraten; und Captain Staple, der sich Lady Charlottes liebenswürdiger Entschlossenheit, ihn gut leiden zu wollen, nicht bewusst war, erwiderte das spöttische Heben von Lucius’ sandfarbenen Brauen mit einer ausdrucksvollen Grimasse.
Beide standen nach dem Diner an einem Ende des Roten Salons beisammen. Lucius kicherte und sagte: »Oh, sie passt Bevis recht gut.«
»Hoffentlich. Mir würde sie nicht passen!«, sagte der Captain. Er schaute sich in dem prunkvollen Raum um. »Eine grässliche Gesellschaft!«, entschied er. »Was, zum Teufel, hat Saltash veranlasst, alle seine Verwandten aufzutischen? Es genügt, um das Mädchen zur Auflösung der Verlobung zu treiben. Himmel, und da kommt auch noch mein Onkel auf uns zu! Wäre ich doch bloß nicht so dumm gewesen, herzukommen!«
»Na, mein lieber Junge!«, sagte der Archidiakon honigsüß und legte dem Captain liebreich eine Hand auf die breite Schulter. »Wie geht’s, wie steht’s? Aber da muss man nicht erst fragen – es geht dir natürlich glänzend! Ein frohes Ereignis hier, nicht?«
»Ja, falls Bevis dieser Ansicht ist«, erwiderte der Captain.
Der Archidiakon hielt es für das Beste, den tieferen Sinn dieser Antwort zu überhören. Er sagte: »Ein junges Frauenzimmer bester Herkunft! Aber jetzt heraus damit – wann werden wir denn deine bevorstehende Verehelichung feiern, du Riesengeschöpf?«
»Noch nicht, Sir – ich bin noch nicht auf Brautschau. Und sollte ich mich je verloben«, fügte er hinzu, und seine blauen Augen schweiften nachdenklich durch das Zimmer, »dann würde ich, beim Jupiter, das Ereignis bestimmt nicht so feiern!«
»Na, Jack«, bemerkte Lucius, als ihr Onkel mit einem mechanisch liebenswürdigen Lächeln weiterging, »du verstehst es, den Feind zurückzutreiben, wie?«
»Das wollte ich nicht. Glaubst du, dass er beleidigt ist?« Captain Staple brach ab, und seine Augen weiteten sich vor Misstrauen und Bestürzung. »Großer Gott, Lucius, sieh dir das bloß an!«, stieß er hervor.
Lucius folgte dem entsetzten Blick. Ein Lakai hatte vorsichtig eine vergoldete Harfe in den Salon hereingetragen, und Lady Charlotte wurde dringend gebeten, ihr Haupttalent zu entfalten, während ihre Mama Mrs Staple selbstgefällig informierte, dass die Stimme ihres Töchterchens von den ersten Meistern geschult worden war. Während Lord Saltash eifrig, die älteren Damen der Gesellschaft höflich Charlotte baten, doch ihre Schüchternheit zu überwinden, schlich sich der Bruder der Dame, Lord Melksham, durch den Salon und schlug Lucius vor, sie sollten Ralph Tackenham schnappen – wie er sich ausdrückte – und sich mit Captain Staple zu einer ruhigen Whistpartie aus dem Salon zurückziehen.
»Mit Freuden!«, antwortete Lucius. »Aber du wirst draufkommen, dass Ralphs Frau ihm nicht erlaubt, mitzukommen, soweit ich meine Cousine Albinia kenne!«
»Dann schnapp ihn eben, wenn sie nicht herschaut«, sagte Lord Melksham hoffnungsfroh. »Ralph hat eine stille Partie sehr gern!«
»Nein, das geht nicht.« Captain Staple sprach sehr entschieden. »Wir müssen – und werden! – hierbleiben und dem Vortrag deiner Schwester zuhören.«
»Aber die wird doch ewig weitersingen!«, wandte Seine Lordschaft ein. »Außerdem lauter fades Zeug, kann ich euch versichern!«
Aber Captain Staple schüttelte den Kopf, ging zu der Gruppe, die sich um die schöne Harfenistin sammelte, und setzte sich, einem einladenden Lächeln seiner Cousine Lettice folgend, auf ein kleines Sofa neben sie.
»Das wird ja grässlich werden!«, flüsterte Miss Yatton.
»Sehr wahrscheinlich«, sagte er zustimmend. Er wandte sich zu ihr und schaute mit einem Lächeln in den Augen auf sie herab. »Du bist aber sehr groß geworden, seit ich dich das letzte Mal gesehen habe, Letty. Ich nehme an, du hast debütiert?«
»Heiliger Himmel, natürlich! Gleich zu Beginn der Saison! Wärst du in London gewesen, dann wüsstest du, dass ich einen ganz beträchtlichen Erfolg hatte!«, sagte Miss Yatton, die ihr Licht nie unter den Scheffel stellte. »Stell dir bloß vor – Papa erhielt drei Heiratsanträge für mich! Natürlich ganz unstandesgemäß, aber immerhin – denk nur, gleich drei, und in meiner allerersten Saison!«
Er amüsierte sich, gebot ihr jedoch Stille, weil sich Lady Charlotte nunmehr an der Harfe niedergelassen hatte. Er legte seine große Hand auf die seiner lebhaften jungen Cousine und drückte sie ermahnend. Miss Yatton, die ein vollendet kokettes Persönchen zu werden versprach, gehorchte dem unausgesprochenen Befehl, warf ihm aber einen so spitzbübischen Blick zu, dass seine Schwester, die ihn und das Lächeln bemerkt hatte, mit dem es aufgenommen wurde, sofort erschrak und beschloss, bei der ersten Gelegenheit die Aufmerksamkeit ihrer Mutter auf eine Gefahr zu lenken, die dieser vielleicht entgangen war.
Aber Mrs Staple, der ihre Tochter ungefähr zwei Stunden später einen Besuch abstattete, hörte sich die Warnung mit unerschütterlicher Gelassenheit an und sagte nur: »Heiliger Himmel, habe ich nur deshalb meine Zofe wegschicken müssen, weil du mir das zu sagen hast, Fanny?«
»Aber, Mama, sie hat das ganze Diner hindurch mit ihm geliebäugelt! Und die Art, wie er ihre Hand genommen und sie angelächelt hat! Ich versichere dir –«
»Das alles habe ich bemerkt, mein Liebes, und es hat mich stark daran erinnert, wie er mit seinen Hundejungen umgeht.«
»Hundejungen!«, rief Lady Lichfield aus. »Letty ist aber kein Hundejunges, Mama. Ja, ich halte sie für eine abgefeimte kokette Person, und mir ist einfach unbehaglich zumute. Du wirst zugeben, dass sie für meinen Bruder nicht das Passende ist.«
»Rege dich doch nicht auf, meine Liebe«, antwortete Mrs Staple und band sich die Bänder ihrer Nachthaube unter dem Kinn fest. »Ich hoffe nur, sie unterhält ihn genügend, um ihn hier über das Wochenende festzuhalten, obwohl ich gestehen muss, dass ich das sehr bezweifle. Meine liebe Fanny, hat man je schon einmal eine so fade Angelegenheit erlebt?«
»Oh, noch nie!«, stimmte ihr die Tochter bereitwillig zu. »Aber, Mama, wie grässlich, wenn John sich in Letty Yatton verlieben würde!«
»Das befürchte ich durchaus nicht«, erwiderte Mrs Staple ruhig.
»Er schien aber ganz angetan von ihr zu sein«, sagte Fanny. »Ich frage mich nur, ob Lettys Lebhaftigkeit ihm vielleicht das sanftere Betragen der lieben Elizabeth – nun, zahm erscheinen lässt!«
»Du machst aus einer Mücke einen Elefanten«, sagte Mrs Staple. »Sollte er für Elizabeth etwas empfinden, dann wäre ich äußerst glücklich. Aber ich hoffe, ich bin nicht so dumm, dass ich mein ganzes Herz an diese Verbindung hänge. Verlasse dich darauf, dein Bruder ist sehr gut imstande, sich selbst eine Frau zu suchen.«
»Mama! Wie kannst du nur so aufreizend sein?«, rief Fanny aus. »Wenn wir beide uns doch so viel Mühe gegeben haben, John und Elizabeth zusammenzubringen, und du sie sogar für nächste Woche nach Mildenhurst eingeladen hast!«
»Das stimmt schon«, erwiderte Mrs Staple unerschütterlich. »Und es würde mich nicht wundern, wenn John Elizas ruhige Vernunft nach drei in Lettys Gesellschaft verbrachten Tagen willkommen wäre – falls es der kleinen Range überhaupt gelingt, ihn so lange hierzuhalten.«
Fanny schaute etwas zweifelnd drein, aber ein Klopfen an der Tür hinderte sie, etwas zu erwidern. Mrs Staple hieß den späten Besucher hereinkommen, fügte dabei aber leise hinzu: »Vorsicht! Das ist John – ich kenne sein Klopfen.«
Es war tatsächlich Captain Staple; er trat ein und sagte: »Darf ich hereinkommen, Mama? Hallo, Fan! Habt ihr Geheimnisse miteinander?«
»Heiliger Himmel, nein! Falls du es nicht für ein Geheimnis hältst, dass das die langweiligste Gesellschaft war, die je gegeben wurde!«
»Genau das«, sagte John vertraulich. »Wenn du nichts dagegen hast, Mama, glaube ich, reite ich morgen früh lieber ab.«
»Du bleibst nicht bis Montag?!«, rief Fanny. »Aber du kannst doch nicht einfach so verschwinden!«
»Ich verschwinde ja gar nicht. Ich wurde eingeladen, um die Braut kennenzulernen, und das habe ich getan.«
»Aber du kannst doch Bevis nicht sagen, dass du nicht mehr hierbleiben willst!«
»Praktisch habe ich es ihm schon gesagt«, sagte John etwas schuldbewusst. »Ich habe ihm erzählt, dass ich eine Verabredung mit Freunden habe, weil ich das nicht so aufgefasst hätte, dass ich länger als eine Nacht hierbleiben sollte. Aber, Fan, mach doch kein solches Gesicht! Wenn du glaubst, dass Bevis beleidigt war, dann irrst du dich gewaltig!«
»Na schön, mein Junge«, schaltete sich seine Mutter ein, bevor Fanny noch etwas sagen konnte. »Gedenkst du heimzureiten? Ich muss dir ja gestehen, dass mir auch nichts lieber wäre, als meinen Besuch ebenfalls schon morgen zu beenden, aber ich kann das nicht, ohne Tante Maria zu verstimmen.«
»Nein, nein, Mama, ich denke nicht daran, dich mit fortzuschleppen!«, versicherte er ihr. »Um die Wahrheit zu gestehen, ich habe daran gedacht, ich könnte einen Abstecher ins Leicestershire machen, um Wilfred Babbacombe zu besuchen. Er müsste jetzt dort sein, weil doch die Fuchsjagd begonnen hat.« Er las Missbilligung in den Augen seiner Schwester und fügte hastig hinzu: »Es wäre ein Jammer, wenn ich’s nicht täte, da ich schon einmal in der Gegend bin.«
»In der Gegend! Easterby muss an die sechzig Meilen von Leicester entfernt liegen, wenn nicht noch weiter!«
»Nun also, wenn ich schon im Norden bin«, verbesserte sich der Captain.
»Aber du wirst doch Mama nicht ohne Begleitung nach Mildenhurst zurückfahren lassen!«
»Nein, natürlich nicht. Mein Kammerdiener wird sie begleiten. Du hast doch nichts dagegen, dass Cocking statt meiner neben der Chaise reitet, oder, Mama? Du bist bei ihm gut aufgehoben.«
»Durchaus nicht, mein Junge. Aber solltest du ihn nicht lieber selbst mitnehmen?«
»Himmel, nein! Ich nehme alles, was ich brauche, in einer Satteltasche mit und brauche ihn nicht im Geringsten.«
»Wann«, fragte Fanny mit einem unheilschwangeren Ausdruck in den Augen, »hast du vor, nach Mildenhurst zurückzukehren?«
»Oh, ich weiß nicht!«, sagte ihr Bruder, der einen rasend machen konnte. »Ungefähr in einer Woche, vermutlich. Warum?«
Ein zwingender Blick von Mama verbot es Fanny, diese Frage zu beantworten, daher ließ sie sich ihre Missbilligung nur ansehen. Mrs Staple sagte: »Es ist völlig unwichtig. Ich habe nächste Woche ohnehin Freunde in Mildenhurst zu Gast, also brauchst du nicht zu fürchten, dass ich mich einsam fühlen könnte, John.«
»Oh, dann ist das ja großartig!«, sagte er erleichtert. »Weißt du, Mama, ich weiß nicht, wie das kommt – ob es mein Onkel ist mit seiner bombastischen Art, oder Tante Caroline, oder das Lachen von Lucius, oder Ralph Tackenham mit seinem ewigen langweiligen Gerede, oder der junge Geoffrey, der den Stutzer spielt, oder einfach nur dieses teuflische Schicklichkeitsgetue auf Easterby – aber ich halte es hier einfach nicht aus!«
»Ich verstehe dich«, versicherte ihm die Mutter.
Er beugte sich zu ihr hinunter, umarmte sie und gab ihr einen Kuss. »Du bist doch die beste Mutter der Welt!«, sagte er. »Und außerdem ist das ein ganz reizendes Nachthäubchen, Ma’am. Ich muss gehen: Melksham will jetzt eine Pharo-Bank eröffnen, und Bevis mag das überhaupt nicht. Der arme alte Junge! Der wird Melksham nie richtig behandeln können, wenn Melksham einen Schwips hat, und den hat er von sieben Tagen der Woche sechs. Den Burschen hat man auch nicht mit Wasser getauft. Der ist noch vor Tagesanbruch betrunken wie ein Artillerist.«
Mit dieser unheilschwangeren Prophezeiung zog sich der Captain zurück und ließ seine Mutter unerschüttert, seine Schwester schäumend vor Zorn zurück. Kaum hatte sich die Tür hinter ihm geschlossen, als Fanny auch schon, ausrief: »John ist doch das ärgerlichste Geschöpf auf Erden! Wie hast du ihn nur gehen lassen können, Mama? Du weißt doch, wie er ist! Wetten, du siehst ihn einen Monat lang nicht wieder. Und jetzt wird er nicht einmal Elizabeth kennenlernen.«
»Das ist zwar ein Pech, aber ich verzweifle nicht«, erwiderte Mrs Staple und lächelte leicht. »Und was das Fortlassen betrifft – einen Mann von neunundzwanzig Jahren, Liebes, kann man nicht mehr am Gängelband halten. Außerdem – hätte ich ihn gezwungen, heimzukommen, damit er Elizabeth kennenlerne, so bin ich überzeugt, dass sie ihm von vornherein verleidet gewesen wäre.«
»Nun«, sagte Fanny verärgert, »meiner Meinung nach ist er einfach unausstehlich, Ma’am!«
»Sehr richtig, Liebes – alle Männer sind einfach unausstehlich«, sagte Mrs Staple zustimmend. »Ich gehe jetzt zu Bett, und du tust am besten das Gleiche.«
»Ja, sonst fragt sich Lichfield, was aus mir geworden ist«, sagte Fanny und stand auf.
»Das tut er keineswegs«, antwortete ihre Mutter kühl. »Lichfield, mein liebes Kind, ist nicht weniger unausstehlich als jeder andere Mann und spielt ohne Zweifel in diesem Augenblick unten Pharo.«
Fanny gab die treffende Wahrscheinlichkeit dieser Äußerung damit zu, dass sie ihrer Mutter würdevoll gute Nacht wünschte.
Kapitel 2
Captain Staple sollte es nicht bestimmt sein, Easterby am folgenden Morgen schon zu früher Stunde zu verlassen. Dank den nächtlichen Gewohnheiten Lord Melkshams war es heller Tag, als er zu Bett ging. Nachdem man diesen liebenswürdigen, aber sprunghaften Aristokraten davon abgebracht hatte, eine Pharo-Bank zu eröffnen, hatte er die Gesellschaft zu einem stillen Lu-Spiel aufgefordert. Und da die älteren Mitglieder der Gesellschaft, zu denen außer dem Archidiakon, seinem Schwager, Mr Yatton, auch der Kaplan des Earls, Mr Merridge, gehörten, sich bald nach den Damen zurückgezogen hatten und der Earl offenkundig nicht imstande war, das Spiel in Grenzen zu halten, hatte es Captain Staple nicht übers Herz gebracht, ihn im Stich zu lassen. Der Earl war ihm dankbar, wollte es aber nicht zulassen, dass John die Gesellschaft bewege, Schluss zu machen, was er durchaus zu tun bereit war. Der Earl sagte: »Nein, nein, wenn Melksham einmal zu etwas entschlossen ist – er ist mein Gast, und außerdem – na ja, du verstehst ja, wie das ist!«
»Nein, das verstehe ich nicht«, sagte John rundheraus. »Wenn ich an deiner Stelle wäre, alter Junge, dann würde ich es in meinem eigenen Haus so zugehen lassen, wie ich es wünsche!«
Nach einem einzigen Blick auf das zwar gutmütige, aber energische Gesicht des Captains hätte niemand daran gezweifelt. Der Earl sagte verdrießlich: »Ja, aber das verstehst du nicht! Du hast gut reden – aber es ist ja egal. Die Hauptsache ist – du weißt ja, wie Lucius ist, und dieser stupide Schwager von mir. Und Onkel Yatton ist einfach verschwunden, und der junge Geoffrey kann tun, was ihm passt! Ich wollte, du bliebest und hilfst mir, drauf zu schauen, dass sie die Grenze wahren!«
Also blieb Captain Staple, obwohl er kein Spieler war; und wenn es ihm auch nicht gelang, die Einsätze so niedrig zu halten, wie sich das sein nobler Vetter von ihm gewünscht hatte, so gelang es ihm doch, zu verhindern, dass das ruhige Lu-Spiel zu einem äußerst lautstarken Lu-Spiel wurde. Als Lord Melksham dieser Belustigung müde geworden war und ein Brag-Spiel begann, war der junge Mr Yatton seinen Getränken erlegen, was, wie der Captain den Earl heiter informierte, ein sehr glücklicher Umstand war, denn damit war es mit seinen Verlusten aus. Nachdem er Geoffrey ins Bett hinaufgebracht hatte, hielt er gleich darauf seinem eigenen Schwager den Kopf unter die Pumpe im Waschhaus, lenkte die schwankenden Schritte seines Vetters Arthur die Treppe empor und überzeugte Lord Melksham sanft, aber fest, dass es besser wäre, sich ins Bett zurückzuziehen, als die Lautstärke eines Jagdhorns auszuprobieren, das dieser in der Großen Halle entdeckt hatte.
Nach einer so anstrengenden Nacht war es nicht überraschend, dass der Captain bis tief in den Morgen hinein schlief. Er verließ Easterby erst nach Mittag, und hätte er auf die Vorhaltungen seines Gastgebers und seiner Schwester gehört, dann hätte er es an jenem Tag überhaupt nicht verlassen. Man wies ihn darauf hin, dass der Himmel schlechtes Wetter androhe, dass er nicht hoffen konnte, mehr als nur einige Meilen seiner Reise hinter sich zu bringen, und dass er gut daran täte, den ganzen Plan, ins Leicestershire zu reiten, überhaupt aufzugeben. Aber ein zu erwartender Regen verwirrte einen Mann nicht sehr, der daran gewöhnt gewesen war, auf der spanischen Halbinsel und in den Pyrenäen unter schlimmsten Umständen zu biwakieren; und die Aussicht, irgendwo unterwegs in einem Gasthof übernachten zu müssen, erschien ihm wünschenswerter als ein weiterer von Lord Melkshams geselligen Abenden. Daher führte Cocking, der ihn als sein privater Diener auf allen seinen Feldzügen begleitet hatte, seinen großen Goldfuchs mit der römischen Nase vor, schnallte einen schweren Friesmantel und die Tasche mit allem, was der Captain für seine Reise für nötig hielt, an den Sattel. Sein übriges Gepäck bestand aus zwei Koffern, und diese sollte Cocking über Johns Anweisung mit dem Lohnfuhrmann nach Edenhope, dem Jagdhaus Mr Babbacombes im Leicestershire, senden. Der Anblick zweier so bescheidener Gepäckstücke veranlasste Lord Melkshams Diener, eine sehr überlegene Persönlichkeit, zu staunen, dass ein Gentleman so spärlich ausgerüstet über Land reiste. Sein Herr, sagte er, rühre sich nie ohne mehrere Koffer, einen Toilettekoffer und ihn, einen höchst talentierten Kammerdiener, von zu Hause fort. Aber seiner Aufgeblasenheit wurde schnell ein Hieb versetzt. Cocking antwortete sofort, da gebe es nichts zum Naserümpfen. »Wenn der Captain ein bleicher Nichtstuer auf zwei Zahnstochern wäre, dann brauchte er natürlich einen Wicht wie dich, der ihm die Waden ausstopft und ihn herausputzt«, sagte er. »Nur ist er das eben nicht! Möchtest du vielleicht sonst noch was über den Captain verlauten lassen?«
Lord Melkshams Diener beschloss vorsichtigerweise, dass er nichts mehr zu sagen wünschte und erklärte diese Enthaltsamkeit seinen Kollegen später damit, sie sei auf sein Widerstreben zurückzuführen, mit einem ordinären Stänkerer einen Wortwechsel zu führen. Cocking, dem das Feld geräumt worden war, lud sorgfältig die Pistolen des Captains, steckte sie in die Sattelhalfter und führte den Goldfuchs zum Haus. Der Captain in Lederreithose und Stiefeln und einem Mantel von leicht militärischem Schnitt gab ihm einige letzte Anweisungen und bestieg das große Pferd. Cocking, eine Hand am Zügel, schaute zu ihm auf und fragte, ob er zu ihm nach Edenhope kommen solle, sowie er die Herrin sicher heimgeleitet haben würde.
»Nein, es könnte sein, dass du mich dort nicht antriffst. Außerdem werde ich dich nicht brauchen.«
»Nun ja, Sir, möglich, aber eigentlich möchte ich gern wissen, wer Ihr Lederzeug reinigen soll?«, fragte sein getreuer Knappe.
»Ich weiß nicht. Mr Babbacombes Diener vermutlich.«
»Ho!«, sagte Cocking. »Das wird Mr Babbacombes Diener schön aufbringen, bestimmt! Aber natürlich, ganz wie Sie wünschen, Sir!«
Als sein Herr die Allee hinunterritt, sah er ihm nach und schüttelte den Kopf. Einem Spatzen, der einige Meter weit vor ihm herumhüpfte, vertraute er seine nächsten, etwas undurchsichtigen Bemerkungen an. »Nervös, sehr nervös!«, sagte er und schaute den Vogel streng an. »Wenn du mich fragst, so würde ich sagen, wir werden ihn im Handumdrehen mitten in irgendeinem Wirbel haben!«
Der Captain hatte zwar nicht die geringste Absicht, in irgendeinen Wirbel zu geraten, war aber herzlich froh, aus Easterby entkommen zu sein. Es gab dort nichts, was die Langeweile unterbrach, als die milden Exzesse Lord Melkshams, und die fand John nicht unterhaltsam. Das Leben seines Vetters war umhegt von all der Wohlanständigkeit, die den Captain vor acht Jahren dazu getrieben hatte, seinen Vater zu überreden, ihn in die Armee einzukaufen. Er hatte das starke Gefühl, dass eine kriegführende Armee genau das Richtige für ihn sein würde, und die Ereignisse hatten ihm recht gegeben. Das Leben auf der Halbinsel war voll Ungewissheit gewesen, unbequem und häufig dem Zufall ausgeliefert, aber es hatte alle möglichen Abenteuer geboten, und John hatte sich keinem entzogen. Er hatte es ungeheuer genossen, und am intensivsten dann, wenn er an irgendeinem gefährlichen Unternehmen teilnahm. Aber als der Krieg 1814 zu Ende war, wusste er bei aller Freude über den Sturz Bonapartes, die er mit allen teilte, dass damit die Lebensweise, die er liebte, ebenfalls zu Ende war. Das langweilige Soldatenleben in Friedenszeiten war nichts für einen John Staple. Er gab schließlich den Bitten seiner Mutter nach und quittierte den Dienst. Da sein Vater ein Jahr zuvor gestorben war, würde er, so meinte sie, eine Menge mit der Verwaltung seines Gutes zu tun haben. John Staple der Ältere war ein träger Mann gewesen, und einige Monate lang musste sein Sohn tatsächlich viel arbeiten. Dann aber war die Nachricht von Bonapartes Flucht aus Elba und damit wieder eine kurze Periode aufregender Beschäftigung für John gekommen. Nun jedoch war Bonaparte schon seit zwei Jahren Gefangener auf St. Helena, und jedermann schien das Gefühl zu haben, dass sich John zu einem Leben ziviler Ehrbarkeit niederlassen sollte. Er selbst hatte das gleiche Gefühl und versuchte, zufrieden zu sein, aber von Zeit zu Zeit packte ihn Rastlosigkeit. Wenn das geschah, konnte man nie voraussagen, was er unternehmen würde. Nur eines konnte man mit Sicherheit annehmen, wie sein Schwager düster sagte: dass es etwas Schrullenhaftes und möglicherweise unerhört Skandalöses sein würde. Lord Lichfield hatte allen Grund zu vermuten, dass John einmal einige Wochen lang mit einer Zigeunergruppe umhergewandert sei; und er würde nicht so leicht Johns plötzliche Ankunft um Mitternacht in seinem Haus in Lincolnshire vergessen, in fremdartiger, schandbarer Kleidung. »Guter Gott, was hast du getrieben?«, hatte der Lord ausgerufen.
»Schmuggel!«, hatte John geantwortet und ihn angegrinst. »Ich bin froh, dass du daheim bist. Ich brauche ein Bad und reine Kleider.«
Lord Lichfield war zu entsetzt gewesen, um mehr zu tun, als ihn eine volle Minute lang anzuglotzen. Natürlich war es nicht so schlimm gewesen, wie John es hatte klingen lassen. Die ganze Sache hatte sich aus einem Unglücksfall ergeben. »Aber ich sage dir Folgendes, Fanny«, hatte Seine Lordschaft später geklagt: »Wenn ich segeln gehe und in eine Bö gerate und ums Leben schwimmen muss, werde ich dann von einem Schmugglerschiff aufgefischt? Natürlich nicht! Niemandem außer John würde so was passieren! Außerdem – niemand außer John würde die Reise mit einer Bande schurkischer Räuber fortsetzen oder gar ihnen helfen, ihre Branntweinfässer an Land zu bringen! Aber selbst wenn mir so etwas passiert wäre, dann wäre ich nicht am Leben geblieben, um die Geschichte erzählen zu können. Mir hätten sie eins über den Kopf gehauen und mich über Bord geworfen.«
»Ich begreife nicht, wie es zugegangen ist, dass sie ihn verschont haben!«, hatte Fanny gesagt. »Oh, ich wünsche mir sehnlichst, dass er keine solchen Sachen machte!«
»Ja«, sagte ihr Herr und Gebieter zustimmend. »Obwohl er, wohlgemerkt, sehr gut imstande ist, auf sich selbst aufzupassen.«
»Aber in der Gewalt einer ganzen Schmugglerbande!«
»Ich vermute, dass sie ihn gernhatten.«
»Ihn gernhatten?!«
»Na ja, man muss ihn einfach gernhaben!«, erklärte Seine Lordschaft. »Er ist ein sehr charmanter Bursche – und ich wünschte zu Gott, dass er sich endlich niederließe und aufhörte, diese tollen Streiche anzustellen!«
»Mama hat recht«, erklärte Fanny, »wir müssen eine passende Frau für ihn finden.«
Fanny und ihre Mama fanden auch tatsächlich eine Anwärterin um die andere für diesen Posten und stellten sie listig John in den Weg. Scheinbar gefielen sie ihm – aber leider alle. Mit der einen konnte man sich sehr nett unterhalten, die andere schien ihm ein recht lebhaftes Mädchen zu sein, eine dritte bemerkenswert hübsch – aber keine bat er um ihre Hand. Als ihn seine Schwester einmal zu fragen wagte, ob er denn je verliebt gewesen sei, hatte er ganz ernst geantwortet, ja, er glaube schon, dass er die Frau des Pförtners verzweifelt geliebt habe, die ihm immer Pfefferkuchen gegeben und ihm erlaubt hatte, die Frettchen, die Mama so sehr verabscheut hatte, in einem Ställchen vor ihrer Küchentür zu halten. Nein, in Lissabon hatte es ein Mädchen gegeben, als er das erste Mal bei der Armee war. Juanita – oder hieß sie Conchita? Er konnte sich nicht mehr erinnern, aber jedenfalls war es das lieblichste Geschöpf gewesen, das man je gesehen hatte. Dunkel, natürlich, mit den größten Augen und wohlgedrechselten Fesseln! War er in sie verliebt gewesen? »Himmel, ja!«, antwortete John. »Alle waren wir in sie verliebt.«
Er gab zu, dass es für ihn an der Zeit sei, ans Heiraten zu denken. Natürlich nicht Fanny gegenüber, aber Mama gegenüber. »Nun ja, ich weiß, Mama«, sagte er entschuldigend. »Aber die Sache ist die, dass ich keinen Geschmack an diesen verflixten sogenannten passenden Partien finde, wo man sich in Wirklichkeit keinen Deut aus dem Mädchen macht und umgekehrt. Ich habe nicht vor, um ein Mädchen anzuhalten, das mich nicht einfach umschmeißt. Daher werde ich vermutlich Junggeselle bleiben, denn sie tun’s einfach nicht – keine von ihnen! Und wenn doch eine käme«, fügte er nachdenklich hinzu, »dann ist eins zu zehn zu wetten, dass sie dir nicht gefallen würde!«
»Mein liebster Junge, mir würde jedes Mädchen gefallen, das du liebst«, erklärte Mrs Staple.
Er grinste anerkennend über diese tapfere Verlogenheit und sagte: »Das war eine Bombenlüge!«
Sie gab ihm einen Klaps. »Abscheulicher Bub! Jammerschade jedenfalls, dass wir nicht in archaischen Zeiten leben. Was dir gefiele, mein Sohn, wäre, irgendein Frauenzimmer vor einem Drachen oder Menschenfresser zu retten!«
»Ein famoser Spaß, Streit mit einem Drachen zu bekommen«, sagte er zustimmend. »Solange man nachher das Mädchen nicht für immer am Hals hat, was aber, wie ich vermute, bei den Burschen damals der Fall war.«
»Solche Mädchen«, erinnerte ihn seine Mutter, »waren immer sehr schön.«
»Und ob! Aber außerdem tödlich langweilig, verlass dich drauf! Ja, ich wäre gar nicht überrascht, wenn die Drachen sehr froh gewesen wären, sie wieder los zu sein«, sagte John.
Das klang ja nun nicht sehr vielversprechend. Aber Fanny hatte Elizabeth Kelfield entdeckt, und Mrs Staple hatte nach einem sorgfältigen und kritischen Studium der Miss Kelfield zur Kenntnis genommen, dass es endlich eine junge Dame war, die Johns Gefallen durchaus erregen konnte. Sie war dunkel; sie war entschieden schön; sie besaß ein ansehnliches Vermögen; und obwohl sie noch nicht ganz zwanzig Jahre alt war, erschien sie älter, da sie durch den Umstand, dass sie die Last eines Haushalts von der kränkelnden Mutter übernommen hatte, eine Selbstsicherheit besaß, die über ihre Jahre hinausging. Mrs Staple meinte, sie habe Qualität, und begann die Freundschaft der kränkelnden Mrs Kelfield zu kultivieren.
Und jetzt, da man Mutter und Tochter dafür gewonnen hatte, nach Mildenhurst zu kommen, ging John einfach ins Leicestershire auf und davon, sodass alles so sorgfältig um seinetwillen unternommene Pläneschmieden sehr wahrscheinlich umsonst gewesen war.
In glücklicher Unkenntnis alles dessen befand sich Captain Staple, nachdem er die Abhänge der Pennines erklommen hatte, in einer wilden Moorlandschaft, und sie gefiel ihm. Da er einen guten Orientierungssinn besaß, hatte er so bald wie möglich die Mautstraße und damit in ganz kurzer Zeit alle Anzeichen der Zivilisation verlassen. Das passte genau zu seiner Stimmung, und er ritt in bequemem Tempo in südöstlicher Richtung über die Moore. Ursprünglich hatte er vorgehabt, die Nacht in Derby zu verbringen, aber sein später Aufbruch hatte das unmöglich gemacht. So wurde Chesterfield sein Ziel. Das war aber noch, bevor sein Goldfuchs ein Hufeisen verlor. Als das geschah, hatte der Captain massenhaft Zeit, zu bereuen, dass er die Landstraße verlassen hatte, denn nun schien er sich mitten in einer riesigen Einöde zu befinden. Die wenigen Behausungen über Meilen hin waren gelegentlich ein Bauernhaus und einige derbe Schuppen, die zum Schutz der Hirten über die Moore verstreut dalagen. Es dämmerte schon, als der Captain, Beau am Zügel führend, vom Moor in ein kleines Dorf gelangte, das stolz nicht nur eine Schmiede, sondern sogar eine Schenke sein eigen nannte. Der Schmied war schon heimgegangen. Und als man ihn schließlich von zu Hause geholt und das Feuer wieder angefacht hatte, war nicht nur der letzte Funke Tageslicht verschwunden, sondern es hatte auch der Regen, der den ganzen Tag gedroht hatte, zu fallen begonnen. Es gab zwar keine Übernachtungsmöglichkeit in der Schenke, wohl aber für Mann und Tier Essen. Captain Staple nahm ein herzhaftes Mahl aus Schinken und Eiern zu sich, zündete einen seiner spanischen Zigarillos an und trat ins Freie, um zu schauen, ob Aussicht bestand, dass das Wetter aufklarte. Es bestand nicht die geringste. Der Regen fiel mit hartnäckiger Gleichmäßigkeit, und es war kein Stern zu sehen. Der Captain machte sich auf einen nassen Ritt gefasst und fragte den Wirt um Rat. Das aber wurde zu seinem Verhängnis. Der würdige Mann kannte nicht nur einen einige Meilen entfernten gemütlichen Gasthof, sondern, eifrig bemüht, sich hilfreich zu erweisen, dirigierte er den Captain auf dem, wie er ihm versicherte, kürzesten Weg hin. Er sagte, er könne ihn nicht verfehlen, und zweifellos hätte ihn der Captain auch nicht verfehlt, wenn der Wirt es nicht unterlassen hätte, ihm zu sagen, dass er bei seinem Rat, den ersten Weg rechts zu nehmen, nicht die Wagenspur meinte, die, wie jeder Einheimische jener Gegend wusste, sich aufwärts zum Moor wand und dort an einem kleinen Bauernhaus endete. Erst eine Stunde später fand der Captain, auf seinen Instinkt vertrauend und ständig südwärts reitend, einen Feldweg, der, so wenig begangen er war, sehr wahrscheinlich zu einem Dorf oder einer Mautstraße führte. Er folgte ihm, bemerkte mit Genugtuung, dass er leicht abwärts führte, und fand in kurzer Zeit seine Vermutung bestätigt. Der Feldweg mündete in eine breitere Straße, die ihn im rechten Winkel kreuzte. Captain Staple wusste zwar nicht genau, wo er sich befand, war aber ziemlich sicher, dass Sheffield im Osten lag, wahrscheinlich nicht mehr weit. Also bog er nach links in die größere Straße ein. Der Regen tropfte vom Rand seines Hutes, seine Reitstiefel waren über und über schmutzbespritzt, aber der schwere Friesmantel hatte ihn ziemlich trockengehalten. Er lehnte sich vor, um Beaus regenüberströmten Hals abzuklopfen, und sagte ermutigend: »Jetzt dauerts nicht mehr lang, alter Junge!«
Eine Straßenkrümmung bot einen hoffnungsvollen Anblick: Ein kleines Licht glomm in einiger Entfernung, nach dessen Stellung zu urteilen es die Laterne an einer Mautschranke sein musste. »Schau, Beau«, sagte er aufmunternd, »jedenfalls sind wir auf dem richtigen Weg. Wenn das eine Mautstraße ist, führt sie zu irgendeiner Stadt.«
Er ritt weiter und kam bald an die Mautschranke. So trüb das Licht auch war, konnte er doch sehen, dass das Tor geschlossen und an der Nordseite der Straße von einem Zollhaus bewacht war. Im Haus selbst war kein Licht und die Tür geschlossen. »Eine Überlandstraße, nicht sehr benützt«, informierte der Captain Beau. Er hob die Stimme und rief herrisch: »Tor!«
Nichts geschah. »Soll ich absteigen und die Schranke selbst öffnen?«, fragte der Captain. »Nein, verdammt noch einmal. Tor, sage ich! Tor! Heraus mit dir dadrin, und schnell!«
Die Tür in der Mitte des Mauthauses öffnete sich einen Spalt, und der schwache Schimmer eines Laternenlichts fiel quer über die Straße. »Na also, komm schon!«, sagte der Captain ungeduldig. »Mach auf, Menschenskind!«
Nach einigem Zögern wurde dieser Aufforderung Folge geleistet. Der Zollwärter trat auf die Straße heraus, und im Licht der Laterne, die er trug, zeigte sich, dass er von winziger Gestalt war. Der Captain, der einigermaßen überrascht auf ihn hinunterblickte, als der Kleine an den Mautzetteln herumfingerte, entdeckte, dass es ein magerer Knirps war, sicher nicht älter als dreizehn Jahre, wenn nicht sogar noch jünger. Die Laterne enthüllte ein sommersprossiges und leicht verweintes, verschrecktes Gesicht. Staple sagte: »Hallo, was ist denn das? Bist du der Zollwärter?«
»N-Nein, Sir. Mein Vater ist’s!«, antwortete der Junge und schluckte.
»Na, und wo ist dein Vater?«
Wieder ein Schlucken. »Weiß nich.« Ein Zettel wurde hochgehalten. »Threepence, bitte, Euer Gnaden, und er gilt gleich für die nächsten zwei Schranken.«
Aber nun hatte den Captain seine Gewohnheitssünde, die heftige Vorliebe für die Erforschung des Ungewöhnlichen, gepackt. Er übersah den Zettel und sagte: »Lässt dich dein Vater an seiner Stelle auf die Schranke aufpassen?«
»Ja, Herr«, sagte der Junge mit einem etwas feuchten Aufschnupfen. »Bitte, Herr, es macht Threepence und –«
»– gilt für die nächsten beiden Schranken«, ergänzte der Captain. »Wie heißt du?«
»Ben«, antwortete der Jüngling.
»Wohin führt diese Straße? Nach Sheffield?«
Nach einiger Überlegung bejahte es Ben.
»Wie weit ist das noch?«, fragte der Captain.
»Weiß nich. Zehn Meilen, wahrscheinlich. Bitte, Herr –«
»So weit? Zum Teufel!«
»Es können aber auch zwölf sein. Weiß nich. Aber der Zettel macht Threepence, bitte, Herr.«
Der Captain schaute in das nicht sehr einnehmende Gesicht hinunter, das ängstlich zu ihm aufschaute. Der Junge sah verschreckt und übermüdet aus. Staple sagte: »Wann ist denn dein Vater weggegangen?« Er wartete und fügte nach einer Weile hinzu: »Hab keine Angst, ich tu dir nichts. Passt du schon lange auf die Schranke auf?«
»Ja – nein! Vater ist gestern weg. Er hat gesagt, er kommt zurück, is aber nich, und bitte, Herr, erzählen Sie das niemandem, sonst bekomm ich eine Mordstracht Prügel vom Vater«, bat der Jüngling flehentlich.
Jetzt war die Neugierde des Captains endgültig geweckt. Zollwärter mochten ihre Fehler haben, aber gewöhnlich verließen sie ihre Posten, die nur von kleinen Jungen bewacht, nicht für ununterbrochene vierundzwanzig Stunden. Außerdem hatte Ben eine Riesenangst, und nach den Blicken zu schließen, die er verstohlen um sich warf, fürchtete er sich noch vor etwas anderem als nur der Dunkelheit und dem Alleinsein.
Der Captain schwang sich aus dem Sattel und zog die Zügel Beaus über dessen Kopf. »Mir scheint, es ist besser, ich bleibe lieber hier und leiste dir in der Nacht Gesellschaft«, sagte er heiter. »Na, wo kann ich mein Pferd unterbringen?«
Ben war so erstaunt, dass er nur dastehen und den Captain offenen Mundes und mit vorquellenden Augen anstarren konnte. Der Captain wusste, dass hinter den meisten ländlichen Mauthäusern kleine Gärten lagen und häufig auch ein roh gezimmerter Schuppen für Werkzeug und Holz. »Habt ihr einen Schuppen?«, fragte er.
»Ja«, stieß Ben hervor, der immer noch fasziniert diesen riesigen fantastischen Reisenden anstarrte.
»Was ist drin?«
»Mistkratzer.«
Der Captain erkannte diese Sprache. Er hatte in seiner Truppe mehrere der Landstreicher gehabt, aus denen, wie Seine Gnaden, der Herzog von Wellington, mit verdrießlichem Humor mehr als einmal versichert hatte, seine tapfere Armee zum großen Teil bestand. »Hennen?«, fragte er. »Na schön, macht nichts! Führ mich hin. Ist er groß genug für mein Pferd?«
»Ja«, sagte Ben zweifelnd.
»Dann geh also voraus!«
Anscheinend hatte Ben das Gefühl, dass es unklug wäre, Einwendungen zu machen, wozu er anscheinend sehr neigte. Nachdem er noch einmal geschluckt hatte, hob er seine Laterne auf und führte den Captain zu einer Nebenpforte hinter dem Mauthaus.
Der Schuppen erwies sich als überraschend groß, und als die Laterne an einem vorstehenden Nagel aufgehängt wurde, enthüllte ihr Licht nicht nur eine Reihe Federvieh auf der Stange, sondern auch etwas Stroh und einen Ballen Heu in einer Ecke. Es waren unverkennbar Zeichen, dass Beau nicht das erste Pferd war, das hier eingestellt wurde, ein Umstand, den John interessant fand; aber er hielt es für das Klügste, keine Bemerkung darüber zu machen. Ben betrachtete ihn mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Misstrauen, daher lächelte er auf den Jungen hinunter und sagte: »Du brauchst keine Angst zu haben – ich tu dir nichts. Aber jetzt – mein Mantel ist zu nass, als dass ich ihn Beau auflegen könnte – hast du irgendeine Decke?«
»Ja. Aber wenn Mr Chirk kommt – aber ich vermute, er kommt ohnehin nich!«, sagte Ben. »Jö, ist das ein großer Gaul!«
Dann nahm er die Satteltasche, die John abgeschnallt hatte, und ging mit ihr fort. Als er wiederkam, brachte er einen Eimer Wasser und eine Pferdedecke mit. Da der Captain, der seinen Rock ausgezogen hatte, dabei war, Beau abzureiben, nahm er sofort einen Strohwisch und begann die Beine des großen Pferdes zu bearbeiten. Ben schien entschieden zu haben, dass sein ungeladener Gast zwar erschreckend groß war, ihm aber wirklich nichts Böses wollte, denn er schaute viel heiterer drein und ließ verlauten, dass er den Kessel zum Kochen aufgesetzt hatte. »Rum is noch da«, sagte er.
»Der wird gleich weg sein«, antwortete John und beobachtete, wie der Junge furchtlos mit seinem Pferd umging. Der milde Witz kam gut an, ein freundliches Grinsen wurde ihm kurz zugeworfen. John fragte sachlich: »Arbeitest du in einem Stall?«
»Manchmal ja. Meistens aber tu ich alles Mögliche«, sagte Ben. »Am meisten stellt mich Mr Sopworthy an.«
»Wer ist das?«
»Der Büffeter in Crowford. Im Blauen Eber«, sagte Ben und begann, die Steigbügel mit einem Stück Sackleinwand zu reinigen.
»Der Wirt?«, riet John aufs Geratewohl.
»Ja.«
»Hat dein Vater ein Pferd?«
Der vorsichtige Ausdruck kehrte in Bens Gesicht zurück. »Nein.« Er sah John von der Seite an. »Die Pferdedecke gehört nicht meinem Vater – sie – sie gehört einem Freund. Der kommt manchmal her. Vielleicht möcht er nicht, dass Sie sie benutzen, drum – drum werden Sie auch nichts davon verraten, bitte, Herr! Und auch nichts von ihm, weil – weil er nicht gern Fremde trifft!«
»Menschenscheu, ja? Ich werde nichts sagen«, versprach John und fragte sich, ob das vielleicht der Mann war, vor dem sich Ben fürchtete. Er war jetzt überzeugt, dass irgendein Geheimnis über dem Mauthaus lag, mit dem zweifellos das Verschwinden seines Wärters zusammenhing; aber er war klug genug, diese Überlegung für sich zu behalten, da Ben offenkundig ihm nicht ganz traute und immer noch bereit war, wie ein Fohlen in panischer Angst vor ihm zu scheuen.
Als Beau zugedeckt war und sie ihn mit einem Armvoll Heu zurückließen, führte Ben den Captain den Garten hinauf zur Rückseite des Mauthauses, wo eine Mitteltür in eine kleine Küche führte. Das Haus war, wie John mit einem Blick sah, nach dem üblichen Schema gebaut. Es bestand aus zwei genügend großen Räumen, von einem dritten getrennt, der durch eine Holzwand in zwei Teile abgeteilt war. Die hintere Hälfte war die Küche, die vordere die Mautkanzlei. Die Küche war klein, überheizt und in großer Unordnung. Sie wurde von einigen Talgkerzen in Zinnhaltern erleuchtet, und ein unangenehmer Geruch nach heißem Talg lag in der Luft. Aber der Captain wusste aus früheren Erfahrungen in den primitiveren Teilen Portugals, dass sich die menschliche Nase sehr schnell selbst an die übelsten Gerüche gewöhnen kann, und betrat daher den Raum ohne Widerwillen. Ben schloss und verriegelte die Tür, setzte die Laterne nieder und brachte aus dem Küchenschrank eine schwarze Flasche und einen dicken Glasbecher. »Ich mische Ihnen einen Grog«, erbot er sich.
Der Captain, der sich in den Windsorstuhl am Herd gesetzt hatte, grinste, sagte aber: »Vielen Dank, aber ich glaube, ich mische ihn mir lieber selbst. Wenn du dich schon nützlich machen willst, schau zu, ob du mir diese Stiefel da abziehen kannst!«
Dieser Vorgang, der Zeit und alle Kraft Bens brauchte, trug viel dazu bei, das Eis zu brechen. Ben fand es äußerst lustig, dass er, einen schmutzigen Reitstiefel an die Brust gepresst, fast nach hinten geplumpst wäre. Er begann zu kichern, vergaß alle Ehrfurcht und sah plötzlich viel jünger aus, als John zuerst angenommen hatte. Er offenbarte John auf dessen Frage, dass er demnächst elf würde.
Nachdem John ein Paar Hausschuhe in seiner Satteltasche gefunden hatte, mischte er sich ein Glas heißen Wassers mit Rum und setzte sich wieder hin, die Beine weit von sich gestreckt; seine Stiefel standen neben dem Herd zum Trocknen. »So ist’s schon besser«, sagte er, lehnte den blonden Kopf gegen die hohe Stuhllehne und lächelte seinem Gastgeber schläfrig zu. »Sag, werden wir zum Schrankenöffnen sehr oft hinausgerufen?«
Ben schüttelte den Kopf. »Nach Dunkelwerden kommt keiner viel her«, sagte er. »Außerdem gießt’s.«
»Fein!«, sagte John. »Und wo werde ich schlafen?«
»Sie könnten das Bett von meinem Vater haben«, schlug Ben etwas zweifelnd vor.
»Danke, nehm ich. Wohin könnte dein Vater wohl gegangen sein?«
»Weiß nich«, sagte Ben schlicht.
»Geht er oft so fort?«
»Nein. Das hat er noch nie getan – nicht so. Und er ist nicht auf eine Sauftour gegangen, weil er kein Säufer ist, nicht mein Vater. Und wenn er nicht zurückkommt, übergeben sie mich der Fürsorge.«
»Er wird schon zurückkommen«, sagte John beruhigend. »Hast du Verwandte? Brüder, Onkel?«
»Ich hab einen Bruder. Das heißt, wenn er nicht ertrunken ist. Er ist in den Militärdienst gepresst worden. Ich tät mich nicht wundern, wenn ich ihn nie wiedersehen würde.«
»Himmel, doch, natürlich wirst du ihn wiedersehen!«
»Na ja, ich will ja gar nicht«, sagte Ben freimütig. »Er ist ein richtiger Tölpel, das is er. Denn sonst hätten sie ihn nie geschnappt, sagt mein Vater.«
Falls Ben andere Verwandte besaß, wusste er nichts von ihnen. Seine Mutter war anscheinend vor einigen Jahren gestorben, und es zeigte sich bald, dass er an seinem Vater weniger aus Liebe hing, als aus einer heftigen Angst, der Fürsorge übergeben zu werden. Er war überzeugt, dass er, sollte ihm das zustoßen, in eine der Gießereien in Sheffield geschickt würde. Er lebte genügend nahe dieser Stadt, um zu wissen, was für ein Elend die Scharen verkümmerter Kinder erdulden mussten, die vom Alter von sieben Jahren an in den großen Industriestädten arbeiten mussten. Es war daher nicht überraschend, dass ihm dieses Schicksal so schrecklich erschien. Es gab nur noch ein einziges schlimmeres Schicksal, das er kannte, und das sollte er John bald anvertrauen.
Während er erzählte und John dasaß und seinen Grog schlürfte, hatte sich der Wind etwas erhoben und trug andere Geräusche herbei als das stete Tropfen des Regens. Die Nebenpforte für Fußreisende knarrte und schlug leise ein-, zweimal zu; und als dies geschah, wurde Bens Gesicht plötzlich angespannt, und er brach mitten im Reden ab, um angestrengt zu lauschen. John bemerkte, dass seine Augen ständig zu der Hintertür wanderten und dass die Geräusche, die von der Rückseite des Hauses kamen, ihn mehr als das Knarren der Pforte aufzuregen schienen. Ein Windstoß blies etwas um, und es klapperte. Für John klang es, als sei ein Besen oder ein Rechen umgefallen, aber Ben brachte es blitzartig auf die Beine und trieb ihn instinktiv neben John.
»Was ist denn?«, sagte John ruhig.
»Er!«, sagte Ben atemlos, den Blick auf die Tür geheftet.
John stand auf, überhörte einen jammernden Einspruch und ging zur Tür. Er stieß die Riegel zurück, öffnete und trat in den Garten hinaus. »Es ist niemand da«, sagte er über die Schulter zurück. »Du hast einen Besen an die Wand gelehnt stehen gelassen, und der Wind hat ihn umgeblasen. Das ist alles. Komm und schau selbst!« Er wartete einen Augenblick und wiederholte dann in befehlendem Ton: »Komm her!«
Zögernd kam Ben näher.
»Das Wetter klart auf«, bemerkte John, lehnte sich an den Türrahmen und schaute zum Himmel hinauf. »Es wird lichter. Morgen haben wir einen schönen Tag. Na, siehst du jemanden?«
»N-Nein«, gab Ben mit einem kleinen Schauer zu. Er schaute zu John auf und fügte hoffnungsvoll hinzu: »Er kann mich nicht holen, nicht wahr? Nicht, wenn ein so großer Bursche wie Sie da ist.«
»Natürlich. Niemand kann dich holen«, antwortete John, schloss die Tür und ging zum Fenster zurück. »Du kannst die Tür verriegeln, aber nötig ist es nicht.«
»Doch, weil er meinen Vater besuchen kommen könnte, und ich darf ihn nicht sehen, und er mich auch nicht«, erklärte Ben.
»Himmel, ist der gar so scheu? Was ist denn mit ihm los? Ist er so hässlich?«
»Weiß nich. Hab ihn noch nie gesehen. Nur seinen Schatten – ein Mal!«
»Aber du hast ihm doch sein Pferd abgerieben, nicht?«
»Nein!«, sagte Ben und starrte John an.
»War das nicht seine Decke, die du mir für Beau gebracht hast?«
»Aber nein! Die gehört doch Mr Chirk!«, sagte Ben. »Das ist ein –« Er unterbrach sich, hielt den Atem an und fügte schnell hinzu: »Der ist so gut wie immer in der Zwickmühle! Sie werden niemandem von ihm erzählen, oh bitte, Herr –«
»Aber nein, kein Wörtchen werde ich über ihn sagen! Sind eigentlich alle deine Freunde so scheu?«
»Der ist nicht scheu. Der mag nur keine Fremden.«
»Aha. Und mag dieser andere Mann, der, vor dem du Angst hast – Fremde auch nicht?«
»Weiß nicht. Er kann Jungen nicht leiden. Mein Vater sagt, wenn er mich dabei erwischt, dass ich ihn anschaue, nimmt er mich mit, zur Arbeit in den Kohlengruben.« Er sagte das Wort ganz leise und erschauerte dabei so heftig, dass es leicht zu erraten war: Kohlengruben waren für ihn noch entsetzlicher als Gießereien.
John lachte. »Das ist ja eine schöne Schauergeschichte! Dein Vater hat dich gefoppt, mein Sohn!«
Ben schaute ungläubig drein. »Aber er könnte mich mitnehmen, mir einen Sack über den Kopf binden und –«
»So, könnte er das, ja? Und was meinst du, würde denn ich tun, wenn jemand hereinkäme und versuchen würde, dir einen Sack über den Kopf zu binden?«
»Was denn?«, fragte Ben mit großen, staunenden Augen.
»Ihm selbst einen Sack über den Kopf binden, natürlich, und ihn dem nächsten Polizisten übergeben.«
»Das täten Sie wirklich?« Ben hielt hörbar den Atem an.
»Aber bestimmt! Kommt er oft her?«
»N-Nein. Wenigstens, ich weiß nich. Nachdem es dunkel ist, kommt er. Ich weiß nich, wie oft. Einmal waren zwei da. Ich bin aufgewacht und hab sie mit meinem Vater reden gehört.«
»Worüber haben sie denn geredet?«
Ben schüttelte den Kopf. »Ich hab nichts gehört, nur gerade Stimmen. Ich bin gleich unter die Decke, weil ich gewusst hab, dass es er ist.«
Es war inzwischen für John ziemlich sicher geworden, dass das Verschwinden des Zollwärters irgendwie mit Bens geheimnisvollem Popanz zusammenhing; und noch sicherer war, dass der Vater mit irgendeiner ruchlosen Sache zu tun hatte. John hatte nicht die leiseste Vermutung, was das sein konnte, und es war offensichtlich nutzlos, Ben weiter zu befragen. Also stand er auf und sagte: »Höchste Zeit, dass du wieder unter die Decke kommst. Wenn jemand Tor schreit, werde ich mich darum kümmern, also zeig mir, wo das Bett deines Vaters ist, und dann fort mit dir in dein eigenes.«
»Sie können doch nicht die Schranke öffnen!«, sagte Ben entsetzt. »Sie sind doch ein Nobler!«
»Kümmere dich nicht darum, was ich bin. Tu, was ich dir sage!«
So ermahnt, geleitete ihn Ben in die Mautkanzlei, von der aus man die beiden anderen Zimmer betrat. Das eine, in dem Ben auf einem Feldbett schlief, war ein Vorratsraum, das andere aber war einigermaßen behaglich eingerichtet, das Bett sogar mit Baumwolllaken und einer verblassten Steppdecke ausgestattet. Der Captain hatte keine Lust, in dem Bettzeug des Zollwärters zu schlafen, zog es also kühl vom Bett, rollte es zu einem Bündel zusammen und warf es in einen Winkel. Dann streckte er sich auf den Decken aus, zog sich die Steppdecke über und blies die Kerze aus. Kurz bevor er einschlief, fragte er sich, was er wohl tun werde, falls der Zollwärter auch in dieser Nacht nicht zurückkäme. Das Richtige wäre gewesen, das Verschwinden des Mannes zu melden; das aber erschien John als ein unerfreulicher Verrat an Ben; etwas anderes aber fiel ihm nicht ein. Da der Captain jedoch stets ruhig alles an sich herankommen ließ, hörte er sehr bald auf, sich den Kopf über dieses Problem zu zerbrechen. Höchstwahrscheinlich würde der Zollwärter ohnehin noch vor Morgengrauen auf seinem Posten zurück sein. Und stockbesoffen dazu, dachte John, denn er verließ sich wenig auf Bens Versicherung, sein Vater sei keiner, der auf Sauftour gehe.
Kapitel 3
Der Captain schlief fest und erwachte erst, als schon heller Tag war und von draußen Stimmen kamen. Als er aufstand und aus dem kleinen vergitterten Fenster hinausschaute, sah er, dass Ben das Tor einer Herde Kühe offen hielt und Höflichkeiten mit dem Hüterjungen austauschte. Dem Regenguss der Nacht war ein schöner Herbsttag gefolgt; über den Feldern jenseits der Straße lagen immer noch Nebelschleier. Ein Blick auf die Uhr, die er auf den Stuhl neben dem Bett gelegt hatte, informierte John, dass es halb sieben war. Er schlenderte in die Mautkanzlei, als Ben eben die Schranke schloss und hereinkam.
Das Tageslicht hatte auch die Ängste Bens beschwichtigt. Es war ein anderer Knabe als der zermürbte Knirps des Vorabends, der da pfeifend hereinkam und den Captain mit einem Grinsen begrüßte.
»Dein Vater noch nicht da?«, fragte John.
Das Grinsen verschwand. »Nein. Wahrscheinlich ist er abgehauen.«
»Fortgelaufen? Warum sollte er denn?«
»Na ja, wenn er nicht davon ist, is er vielleicht tot«, meinte Ben anpassungsfähig. »Weil, wie er weg ist, hat er mir gesagt, ich soll eine Stunde auf die Schranke aufpassen, dann wär er zurück. Was fange ich jetzt an, Chef?«
Diese Frage wurde nicht etwa im Ton der Befürchtung, sondern voll heiteren Vertrauens gestellt. Ben blickte fragend zu John auf, und dieser erkannte kläglich, dass sich sein kleiner Schützling voll und ganz auf seine Bereitwilligkeit und Fähigkeit verließ, die Zukunft befriedigend für ihn zu regeln.
»Na ja, das ist ein Problem, das anscheinend noch ein bisschen in der Luft hängt. Wir werden das besprechen müssen. Aber erst will ich mich waschen und frühstücken.«
»Ich habe einige Speckscheiben, und Eier sind da und ein bisschen Rindfleisch«, bot Ben seinem Gast an und überging das erstere Bedürfnis des Captains als einen frivolen Scherz.
»Ausgezeichnet. Wo ist die Pumpe?«
»Draußen, hinten. Aber –«
»Na, dann komm mit und pumpe für mich«, sagte John. »Ich brauche ein Handtuch und Seife.«
Sehr verblüfft – denn der Captain sah ganz rein aus, dachte Ben – nahm er ein Stück derber, von der Stange geschnittener Seife und ein grobes Leinenhandtuch und folgte seinem Gast in den Garten. Als er aber entdeckte, dass sich der Captain nicht damit zufriedengab, nur Kopf und Nacken ins Wasser zu tauchen, sondern seinen ganzen mächtigen Oberkörper waschen wollte, bewog ihn das zu einem entsetzten Protest: »Sie werden sich den Tod holen!«, stieß er atemlos hervor.
Der Captain verrieb munter die Seife über Brust und Arme und lachte. »Keine Spur!«
»Aber Sie brauchen sich doch nicht ganz zu waschen!«
»Was – nachdem ich die ganze Nacht in den Kleidern geschlafen habe? Und ob ich es brauche!« John maß Ben kritisch und fügte hinzu: »Dir täte es auch nicht schaden, unter die Pumpe zu gehen.«
Instinktiv trat Ben aus Johns Reichweite, wurde aber zurückgerufen, um den Pumpenschwengel zu bedienen. Dann wollte er sich hastig zurückziehen, das aber wurde vereitelt; eine große Hand fing ihn ein und hielt ihn fest. Erschrocken schaute er auf und sah in lachende blaue Augen. »Ich habe mich doch erst letzten Sonntag gewaschen!«, sagte er flehend. »Ich lüge wirklich nicht. Ehrenwort, nicht!«
»Wirklich nicht? Beim Jupiter! Dann ist es eine Woche her, seit du rein warst, wie? Zieh dich aus, Bürschchen!«
»Nein!«, sagte Ben weinerlich und wand sich, um dem Griff an seiner Schulter zu entkommen. »Ich will nicht!«
Der Captain gab ihm einen festen, ermahnenden Klaps. »Ich tät’s lieber doch!«
Seine Stimme klang durchaus gut gelaunt, aber Ben war nicht dumm, und mit einem verzweifelten Aufschnupfen kapitulierte er. Es war zweifelhaft, ob er je zuvor gezwungen worden war, seine hagere Person so gründlich zu schrubben; und sicher hatte ihn noch nie ein ihm Wohlgesinnter so unbarmherzig unter die Pumpe gehalten und sie mit einer solchen Energie bearbeitet. Er tauchte prustend und fröstelnd aus der Prozedur hervor und beäugte seinen Verfolger mit einer Mischung aus Respekt und Trotz. John warf ihm das Handtuch zu und sagte: »So ist’s schon besser! Wenn du ein zweites Hemd besitzt, dann zieh es an!«