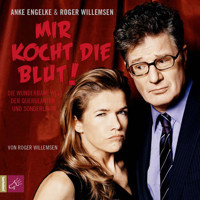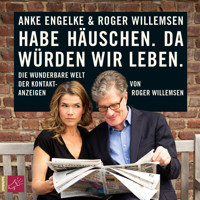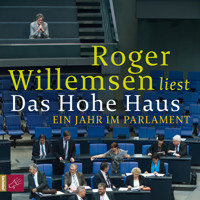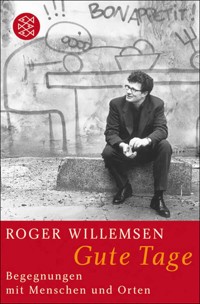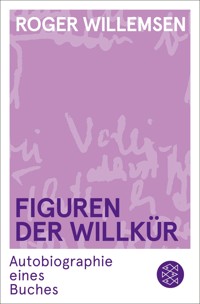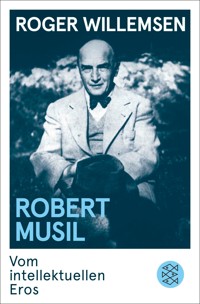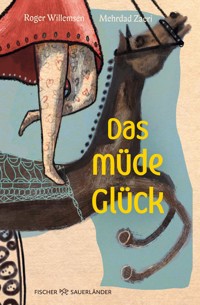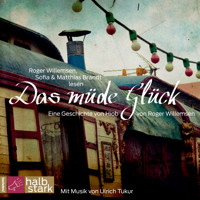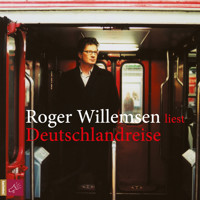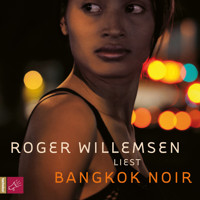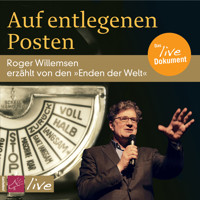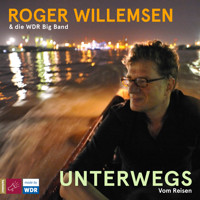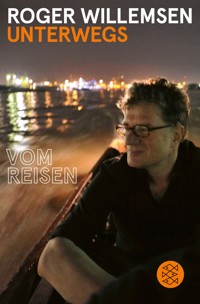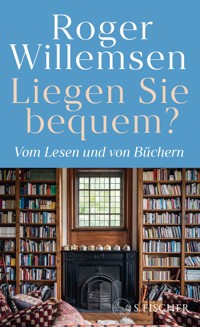
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Roger Willemsen und die Bücher – das war eine mitreißende Liebe, übermütig und intensiv. Kaum einer redet heute so lustig, offen und zugleich tiefernst vom Lesen, wie er es tat, ganz gleich, ob er kritisiert oder schwärmt, huldigt oder durchleuchtet. Klug wie kein Zweiter porträtiert Willemsen große Autorinnen und Autoren, erzählt von Märchen und analysiert das Obszöne in einem Essay von hoher Aktualität. Er stellt »10 Regeln für Leserinnen und Leser« auf, gibt mehr als siebzig ganz konkrete Buchempfehlungen und verspottet nach durchlebten Buchmessenächten den Literaturbetrieb. Sprühend von Witz und Geist unterzieht er die Literaturwissenschaft einer Fundamentalkritik und formuliert zum Thema »Literatur und Menschenrechte« das Notwendige. Dieses einzigartige Buch zeigt Willemsen in seinen Büchern. Es ist die Summe eines Leselebens und lebendige Bibliothek.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Roger Willemsen
Liegen Sie bequem? Vom Lesen und von Büchern
Über dieses Buch
Roger Willemsen und die Bücher – das war eine mitreißende Liebe, übermütig und intensiv. Kaum einer redet heute so lustig, offen und zugleich tiefernst vom Lesen, wie er es tat, ganz gleich, ob er kritisiert oder schwärmt, huldigt oder durchleuchtet. Klug wie kein Zweiter porträtiert Willemsen große Autorinnen und Autoren, erzählt von Märchen und analysiert das Obszöne in einem Essay von hoher Aktualität. Er stellt »10 Regeln für Leserinnen und Leser« auf, gibt mehr als siebzig ganz konkrete Buchempfehlungen und verspottet nach durchlebten Buchmessenächten den Literaturbetrieb. Sprühend von Witz und Geist unterzieht er die Literaturwissenschaft einer Fundamentalkritik und formuliert zum Thema »Literatur und Menschenrechte« das Notwendige. Dieses einzigartige Buch zeigt Willemsen in seinen Büchern. Es ist die Summe eines Leselebens und lebendige Bibliothek.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Roger Willemsen, geboren 1955 in Bonn, gestorben 2016 in Wentorf bei Hamburg, war Autor und Literaturwissenschaftler. Darüber hinaus produzierte er Fernsehsendungen, drehte Dokumentarfilme und stand mit zahlreichen Programmen auf der Bühne. Willemsen war Honorarprofessor an der Humboldt-Universität in Berlin und langjähriger Schirmherr des Afghanischen Frauenvereins. Für sein Werk wurde er vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bayerischen Fernsehpreis und dem Adolf-Grimme-Preis in Gold, dem Rinke- und dem Julius-Campe-Preis, dem Prix-Pantheon-Sonderpreis, dem Deutschen Hörbuchpreis und der Ehrengabe der Heinrich-Heine-Gesellschaft. Zu seinen Bestsellern gehören »Deutschlandreise«, »Der Knacks«, »Die Enden der Welt«, »Das Hohe Haus« und »Wer wir waren«, posthum erschien »Musik! Über ein Lebensgefühl«. Über sein Werk informiert der Band »Der leidenschaftliche Zeitgenosse«, herausgegeben von Insa Wilke.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Für diese Ausgabe:
© 2025 S. Fischer Verlag GmbH,
Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Suse Kopp, Hamburg
Coverabbildung: Daniel Pilar
ISBN 978-3-10-491969-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
10 Regeln für Leserinnen und Leser
I Porträts
Der Tausendkünstler
In einem fernen Land
Buchtipps
Der Dichter als Delegierter Gottes
Das gute schlechte Gewissen
Der einzig Wahre
Mein Held: Samuel Beckett
Buchtipps
Lewis im Wunderland
Der leidenschaftliche Zeitgenosse
Zum Tod von Robert Gernhardt
Buchtipps
II Bücher und Gedichte
Herzblut
Über Hugo von Hofmannsthal: Terzinen über Vergänglichkeit
Odysseus der Misanthropen
Buchtipps
Wir und das Tier
Kompass ohne Nadel
Über Jürgen Becker: Zwischendurch im Erzgebirge
Aus einer fernen Welt
Über Nikolaus Lenau: Himmelstrauer
Brüchige Idyllen
Buchtipps
Über Joachim Ringelnatz: Kinder-Verwirr-Buch
Über Rainer Maria Rilke: Kindheit
Die Toten und die Mundtoten
Über die Erzählungen von Franz Hohler
Si tacuisses
Über Christine Lavant: Sind das wohl Menschen?
Über Robert Walser: Langezeit
Über Anton Ulrich Herzog zu Braunschweig-Lüneburg: Sterbelied
Buchtipps
III Das Obszöne und sein Gegenteil
Über das Obszöne
Enfant flexible
Über Erich Fried: Gründe
Die Gewalt und die Herrlichkeit
Über Georg Heym: Der Krieg II
Über den Leitfaden für amerikanische Soldaten im Irak 1943
Buchtipps
Leben in Versen
Poetischer Kosmos und neues Reich
Buchtipps
Ich rieche, rieche Menschenfleisch
IV Was Literatur kann und will
Was will Literatur?
Was kann Literatur?
Literatur und Menschenrechte
Ich habe gelesen
Buchtipps
Der Aufstieg zum Misserfolg
Der schöne Satz
Do You Speak Germish?
Buchtipps
V Markt, Medien, Möglichkeiten
Von Büchern und Maulwurfshügeln
Tragödien der Forschung
Anti Karenina
Der Selbstmörder in der Gegenwartsliteratur. Literaturkanon
Buchtipps
20 Thesen zu Buch und Buchmarkt heute
Das Wichtigste
Ein Brief an Thomas Stangl
Buchtipps
Willemsens Wecker
Dienstag: Eröffnungsrhetorik
Mittwoch: Anders als Sauerbraten
Donnerstag: In aller Stille
Freitag: Das Unaussprechliche
Samstag: Die Terrasse
Sonntag: Kehraus
Schrift-Typen
13 Regeln für Schriftstellerinnen und Schriftsteller
Nachwort
Editorische Nachbemerkung
Quellen
10 Regeln für Leserinnen und Leser
Sitzen Sie gerade. Liegen Sie bequem. Lungern Sie rum. Nichts soll Sie stören. Sie und das Buch, das ist gerade die einzige Beziehung, die zählt. Am besten, Sie suchen auch innerlich nach einer Haltung, die Sie aufnahmefähig macht, bereitwillig, andere Menschen, anderer Menschen Probleme in Ihr Leben zu lassen. Sie werden sich am Ende selbst in diesen finden.
Überlegen Sie sich gut, welches Buch es wert ist, Ihnen Gesellschaft zu leisten. Aber dann gewähren Sie ihm einen Vorschuss, ein vorauseilendes Wohlwollen. Es soll sich zeigen, ausbreiten, erklären dürfen. Räumen Sie ihm Rederecht ein.
Etwas gut Geschriebenes ist etwas anderes als etwas flott Geschriebenes. Entscheiden Sie sich. Ist es die Rasanz der Sprache, der Reiz des Stoffs, der Sog der Spannung, die Wiedererkennung Ihrer Gegenwart, die Beantwortung Ihrer Fragen, das sinnliche Erkennen, die Beunruhigung, die Kritik, der Trost – identifizieren Sie, was Sie von Ihrem Buch erwarten. Bekennen Sie sich zu Ihren Ansprüchen.
Lassen Sie sich ruhig überfordern. Bücher müssen nämlich nicht sofort und auf Anhieb komplett und erschöpfend verstanden werden. Von Jean Paul stammt der Satz: »Ein Buch, das es nicht wert ist, zweimal gelesen zu werden, ist es auch nicht wert, einmal gelesen zu werden.« Gut sind oft Bücher, die nach der ersten Lektüre immer noch den Charakter des Versprechens besitzen.
Leisten Sie sich eine hohe Meinung vom Umgang mit Ideen. Alles wird besser, wenn es gut gedacht ist, und selbst das Bauchgefühl braucht einen guten Kopf.
Im Lesen verfolgen Sie eine Organisation von Informationen. Deshalb ist oft nicht vor allem der Stoff entscheidend, sondern die Form, die er annimmt. Diese schwingt selbst im Klang der Stimme, die da spricht, in den Pausen, den Sprüngen, die sie sich erlaubt, dem Swing. Die Schönheit eines Buches verpasst, wer nur seinen Informationen, nicht seinen Unterströmungen und Subtexten folgt.
Wenn Ihnen Genauigkeit nichts bedeutet, werden Ihnen viele Bücher bloß umständlich, weitschweifig oder sprachverliebt erscheinen. Am ergiebigsten erscheint einem das Sprechen der Bücher, wenn man ihr Drängen nach Exaktheit teilt.
Autoren verbringen weit mehr Zeit mit ihrem Stoff als Leser oder Kritiker. Urteilen Sie behutsam, machen Sie den Autor nicht dümmer, als er ist. Vor dem Urteil muss die präzise Anschauung stehen. Wenn Sie sich langweilen, muss es nicht am Buch liegen.
Prüfen Sie inständig die Wirkung, nicht die Effekte eines Buches. Kein Text taugt, der nicht an der Erfindung Ihres Innenlebens teilnimmt.
Ein Buch ist auf keiner Seite abgeschlossen. Es wird erst in der Lektüre fertig und will eigentlich immer weiter werden. Anders gesagt, das Buch vollendet sich, indem es die Leserin, den Leser selbst produktiv werden lässt. Das Buch ist, so betrachtet, nicht das Hervorgebrachte, sondern das Hervorbringende, und das Unglaubliche ist: Es bringt seine Leser, es bringt Sie hervor!
IPorträts
Der Tausendkünstler
Über Goethe
Er lebe also hoch, der Größte unter den Toten, der toteste unter den großen deutschen Dichtern, der nun seit zwei Jahrhunderten jährlich tiefer in den Todesschlaf gestoßene, in durchwachten Schulstunden verblichene, in Denkmälern eingefrorene, schließlich in Jubelfeiern mit den Füßen im Werk einzementierte und von der Kultur-Cosa-Nostra in einem Meer der Feuilletons verklappte Dichterfürst, der kein Fürst und nicht vor allem Dichter war, er lebe hoch!
Von Robert Musil stammt der lapidare Satz, das natürliche Verhalten einer alten Kirchenfassade gegenüber sei nicht, dass man sie schön, sondern dass man sie alt finde. Goethe ist im künstlichen Klima der Fraglosigkeit, das ihn umgibt, so alt geworden, dass man ihn schon verachten möchte für seine Unfähigkeit, zum Zeitgenossen zu werden. Denn nur als Zeitgenosse – also auch als Gegenstand der Kritik – widerlegt der tote Künstler die Beleidigung, ein »Kulturgut« zu sein.
Wir wissen mehr über Goethe, als er über sich wusste, und tun so, als werde sich erst nach diesem Amoklauf des Wissens das Werk entschlüsseln. Aber wie sich ein Leichnam nur zu bewegen scheint kraft der Maden, die sich in ihm tummeln, kommt uns Goethe schon lebendig vor, bloß weil wir für unsere Ratlosigkeit von Gedenktag zu Gedenktag einen immer neuen Ausdruck finden. So wurde auch zum Anlass seines 250. Geburtstags um Goethe eine Materialschlacht der Fakten geschlagen, in der eher ermittelt als interpretiert wurde. Eine solche Recherche treibt man nur für tote Dichter und lebende Staatsfeinde. Deshalb lasen sich die Gedenkartikel manchmal wie Fahndungsprofile.
Diesmal hat man die schöne Leich’ zu reanimieren versucht, indem man den Nachweis antrat, der große Mann sei gewesen, was man im Rheinischen »ne fiese Möpp« nennt. Nun wird ein Mensch nicht dadurch lebendiger, dass er unsympathisch ist, und selbst dass Roman Herzog vor zu viel Goethe-Verehrung warnte, weckte den Schlafenden nicht, nur die Weimarer. »Da man an mein Talent nicht rühren kann«, hatte Goethe noch selbst lamentiert, »so will man an meinen Charakter.« Tatsächlich ist es einem Werk gegenüber völlig irrelevant, wie nett der lebende Autor oder wie konsequent er in der Einhaltung der eigenen Statuten war – »dass einer Wechsel fälscht, sagt nichts gegen sein Geigenspiel«, befand Oscar Wilde.
Vor dem Anspruch seines Werkes jedenfalls besteht auch Goethe nicht, dichtet »edel sei der Mensch, hilfreich und gut« und setzt sich zeitgleich für das Todesurteil gegen eine Kindsmörderin ein; verbittet sich »den zweideutigen Titel, ein Freund des Bestehenden zu sein«, wirkt bei Hofe aber als konservative Kraft; imaginiert im »Werther« eine klassenlose Gesellschaft, tritt im Leben aber gegen die Ansprüche der Bauern auf; ist juristisch ausgebildet, stimmt aber dem Verkauf von Sträflingen als Söldner zu; verachtete Höflinge, wird aber selbst einer; tritt für die Freiheit des Geistes ein, aber ebenso für die Zensur.
Goethes Werk ist nicht stringent, sondern eklektisch, aber auch der Autor versteht sich nicht als Einheit, sondern als »ein Kollektivwesen, das den Namen Goethe trägt«. Wenn etwas modern ist an Goethe, dann dieser geradezu postmoderne Blick auf sich und das Werk. In seiner »Archäologie des Wissens« hat Michel Foucault viel später ganz ähnlich appelliert: »Man frage mich nicht, wer ich bin, und man sage mir nicht, ich solle der Gleiche bleiben, das ist eine Moral des Personenstandes; sie beherrscht unsere Papiere. Sie soll uns frei lassen, wenn es sich darum handelt, zu schreiben.«
Mag man ihn im Schreiben frei gelassen haben, als Autor war Goethe – »der Tausendkünstler«, wie Herder ihn nannte – trotzdem ein Meister auch des Selbst-Managements. Zwar schrieb er mit dem »Werther« den ersten Bestseller, erreichte aber diesen Ruhm nie wieder: »›Ach, das Publikum‹, seufzete Goethe«, heißt es schon in den Gesprächen mit Eckermann. Zwar wurde er mitunter schlecht verkauft, noch schlechter rezensiert und erlebte mit dem Absatz seiner Gesammelten Werke ein Fiasko, trotzdem diktierte er den Verlegern geradezu unverschämte Bedingungen und machte sich an so hybride Projekte wie »einen Roman über das Weltall« zu schreiben oder die Lücke zwischen »Ilias« und »Odyssee« durch die Abfassung einer »Achilleis« zu schließen. Zwar reiste er inkognito, wollte aber durchaus erkannt werden. Mit festem Blick auf die Nachwelt vernichtete er Briefe und verfängliche Notizen und bereitete kommende Zeiten auf ihren »Goethe« vor. Das gelang.
Doch wem hat sich Goethe je altruistisch gezeigt, wen hat er selbstlos gefördert, wem Platz gelassen? Mögen die Zeitgenossen unisono Goethes »Kälte« beklagen, Jean Paul sogar schreiben, es gebe »keinen frostigern Gesellen auf Gottes Erdboden«, mag der Naturwissenschaftler Emil Du Bois-Reymond später von Goethes »wertloser und totgeborener Spielerei« auf dem Feld der Naturforschung sprechen, der Schatten des Olympiers fällt quer über das 19. Jahrhundert in Deutschland, über Immermanns »Epigonen«, Mörikes und Raabes Bildungsromane bis in die ersten Jahre unseres Jahrhunderts. 1857 erscheinen in Frankreich Baudelaires »Blumen des Bösen«, in Deutschland beendet Stifter den »Nachsommer«, ein Buch, goethischer als Goethe. Ein ganzes Jahrhundert scheint die bürgerlichen Beschaulichkeiten des deutschen Romans von den morbiden Nachtschattengewächsen Baudelaires zu trennen, ja, es sieht aus, als liege Goethe aufgebahrt im 19. Jahrhundert der deutschen Literatur und hielte die Autoren im restaurativen Bann.
Das aber ist gleich doppelt erstaunlich. Einmal ist in seinem Werk selbst alles Abschied. Die Feudalgesellschaft weicht der bürgerlichen, eine Epoche geht zu Ende, und Goethe begleitet sie mit Wehmut, mit Abschiedsgesten und Entsagung. Am Ende hat er sein Werk wie ein Mausoleum errichtet über der verlorenen Zeit.
Zugleich ist ihm, was sich in seiner Epoche als Moderne regte, zuwider. Da interessieren sich Autoren plötzlich für das Spirituelle, Paranormale, Psychologische, für den Liebeswahn, die Entgrenzung, den Tod. Der aufgeklärte Mensch wird mit einem Mal nicht mehr auf seine Rationalität beschränkt, vielmehr das Nicht-Rationale als Teil der Vernunft begriffen.
Wer Goethes Balladen, seine Lyrik insgesamt, wer die Gestalt der »Mignon« oder des »Mephisto« betrachtet, wird einwenden, Goethe habe an diesem Prozess durchaus teilgenommen. Er hat im »Werther« die Innerlichkeit zur öffentlichen Angelegenheit, hat die Liebe zur Naturkraft erhoben. Geheuer aber war ihm die Vernunft jenseits der Vernunft keineswegs. Er fand sie bei Kleist und begegnete diesem mit so viel »Schauder und Abscheu«, dass Hofmannsthal später schreiben konnte, der »Greis von Weimar« habe »Kleists Seele getötet« – wie die von Lenz, Merck oder Schubert. Das Genialische an Schiller oder Hölderlin ließ ihn kalt.
Dem Tod wich er nicht nur aus, seine Befangenheit hatte paranoide Züge. Vier Kinder sterben ihm, im Tagebuch fehlt jede Notiz. Den Leichenzug der Frau von Stein leitet er absichtlich fern vom eigenen Haus zum Friedhof. Zu Schillers Begräbnis erscheint er nicht, und selbst die eigene Gattin lässt er elendiglich alleine sterben. Diese Obsession mag oberflächlich damit zu tun haben, dass Goethe oft und schwer krank gewesen ist, sie verrät aber auch eine tiefe Verunsicherung allem gegenüber, was er nicht beherrschen konnte, und greift in dieser Hinsicht tiefer in das Werk ein als seine Charaktermängel.
Wenn seine Manuskripte heute gefunden worden wären, und wir Nachgeborenen sie nicht hätten kanonisieren können, wir wären vielleicht betört von der enzyklopädischen Neugier, der Vielgestaltigkeit des Wissens, der Stärke des Ausdrucks, aber vielleicht wären wir gleichzeitig nüchterner in der Bewertung des Bleibenden, abgekühlt von der Kälte der Beherrschung, dem Ebenmaß der formalen Gestaltung, dem ständigen Ausgleich, der Kontrolle, die dieses Werk fast unbarmherzig über sein Material auszuüben scheint.
Distanz ist in der Kunst bekanntlich die erste Bedingung für die Annäherung an das Werk: Unsere Zeit ist ironisch und lakonisch, Goethe ist es nicht. Wir haben den Glauben an die Aufklärung verloren, Goethe vertraute ihr tief. Er wies der Dichtung eine ethische Aufgabe zu, wir reagieren allergisch auf Botschaften. Er war ein Ziehkind Weimars, wir sind Enkel der Weimarer Republik. Er träumte von einem humanen Staat, wir haben ausgeträumt. Er wollte auf die Nachwelt kommen, die Nachwelt sind wir.
Als Goethe am 6.11.1970 exhumiert wurde, war der Lorbeer noch frisch, der Rest müffelte. Weh dem, der Symbole sieht!
In einem fernen Land
Über Jack London
Als die Welt der Zeitung groß wurde, als sich neue Räume öffneten für Reporter und Geschichtenerzähler, die die Ferne aus der Nähe zeigen wollten und die Fremde im Detail, da zogen auch Schriftsteller in die Welt und suchten den Augenschein. Es waren Abenteurer unter ihnen. Allerdings waren die großen Autoren selten echte Abenteurer, und die echten Abenteurer waren selten auch große Autoren.
Anders Jack London. Robert Musil bemerkte einmal, heutzutage würden die Schriftsteller immer schlechter und die Journalisten immer besser, und an anderer Stelle nennt er Jack London »einen sehr lebendigen und klugen Mann«, der zufrieden sei, eine starke Szene und einen guten Gedanken in seine Texte zu schmuggeln, sich sonst aber nicht zu schade sei, ein gutes Garn zu spinnen. Ja, anders als in der deutschsprachigen Literatur üblich, wird hier ein Werk nicht mit Botschaften überfrachtet, vielmehr kann Jack London schlicht gut schreiben, das heißt sachkundig, genau, dicht, fesselnd, und ihm geht der Stoff nicht aus, ihm, dem Kraft- und Tatmenschen, der Arbeiter in der Konservenfabrik, Matrose auf einem Robbenfänger, politischer Aktivist der Arbeitslosenbewegung, Tramp und Student gewesen war, ehe er sich für die Schriftstellerei entschied, und der seinem Scheitern zu entkommen suchte, indem er Goldgräber in Alaska wurde. Dieser Jack London hatte, als er mit 22 Jahren erfolglos von der Goldsuche nach Oakland zurückkehrte, schon ein paar Leben hinter sich. Was er schreiben würde, konnte gar nicht anders als prall sein.
Wenn je ein Autor seine Leserschaft mit Fremde angesteckt, wenn je einer sein Publikum mit Lebenshunger infiziert hat, dann war er es. Jack London ist rasant, er ist ein Wagemutiger, ein Berserker, doch Behutsamer, er ist suchtkrank und depressiv, unvoreingenommen, aber schwärmerisch, zugleich entschieden und den Unterworfenen unweigerlich verbunden. Dies zusammengenommen, sättigt die Sphäre, in die der Leser eintritt, wo er Jack Londons Bücher öffnet. Es herrscht dort ein Geist der Kühnheit in jeder Hinsicht, und eigentlich ist er es, der das Abenteuerliche bezeichnet. Das Fluidum der inneren Beweglichkeit, der Freizügigkeit und Beherztheit umgibt diesen Erzähler, der seine Leserschaft bindet, nicht allein weil er Strapazen für sie schultert und das Erzählte mit Leiden beglaubigt, sondern auch weil er schreibend Räume zu einem anderen Wahrnehmen, Denken und Urteilen aufstößt. So kann auch dem Leser auf diesen Seiten alles passieren, und vielleicht sucht er eben das.
So wie ich haben viele diesen Autor im jugendlichen Alter entdeckt. Viele vollzogen mit ihm nicht allein den Eintritt in den größeren Horizont der fernen Welt, sondern auch in die Welt erwachsenen Lesens. Man kann sich von dem Bann dieser frühen Lektüren später kaum lösen. Sie bedeuten so viel, und es gibt ja auch Texte, die man mit fünfzehn besser versteht als mit fünfzig. Zu diesen kehrt man später befangen zurück, ängstlich, ihr Zauber könnte sich abgenutzt, ihre Magie verbraucht haben. Mit Jack London ergeht es mir anders: Ich trete wieder ein und alles ist sofort da, ich kenne mich aus, ich staune, ganz wie ich damals staunte, und wie damals sind es gar nicht immer die Verläufe der Geschichte, die mich primär in diesen Spannungszustand versetzen, es sind Räume, Requisiten, Situationen, Konstellationen, Satzfetzen, Wendungen, Tempobezeichnungen, Details.
Einen »Abenteuerschriftsteller« hat man Jack London ehemals vorwurfsvoll genannt und gemeint, seine Qualitäten seien eher stofflicher als ästhetischer Natur. Aber nein, manche dieser Erzählungen sind vielmehr trojanische Pferde. Sie erzählen Geschichten, aber der Bauch der Geschichten steckt voller Informationen aus einer unbekannten Welt.
Gewiss hat die historische Situation, in der Jack Londons Reise- und Abenteuergeschichten entstanden, zur Abwertung ihres literarischen Gehalts beigetragen. Der Reisebericht fungierte ja ehedem vor allem als Medium des Kulturtransfers. Missionare, Ordensbrüder, Kaufleute, Forscher waren es zuerst, die vom Exotischen erzählten. Für sie war der fremde entweder der barbarische Raum, den es nach den Gesetzen des eigenen Lokalpatriotismus zu zivilisieren galt, oder man suchte gerade das andere, vermeintlich »natürliche« Leben als das Korrektiv zum eigenen.
Der Brockhaus von 1886 geht dagegen bereits so weit und behauptet, die Kulturstufe eines Volkes lasse sich an der Entwicklung seiner Reisetätigkeit ablesen. Das bloße Überschreiten der Handelsreisen – und man ergänze, der Feldzüge – zeuge bereits von überlegenen Zielen und mindere zwangläufig den hinderlichen »Nationalhass«. Kein Kulturraum, den Jack London bereist, dem er nicht seine Würde gelassen, keiner, dem er nicht mit Achtung begegnet wäre.
Die literarische Kritik der Zeit aber wandte sich gegen die Reiseliteratur als Unterhaltungsliteratur, nannte sie kommerziell, sensationslüstern, geschwätzig, schädlich. Zudem dürfe zweckfreies Reisen nie einem kommerziellen Zweck untergeordnet werden, und der Reiz des Außenraums mindere den Wert des Textes. Schon Louis Antoine Bougainville, Leiter der ersten französischen Weltumsegelung hatte in diesem Sinne geschrieben: »Ich bin Reisender und Seemann, das heißt ein Lügner und Dummkopf in den Augen jener Klasse bequemer und anmaßender Schriftsteller, die im Schatten ihres Arbeitszimmers über die Welt und ihre Bewohner philosophieren.«
Zusammenfassend könnte man sagen, drei Dinge sollte der Autor, der auf sich hielt und das Feuilleton seiner Zeit achtete, meiden, wollte er geschätzt sein: Er sollte kein Abenteurer sein, nicht für die Jugend und schon gar nicht um des Geldes Willen schreiben. Dreimal hat Jack London gegen die Literaturkritik verstoßen, und deshalb war er in seiner Heimat bald, anders als in Europa oder Russland, ein weltbekannter vergessener Autor.
Seit sich der Siebzehnjährige 1893 erfolgreich am Schreibwettbewerb einer Zeitung beteiligt hatte, war durch die Vervielfältigung der Magazine und Zeitungen der Bedarf an Kurzprosa stark gewachsen, und wie Uwe Böker dargelegt hat, erkannte London hier eine Möglichkeit, von seiner Passion zu leben. Seit obendrein 1891 das Copyright in Kraft getreten war, bedienten sich die Verleger nicht mehr bei den rechtefreien englischen Autoren, sondern beschäftigten lieber lokale Schriftsteller und banden sie an ihre Organe, so Edgar Allan Poe, Rudyard Kipling, Bret Harte, Mark Twain, Herman Melville … Mit seinem Studienabbruch im Jahre 1897 setzt bei Jack London ein überbordender Produktionsdrang ein. Er schreibt nachts auf der Schreibmaschine des Schwagers und zwar gleich in mehreren Gattungen, auch Essays, Betrachtungen, Short Stories, sogar Verse und Epen.
Nicht länger als fünf Jahre wird er brauchen, um als ein gut bezahlter Autor reißenden Absatz bei diversen Magazinen zu finden. Trotzdem war es keineswegs immer einfach, die Vermittlung zwischen den kommerziellen Ansprüchen der Verleger und den eigenen künstlerischen zu finden, war Jack London doch nebenbei ein akribisch studierender, das Schreiben wie die Wissenschaft, die Philosophie, die Abstammungslehre oder die Gesellschaftstheorie erkundender Autor. Er weiß wohl, wie viel er seinem Stoff verdankt, doch liebt er es zum Missfallen der Chefredakteure besonders, mit Ideen zu schreiben, eine Sicht vom Menschen auszubreiten, Thesen zu verfechten, die der Zeit mitunter riskant erschienen, das Publikum überfordern konnten und die man manchmal geschickt im Stoff verhüllen musste.
Knapp zweihundert Erzählungen hat Jack London geschrieben. Die meisten erschienen zuerst in Publikumszeitschriften. Sie begegneten einer klaren Lesererwartung, und je erfolgreicher der Autor wurde, desto mehr glaubte man zu wissen, was eine typische Jack-London-Erzählung auszumachen hatte. Man kann nicht sagen, dass der Autor diese Erwartung ignoriert hätte. Manche Schnurre ist unter den Texten, manches gute Garn, manche Kolportage-Erzählung, ja in manchen Texten ist es ganz offenbar, das Zugeständnis an den Ort der Veröffentlichung, den Verleger, die Absatzerwartung, die Flüchtigkeit. Einigen dieser Texte hat London in den später erschienenen Erzählbänden wieder ihre ursprüngliche Gestalt gegeben. So recht zusammen aber fließen Recherche und literarischere Idee erst, als er eine Vorstellung vom »Leben« gewonnen hat, und das heißt auch von jener Größe, die mehr ist als ein vitaler Impuls.
Ganz selten reflektiert Jack London sein Reisen und Schreiben, aber seine umfangreichste Reiseerzählung »In einem fernen Land« beginnt er mit den Worten: »Wenn ein Mensch in ein fernes Land reist, muss er bereit sein, viele Dinge, die er gelernt hat, zu vergessen und sich andere zur Gewohnheit zu machen, die Voraussetzung für das Leben in dem neuen Land sind; er muss die alten Ideale und die alten Götter verleugnen und nicht selten die Grundsätze, nach denen er sein Verhalten bis dahin ausgerichtet hat, geradezu umkehren. Wer die proteische Fähigkeit der Anpassung besitzt, dem mag das Neuartige dieser Veränderungen sogar Vergnügen bereiten; doch jene, die die ausgefahrenen Gleise ihrer Lebensbahn noch nie verlassen haben, empfinden den Druck der fremden Umgebung als unerträglich und reiben sich seelisch und körperlich an den neuen Fesseln wund, die sie nicht verstehen.« Diese entlässt der Erzähler entweder in die Umkehr, auf den Heimweg oder in den Tod.
Jack London, dessen Blick uns aus allen Fotos mit brennender Intensität entgegenflammt, ist der Typus des beteiligten Autors, der, was er bezeugt, selbst durchgemacht hat. Er schreibt nicht aus dem Hörensagen, nicht einmal als bloßer Ohrenzeuge, und unglaublich ist, was er weiß: dass die Schlittenhunde vor Hunger die Zugriemen fressen, dass der Frost an den Lungen nagt und dem Husten Klangfarbe gibt, dass man in tiefster Kälte in Schweiß ausbrechen kann, wenn man den Schmerzensschrei beim morgendlichen Schuhe-Anziehen unterdrücken will, er weiß um die Zerfallsstufen der Hand eines Leprakranken, kennt die Kur gegen Pockenbakterien und die Typen der Wogen, die ein Orkan über ein Schiff wirft. Er kennt Stammeskulturen und indianische Traditionen, er ergründet die Psychologie der Mischlinge und Fragen der Integration, er kennt sich aus in der chinesischen Geschäftswelt, weiß, welche Rohstoffe gehandelt, welche Plantagen man wo zu welchem Preis und mit wie viel Prozent Profit verkaufen konnte. Ja, wie Chinatowns in der Südsee entstanden sind, wie sich das anti-chinesische Ressentiment bilden konnte, das versteht man bei Jack London, und man findet es heute noch in Tonga oder auf den Salomonen, wo chinesische Verkäufer die Kundschaft hinter den Vergitterungen ihrer Läden erwarten, aus Angst vor Plünderungen.
Wo sonst fänden sich Szenen wie der Abschied einer Leprakranken, bevor sie auf die Quarantäne-Insel reist, oder der Amoklauf eines alten Indianers? Wo sonst offenbarte sich der polynesischen oder der indianischen Welt gegenüber solches Verständnis für die Alten, solche detailscharfe Sicht der Generationsprobleme unter Einwanderern? Und welchem Augenzeugen stünden solche literarischen Mittel zur Verfügung?
London schreibt mal blumig, mal protokollarisch, mal im Idiom eines fiktiven Erzählers oder Einheimischen, mal als der ferne Beobachter aus der weißen Welt. Er stellt die romantische Mär von der tiefen Freundschaft zwischen Herr und Diener neben die Legende vom sagenhaften Ahnen und dem Verbleib seiner Leiche, die Geschichte der Bekehrung einer Frau neben den Rapport einer Hai-Jagd, die Liebeserklärung an das Hawaii seiner Zeit neben die Klage über den Kolonialismus. Er ist der Meister des Kolorits, auch des Idioms und kann »mit Zungen reden«. Er ist großzügig mit seinen Stoffen und lässt am Rande ganze Miniaturen liegen, aus denen man Geschichten hätte gewinnen können.
Mitten in einer klassischen Männerwelt, dort, wo herkömmlicherweise die Rituale der Alphatiere vollzogen, wo Prüfungen bestanden, Konkurrenzen entschieden werden, gelingen ihm obendrein immer wieder starke, vorurteilsfreie Frauenfiguren, denen nicht vor allem Schönheit, sondern Kraft, Zähigkeit, Charakterfestigkeit, Witz verliehen wird. Ja, eigentlich »kann« er sie alle: Frauen, Männer, Helden, Verlierer, Schwächlinge, Kraftmenschen, Alte, Unreife, alle sind ihm zugänglich, und manche Wirkung verdankt sich schierer Magie.
So hinterlässt Jack London im Leser starke, suggestive Landschaftsbilder. Blickt man aber genauer hin, entdeckt man, dass er de facto kaum Landschaftsbeschreibungen kennt – ein paar Striche, gewiss, im Nebenher, im peripheren Sehen auch mal eine dahingetuschte Bucht, eine Hügellinie, ein Wald, aber eigentlich sind es die handelnden und die leidenden Figuren, in denen sich die Landschaft herausbildet, indem sie sie erschließen. Es kann Jack London sogar gelingen, einen Ort nur durch Wind und Stille entstehen zu lassen, er kann die Natur ausbreiten allein als der vom Menschen zu durchquerende, zu meisternde Raum, und dann bricht sich alles in der Leidensfähigkeit von Figuren, nicht in der des Autors. Denn der Abenteurer weiß um die Natur auf ganz andere Weise, als es der Autor weiß. Der Abenteurer ist kein Betrachter, er hat die Natur überleben müssen. Das ändert auch ihr Bild.
Jack London ist 17 Jahre alt, als er 1893 auf einem Robbenfänger an den Marquesas vorbeisegelt. Da liegen sie fern, doch nah, viel versprechend. Er wird sie wiedersehen, er wird wieder aufbrechen, als Reporter, als Autor. Später als er, der Kapitän seiner selbstgebauten »Snark«, das Projekt der Weltumsegelung im Hafen von Honolulu unterbrechen muss, wird er die zwei Monate der Schiffsreparatur nutzen, um in die hiesige Gesellschaft, das multinationale, multiethnische Leben von Hawaii einzudringen.
Am Ende wird London seine Weltumsegelung ganz abbrechen müssen. Krankheiten zwingen ihn, Nierenkoliken, Rheuma. Er ist Alkoholiker, seine Frau erleidet eine Fehlgeburt, die Ranch, die er bei San Francisco ausbaut und bewirtschaftet, entwickelt sich zum Fiasko. Er trägt innere weltanschauliche Kämpfe aus, wird Kriegskorrespondent in Mexiko, tritt noch 1916, im Jahr seines Todes, aus der Sozialistischen Partei aus und reist ein letztes Mal nach Hawaii. Jetzt aber wendet er sich vom Alltäglichen ab und stärker den Mythen und Legenden zu, auch im Bewusstsein ihrer Gefährdung durch das Eindringen weißer Forscher, Missionare und Kolonialisatoren. »Wahrlich!«, so hatte schon Georg Forster, der James Cook auf seiner zweiten Reise in den südpazifischen Ozean begleitete, ausgerufen, »wenn die Wissenschaft und Gelehrsamkeit einzelner Menschen auf Kosten der Glücksseligkeit ganzer Nationen erkauft werden muß; so wär’ es für die Entdecker und Entdeckten besser, dass die Südsee den unruhigen Europäern ewig unbekannt geblieben wäre!«
Jack London ist immer der Autor der Differenz. Nicht nur gelingt es ihm, die Fremde als Fremde intakt zu halten, er setzt sie immer wieder ins Recht, so wenn er den alten Indianer, der ein Massenmörder ist, vor Gericht sagen lässt: »Wir waren bitter enttäuscht: ›Was für den weißen Mann gut ist, ist nicht gut für uns.‹ Und das ist wahr. Es gibt viele dicke, weiße Männer, aber sie haben uns aufgezehrt und wir sind mager geworden. (…) Die Weißen kommen zwar wie der Hauch des Todes, alles, was sie bringen, führt zum Tod, sie atmen den Tod, aber sie sterben nicht. Sie haben den Whisky, den Tabak, die kurzhaarigen Hunde; sie haben die vielen Krankheiten, die Pocken und Masern, den Husten und das Blutspucken; sie haben die weiße Haut, keine Widerstandskraft gegen Frost und Sturm; die Pistolen, die sechsmal sehr schnell hintereinander schießen und wertlos sind. Und doch werden sie fett und gedeihen trotz ihrer zahllosen Übel; ihre schwere Hand lastet auf dem ganzen Land, und sie treten seine Völker mit Füßen. Ihre Frauen sind zart wie Säuglinge, ganz zerbrechlich und werden doch nie gebrochen, sondern Mütter von Männern. Aus aller Zartheit und Krankheit und Schwäche kommt Kraft und Macht und Herrschaft. Vielleicht sind sie Götter, vielleicht Teufel. Ich weiß es nicht.«
Vielleicht auch, weil er sich selbst in ihnen erkennt, besitzt Jack London ein unstillbares Interesse an den Grenzgängern – Einheimischen, die sich in Polynesien den Weißen annähern, Indianern, die als Vermittler auftreten, wie jener alte Indianer Sitka Charly, der den Seinen den Rücken kehrte, unter Weißen lebte und doch kein Weißer wurde. Immer wieder sind es jene Figuren, die ihm selbst, dem hoch Assimilierten, ähnlich sind. Es geht hier auch um das Verständnis des Eigenen im Fremden, um das Erkennen des Eigentlichen im Anderen.
Eine derartig ebenbürtige Darstellung jener Kultur, in die er eintritt, könnte ihm nicht gelingen, wäre Jack London nicht auch Bewahrer der »oral history«, der mündlichen Überlieferung. Eingeschlossen in seine Texte hat er die Stimmen derer, die keine Stimme hatten und sie im Werk erheben auch zum vernichtenden Urteil über die Weißen, jene, die als Ausbeuter kamen und nichts zu schenken hatten. Lange bevor die Weisheit der Indianer zu Coffeetable-Plattitüden und Kalendersprüchen verarbeitet wurde, exzerpierte Jack London ihre apokalyptischen Visionen, aber nicht als düstere Weissagungen, sondern als Expertise der gegenwärtigen Welt. Dies sind Berichte aus einer Welt, in der der Indianer schon unterworfen, aber noch nicht besiegt ist. Sie müssen in einer Zeit, da sich die Vernichtungsenergie des Weißen gegen sich selbst und die Grundlagen seiner Existenz gerichtet hat, erst wahrhaft prophetisch erscheinen.
Wo die Weißen in diese Landschaften eindringen, gleich ob es die Goldgräber in Alaska sind, die Kolonialherren in Polynesien oder die Missionare allüberall, besteht ihre fatale Wirkung nicht allein in der Missachtung der Naturgesetze, denen sie oft selbst zum Opfer fallen, sondern in ihrer Macht, die Einheimischen zum Verrat am Eigenen bringen. Obsessive Charaktere sind diese Weißen, geradezu fanatisch treiben ihre Missionen die Handelnden voran. Immer wieder verleugnen sie, was London als »die rechte innere Einstellung«, »Selbstlosigkeit, Nachsicht und Toleranz« propagiert, ein Bewusstsein, das im Handeln eher sichtbar wird als im Reden.
Der zentrale Komplex der Erzählungen Jack Londons entfaltet sich zwischen der lieblichen Opulenz Polynesiens und der lebensabweisenden Kargheit Alaskas. Die Südsee, ein utopischer Ort, an dem Exotismus und Eskapismus zusammenlaufen, die Gegend, in der Herman Melville, Paul Gauguin, Robert Luis Stevenson das Glück fanden, verklärt Jack London in einer Liebesbekundung, die er von Mark Twain zitiert, der über Hawaii schrieb: »Kein fremdes Land auf der ganzen Welt hat einen so tiefen, starken Reiz auf mich ausgeübt wie dieses; kein anderes Land konnte mich, ob ich nun schlief oder wachte, ein halbes Leben lang so ganz und gar in seinen Bann schlagen. Andere Dinge entfallen mir, aber Hawaii haftet in der Erinnerung; andere Dinge ändern sich, aber dieses Land bleibt, wie es war.«
Wo aber würde dieser Ferne so sehnsüchtig gedacht wie am anderen Pol der Welt Jack Londons, in der Todeszone des Eises, an den unwirtlichsten Plätzen Alaskas. Die Erzählungen aus dieser Region wimmeln von jenen Namen, deren Aura sich bis heute nicht zuletzt seinem erzählerischen Werk verdankt: Klondike, Yukon, Dawson, Forty Mile, es sind die Außenposten der Suche nach Gold, nach Glück, es sind die Schauplätze der Kämpfe, die der Mensch mit der Natur, mit sich und seinesgleichen führt und an denen nur ein Gewinner immer schon a priori feststeht: die Wildnis. Denn mag der Mensch auch mal entkommen, überleben, die Natur ist Macht, sie herrscht, und bei Jack London zeichnet sich noch nicht ab, dass sie besiegt, zerstört und in die Defensive getrieben werden könnte. Gleichwohl schließt der Boden sie überall ein, die Leichen jener, die hier verendeten. Die Erde erzählt ihre Geschichten. Jack London aber sucht nicht dies Drama allein. In den Extremen der Landschaft, des Klimas und des Abenteuers kommt in seinen Erzählungen am Ende aller Erniedrigung das Eigentliche zum Vorschein, und so erscheint sie zuletzt, die Kategorie des Erhabenen im Menschen und in der Natur.
Für Jack London erscheint in der Strapaze, in der lebensbedrohlichen Situation, in der Konfrontation mit dem Sturm, der Woge, dem Frost, nicht die Gefahr allein, sondern hier öffnet sich eine neue Möglichkeit, den Menschen zu sehen, den ausgesetzten, gebrechlichen, gefährdeten Menschen, und so ist alles Abenteuern um des Abenteuers Willen eine unbeschenkte, blindwütige, zum Scheitern verurteilte Tätigkeit.
In einer seiner ergreifenden Erzählungen, »Feuermachen«, verfolgt er den Sterbeprozess eines Unbedarften, eines Neulings in seinem ersten Winter, und es heißt: »Das Problem war, dass ihm das Vorstellungsvermögen abging. Er erfasste die Dinge des Lebens rasch, aber nur die Dinge, nicht ihre Bedeutung.« Minus fünfzig Grad Fahrenheit bedeuten für ihn »bloß, dass es ungemütlich kalt war, mehr nicht. Es brachte ihn nicht dazu, über seine Gebrechlichkeit als temperaturabhängiges Wesen nachzudenken oder über die Gebrechlichkeit des Menschen im Allgemeinen, (…), und er stellte, von solchen Überlegungen ausgehend, auch keine Mutmaßungen über die Unsterblichkeit des Menschen und den Platz des Menschen im Universum an.« Die Überlebenden aber sind immer solche, denen fünfzig Grad unter null mehr sagen als fünfzig Grad unter null.
Jack London ist in solchen Texten ein unbarmherziger, aber gerechter Porträtist: Der Mensch wird unterworfen, er unterliegt einer Natur, die herrscht, die ihn duldet oder die ihn abschütteln möchte, deren Geboten er gehorcht oder deren Verbote er missachtet. Der Einheimische ist dem Eindringling voraus nicht allein im Wissen um die Natur – und dieses Wissen drückt sich in auch animistischen, religiösen, rituellen Formeln, Gebeten und Opfern aus – er kennt sich selbst genauer, als der Fremde sich kennt, er weiß, geschult an den Vernichtungsszenerien der Schöpfung, besser um die eigenen Grenzen. Schließlich war er schon so oft in Gefahr, hat sich dem Meer, dem Sturm, der Hitze, dem Eis, der Finsternis, dem Flusslauf schon so oft ausgesetzt, hat die Aussicht auf den eigenen Tod schon so oft überlebt, dass er davor schlicht geworden ist, man könnte auch sagen weise, abgeklärt, wissend. Die größten Abenteurer im Werk Jack Londons hat man alle immer wieder klein werden sehen, demütig vor der Naturgewalt, an die Grenze ihrer Existenz getrieben, reduziert auf einen Zustand, in dem sie nur noch vom Glimmen des eigenen Lebenslichts erwärmt wurden.
Moral und Amoral der Welt Jack Londons entspringen hier. Sie haben im elementaren Sinn oft weniger mit dem Gemeinschaftswohl zu tun als mit einem Gehorsam gegenüber Naturgesetzen, der Anerkennung jener überlegenen Macht, die sich wie jede Macht als aufgeschobene Gewalt manifestiert. Räume öffnen sich, in denen sich eine ungeheure Zerstörungsenergie staut, und die Protagonisten, die in diese Räume treten, werden entweder Opfer der Natur oder ihrer selbst. Exemplarisch hat Jack London diese Bewegung in seiner Erzählung »Der Blick aus dem Fenster« instrumentiert: Atemlos und von geradezu symbolischer Unrast ist die Bewegung, in der drei Menschen in einer grimmigen Schneelandschaft einen vierten verfolgen. Zuletzt verlangsamt sich die Bewegung der Beschleunigung bis in die Zeitlupe. Dort haben alle vier endlich »das Leben« vor sich, die Freude, den Tod, den »Sinn« sogar und alles erstarrt in einem finalen Bild, das offenbleibt und zu deuten ist.
Jack London, der manchen Ort erstmalig literarisch besetzte und für eine lesende Weltöffentlichkeit die Vorstellung von Alaska wie von der Südsee prägen half, er hat sich gegen Exotismus auf der einen und Abenteuerromantik auf der anderen Seite immer wieder verwahrt, hat immer wieder selbst das Eigene wie etwas Fremdes betrachtet. In »Nam-Bok der Lügner« verlässt der Indianer seinen Stamm in Alaska und betritt die Welt der Weißen, die er sich fassungslos, mit dem immer wieder erneuerten »ersten Blick« aneignet. Nach seiner Heimkehr erzählt der tot Geglaubte den Seinen von Schiffen, der Eisenbahn, der Großstadt, dem Geld und wird als Lügner, als Geist oder Untoter verstoßen.
Nicht bei dem arglosen, unvoreingenommenen Blick des »Primitiven« auf die technische, großstädtische Welt der Weißen belässt es Jack London. Nein, als Nam-Bok heimkehrt, endlich wieder jene sehnsuchtsvollen Bilder sieht – etwa, wie Frauen das Fett von der Innenseite der Robbenfelle schaben oder mit Tiersehnen Stiefel aus Seehundsfell zusammennähen –, da heißt es unvermittelt: »Nam-Bok ließ das Bild auf sich wirken, doch fehlte ihm der Zauber, den es in seinen Erinnerungen ausgestrahlt hatte. In den Jahren seiner Wanderschaft hatte er immer davon geträumt, und jetzt, wo es Wirklichkeit war, fühlte er sich enttäuscht. Es war ein schäbiges, dürftiges Leben, dachte er.«
Jack London ist ein klassischer Schriftsteller auch durch den Rhythmus seiner Blickwechsel. Seine Abenteuer erzählen von Berührungen mit einer Wirklichkeit, die sich in der Illusion, im Heimweh, im Staunen, im Existenzkampf wie in der Todesangst immer anders offenbart, sich aber selbst aus dem Bodensatz von allem, aus der »schäbigen, dürftigen« Realität, zum Hymnus an das Leben erheben kann.
Antal Szerb:Reise im Mondlicht
Da steigt einer aus seinem Leben aus, einfach weil er mitgerissen wird von der Wirklichkeit der Reise, die ihn quer durch Italien führt auf der Flucht vor seiner Frau, seiner Pflicht, seiner Tristesse. Wunderschön erzählt.
Thomas Stangl:Der einzige Ort
Auf getrennten Wegen reisen zwei Männer gegen Anfang des 19. Jahrhunderts nach Timbuktu. Sie durchqueren alle inneren Zustände. Ein atemberaubend konzentrierter, kluger Debütroman.
Alice Munro:Himmel und Hölle
Was diese kanadische Meisterin kann, verfolgt man fassungslos. Sie setzt Erzählungen aus lauter Lücken, Zuständen des Schweigens und Ausblendens zusammen und gewinnt reine Poesie. Man wird sie nicht mehr los.
Paul Gauguin:Noa Noa
Der Reisebericht, den der große Maler in der Südsee verfasste, ist für mich immer noch eines der schönsten exotischen Werke, eine magisch beschriebene Berührung mit der Fremde.
Gustave Flaubert:Briefe
Hat irgend jemand bessere Briefe geschrieben als Flaubert? So zart, so stark, so roh auch, so detailscharf und befreit von der Disziplin des Schreibens, die ihn sonst so drückte? Ich bezweifle es.
Frank Schulz:Morbus Fonticuli
Der virtuos geschriebene Gegenwartsroman, auf den alle immer noch warten, er ist längst da und spielt im Hamburg der Siebziger. Eine große, berauschende Groteske.
Vladimir Nabokov:Gelächter im Dunkel
Nehmen wir diesen Roman, weil er komisch, hell und dunkel in einem ist. Aber von Nabokov ist mir fast jede Zeile kostbar. Sein Ruhm wäre längst größer, ließe sich das Publikum durch »Lolita« nicht zu falschen Wallungen von Political Correctness verleiten.
Samuel Beckett:Murphy
Dieser große, stille, gleichwohl radikale Mann geht mit seinem Werk geradezu auf einen Punkt der Ausdrucksverweigerung zu. Dieses größte moderne Gesamtwerk hat in »Murphy« noch leuchtend erzählerische Momente.
Nina Berberova:Der Lakai und die Hure
Ungewöhnlich verdichtetes, dabei genüssliches und nur atemlos zu lesendes Schreiben. Desillusioniert, sachlich und in seiner Lakonie so klug, dass man nur durch die Zähne pfeifen kann.
Robert Musil:Drei Frauen
Diese Meisterwerke der kleinen Form sind die beste Einführung in das Werk des Mannes, der sich anschickte, der Moderne zu zeigen, wie man schon denken und fühlen kann.
Der Dichter als Delegierter Gottes
Zum hundertsten Geburtstag von Max Brod
Der Fall ist in der Literaturgeschichte ohne Seitenstück: Wer von Max Brod spricht, der muss auch von Franz Kafka sprechen. Keine deutsche Dichterfreundschaft hat für die Nachwelt solche Bedeutung, keine wirkt so tief in den Werken fort wie diese. Für Max Brod mag diese Verbindung so glücklich wie fatal sein; glücklich, weil sie bestimmend für sein Leben und eine große Anzahl seiner Werke wurde, fatal, weil nicht nur seine eigenen literarischen Arbeiten immer wieder in den Hintergrund gerückt wurden, sondern auch weil ihm seine Dienste an Kafkas Werk manche Kritik eingetragen haben. Und dennoch: Wie viel wüssten wir heute von Brod, wenn er uns nicht an der Seite Kafkas erhalten geblieben wäre? Und andererseits: Wie schwer wiegt dieses Persönliche an seinem Werk, wenn man es unbefangen besieht?
Der Fall bleibt eigenartig. Wäre Kafka ein weniger rätselhafter Autor gewesen, Brod wäre uns als sein Freund und Interpret weniger wertvoll. Thomas Mann hatte keinen Max Brod. Man könnte schroff sagen: Weil er ihn nicht nötig hatte, oder aber: Weil die Interpreten auch ohne auskommen. Kafkas Werk aber, das wie kein zweites der modernen deutschen Literatur zum Inbegriff der ästhetischen Verdunkelung geworden ist, schreit geradezu nach Aufhellung. Und was läge näher, als diese gerade bei dem Mann zu suchen, der nicht nur über Kafkas unzugängliches Leben spätestens seit 1903 im Intervall täglicher Begegnungen berichten konnte, sondern der auch sein Werk mit der Empfindsamkeit und Integrität dessen begleitet, der selbst ein Schriftsteller ist?
Von Max Brod und Franz Kafka zu sprechen, bedeutet aber zunächst von Prag zu sprechen, der Stadt, deren eigenes literarisches Klima beide Autoren auf ihre Weise wesentlich mitbestimmt haben. »Ganz Praha ist ein Goldschatz von Gedichten«, schreibt Detlev von Liliencron, den die jungen Prager Dichter bewundernd zu Lesungen einluden. Sein Einfluss wird früh bestimmend für alle drei Kreise, in denen das literarische Prag prosperierte: dem Kreis um Hugo Salus, dem um Paul Leppin und den frühen Rilke und schließlich dem jüngsten um Max Brod, Werfel, Urzidil, Weltsch, Kafka und andere. Brod wurde früh zum eigentlichen Kraftzentrum dieses Zirkels. Bereits auf dem Gymnasium ließ er sich durch Vermittlung seines Mitschülers Willy Haas die Gedichte eines Schulkameraden namens Franz Werfel aushändigen. Sie begeistern die Entdeckerfreude Brods, und es gelingt ihm nicht nur, sie einem widerwilligen Verleger unter dem Titel »Der Weltfreund« gesammelt zum Druck zu geben, er trägt sie auch öffentlich vor und wird so zum eigentlichen Entdecker und Popularisator Werfels. Erst später, als sich dieser zum Christentum, Brod aber zum Zionismus wandte, trübte sich die Verbindung. Brod spricht rückblickend von dem »prunkvollen Ästhetizismus der Hoffnungslosigkeit«, der in Werfels späteren Werken die frühere Zustimmung zum Leben verdrängt habe. Erst lange Zeit später ist es über Abgründe hinweg zu einer Versöhnung gekommen. Alma Mahler-Werfel hat über Max Brod gesagt, er sei »ein viriler Antiheld, der Schönheit brauchte wie eine Blume die Sonne«, und Werfel selbst befand über ihn, er sei zu schwärmerisch und zu wenig kritisch, er habe zu schnell geschrieben und oft nur die ausgewalzte Form benutzt. Solche Urteile sind so unverdient nicht. 83 Bücher hat Brod hinterlassen, viele von ihnen haben einen Umfang von etwa 500 Seiten. Zahlreich sind daneben seine Übersetzungen, seine Artikel und Opernlibretti. Die musikalischen Kompositionen aus seiner Hand würden nummeriert etwa die Opuszahl 100 erreichen. Nicht nur Werfels kritische Wertschätzung des einstigen Mentors trägt gemischte Züge. Bündig hat Hermann Kesten über Brod befunden: »Er ist ein typischer Prager Dichter, mit Mystik und Witz, sehr fein und wiederum mit vulgären Volkselementen, ein präziser Schilderer und lebensvoller Erzähler. Wie Rilke, Weiß und Werfel ist er ein ungleichmäßiger Stilist zwischen Tiefsinn und Banalität. Er ist ein Wahrheitsfanatiker wie Kafka, ein Slawophile wie Weiskopf, phantastisch wie Meyrink, auf Duzfuß mit der Weltordnung wie Kisch, ein geistreicher Kritiker wie Willy Haas, voller Prager Exotismen und böhmischer Popularismen, zuweilen ein nebuloser Denker und Provinzmystiker. … Diese ganze Prager Schule ist telefonisch mit dem lieben Gott verbunden.«
Hier fallen bereits die meisten jener Namen, die auch Max Brod gerne unter der Bezeichnung »der Prager Kreis« zusammenfasste, eine Vereinigung, die wahrscheinlich zu Lebzeiten weniger fest gefügt war, als der posthume Blick suggeriert. Richtig ist indessen, dass sich die Mitglieder dieses Kreises früh durch ein artikuliertes Verhältnis zur Religion auszeichneten. Der akademische Verein »Lese- und Redehalle der deutschen Studenten« wurde zum Sammelpunkt des jungen literarischen Prags. Hier waren Juden stärker vertreten als christliche Mitglieder, ihre Kontroversen mit den Nationalen und Antiliberalen schufen ein intellektuell erregtes Klima. Hier begegnete Brod zum ersten Mal Franz Kafka, der an den Debatten jedoch nur passiv Anteil nahm.
Brod traf mit Kafka seit 1903 täglich zusammen. Er wurde das Vorbild des Älteren durch die Entschlossenheit und Vitalität seines Auftretens und Agierens. Durch ihn lernte der scheue und oft kränkelnde Freund die Umgebung Prags, Oberitalien, Weimar, Paris und die Schweiz kennen, durch ihn wurde er ins literarische Leben eingeführt und neuen Freunden vorgestellt. Zur Persönlichkeit Franz Kafkas hat Brod einmal notiert: »Nie sprach er ein unbedeutsames Wort. Was von ihm kam, war auf eine Art, die im Laufe der Jahre immer ungezwungener wurde, ein kostbarer Ausdruck seiner ganz besonderen, geduldigen, lebenswilligen, den Narrheiten der Welt gegenüber ironisch nachsichtigen, daher scherzlich humorvollen und doch niemals den echten Kern, das ›Unzerstörbare‹ vernachlässigenden, also stets dem Blasierten oder Zynischen am weitesten abgekehrten Betrachtungsweise. In seiner Gegenwart veränderte sich der Alltag, alles wirkte wie zum erstenmal gesehen, war neu, oft auf eine traurige, ja niederschmetternde Art neu. Übrigens wirkte Kafka nicht etwa nur auf mich, sondern auf viele in der bezeichneten Richtung. Seine literarischen Werke kannte damals niemand außer mir. Es bedurfte der Werke nicht: der Mensch selbst wirkte.« Über das Leben Kafkas, seine Lektüren und seine Urteile ist von Brod Wichtiges zu erfahren. Von ihm wissen wir, dass Kafka noch vor 1910, als er seine ersten Skizzen unter dem Titel »Betrachtungen« veröffentlichen konnte, viele Manuskripte vernichtet hatte. Von Brod ist zu erfahren, welche Einflüsse Kafkas Werk aus der Lektüre Goethes, Flauberts, Kleists oder Kierkegaards empfing und wie stark Hofmannsthals »Chandos-Brief« auf ihn wirkte. Die Gestalt Kafkas ist in den Porträts des Freundes insgesamt vom Charisma des Religionsstifters umgeben.
Anders als Kafka sympathisierte Brod früh mit den zionistischen Ideen aus dem Umkreis Theodor Herzls. Viele der Mitglieder dieser Bewegung waren Sozialisten, die in der Idee eines »Nationalhumanismus« die Utopie des idealen Volkes verfolgten, das zum Vorbild der Welt heranreifen sollte. Das Modell dieser infinitesimalen Versittlichung der Nation bildete der jüdische Staat. Kafka stand den zionistischen Ideen wie auch den literarischen Zirkeln eher reserviert gegenüber, er verkehrte nur selten und nur von Brod gedrängt in der Sphäre des öffentlichen Lebens. Auch war er auf dem Feld der Philosophie mit Brod nicht durchaus einig und verteidigte Nietzsche, den dieser bis ins hohe Alter hinein »für höchst bekämpfenswert« erachtete. Nach Aussagen Brods war Kafka »an abstrakter Philosophie fast vollständig uninteressiert«. Seine philosophischen Neigungen waren vielmehr »schwermütig religiöser Färbung«. Das entsprach zumindest zur Hälfte der eigenen Position. Brod ist nicht müde geworden, Material zur religiösen Deutung Kafkas heranzutragen, und es ist dies einer der Punkte, die in der Forschung zu erheblichen Kontroversen geführt haben. Brod bestand neben dem düsteren vor allem auf dem gläubigen Kafka, der sich zuletzt innerlich durchgesetzt habe. »Franz Kafkas Glauben und Lehre«, »Verzweiflung und Erlösung im Werk Franz Kafkas« heißen zwei der Bücher, die Brod neben der Biographie über den Freund verfasst hat. »Kurz vor dem Nichts kommt Gott« hat Kafka notiert. Im Tagebuch nennt er ein andermal das Schreiben eine Form des Gebets. In solchen Wendungen, und seien sie noch so zweideutig, fand Brod Kafkas Gläubigkeit bestätigt, und auch die zugestandene Düsterkeit des Freundes zerging vor Brods apodiktischer Wendung: »Wer die Welt für unverbesserlich schlecht hält, hat in ihr eigentlich gar nichts zu suchen. Denn die Idee des Schöpfers ist anders.« Für Brod war alles Sein von einem Absoluten her bestimmt. In der Welt der Werke Kafkas fand er die Wirklichkeit offen gegenüber einer metaphysischen Realität, in der er das Göttliche erkannte. Es ist aber nicht dies interpretatorische Diktum allein, das Brod in Kontroversen zu großen Teilen der Kafka-Forschung gebracht hat. Vielmehr steht dort die philologische Integrität der von Brod besorgten Kafka-Ausgaben zur Debatte. Bekanntlich hatte Kafka in einer letzten Verfügung die Vernichtung seiner ungedruckten Manuskripte angeordnet. Dass Brod dieser Bitte nicht entsprechen würde, muss Kafka bewusst gewesen sein. Brod also edierte die Texte seines Freundes, indem er behutsame Berichtigungen vornahm und ausbesserte, was er für korrekturbedürftig befand. Gravierender waren dagegen die Textanordnungen und Umstellungen, die er in dem Fragment gebliebenen Roman »Der Prozess« durchführte. Sie taten der mutmaßlichen Konzeption Kafkas Gewalt an und zogen beträchtliche Missverständnisse nach sich. Dass hier keine philologisch exakte Ausgabe entstand, hat Brod später vehement mit der Maxime der Lesbarkeit verteidigt. Kafka, der fast unbekannte Autor, wurde zu einem der populärsten des 20. Jahrhunderts.
Brod hat nicht nur über Kafkas Persönlichkeit und Leben Auskunft gegeben, er hat sich immer wieder um die Darstellung des »Prager Kreises« bemüht und die intellektuellen Wechselwirkungen dargestellt, von denen der scheue Freund nicht ausgeschlossen blieb. Neben den Zionisten und den Sozialisten waren es nicht zuletzt die Universitätsprofessoren und Gelehrten, die auf die literarische Jugend Prags bedeutenden Einfluss ausübten. Brod hatte zwar nach Abschluss des Gymnasiums wie die Freunde Weltsch und Kafka das Studium der Jurisprudenz aufgenommen, die wesentlichen Impulse seiner geistigen Entwicklung aber erhielt er auf anderen Gebieten. Da war zunächst der genialische Soziologe Alfred Weber, der durch sein Werk »Kulturgeschichte als Kultursoziologie« bekannt werden sollte, sodann lehrte Christian von Ehrenfels, der Begründer der Gestaltpsychologie, in Prag, der in der Konzeption dichterischer Psychologie auch in den Werken Musils und Brochs deutliche Spuren hinterlassen hat. Albert Einstein verkehrte in den literarischen Zirkeln, die auch Brod besuchte, und neben ihm Hugo Bergmann, der Gelehrte ohne Lehrstuhl, der Erste des Kreises, der damals nach Palästina auswanderte und Brods zionistische Ideen wesentlich mitbestimmte. – Brod betrieb ein Studium universale, das seine philosophische Vertiefung vor allem in der gründlichen Auseinandersetzung mit der platonischen Ideenlehre erfuhr. Der antike Dualismus zwischen einer Welt des Werdens und einer Welt des Seins setzt sich bis in Brods späte kulturphilosophische Werke fort. Hier opponiert der negativen Geschichte, dem Fortschritt, die Welt der Liebe, die das Sein und Bewahren in einer durchaus religiösen Bedeutung einschließt. Der Künstler war für Brod ein Liebender im emphatischen Sinn, ein Bewahrer und ein Erfinder ewiger Werte. Die Repräsentanten dieser ästhetischen Opposition gegen den Zeitgeist fasste Brod summarisch als »Generation des Trotzdem« zusammen. In Flaubert, Gustav Mahler, Robert Walser und Hugo von Hofmannsthal erkannte er ihre glänzenden Verkörperungen, die realen Exempel eines kommenden »unzynischen Typs«. Es liegt nun eine, auch von der Kritik beanstandete Doppeldeutigkeit darin, dass Brods literarische Produktion dem Begriff der Liebe einerseits in leichten Gesellschaftsromanen eine frivole und ganz unmetaphysische Rolle zuschreibt, und dass sie ihm andererseits einen Weihecharakter verleiht, der die priesterlich verschleierten unter seinen Romanen um ihren realistischen Wahrheitsanspruch bringt. Auf der einen Seite stehen Bücher wie »Franzi oder Eine Liebe zweiten Ranges«, »Die Frau, nach der man sich sehnt« oder »Die Frau, die nicht enttäuscht«, auf der anderen Seite steht vor allem »Mira«, ein Werk, dem Brod den Untertitel »Roman um Hofmannsthal« gab und das wie kein zweites die Idee der hehren antizynischen Gesellschaft propagiert. Auf einer Burg in den österreichischen Hochalpen hat eine Gesellschaft von Büßern einen Orden installiert, der nach den Regeln ästhetischer Selbstverantwortung die Idee der idealen Gesellschaft zu realisieren trachtet. Die eingeflochtene Liebesgeschichte löst sich zuletzt in der Idee des platonischen Eros auf, der Erzähler tritt mit dem letzten Satz als Mitglied in die Gemeinde ein. »Man glaubt sich bei Beginn der Lektüre in eine Schwesterkolonie von Hermann Hesses ›Glasperlenspiel‹ versetzt«, schrieb ein zeitgenössischer Kritiker, und so sinnfällig der Bezug auch ist, so sehr schadet er dem Werk, das in der Beschwörung Platons, Goethes, Laotses und der romantischen Idealisten bisweilen zum anachronistischen Kulturkuriosum zu verkommen scheint.
Zur Zeit aber als Brod die Idee einer »Generation des Trotzdem« und eines »unzynischen« Menschentyps entwarf, da haftete ihr noch sehr viel praktisches Interesse an. Bereits in seinen Studentenjahren hatte er sich als Vermittler und Organisator der literarischen Welt Prags erwiesen. In den folgenden Jahren, als er Versicherungs-, Finanz- und Postbeamter im Staatsdienst geworden war, weitete sich diese Tätigkeit noch aus. Er holte Heinrich Mann zu Lesungen in die Stadt, übersetzte mit Franz Blei Laforgue, bemühte sich um die Popularisierung der Komponisten Adolf Schreiber und Carl Nielsen, hielt Vorträge und lancierte Werke junger Autoren zum Druck. In späteren Jahren hat er durch seine Übertragungen der Werke Janáčeks das Œuvre dieses bedeutenden Musikers erst für den deutschen Sprachraum erschlossen. Der getreueste Spiegel der Vermittlertätigkeit Brods ist sein 1913 erschienenes Jahrbuch »Arkadia«, in das er neben dem Erstdruck von Kafkas Erzählung »Das Urteil« vor allem Werke des bis dahin fast unbekannten Robert Walser aufnahm. Der Band enthält außerdem Texte von Werfel, Mell, Lautensack, Blei, Heimann, Tucholsky, Stoessl und Janowitz – ein ausgezeichneter Schnitt durch die bedeutende und zugleich keiner Strömung und keiner politischen Richtung zuzuordnende Literatur der Zeit.
Das war 1913. Das expressionistische Jahrzehnt war bereits angebrochen, die erste wichtige Phase der schriftstellerischen Arbeit Brods fällt mitten hinein. Ob er selbst zum Expressionismus zu zählen sei, das war ihm keineswegs klar, auch wenn Literaturforscher verlegenheitshalber und ohne Rücksicht auf die durchwegs formkonservativen Werke so verfahren sind. Brod schreibt einmal, er sei »aus dem Expressionismus ausgetreten«, ein andermal, er gehöre zu den Ideologiekritikern dieser Bewegung. Was er in seiner Autobiographie »Streitbares Leben« unter dem Stichwort »Expressionismus« verzeichnet, hat auf Prägnanz keinen Anspruch. Er beschreibt die literarisch Tätigen dieser Jahre als »die Generation, der zum ersten Mal Weltuntergangsstimmung in die Knochen gefahren war, die aber doch nicht in Furcht verging; die unablässig, theoretisch wie praktisch, auf den verschiedensten Wegen daran herumexperimentierte, dem ewigen Guten und Ordnenden eine Stelle in dem nervenzersägenden Getriebe der Zerfallserscheinungen zu erkämpfen. Der literarische Ausdruck hierfür war der Expressionismus. Ich wandte mich von ihm ab, weil ich ihn zu rhetorisch fand. Zu unecht, unredlich. Wo er aber ehrlich gemeint war, war er groß. Man machte sich nichts vor.«
Innerhalb des Expressionismus hat Brod eine konservative Stellung inne. Seine Prosa bleibt durchaus traditionellen Erzähltypen verpflichtet, die Probleme rekurrieren zum guten Teil auf Konstellationen, die bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erarbeitet worden waren. Diese traditionalistische Erzählhaltung wird der Glaubwürdigkeit der Texte zum Verhängnis, wo Brod sich Gestalten vornimmt, deren psychologische Forderungen gegen Brods eigene Stilprinzipien zeugen wollen. In der Erzählung »Notwehr« beispielsweise, die in die meisten Anthologien des Expressionismus aufgenommen wurde, kollidiert die phantastische Innenwelt des vom Land in die Großstadt transplantierten Helden mit der Zweckwelt der Bürovorsteher. Brod weicht den Erfordernissen des Stoffes aus, so scheint es, er wird dem Problem, das er immerhin zu stellen wusste, ästhetisch nicht mehr gerecht. Jahre später hat Heimito von Doderer einen sehr verwandten Stoff in seinem vorzüglichen Roman »Ein Mord, den jeder begeht« adäquat bearbeitet.
In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg war Brod vom Staatsbeamten zum Amt des Musik- und Theaterkritikers beim äußerst renommierten »Prager Tageblatt« übergewechselt. Zunehmend verstand er sich selbst als Advokat der publizistischen Sittlichkeit. Er veröffentlichte gegen den wachsenden Widerstand der Redaktion zahlreiche Gedichte Robert Walsers, er stritt öffentlich gegen die christliche Wendung Werfels, er verteidigte unglücklich Alfred Kerr gegen Karl Kraus. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs trifft den »Prager Kreis« völlig überraschend. Wir verdanken Brod eine detaillierte Darstellung der Stimmung, in der dieser Krieg zunächst als das Unglaubwürdigste, als ein diplomatischer Fehler, als Unfall angesehen wurde. »Wir waren nicht einmal Pazifisten«, heißt es in Brods Autobiographie, »denn der Pazifismus setzt doch einen klaren Begriff voraus, daß es so etwas wie Krieg gibt, und daß man sich gegen ihn wehren, die Abwehr vorzubereiten habe.« Immerhin reagieren die Freunde Brods rasch und couragiert, eine Delegation wird gebildet, die bei Masaryk für die Friedensvermittlung durch Italien eintritt. Die Mission scheitert, eine Notiz in Masaryks Kalender wird dazu führen, dass Brod während der Kriegszeit als gefährlicher Pazifist geheimdienstlich überwacht wird.
Zur Zeit des Ersten Weltkriegs tritt Brod endgültig zum Zionismus über. Die Auseinandersetzung zwischen Judentum und Christentum tritt nun auch in seinem Werk immer wieder in den Vordergrund: deutlich in seinem Roman »Das große Wagnis«, der die jüdische Frage nach der Ebenbürtigkeit des Menschen mit Gott in der sittlichen Entscheidungsfreiheit thematisiert, deutlich auch in seinem antichristlichen Roman »Der Meister«. Dieser biographische Versuch zur Gestalt Christi stellt die Frage nach der religiösen Funktion von Jesu Leben und Sterben in der Form der Familiengeschichte. Die rigorose Ablehnung, die hier die »Parolen« Christi erfahren, enthält zugleich den Widerstand gegen die Zukunft dieser Ideen. Noch später hat Brod bekannt, außer der Lehre von der Nächstenliebe habe er mit dem Christentum nichts gemeinsam.
Die unmittelbare Verarbeitung, die hier Brods geistige Entwicklung im Roman erfährt, zeichnet sein gesamtes Werk aus. Die Überzahl seiner Bücher hat deutlich autobiographischen Charakter, und auch wenn der Autor wiederholt darum gebeten hat, seine Werke nicht als Schlüsselromane zu lesen, so sind die Bezüge zur eigenen Vita bis in die Erkennbarkeit